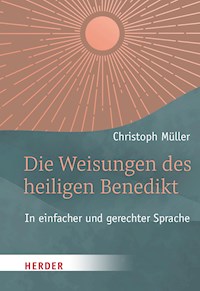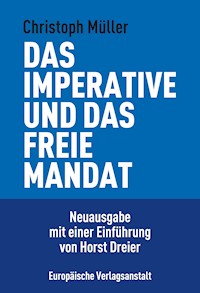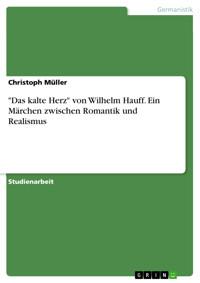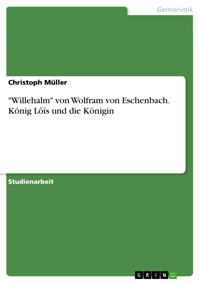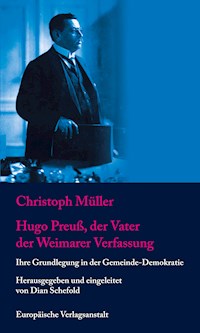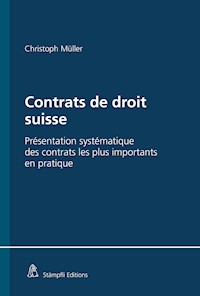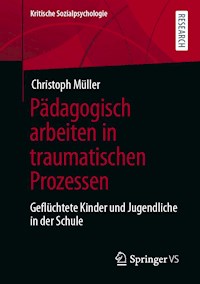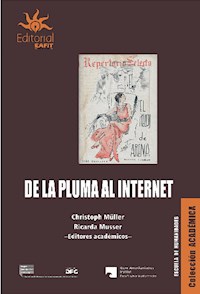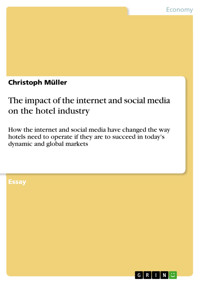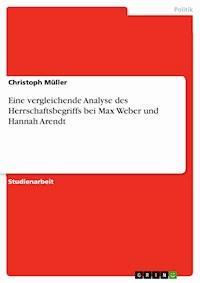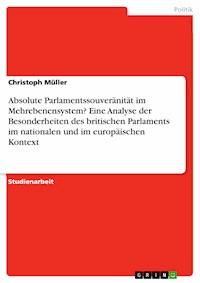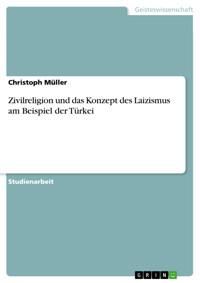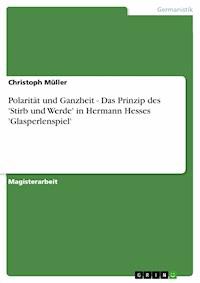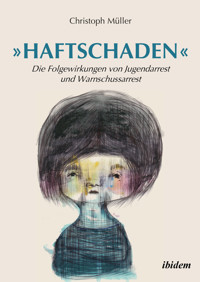
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Sie haben die Schule geschwänzt, sind ohne Führerschein gefahren, haben geklaut, sich geprügelt oder etwas kaputt gemacht. Dafür sitzen sie nun für ein bis vier Wochen hinter Gittern. Die Zeit im Jugendarrest soll kurz und hart sein. Und sie soll abschrecken, einen Schock auslösen – und so verhindern, dass die Jugendlichen wieder straffällig werden. Wieso sind ausgerechnet diese Jugendlichen im Gefängnis gelandet? Wie geht es ihnen dort? Wie wirkt sich der Arrestaufenthalt auf ihre Psyche aus? Und was bedeutet das für ihr zukünftiges Legalverhalten? Diese Fragen stellt Christoph Müller in den Mittelpunkt seiner Studie und beantwortet sie im empirischen Teil mithilfe narrativ-verstehender Interviews mit Jugendarrestanten, die tiefenhermeneutisch ausgewertet wurden. Diese zeigen eindrücklich, wie sehr die Betroffenen unter dem Jugendarrestaufenthalt leiden. Ihre Zeit in der Haft wird durch die Kriterien der totalen Institution geprägt, der sie sich versuchen anzupassen, damit der Aufenthalt aushaltbar bleibt. Auch wenn sie sich aufgrund der leidvollen Erfahrung durchaus vornehmen, nicht mehr straffällig zu werden, spüren sie ihre Perspektivlosigkeit. Die beschämende Erfahrung in den Jugendarrestanstalten lässt sie potentiell depressiv und aggressiv werden. Dabei verstärkt sich unter dem Druck der entwicklungspsychologischen Phase der Adoleszenz ein Selbstbild als Gescheiterter und Verlierer oder als 'harter' Verbrecher. Obwohl am Jugendarrest seit Jahren wissenschaftlich fundierte Kritik geäußert wird, wurde dieser im September 2012 mit der Einführung des sogenannten Warnschussarrests weiter aufgewertet und ausgeweitet. Mit diesem Buch liegt nun erstmals eine fundierte Studie über die Folgewirkungen dieses kurzzeitigen Einsperrens von Jugendlichen und Heranwachsenden vor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Den Insassen in Jugendarrestanstalten gewidmet.
Inhaltsverzeichnis
Teil I: Jugendarrest und Warnschussarrest als Schockideologie
1. Einleitung
1.1 Einführung: Jugendarrest
1.2 Einführung: Warnschussarrest
1.3 Einführung: Schockideologie
2. Der Diskurs um den Warnschussarrest
2.1 Die juristische Debatte
2.2 Die Mediendebatte
2.2.1 Methodische Überlegungen: Kritische Diskursanalyse
2.2.3 Rassismus im Warnschussarrest-Diskurs
2.2.4 Geschlechterbiologismus im Warnschussarrest-Diskurs
2.2.5 Schockideologie im Warnschussarrest-Diskurs
3. Die Folgewirkungen autoritärer Schockideologien – theoretische Annäherung
3.1 Das Milieu der (Jugend-)Delinquenten
3.2 Totale Institution Jugendarrestanstalt – und die subjektiven Folgen?
Teil II: Haftschaden. Empirische Untersuchung
4. Methodische Zugänge zu subjektiven Folgewirkungen
4.1 Methodische Überlegungen: Narrative verstehende Interviews
4.2 Methodische Überlegungen: Tiefenhermeneutische Auswertung
5. Gespräche in einer Jugendarrestanstalt
5.1 Adnan: Zusammenfassung des Interviews
5.1.1 Adnan: Tiefenhermeneutische Interpretation
5.2 Badu: Zusammenfassung des Interviews
5.2.1 Badu: Tiefenhermeneutische Interpretation
5.3 Edin: Zusammenfassung des Interviews
5.3.1 Edin: Tiefenhermeneutische Interpretation
5.4 Haftschaden – Zusammenfassung der Ergebnisse
Teil III: Pädagogische Perspektiven
6. Zwei Seiten von Pädagogik
6.1 Schockideologische Pädagogik als vermeintliche Alternative zum Arrest
6.2 Perspektiven einer emanzipatorischen Pädagogik
7. Abschlussplädoyer
8. Literatur
Teil I: Jugendarrest und Warnschussarrest als Schockideologie
1. Einleitung
„Ich hasse es, hier eingesperrt in der Zelle zu sein. Man vermisst seine Freunde und Freundin. Ich denke an die Zukunft und kann nachts nicht einschlafen. Am liebsten würde ich Gewalt einsetzen, um hier rauszukommen, doch es lohnt sich nicht. Meine Wut hinter diesen Gittern kann ich nicht beschreiben, ich weiß nur, dass der Hass genauso groß wie die Liebe zu meiner Familie ist.“
Aus dem Brief eines Insassen an den Autoren
Ein Grundgedanke dieser Arbeit ist, dass Sozialwissenschaftler_innen an die Peripherien, an die Ränder der Gesellschaft gehen müssen, um von dort aus Gesellschaft zu analysieren. In dem Besonderen und Speziellen dort kann etwas allgemein Herrschendes entdeckt und verstanden werden. An den Rändern der Gesellschaft sind all jene „totalen Institutionen“ (Goffman, 2014) angesiedelt, in denen diejenigen Menschen untergebracht sind, die nicht in eine der Schubladen passen, auf denen „verwertbar“ steht, zum Beispiel in Psychiatrien, Gefängnissen und Abschiebelagern – aber gewissermaßen auch in Förderschulen, Kinder- und Jugendheimen und Behindertenwerkstätten. Diese Institutionen sind „Zonen besonderer Verdichtung der Macht“ (Breuer, 1985, S. 300), unter denen nur ein geringer Teil der Gesellschaft direkt leidet, die aber doch alle in der Gesellschaft prägen. In ihnen lässt sich das Wesen der „Disziplinargesellschaft“ (Foucault, 2013) nachvollziehen – nicht aber die Ursachen für die Ausgrenzung. Um diese zu verstehen, muss der Blick wieder auf das Zentrum der Gesellschaft und seine historisch gewachsenen und systematisch bedingten Machtpraktiken und die ihnen zugrundeliegenden Ideologien geworfen werden.
In dieser Arbeit beschäftige ich mich mit Jugendarrestanstalten. Dieser Fokus scheint für eine sonderpädagogische Arbeit auf den ersten Blick ungewöhnlich, beschäftigen sich doch vornehmlich die Kriminologie, die Rechtswissenschaft und die Kriminalpsychologie mit diesem Thema. Ich meine aber, dass die sonderpädagogische Perspektive hier eine spezielle Kompetenz einbringen kann. Sie hat einen spezifischen Blick auf die Ursachen und eine große Erfahrung im Umgang mit abweichendem Verhalten junger Menschen. Wenn Jugendliche und Heranwachsende in einer Jugendarrestanstalt landen, kann dies auch als ein Versagen der (Sonder-)Pädagogik interpretiert werden, da dann an die Stelle von pädagogischer Unterstützung straf- oder ordnungsrechtliche Sanktionen getreten sind. Außerdem können die Analyse des Diskurses, der zur Einführung des Warnschussarrests beigetragen hat, und die Analyse der Folgewirkungen der Arrestpraktiken den Blick für gewisse Tendenzen in der Pädagogik selbst schärfen. Denn was man dort verdichtet betrachten kann – das Herrschen einer Schockideologie –, ist auch in pädagogischen Kontexten zu beobachten.
Zu dem Thema liegen erstaunliche Forschungsdesiderate vor. Es gibt kaum sozialwissenschaftlich aktuelle Publikationen zum Thema Jugendarrest (Redmann & Hußmann, 2015, S. 9) – eine (kritisch) psychoanalytische Untersuchung zu den Folgewirkungen des (kurzzeitigen) Einsperrens von Jugendlichen und Heranwachsenden liegt bisher überhaupt nicht vor. Mit dieser Arbeit will ich dazu beitragen, diese Lücken zu schließen. Dabei geht es mir um die folgenden erkenntnisleitenden Fragestellungen: Wie ist es zu der jüngsten Ausweitung des Jugendarrests, zum Warnschussarrest, gekommen? Auf welchen Prinzipien fußt eine solche Disziplinartechnologie und welche gesellschaftliche Funktion erfüllt sie? Wer ist warum von dieser Punitivitätspraktik direkt betroffen und was passiert konkret mit den Betroffenen im Jugendarrest? Was sind die subjektiven Folgewirkungen des kurzzeitigen Einsperrens junger Menschen in Jugendarrestanstalten? Inwiefern gibt es in der Pädagogik ähnliche Praktiken? Und schlussendlich: Was wären Alternativen zu diesen Strafpraktiken; was wären emanzipatorische, pädagogische Antworten?
Die Arbeit ist in drei Teile gegliedert. In dem ersten Teil werde ich den Gegenstand der Arbeit skizzieren, in den Jugendarrest (1.1) und den Warnschussarrest (1.2) einführen und den Begriff der „Schockideologie“ präzisieren (1.3). Im Anschluss daran will ich mithilfe des so erarbeiteten begrifflichen Inventars analysieren, wie es zu der jüngsten Ausweitung des Jugendarrests gekommen ist. Dafür stelle ich zum einen die juristische Debatte zum Warnschussarrest vor (2.1) und nähere mich im zweiten Schritt der Mediendebatte mithilfe der Methode der Kritischen Diskursanalyse (2. 2). Im anschließenden theoretischen Teil werde ich mich anhand soziologischer Theorien den Fragen widmen, wer warum in den Jugendarrest kommt und was den Jugendlichen dort widerfährt (3.).
Der zweite Teil der Arbeit ist eine empirische qualitative Untersuchung der Folgewirkungen des kurzzeitigen Einsperrens Jugendlicher und Heranwachsender in Jugendarrestanstalten. Dafür habe ich narrative verstehende Interviews mit Jugendarrestanten geführt und diese tiefenhermeneutisch ausgewertet. Der Teil beginnt mit methodischen Überlegungen zu der Interviewform (4.1) und der Auswertungsmethode (4.2). Daran anschließend werden drei Interviews und die jeweiligen Interpretationen dazu zusammengefasst (5). Zum Ende des zweiten Teils werden die Ergebnisse der empirischen Untersuchung mit theoretischen Erkenntnissen in Verbindung gebracht (5.4).
Im abschließenden dritten Teilder Arbeit werde ich mich mit Alternativen zum Jugendarrest auseinandersetzen und dabei verschiedene pädagogische Programme in Hinblick auf darin vertretene schockideologische Komponenten untersuchen (6.). Diesen werde ich einen – aus meiner Perspektive – potentiell emanzipatorischen pädagogischen Ansatz gegenüberstellen (6.1). Die Arbeit endet mit einem resümierenden „Abschlussplädoyer“ (7.).
1.1 Einführung: Jugendarrest
Der Jugendarrest ist ein „Zuchtmittel“ des deutschen Jugendstrafrechts und ist im Jugendgerichtsgesetz (JGG) – §§ 13 Abs. 2 Nr. 3, 16 JGG – geregelt. Demnach soll er verordnet werden, „wenn Jugendstrafe nicht geboten ist, dem Jugendlichen aber eindringlich zum Bewusstsein gebracht werden muss, dass er für das von ihm begangene Unrecht einzustehen hat“ (§ 13 Abs. 1 JGG). Der Jugendarrest steht damit im deutschen Recht zwischen einer bloßen „Weisung“, etwa „Arbeitsstunden“ abzuleisten oder an „sozialen Trainingskursen“ teilzunehmen und einer Jugendstrafe, die für mindestens sechs Monate verhängt wird. Der Jugendarrest gilt damit als „Vorschaltaktion vor der Verhängung einer Jugendstrafe“ (Schmidt, 2008, S. 125). Davon betroffen sind – wie allgemein vom Jugendstrafrecht – Jugendliche (zwischen 14 und 18 Jahren) und Heranwachsende (zwischen 18 und 21 Jahren).
Typische Delikte, die zum Jugendarrest führen, sind Schulschwänzen1, Fahren ohne Führerschein, Sachbeschädigung, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie „kleinere“ Raub- und Körperverletzungsdelikte (vgl. bspw. Schrapper, 2015, S. 15).
Der Jugendarrest kann in den Arrestformen Freizeitarrest, Kurzarrest und Dauerarrest verhängt werden (§ 16 JGG). Ein Freizeitarrest, der meistens für die Wochenenden gilt, kann für ein oder zwei Freizeiten der Jugendlichen verhängt werden. Der Kurzarrest kann anstelle des Freizeitarrests verhängt werden, wenn er die Ausbildung oder Arbeit der Jugendlichen nicht behindert, und gilt für zwei bis vier Tage. Der Dauerarrest wird für ein bis vier Wochen verhängt (ebd.) und macht den Großteil der verhängten Jugendarreste aus (vgl. Statistisches Bundesamt, 2013, S. 312).
Insgesamt werden jedes Jahr um die 15.000 Jugendliche und Heranwachsende zum Jugendarrest verurteilt (ebd.). Der Jugendarrest macht damit einen erheblichen Anteil aller durch Urteil verhängten jugendstrafrechtlichen Reaktionen aus und ist die am häufigsten vollzogene freiheitsentziehende Maßnahme des Jugendstrafrechts (vgl. Goeckenjan, 2013, S. 67).
Der Jugendarrest wird gemäß § 90 Abs. 2 JGG in der Regel in Jugendarrestanstalten (JAA) vollzogen. Für die Zeit des Jugendarrests muss der bzw. die Jugendliche oder Heranwachsende in eine Jugendarrestanstalt und ist dort meist in einer Einzelzelle untergebracht. Er bzw. sie muss sich dort an den von der Anstaltsleitung vorgegebenen Tagesablauf halten. Dieser beinhaltet Einschlusszeiten, in denen der Arrestant bzw. die Arrestantin allein in der Zelle eingeschlossen ist, sowie Aktivitäten innerhalb der Anstalt wie zum Beispiel die Mahlzeiten, Schulunterricht oder alternative Angebote wie Werken. Hält sich der Arrestant bzw. die Arrestantin nicht an die Anstaltsregeln oder gibt es Konflikte, wird von den Justizmitarbeiter_innen spontan ein „Einschluss“ verordnet. Dann ist der oder die Betroffene den ganzen Tag über in seiner bzw. ihrer Zelle eingeschlossen, nimmt auch die Mahlzeiten in der Zelle ein und darf die Zelle nur für eine Stunde am Tag verlassen. In den Zellen der Jugendarrestanstalten, die ich besucht habe, befinden sich nur ein Bett, eine Toilette, ein Waschbecken, ein Regal, ein kleiner Tisch und ein Stuhl. Das Fenster ist vergittert. Internet, Handys, Fernseher, Radio und persönliche Besitztümer außer der Kleidung sind in den Jugendarrestanstalten verboten. Lediglich die Möglichkeit, einzelne Bücher, eine Tageszeitung, Papier und Bleistift auszuleihen, kann gegeben werden.
Das offizielle Ziel des Jugendarrests ist es, „das Ehrgefühl des Jugendlichen [zu] wecken und ihm eindringlich zum Bewusstsein [zu] bringen, dass er für das von ihm begangene Unrecht einzustehen hat“ (§ 90, Abs. 1 JGG).
„Wesentlich für seine Einführung war die kriminalpolitische Auffassung, dass einer nicht allzu schweren Straftat alsbald eine spürbare Sanktion im Sinne einer Schockstrafe folgen müsse, mittels derer entsprechend der ‚Short-Sharp-Schock‘-Ideologie der ‚an sich gut geartete‘ Jugendliche kurzfristig, ohne die Langzeitfolgen einer Strafe aus der ‚Volksgemeinschaft‘ exkludiert werden könne“ (Meyer-Höger, 2015, S. 87).
Diese Formulierungen verweisen auf den Ursprung des Jugendarrests: Er wurde zur Zeit des Nationalsozialismus eingeführt, genauer 1940 im Rahmen der „Verordnung zur Ergänzung des Jugendstrafrechts“ und anschließend kodifiziert im „Reichsjugendgerichtsgesetz“ (RJGG) im Jahre 1943 (vgl. Kühndahl-Hensel, 2014, S. 31).
„Der neu eingeführte Jugendarrest war zum einen durch seine Kürze und Härte gekennzeichnet. Er sollte als kurze, aber harte Erziehungsstrafe, als Ordnungsruf mit abschreckender Schockwirkung oder aber als Denkzettel wirken. Durch Zucht, Ordnung, gewissenhafte Pflichterfüllung und auch „strenge Tage“, die durch vereinfachte Kost und hartes Lager gekennzeichnet waren, sollte der Jugendliche zur Besinnung und Einsicht gebracht werden. Besonderen Wert sollte auf strengste Disziplin gelegt werden“ (ebd., S. 32).
So schlug sich die nationalsozialistische Ideologie im Jugendstrafrecht nieder und prägt es bis heute: Der Jugendarrest wurde in der vom Reichsjugendgesetz geschaffenen Form übernommen (vgl. ebd.). Seitdem hat sich wenig an den Vorschriften zur Verhängung von Jugendarrest geändert – lediglich die Maximalzahl der Freizeitarreste wurde 1990 von vier auf zwei abgesenkt (vgl. ebd.). Mit dem Gesetz zur Einführung des sogenannten Warnschussarrests wurden die Anwendungsmöglichkeiten des Jugendarrestes wiederum erweitert.
1.2 Einführung: Warnschussarrest
Bis September 2012 galt in der Bundesrepublik Deutschland das sogenannte „Kopplungsverbot“ von Jugendarrest und Jugendstrafe (gem. § 8 Abs. 2 JGG). Das bedeutet, dass Gerichte Jugendliche entweder zu einem Jugendarrest oder zu einer Jugendstrafe, also zu einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten zur Bewährung oder zum Aufenthalt in einer Jugendanstalt (JA), verurteilen konnten.
Im September 2012 wurde mit dem von Bundestag und Bundesrat beschlossenen „Gesetz zur Erweiterung der jugendgerichtlichen Handlungsmöglichkeiten“ (BGBl I, S. 1854) dieses bis dahin bestehende „Kopplungsverbot“ aufgehoben und der – allgemein so bezeichnete – „Warnschussarrest“2 eingeführt (gem. § 16 JGG). Ein halbes Jahr später trat das Gesetz in Kraft, sodass Gerichte seit März 2013 die Möglichkeit haben, Jugendliche und Heranwachsende zusätzlich zu einer Jugendstrafe, die auf Bewährung ausgesetzt ist, zu einem Jugendarrest zu verurteilen. Damit hat die Praxis des kurzzeitigen Einsperrens 14- bis 21-Jähriger eine Ausweitung und Aufwertung erhalten.
Vorausgegangen war eine Mediendebatte, in der vor allem von Seiten konservativer Politiker_innen argumentiert wurde, dass Jugendliche, die „nur“ eine Bewährungsstrafe erhielten, dies sonst als „Freispruch zweiter Klasse“ erleben würden (CDU/CSU-Fraktion, 2012b) und daher einen „spürbaren Schuss vor den Bug“ bräuchten (CDU/CSU-Fraktion, 2012a).
Die Möglichkeit zur Verhängung des Warnschussarrests wird in den verschiedenen Bundesländern unterschiedlich häufig angewendet. Im Land Niedersachsen war das nach Angaben des Justizministeriums im Jahr 2014 111-mal der Fall (vgl. Doelek, 2015). Im Jahr 2015 wurden Jugendliche bis Anfang April 18-mal zusätzlich zu ihrer Bewährungsstrafe zum Arrest verurteilt (ebd.). Damit liegt Niedersachsen laut einer Umfrage der Nachrichtenagentur dpa im Bundestrend (ebd.). Insgesamt ist die Tendenz zur Verhängung des Warnschussarrests steigend (ebd.).
1.3 Einführung: Schockideologie
Der Begriff „Schockideologie“ wurde von Sandra Kühndahl-Hensel (2014) in ihrer richtungsweisenden juristischen Dissertation „Der individualpräventive Schock im Jugendkriminalrecht“ in Anlehnung an den aus dem anglo-amerikanischen Rechtsraum bekannten Begriff des „short, sharp shock“ in die Debatte eingeführt. Kühndahl-Hensel definiert Schockideologie als die Überzeugung, man könne einen Menschen mittels einer harten und kurzen spürbaren Intervention positiv in seinem Verhalten beeinflussen (vgl. ebd., S. 1; S. 5). Die Vorstellung, das zukünftige Legalverhalten eines Menschen mittels eines im Wege der Sanktion kurzfristig herbeigeführten Schocks positiv beeinflussen zu können, sei schon seit langem ein immer wiederkehrender Bestandteil kriminalpolitischer Debatten (ebd., S. 12), zeige sich aber ganz besonders im Jugendarrest und Warnschussarrest (ebd., S. 27).
„Das Konzept des Jugendarrests fußt vom Zeitpunkt seiner frühsten Erwähnung bis heute – zumindest auch – auf dem Ziel, im Anschluss an ein Fehlverhalten durch eine kurze Intervention eine Abschreckungs- und / oder Besinnungswirkung zu erzielen“ (ebd., S. 50).
Kühndahl-Hensel führt in ihrer Dissertation eine Vielzahl der Facetten von Schockideologien auf. Etwas unklar bleibt dabei, was die Schockideologie eigentlich zu einer Ideologie macht. Beantworten ließe sich dies mit der häufig Marx zugeschriebenen Definition, wonach Ideologie ein Gebäude ist, das zur Verschleierung und damit zur Rechtfertigung der eigentlichen Machtverhältnisse dient.3 Daran anschließend lässt sich argumentieren, dass die Schockideologie vor allem deshalb eine Ideologie ist, weil sie die tatsächlichen Ursachen abweichenden Verhaltens Jugendlicher und Heranwachsender verschleiert. Sie tut dies, indem sie impliziert, dass es jugendlichen Straftäter_innen nur an „Respekt“ fehle, dass sie einfach nicht verstanden hätten, was ihnen droht, falls sie sich nicht an Gesetze halten und dass sie nur einen kurzen und harten „Warnschuss“ erleben müssten, um dann zurück „auf den rechten Weg“ zu finden. Dies verunmöglicht, strukturelle Ursachen von Jugendkriminalität zu erkennen, wie beispielsweise Benachteiligung und Diskriminierung, soziale Ungleichheit und das Negativ-Betroffen-Sein von Armut, Ausgrenzung und Rassismus, keine Perspektiven auf legalen Wegen haben, keine Arbeits- und Ausbildungsplätze, keine Perspektiven, dem benachteiligten Milieu zu entkommen, keine ausreichende Betreuung durch Sozialarbeiter_innen und anderen Pädagog_innen usw. Es verhindert ebenfalls die individuellen Ursachen, wie beispielsweise belastende und traumatische Erfahrungen in den Blick zu nehmen. All dies verschleiert die Schockideologie, indem sie verspricht, durch simple Bestrafungstechniken Jugendkriminalität verhindern zu können.
Der Ideologiebegriff soll dabei aber keineswegs den Anschein erwecken, es handele sich dabei um eine stets manifest vertretene Position. Aus sozialpsychologischer Perspektive fällt auf, dass Schockideologien in der Regel affektiv funktionieren, als Reaktion auf das störende Verhalten anderer, das einen selbst hilflos macht. Ein typisches Kennzeichen der Schockideologien scheint dabei das mystische Fordern nach „mehr Härte“ zu sein. Mystisch ist die Forderung, weil unklar, quasi geheimnisvoll bleibt, was konkret damit gemeint ist und inwiefern „mehr Härte“ heilsam für Jugendliche sein sollte. Da dies in der Forderung nach „mehr Härte“ nicht ausgeführt wird, handelt es sich dabei für diejenigen, die diese Forderung erheben, offenbar um eine quasi göttliche oder absolute Wahrheit, die keiner Begründung bedarf.
Auch der Bundesgerichtshof bezeichnet den Jugendarrest in einer älteren Entscheidung als „kurzen, harten Zugriff“ und „fühlbaren Ordnungsruf“, der „vermöge seines harten Vollzugs abschreckend“ wirken und so den Jugendlichen davor schützen soll, auf dem erstmalig eingeschlagenen Weg fortzufahren (Goeckenjan, 2013, S. 68). Schockideologien finden sich nicht nur im Jugendkriminalrecht und den Debatten darum, sondern wie ich zeigen werde auch in gewissen pädagogischen Konzepten (Teil III). Auch dort findet sich das Wesensmerkmal der Schockideologie, der Ruf nach „mehr Härte“ im Umgang mit Verhaltensstörungen ohne konkrete Aussagen darüber, was damit konkret gemeint ist und inwiefern dies hilfreich sein sollte.
Diese ständige unbestimmte Verwendung des Begriffs der „Härte“ verweist auch auf die Geschlechterdimension in den Schockideologien: Sowohl im pädagogischen als auch im kriminologischen und im medial-öffentlichen Diskurs wird damit so gut wie ausschließlich gefordert, dass Verhalten von Jungen zu sanktionieren. Auch vom Jugendarrest sind überwiegend, über 87 % (Statistisches Bundesamt, 2013, S. 312), männliche Jugendliche betroffen. Dies ist auch insofern fatal, als dass sozialpsychologisch anzunehmen ist, dass sich die Erfahrung, mit dieser „Härte“ konfrontiert zu sein, auch wieder auf die Subjektkonstitution rückwirkt und Jungen, die den Jugendarrest oder ähnliche schockideologisch geprägte Punitivitätspraktiken durchlebt haben, sich folglich dadurch besonders „hart“ fühlen, was wiederum Ursache von aggressivem Verhalten sein kann (vgl. Müller, 2014).
1 Im Jahr 2014 saßen beispielsweise alleine in Niedersachsen 540 Schüler_innen aufgrund von Schulschwänzen im Jugendarrest (HAZ, 2015).
2 Andere Bezeichnungen sind „Einstiegs-“, „Kopplungs-“ oder „Bewährungsarrest“. Ich verwende in dieser Arbeit allerdings nur die meistverbreitete Variante „Warnschussarrest“.
3 Obwohl sich eine Reihe von Aufsätzen finden lässt, welche Marx als Verfasser dieser Aussage angeben, konnte ich die Stelle in keinem Werke Marx’ finden und das Zitat damit nicht verifizieren, sodass ich davon ausgehe, dass die Formulierung anonymen Ursprungs ist und Marx lediglich zugeschrieben wird – was sie wohlgemerkt inhaltlich nicht weniger hilfreich macht.
2. Der Diskurs um den Warnschussarrest
2.1 Die juristische Debatte
Seit es die Idee gibt, den Jugendarrest für Bewährungsstrafen auszuweiten, gibt es Kritik an dem Vorschlag von juristischen, kriminologischen Fachvertreter_innen. In den zwei Jahren vor der Einführung des Gesetzes hat sich diese Kritik verdichtet.
Der Strafrechtler und Kriminologe Frieder Dünkel (2010) kritisiert den damals erst angekündigten Warnschussarrest deutlich: Zum einen formuliert er juristische Einwände, wonach die geplante Gesetzesänderung verfassungsrechtlich bedenklich sei (ebd., S. 2).1 Zum anderen sprächen auch die empirischen Ergebnisse der Sanktionsforschung gegen den Warnschussarrest: Dünkel weist auf die enorm hohe Rückfallquote des Jugendarrests (70 %) einerseits und die ebenfalls hohe Rückfallquote der Bewährungsstrafe (60 %) andererseits hin. Er bemängelt, es gebe „kein einleuchtendes Argument dafür“, dass eine Kombination aus beiden „zur ‚Wunderwaffe‘ mit einer niedrigeren Rückfallquote als bei isolierter Strafaussetzung mutieren sollte“ (ebd., S. 3).
Der Rechtswissenschaftler und Kriminologe Arthur Kreuzer (2012a) argumentiert ebenfalls, dass der Warnschussarrest ein „kriminalpolitischer Irrweg“ sei. Er stellt fest:
„In der Fachwelt besteht nahezu Einmütigkeit über die Nutzlosigkeit, ja Schädlichkeit eines solchen Arrests. Anhaltend warnen Wissenschaftler davor. Rechtsvergleichende Studien sprechen gegen dieses Instrument. Bedeutende Berufsverbände wie der Deutsche Juristentag (2002), der Deutsche Jugendgerichtstag (zuletzt 2007), die Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen und der Deutsche Richterbund lehnen es ab“ (ebd., S. 101).
Kreuzer macht deutlich, dass schon die Prämissen hinter der Forderung nach dem Warnschussarrest nicht stimmten: Weder nehme Jugendgewalt zu noch könne „Strafhärte“ vor Gewalt abschrecken (ebd.). Im Gegenteil: Kurzer Freiheitsentzug nach einem langen Strafverfahren fördere sogar die Rückfälligkeit (ebd.). Im Weiteren nennt Kreuzer eine Reihe konkreter Einwände gegen den Warnschussarrest. Dazu gehört, dass es – im Gegensatz zum populistisch behaupteten schnellen Reagieren – zu einem Arrestantritt immer erst viel später, in der Regel etwa ein Jahr nach der Tat, käme (ebd., S. 102). Dazwischen lägen noch Verfolgung, oftmals Untersuchungshaft, Verurteilung, Rechtskraft des Urteils und Ladung zum Arrestantritt. Dies bedeute auch, dass der Warnschussarrest immer die Zusammenarbeit mit der Bewährungshilfe störe, weil er mitten in die schon begonnene Zusammenarbeit fiele (ebd.). Kreuzer beendet seinen Beitrag mit der skeptischen Frage, ob die regierende Koalition auf die Einwände der Fachwelt höre und davon absehe oder zumindest „eine Evaluations- und Experimentierklausel“ in das Gesetz einbaue (ebd., S. 103). Wenige Monate später wurde das Gesetz – ohne solch eine Klausel – eingeführt.
Auch in den offiziellen schriftlichen Stellungnahmen im Rahmen der Anhörung des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages am 23.05.2012 zum Entwurf des Gesetzes wurde von den Fachvertreter_innen deutliche Kritik geäußert. Theresia Höynck (2012), Vorsitzende der Deutschen Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e. V. (DVJJ), fasst in ihrer Stellungnahme noch einmal die verschiedenen Kritikpunkte zusammen. Sie betont die nahezu einhellige Ablehnung der Fachwelt und argumentiert, dass es widersprüchlich und nicht plausibel sei, wenn Gerichte einerseits eine Jugendstrafe zur Bewährung aussetzen würden, weil sie erwarten würden, dass der Jugendliche „ohne die Einwirkung des Strafvollzugs unter der erzieherischen Einwirkung in der Bewährungszeit künftig einen rechtschaffenen Lebenswandel führen wird (§ 21 I 1 JGG)“ und gleichzeitig die Notwendigkeit eines „irgendwann während der Bewährungszeit zu vollstreckenden Arrests“ sehen würde (ebd., S. 1). Dadurch, dass diese widersprüchliche Aussage – einer positiven Prognose bei gleichzeitiger Arrestanordnung – auch den Jugendlichen vermittelt werde, werde die bestärkende und unterstützende Aussage, die durch eine gewährte Aussetzung ausgedrückt werden könne, zunichte gemacht (ebd.). Zudem gebe es im Lichte der durch die Kinderrechtskonvention normierte Nachrangigkeit freiheitsentziehender Maßnahmen bei Kindern und Jugendlichen keinen legitimen Grund, mit dem Warnschussarrest den Anwendungsbereich freiheitsentziehender Maßnahmen im Jugendstrafrecht zu erweitern (ebd., S. 2f.).
Bei der offiziellen Anhörung bemühte sich die regierende Koalition selbstredend darum, dass auch solche „Sachverständigen“ benannt wurden, die zu einer positiven Beurteilung des Gesetzesentwurfes kamen.