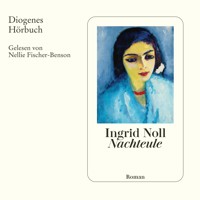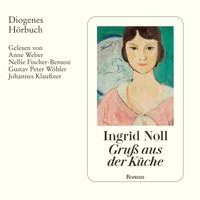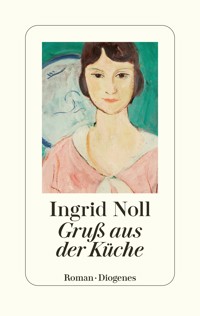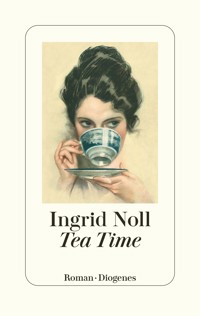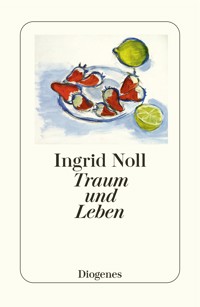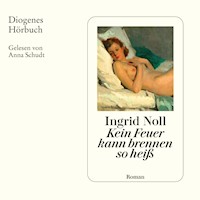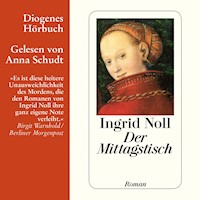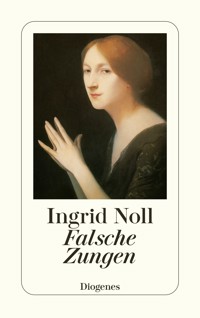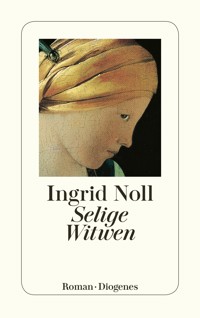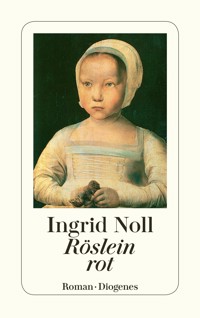10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Natürlich sind Karin und Holda auf Männerjagd, schließlich wollen sie nicht alleine bleiben. Doch auch auf sie wird Jagd gemacht: Eine ganz besondere Sorte Romeos ist im Bonn der Nachkriegszeit im Einsatz. ›Halali‹ – das Sekretärinnendasein wird zum Abenteuer, der graue Alltag ist vorbei. Wehe dem, der ins Visier gerät.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 282
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Ingrid Noll
Halali
Roman
Diogenes
{4}Für meine Schwester
{7}1Schnee von gestern
Beim letzten Arztbesuch fiel mir wieder auf, wie viel sich doch im Vergleich zu früher geändert hat. Noch vor einigen Jahren lasen die meisten Patienten im Wartezimmer die mehr oder weniger zerfransten Lesemappen oder starrten mit düsteren Gedanken taten- und wortlos vor sich hin. Würde man heute von oben auf sie herniedersehen, könnte man denken, sie würden silberne Löffel putzen, stricken oder häkeln, so versonnen neigen sie sich über einen kleinen Gegenstand, den sie mit flinken Fingern bearbeiten. Dieses Ding nannte ich bisher Handy, doch mittlerweile gibt es offenbar noch Smartphones, Tablets und Gott weiß was sonst. Was die Patienten wohl mit ihren Geräten so treiben, während sie warten? Die letzten Details zu ihren Wehwehchen in Erfahrung bringen oder doch lieber spielen? Ich selbst habe mich früher im Wartezimmer immer gern mit von anderen Leuten begonnenen Kreuzworträtseln abgelenkt. Die Lesemappen gibt es zwar heute noch, doch sie werden {8}nur von uns Alten durchgeblättert, und an die Rätsel hat sich meistens keiner herangewagt. Mir fehlt dann das Vergnügen, es besser als meine Vorgänger zu können.
Genau wie ich lebt auch meine Enkelin Laura allein und zu meinem Glück sogar im selben Hochhaus. Für eine zweiundachtzigjährige Witwe wie mich ist diese kleine Wohnung ideal, für Laura als Single wahrscheinlich ebenso. Wenn sie von der Arbeit heimkommt, schaut sie oft noch bei mir herein. Gelegentlich habe ich uns etwas Bodenständiges gekocht, manchmal bringt sie etwas zum Essen mit. Es ist schön, dass sie mir aufmerksam zuhört, wenn ich von meiner Jugendzeit erzähle, denn uns verbindet so mancherlei. So hat meine Enkelin nicht zuletzt ein ähnliches Arbeitsfeld gewählt wie ich.
Meinen ehemaligen Beruf als Sekretärin gibt es zwar immer noch, aber die Vorzimmerdamen heißen jetzt Assistentin des Geschäftsführers, Office Managerin oder so ähnlich. Als ich nach der Handelsschule mit der Arbeit begann, war ich unverheiratet, also ein Fräulein. Meine Enkelin duzt sich mit ihrem Chef, beherrscht weder Steno noch das Zehnfingersystem, hat stattdessen an einer Fachhochschule studiert und nennt sich Betriebswirtin für Controlling. {9}Während ich früher im Innenministerium vor einer schweren Adler-Schreibmaschine saß, hockt sie vor einem Computer. Auch zu Hause hat sie immer ihr Smartphone neben sich liegen, während ich oft ein Buch zuschlage, sowie sie über die Schwelle kommt. Doch ich denke, Laura muss – genauso wie wir im vergangenen Jahrhundert – dem Abteilungsleiter gehorchen und diplomatisch mit seinen Launen umgehen. Und sicherlich macht sie mit ihren Kolleginnen auch ebenso viel Blödsinn wie ich in meinen jungen Jahren. Kichern, tratschen, ein wenig intrigieren, sich auf eine hastig gerauchte Zigarette verabreden, mit attraktiven Kollegen anbändeln, so etwas stirbt nie aus. Ich hoffe bloß, dass Laura sich nicht auf finstere Machenschaften einlässt, wie ich es einmal tat.
Neulich fuhren wir gemeinsam zum Supermarkt. Um ein wenig anzugeben, notierte ich die Einkaufsliste in Steno. Laura staunte nicht schlecht, doch als ich die Kurzschrift am Ende selbst nicht mehr lesen konnte, lachte sie schallend. Um nicht als humorlose alte Schachtel dazustehen, tippte ich an meinen weißhaarigen Kopf und sagte: »De-be-de-de-ha-ka-pe!« Laura starrte mich verständnislos an, und ich musste erklären, dass dies in meiner Jugend die Kurzformel war für: Doof bleibt doof, da helfen keine Pillen. Laura grinste bloß. In ihrer Gesellschaft {10}fühle ich mich manchmal wieder jung und übermütig.
»Weißt du eigentlich, was ein MOF ist?«, fragte Laura mich kürzlich. »Das ist ein Mensch ohne Freunde!« Eine Weile überlegten wir gemeinsam, wie viele wir von dieser Sorte kannten, bei ihr waren es vor allem zwei ehemalige Lehrer und ein neuer Mitarbeiter. Doch auch mir kam bei diesem neudeutschen Ausdruck jemand in den Sinn: ein Regierungsrat im Innenministerium, dem wir den Spitznamen der Jäger aus Kurpfalz gegeben hatten.
Natürlich war er kein Jäger, sondern hatte bloß diesen Allersweltsnamen und stammte aus der Pfalz, womöglich war er gemeinsam mit Helmut Kohl zur Schule gegangen. Das uralte Volkslied musste man damals noch in der Grundschule singen, wobei – wie Laura dank Wikipedia ermittelte – die frivolen Strophen in den Schulbüchern weggelassen wurden. Ein Schürzenjäger war dieser Burkhard Jäger aus meiner Abteilung schon gar nicht, unscheinbar und linkisch, wie er war. Aber gerade weil er so langweilig und brav, so grau und spießig wirkte, machten wir Frauen uns ständig Gedanken über sein Privatleben. Falls es auch für Männer die Bezeichnung graue Maus gibt, dann traf es auf ihn zu. Anfangs setzten wir uns abwechselnd in der Kantine neben {11}ihn und versuchten ihn auszuhorchen. Doch nie kam etwas dabei heraus, er blieb stocksteif und hielt sich bedeckt. Meine Kollegin Karin Bolwer, die nicht nur das Büro, sondern auch den Chef mit mir teilte, hat sogar einmal versucht, ein wenig mit ihm zu flirten, bloß um seine Reaktion zu testen. Doch Herr Jäger war entweder naiv oder schwul oder immun gegen weibliche Reize, wir wurden aus ihm nicht schlau.
Bevor ein Mädchen heiratete, wohnte es in den fünfziger Jahren oft noch bei den Eltern, vor allem aus finanziellen, ein wenig aber auch aus moralischen Gründen. Studentinnen hatten natürlich größere Freiheiten, aber sie waren zahlenmäßig in der Minderheit. In meinem Fall mussten meine Eltern einsehen, dass ich keinen geeigneten Job in unserem Eifelkaff finden würde, und ließen mich daher 1955 schweren Herzens mit zwanzig nach Bonn ziehen, das seit sechs Jahren die neue Hauptstadt war. Vielleicht hegten sie insgeheim auch die Hoffnung auf einen soliden Schwiegersohn mit Beamtenstatus. Die ehemalige Kleinstadt am Rhein boomte, wie man heute sagen würde, Konrad Adenauer verkörperte als der erste Bundeskanzler einen Neuanfang, Botschaften ließen sich in alten Godesberger Villen nieder, Ministerien wurden gebaut oder provisorisch in ehemaligen Kasernen untergebracht. Gleich {12}nach meiner ersten Bewerbung landete ich als Stenotypistin in einem dieser grauen Betonkästen in der Graurheindorfer Straße, zog vom Land in die Stadt und wohnte in einem möblierten Zimmer bei einer Kriegerwitwe. Herrenbesuch war nicht gestattet, denn es galt ja noch der Paragraph 180, der Kuppelparagraph. Eine Vermieterin konnte sogar mit Gefängnis bestraft werden, wenn sie der »Unzucht« Vorschub leistete. Ein Gesetz durchaus im Sinne der Eltern, denn es gab noch keine Antibabypille. Auch tolerante und aufgeschlossene Mütter litten unter der Horrorvorstellung, ihre Tochter könnte viel zu früh und vom falschen Kerl geschwängert werden. »Kleine Sünden bestraft Gott sofort, große in neun Monaten«, pflegte man zu sagen.
Das Haus meiner Wirtin lag in Bad Godesberg, das mittlerweile zu Bonn gehört. Zwar musste ich fast eine Stunde mit der Straßenbahn bis zum Ministerium fahren, aber das war es mir wert. Von meinem Zimmer aus war ich in fünf Minuten am Rhein, konnte spazieren gehen und von meiner Lieblingsbank aus den Raddampfern zusehen. Den Geruch nach rostigem Eisen und Flusswasser werde ich nie vergessen. Mein Zimmer war klein und nach heutigen Maßstäben dürftig eingerichtet. Zum Schlafen diente eine durchgelegene Couch, die tagsüber mit einer karierten Wolldecke zum Sofa umgerüstet {13}wurde. Das Badezimmer durfte ich zwar mitbenutzen, aber warmes Wasser gab es nur am Samstag, und ein Wannenbad musste extra bezahlt werden.
Bei meinem schmalen Gehalt waren vier Mark im Monat keine Kleinigkeit. Deswegen nahm ich anfangs eine andere Gelegenheit wahr, die sich durch den Beruf ergab. Wie ich schon sagte, war das Innenministerium in einer ehemaligen Kaserne untergebracht. Im Keller befanden sich Duschen, nicht etwa in einzelnen Kabinen, sondern in Reih und Glied – wie es für Soldaten üblich war. Da längst nicht alle Angestellten zu Hause ein eigenes Bad besaßen, durften sie aus hygienischen und sozialen Gründen einmal in der Woche brausen, dienstags die Männer, freitags die Frauen. An diesen Tagen sah man die Belegschaft mit Handtüchern, Duschhauben, Shampoo, Föhn und Seifen in den Keller eilen. Ältere Frauen, auf rheinisch Möhnen genannt, waren nicht gerade begeistert, sich in jener prüden Zeit vor ihren Kolleginnen auszuziehen, und mieden die Massenreinigung. Aber wir jungen Mädchen fanden es toll, alle Wasserhähne aufzudrehen und ausgelassen von einer Brause zur nächsten zu wechseln. Bis etwas geschah, das mich eine Abneigung gegen Duschen entwickeln ließ, noch lange bevor ich Hitchcocks Psycho sah.
{14}Eines Tages machte nämlich das Gerücht die Runde, wir Frauen würden beim Duschen beobachtet. Nein, versteckte Kameras gab es damals noch nicht. Doch über dem Keller lag ein wenig benutzter Lagerraum, wo uralte Akten verstaubten und Büromaterial aufbewahrt wurde. Einer der Registratoren hatte gelegentlich hier zu tun und hatte dort auch seine Schnapsflaschen untergebracht. Eines schönen Tages war er so betrunken, dass er torkelte und stürzte. Bei dem Versuch, sich wieder aufzurappeln, bemerkte der Mann eine Unebenheit im Boden, weil jemand einen Schlitz im Untergrund dilettantisch mit Wellpappe zugestopft hatte. Als er das Guckloch freilegte, sah er direkt hinunter in den Duschraum. Wenn er ein kluger Ermittler gewesen wäre, hätte er sich auf die Lauer gelegt, um den Spanner beim nächsten Frauentag zu ertappen. Doch er konnte nicht an sich halten und brüstete sich mit seiner Entdeckung vor einem Kollegen. »Do bisse am lure!«, soll er gesagt haben. Die Katze war aus dem Sack, das Loch wurde fachmännisch verschlossen, aber die Spekulationen hörten nicht auf, welcher der hochanständigen Ministerialbeamten als Spanner in Frage käme. Von da an mochten viele Frauen überhaupt nicht mehr duschen. Ich erzählte meiner ebenso neugierigen wie empörten Wirtin von dem Skandal, und sie machte mir ein {15}Angebot: Wenn ich abends bei meinen Spaziergängen ihren Hund mitnahm, durfte ich einmal in der Woche ohne Bezahlung baden.
Viele meiner ledigen Kolleginnen hielten Ausschau nach einer guten Partie. Die unterste Kategorie waren natürlich die Männer in grauen Kitteln, die Registratoren oder Bürodiener, die Aktenwagen hin und her schoben und überhaupt nicht in Frage kamen. Spitzenbeamte wie Ministerialdirektoren und -dirigenten oder gar der Minister waren in der Regel längst vergeben. In der Beamtenhierarchie standen die jungen Regierungsräte noch auf einer der unteren Stufen, weswegen sie von vielen weiblichen Bürokräften umworben wurden. Bei ihnen war vielleicht eine glanzvolle Karriere zu erwarten. Der Jäger aus Kurpfalz gehörte zwar auch zu dieser Spezies, doch dass sich jemand in ihn verlieben würde, konnten wir uns nur schwerlich vorstellen.
In den fünfziger Jahren sah man noch allenthalben kriegsversehrte junge Männer, die bei der Vergabe von Studienplätzen bevorzugt wurden und offenbar auch bei der Einstellung in staatlichen Behörden. Im Ministerium gab es mehrere junge Juristen mit fehlenden Gliedmaßen. Auch mein Vorgesetzter musste sich mit dem linken Arm begnügen, was {16}immer wieder zu peinlichen Situationen führte. Besucher schienen sekundenlang zu überlegen, welche Hand sie ihm zur Begrüßung entgegenstrecken sollten, und entschieden sich meistens für die linke. Dann wurden sie von meinem Chef durch zornige Blicke bestraft, weil er jegliche Sonderbehandlung hasste und als demütigend empfand. Karin und ich kamen immer gut mit ihm aus, denn er mochte uns und erteilte seine Anweisungen mit milder Herablassung – ja er gab uns sogar dienstfrei, als der Schah von Persien 1955 am Bonner Hauptbahnhof eintraf. Zusammen mit Tausenden begeisterter Mitbürger durften wir die Kaiserin Soraya mit Jubelrufen begrüßen. Wir standen direkt hinter der Absperrung, vor uns eine Kette von Polizisten, die lückenlos aneinandergereiht waren. Die jungen Beamten waren ebenso aufgeregt wie wir, aber sie durften es sich nicht anmerken lassen. Karin fing sofort an, sich über unsere Vordermänner lustig zu machen, denn wir wussten genau, dass sie nicht darauf reagieren durften. »Sieh mal meinen an, von hinten ist er besonders hübsch, nur die Ohren stehen viel zu weit ab …« Natürlich ließ ich mich auch nicht lumpen und bezeichnete meinen Polizisten als niedlichen Bubi, wenn auch noch nicht ganz trocken hinter den Ohren. So lästerten wir fröhlich weiter, bis sich der eine umdrehte und uns auf Bönnsch anzischte: {17}»Hürt op, ihr Zuckerpöppche! Wenn ihr euch weiter so fies beömmelt, jit et jät op de Muul!«
Daraufhin wurde Karin noch provokanter: »Von hinten ist meiner ja ein strammer Kerl, aber nun habe ich seine Visage gesehen, ein Pickel am anderen …« Ich krümmte mich vor Lachen, was mir aber schnell verging. Mein Vordermann keilte nach hinten aus wie ein Gaul und traf mich am Schienbein. Ich jaulte auf, doch in diesem Moment erschien die Kaiserin, und mein Schmerzenslaut ging in Soraya-Rufen unter. Die Hoheiten stiegen in Staatskarossen und fuhren, begleitet von einem gewaltigen Konvoi von Bodyguards, Polizisten und Journalisten, zu ihrer Residenz auf dem Petersberg. Um dem Zorn der beiden Gesetzeshüter zu entgehen, zog Karin mich eilig fort.
Als der Schah 1967, also zwölf Jahre später, Westberlin besuchte, kam es zu ganz anderen Szenen: Studenten, die gegen das diktatorische Regime im Iran demonstrierten, lieferten sich Straßenschlachten mit Anhängern des Schahs, was schließlich zum Tod eines Studenten führte. Es war der Beginn einer unruhigen Zeit. Aber damals haben wir noch alle begeistert Soraya zugejubelt, die für uns so etwas wie eine Märchenprinzessin aus Tausendundeiner Nacht war.
{18}»Guck mal, Holle!«, sagte Karin plötzlich, als nicht weit von uns ein Vespa-Fahrer sein Fahrzeug aufschloss. »Ist das eine Fata Morgana oder unser Jäger aus Kurpfalz?« Da es damals noch keine Helmpflicht gab, konnten wir den MOF gut erkennen, wie er etwas umständlich aufstieg und davonbrauste. »Er reitet durch den grünen Wald«, sang ich belustigt. Aber wir wunderten uns doch sehr, denn der schicke Motorroller passte so gar nicht zu dem mausgrauen Bürohengst.
In meiner Abteilung war ich die Jüngste, Karin war nur ein halbes Jahr älter. Wie viele in unserer Generation hatte sie einen germanischen Vornamen. Meiner war besonders penetrant, denn meine Eltern hatten den seltenen Namen Holda ausgesucht; viel lieber hätte ich wie meine Schulfreundinnen Helga, Gudrun, Edda, Inge, Gerda oder Uta geheißen. Als man mich im Büro spaßeshalber »Fräulein Holle« taufte, schien mir dies das kleinere Übel. Natürlich ließen meine Freunde das Fräulein weg, und es blieb mein ganzes Leben lang bei dem Spitznamen Holle. Selbst meine Enkelin Laura nennt mich nicht Oma, sondern »Frau Holle«, was ich mir gern gefallen lasse. Jeder stellt sich die Märchenfrau als alt und gütig vor.
{19}Neulich sagte Laura: »Weißt du was, Frau Holle, du schüttelst zwar nicht die Federbetten auf, damit es auf Erden schneit, aber du versorgst mich trotzdem mit ziemlich viel Schnee von gestern!«
»Der Schnee von gestern ist der Matsch von morgen«, meinte ich nur.
{20}2Die Godesberger Gräfin
Karin war zwar – ebenso wie ich – eine arme Kirchenmaus, aber in einer Beziehung hatte sie es besser: Sie brauchte keine Miete zu bezahlen. Ihre Mutter war mit der Familie aus Ostpreußen geflüchtet und in Bad Godesberg bei einer adeligen Verwandten untergekommen. Die Gräfin war zwar auch nicht reich, aber sie besaß immerhin eine große Villa in der Rheinallee, in der sie die Heimatlosen aufnahm. Später zog Karins Familie dann nach Krefeld weiter, aber meine Freundin sollte nach ihrer Tante sehen und durfte daher in der Villa bleiben.
Damals bezeichnete man uns noch als Mädchen, bis wir verheiratet waren. Karin wirkte rein äußerlich zwar fast zerbrechlich und zart, sie war aber zäh und eine durch und durch zupackende Frau. Schnell hatte sie erkannt, dass im Großraum Bonn viele herrschaftliche Häuser für ausländische Residenzen genutzt wurden, das Personal des Verwaltungsapparates, der Bundesbehörden und Botschaften aber schließlich auch irgendwo wohnen {21}musste. Im Haus der Tante gab es zwar reichlich Platz, doch den ungemütlichen Zimmern konnte man allenfalls etwas nostalgischen Charme abgewinnen, sie mussten dringend renoviert werden. Obwohl sie noch jung und unerfahren war, überredete die tüchtige Karin ihre Tante, einen Kredit aufzunehmen, um die Handwerker zu bezahlen, und kümmerte sich schließlich um die Vermietung. Vier unterschiedlich große Zimmer wurden hergerichtet und zwei Badezimmer abgezweigt, ein Gemeinschaftsbad und eines für das größere Zimmer, nicht gerade luxuriös, aber eben etwas für kleinere Geldbeutel. Als ich nach Bad Godesberg kam, war leider bereits alles vergeben.
Die Gräfin faszinierte mich, weil sie völlig anders war als meine bodenständige Verwandtschaft aus der Eifel: Sie war Kettenraucherin, stand selten vor elf Uhr auf, besaß eine antike Spazierstocksammlung und benutzte Ausdrücke, die mir fremd waren. Sie empfing Gäste im Boudoir, sprach von ihren Domestiken und echauffierte sich ständig; ich erriet schließlich, dass es sich um ein elegantes Damenzimmer, ihre Dienstboten und ihre leichte Erregbarkeit handelte. An Frauen wollte sie auf keinen Fall vermieten. »Alle Weiber wollen kochen und Wäsche aufhängen und schwirren im ganzen Haus herum, das kommt überhaupt nicht in die Tüte«, {22}echauffierte sie sich und zog heftig an ihrer Zigarettenspitze aus Bernstein. Die Herren, an die sie vermietete, bekamen hingegen von einer Domestikin das Frühstück auf einem Tablett vor das Zimmer gestellt, die Wäsche mussten sie auswärts geben, essen sollten sie in Kantinen und Gasthäusern. Falls sie nicht selbst staubsaugen wollten, mussten sie die Putzfrau extra bezahlen. Es handelte sich meistens um jüngere, alleinstehende Männer. Die Ausnahme war ein Major der neugegründeten Bundeswehr, der seine Familie an jedem Wochenende in Süddeutschland besuchte. Einen deutschstämmigen Chauffeur der russischen Botschaft hatte die Gräfin abgewiesen, weil sie nichts mit einem Iwan zu tun haben wollte.
Für mich war es ideal, dass Karin ganz in meiner Nähe wohnte. Am frühen Morgen fuhren wir gemeinsam mit der Straßenbahn nach Bonn, nach der Arbeit auch wieder zurück. Sie kam ungern zu mir in meine Bude, ich umso lieber zu ihr. Selbstverständlich konnte Karin die Küche ihrer Tante benutzen, während ich meinen Tauchsieder für den morgendlichen Tee im Kleiderschrank verstecken musste. Außerdem stand ihr eine Nähmaschine zur Verfügung. Nicht nur die Arbeit schweißte uns zusammen, sondern auch so manches gemeinsame Abenteuer. Wir besorgten uns im Seidenhaus Schmitz preisgünstige {23}Stoffe und experimentierten mit Simplicity-Schnittmustern. Stolz konnten wir unsere selbstgenähten Sommerfähnchen beim Tanztee im Kastaniengarten des Hotel Dreesen vorführen. Die Röcke mussten weit ausschwingen, Ärmelaufschläge und Bubikragen wurden in Kontrastfarben angefertigt, Hosen trugen wir höchstens an kalten Wintertagen, Jeans gab es keineswegs schon überall zu kaufen. Unsere Perlonstrümpfe wurden damals noch mit Strapsen befestigt. Meine langen rotbraunen Haare band ich zu einem Pferdeschwanz hoch, und Karin föhnte ihren blonden Pagenkopf jeden Morgen über eine Rundbürste zu einer adretten Innenrolle. Meistens traten wir im Doppelpack auf. Die Männer bezeichneten uns anerkennend als flotte Käfer.
Karin und ich interessierten uns sehr für die neuesten Modetrends und betrachteten auch die Männer mit kritischen Blicken. In jener Zeit änderte sich die konservative Herrenbekleidung, man wollte weg vom Uniformierten, die Hosenbeine wurden schmaler, die Mäntel kürzer, die Schultern wurden nicht mehr so stark ausgepolstert, alles sollte freier und natürlicher wirken, amerikanische Vorbilder und die erste Camping-Welle zeigten Folgen.
Laura erzählt mir vom Casual Friday im Büro, an dem die meisten Angestellten in Jeans erscheinen, {24}Männer den Sakko durch einen Pullover, Frauen die Highheels durch Sneakers ersetzen und alle auf ihr übliches Business-Outfit verzichten. Zu meiner Zeit konnte von einer Lockerung am Freitag nicht die Rede sein, weil wir dreimal im Monat bis Samstagmittag arbeiten mussten. Wörter wie chillen und abhängen waren unbekannt. Um die Bürokleidung zu schonen, zog man sie zu Hause zwar aus, aber keine Jogginghosen an. Noch heute kann ich mich nicht für dieses angeblich so bequeme Kleidungsstück erwärmen, da ich unangenehme Erinnerungen damit verbinde. In der Eifel wurde es im Winter so kalt, dass meine Mutter mich mit dicken, blauen Trainingshosen zur Schule schickte; dieses ungeliebte Teil wurde unter dem Rock getragen. In der Taille und an den Knöcheln sorgten ausgeleierte Gummibänder dafür, dass man ständig daran zupfen und zerren musste. Am schlimmsten wurde es, wenn sich das unterste Stück mit Schnee und Matsch vollsog, immer schwerer wurde und rutschte. Genau das passierte mir einmal, als ich gerade vor der Tafel stand und mich reckte, um eine Rechenaufgabe zu lösen. Die Hose glitt zu Boden, die Mitschüler lachten, mir kamen die Tränen.
Karin und ich hatten beide noch keinen festen Freund, aber immer mal wieder einen Verehrer, {25}wie die Gräfin es nannte. Obwohl wir unser relativ freies Leben zu schätzen wussten, gab es doch einen gewissen sozialen Druck: Wer mit Mitte zwanzig noch nicht verheiratet war, galt schon als spätes Mädchen und war ab sechsundzwanzig eine alte Erstgebärende. Es war selbstverständlich, dass Heirat und Familie das erklärte Ziel einer Frau zu sein hatten. Karin hätte gern Sprachen im Ausland studiert, ich wäre gern Grundschullehrerin geworden, aber ich hatte kein Abitur, und mein Vater war Bäcker und kein Krösus.
Das Argument der meisten Eltern hieß: »Du heiratest ja sowieso …« Folglich hielten wir unsere Träume für unrealistisch und fügten uns in unser Schicksal als Tippsen.
Karin war nicht adelig, ihre Mutter hatte einen Bürgerlichen geheiratet. Vielleicht deshalb machte sich meine Freundin gern über die blaublütige Verwandtschaft lustig. Die Gräfin hieß mit vollem Namen Helena Victoria Mary von der Wachenheide – das könnte auch gut ein Hundename sein, spottete Karin. Was mich immer wieder verwunderte, war das Benehmen der feinen Dame, die gelegentlich fluchte wie ein Bierkutscher und stets Klo sagte und nicht Toilette wie meine eigene biedere Mutter. Doch gerade dadurch fühlte ich mich in der {26}Rheinallee zu Hause, ich durfte kommen und gehen, wie ich wollte, und sogar den Hund meiner Wirtin mitbringen.
Zufällig war ich gerade dort, als die Haushälterin kichernd berichtete, der Major habe ein Fisternöllchen. Die Gräfin, Karin und ich starrten sie verständnislos an, doch so sagte man im Rheinland für eine »heimliche Liebschaft«. Auch meine Enkelin Laura hat diesen Ausdruck noch nie gehört, flink bedient sie ihr Lieblingsspielzeug, und ich erfahre, dass das Wort ursprünglich aus dem Französischen stammt, wie so manche rheinische Verballhornung. Fils de Noël war ein uneheliches Kind wie das Christkind oder eines vom Weihnachtsmann – oder eines, das bei Nacht und Nebel entstanden ist.
»Dieser Mensch ist verheiratet und hat drei Kinder!«, rief die Gräfin entsetzt. »Und bei mir schleust er heimlich seine Nutten ein! Skandal! Den nehme ich mir heute noch zur Brust, der fliegt hochkantig raus! Es wird nicht schwer sein, einen Ersatz zu finden!«
Leise meldete ich Interesse am Majorzimmer an, doch ich biss auf Granit. Tür an Tür mit drei Junggesellen, impensable! Auch Karin war von ihnen durch mehrere Stockwerke getrennt: Ebenso wie das Dienstmädchen wohnte sie oben in der Mansarde, unter ihnen residierte die Gräfin, und {27}im Erdgeschoss hausten die vier Untermieter. Die Gräfin bezeichnete sie als ihre möblierten Herren. Ich kannte nur einen von ihnen persönlich, denn er fiel auf. Karin hatte ihm insgeheim den Spitznamen »Grizzly« verpasst, weil er riesengroß, bärenstark und tapsig war. (Überdies war er bis über die Ohren in Karin verliebt.) Der Grizzly war Hausmeister im Auswärtigen Amt und ein geschickter Handwerker. Immer wieder wurde er auch in der Rheinallee für kleinere Reparaturen gebraucht, später übernahm er die Bedienung der Zentralheizung, die Gräfin erließ ihm dafür zehn Prozent des Mietpreises.
Um einen neuen Mieter zu finden, wollte die Gräfin keine Anzeige aufgeben, um nicht eine Überzahl an Zuschriften zu erhalten. Sie wusste ohnedies, was sie suchte: einen soliden Beamten, bei dem eine pünktliche Zahlung gewährleistet war. Der Grizzly sollte im Auswärtigen Amt, Karin im Ministerium einen Aushang am Schwarzen Brett anbringen: »Möbliertes Zimmer in Bad Godesberg an alleinstehenden Herrn zu vermieten«.
Karin fiel aus allen Wolken, als sie wenige Tage später von ihrer Tante erfuhr, ein Regierungsrat aus dem Innenministerium habe angerufen, das möblierte Zimmer zwei Stunden später besichtigt und habe sofort den Zuschlag erhalten. »Er kennt dich {28}sogar!«, sagte die Tante. »Ein wirklich anständiger und bescheidener Mann, er heißt Burkhard Jäger.«
Begreiflicherweise war Karin alles andere als begeistert. »I am not amused«, sagte sie zu mir, denn englische Zitate und Vokabeln wurden gerade modern. »Das ist doch nicht die possibility! Ausgerechnet dieser stinklangweilige Aktenhengst wird hier einziehen! Und auch noch in unser allerbestes Zimmer!« Außerdem fanden wir, dass sich ein Regierungsrat doch eine komplette Wohnung leisten könnte. »Hoffen wir, dass es nur vorübergehend ist«, meinte sie. »Vielleicht ist er ja von seiner bisherigen Vermieterin ebenso Knall auf Fall rausgeschmissen worden wie der lüsterne Major. Auf die Schnelle kam ihm diese Möglichkeit wahrscheinlich gerade recht. Der Nächste wird dann hoffentlich mein Traumprinz!«
Es kam vor, dass eine von uns beiden verschlafen hatte oder krank war. Da meine Wirtin keinen Telefonanschluss hatte, konnten wir uns in einem solchen Fall nicht verständigen. Besonders wunderte ich mich also nicht, als Karin ein paar Tage später nicht an der Haltestelle aufkreuzte. Umso mehr erstaunte es mich, dass ich sie bereits im Büro antraf, wo sie sich die verstrubbelten Haare kämmte. »Ich bin heute chauffiert worden!«, sagte sie angeberisch.
{29}»Bist du etwa getrampt?«, fragte ich.
»Der Jäger hat mich auf dem Roller mitgenommen. Wir haben die Straßenbahn ganz lässig überholt! Zufällig kam ich gerade aus der Haustür heraus, als er seine Maschine starten wollte. Als ich ihn fragte, konnte er schlecht nein sagen.«
Ich muss gestehen, dass ich stinksauer war. Karin würde jetzt womöglich jeden Morgen an der Tram vorbeirauschen und mir gnädig zuwinken. Ein einziges Mal, als ich verschlafen hatte, war ich per Anhalter nach Bonn gefahren – allerdings mit schlechtem Gewissen und Herzklopfen, weil man mir von klein auf eingebleut hatte, nicht zu fremden Männern einzusteigen. Doch ich hatte Glück, mein Fahrer war kein Unhold, sondern ein gutgelaunter Student, der den alten Opel Olympia seines Vaters ausgeliehen hatte und mich direkt vor dem Innenministerium ablieferte. Er fragte sogar, ob ich Lust hätte, ihn am Wochenende zu einer Party zu begleiten. Hinterher ärgerte ich mich schwarz, dass ich aus lauter Wohlerzogenheit abgelehnt hatte.
Autos waren in den fünfziger Jahren noch eine Seltenheit. Motorisiert waren natürlich Feuerwehr, Polizei und Krankentransporter, aber noch längst nicht alle Normalverbraucher – in meinem kleinen Heimatort besaß zum Beispiel nur der Arzt ein Auto. In den Ministerien gab es zwar Dienstwagen {30}und Chauffeure für die Häuptlinge, aber bei den mittleren Rängen war ein eigener Wagen noch keine Selbstverständlichkeit. Motorroller als Zwischenlösung waren für junge Leute eine gute Alternative, Lambretta und Vespa die Favoriten. Neidisch malte ich mir Karin als Klammeraffe mit wehendem Rock und flatternden Haaren aus, als Motorradbraut brauchte sie sich keine Monatsfahrkarte mehr zu kaufen.
Rocker gab es damals noch nicht, das Image eines Rollerfahrers war dank italienischer Filme ein völlig anderes und passte zwar zu einem braungebrannten Papagallo mit verspiegelter Sonnenbrille, aber auf keinen Fall zum mausgrauen Burkhard Jäger.
Am Abend besucht mich Laura. »Wie ging das denn weiter mit deiner Freundin? Fuhr sie jetzt immer nur mit diesem Burkhard Jäger zur Arbeit?«
Nein, zum Glück nicht und auf dem Heimweg schon gar nicht. Der Jäger arbeitete viel länger als wir, die wir stets überpünktlich der ehemaligen Kaserne entflohen. Und am Morgen nahm er Karin auch nur mit, wenn sie ihm beim Abfahren auflauerte, und das wurde sie bald leid. Nicht nur bei der Arbeit, sondern oft auch nach Feierabend steckten wir ständig die Köpfe zusammen.
{31}3Der Jäger aus Kurpfalz
Wehmütig erinnere ich mich daran, wie schön es war, an einem großen Fluss zu wohnen. Der Zauber, der von der Rheinlandschaft ausgeht, dem Siebengebirge, den weißen Ausflugsdampfern, Segelschiffchen, Schleppkähnen, Fähren und Bötchen, den Burgen und Schlössern, wurde ja auch schon von den deutschen Romantikern entdeckt und in Märchen und Sagen besungen. Fast täglich saß ich – selbst bei trübem Wetter – auf meiner Bank, ließ den Hund von der Leine und schaute zu, wie er ans Wasser hinunterrannte und schlabberte. An besonders heißen Tagen lief er auf einen der gemauerten Dämme im Fluss, nahm ein Bad und schüttelte sich hinterher ausgiebig neben meinen Beinen. Im Herbst war die Stimmung manchmal ein wenig unheimlich, bei Hochwasser und Nebel sah ich Gespenster. Neben seinen anmutigen, beschaulichen oder fröhlichen Seiten birgt Vater Rhein ja auch dunkle Geheimnisse: Wasserleichen, versunkene Schiffe und Schätze. Sagenhafte Zauberinnen, {32}Nixen und Hexen, die es speziell auf Männer abgesehen haben, treiben bis heute ihr Unwesen.
Den Drachenfels musste ich einmal an einem strahlenden Sonntag mit meinen Eltern besteigen, wobei sich mein beleibter Vater von einem Esel hinauftragen ließ. Verwandte aus der Provinz waren mir immer über die Maßen peinlich, obwohl die meisten Touristen sich genauso aufführten.
Bei gutem Wetter ließ sich Karin gern dazu überreden, am frühen Abend gemeinsam mit mir am Fluss entlangzuschlendern. Auf der Promenade konnte ich den Hund nicht frei laufen lassen, weil Spaziergänger und Radfahrer sich gestört fühlten. Ein paar Meter hinter der Straße lag im Stadtteil Plittersdorf das Büschelchen, ein kleines verwildertes Terrain am Godesberger Bach, wo es keinen Ärger mit Autos, Radlern oder Rentnern gab und mein vierbeiniger Freund nach Lust und Laune im Gebüsch stöbern und nach Kaninchen jagen konnte. Mittlerweile werden dort noble Eigentumswohnungen angeboten. An jenem Tag plauderten wir gerade ausgiebig über interessante Männer und wie sich eine Kriegsverletzung auf eine Ehe auswirken könnte, als sich der Hund – er hieß übrigens Rüdiger, weil er ein Rüde war – eigenartig benahm. Er blieb wie angewurzelt stehen, knurrte leise und bedrohlich, zog {33}den Schwanz ein und hatte offensichtlich Angst. Ich wusste bereits, dass Hunde schlecht sehen und gelegentlich einen Heuhaufen für ein Monster halten, sich aber kurz darauf schämen und ganz beiläufig mit eifrigem Herumschnüffeln von ihrer Schande ablenken. Suchend schaute ich mich um und entdeckte an einer mickrigen Fichte einen Starenkasten, der mir sonst kaum aufgefallen wäre. Seltsamerweise hing das Vogelhaus viel zu niedrig. Ich hatte schon oft gesehen, wie mein Vater auf eine Leiter stieg, um Nistkästen sachgemäß aufzuhängen.
Auch Karin kam der angeknurrte Gegenstand auf einmal verdächtig vor, neugierig trat sie näher heran, stellte sich auf die Zehenspitzen und konnte den kleinen Schieber mühelos hochschieben. Innen lag nicht etwa ein altes Vogelnest, sondern ein winziger Umschlag aus unauffälligem braunem Packpapier.
»Kinderkram, wohl eine Schnitzeljagd. Oder aber ein Liebesbrief!«, sagte sie und legte ihn wieder hinein. Ich beruhigte den feigen Köter, und wir wollten weitergehen. Doch Rüdiger konnte nicht aufhören, direkt unter dem Nistkasten herumzuschnuppern. Schließlich hob er sein Bein an der Fichte und beruhigte sich erst, nachdem er sein Geschäft verrichtet hatte.
»Morgen schauen wir mal nach, ob eine Antwort von seinem Liebchen drinliegt. Womöglich {34}auf lila Papier mit Veilchenduft«, sagte ich belustigt. Es war irgendwie klar, dass die stille Post von einem Jüngling stammen musste, ein Mädchen hätte Wert auf etwas Ansprechenderes mit zarten Symbolen gelegt. Auf dem Rückweg wollte ich noch einmal die Klappe öffnen und spaßeshalber eine Heckenrose hineinlegen, aber der kleine Brief war verschwunden.
Am nächsten Tag konnten wir nicht anders, wir mussten den Starenkasten erneut untersuchen. Wieder fanden wir nur einen winzigen Umschlag aus Packpapier.
Karin wog ihn in der Hand und sagte: »Zu gern wüsste ich, was er ihr heute geschrieben hat …«
»Aufmachen wäre aber sehr indiskret, oder …?«, wandte ich ein.
»Ach Holle, sei nicht so streng!«, meinte meine respektlose Freundin. »Just for fun! Wir verraten es ja keinem Erziehungsberechtigten!«, und schon fing sie an, ganz vorsichtig an einer losen Ecke zu knibbeln, was ihr auch gelang. Ohne den Umschlag zu zerfetzen, konnte sie ihn behutsam öffnen. Innen lag kein Liebesbrief, sondern nur ein schmaler Papierstreifen. Karin las die Großbuchstaben vor:
ONKEL HERMANN GESTORBEN. 22.7.11.45
{35}Seltsam, fanden wir beide. Und irgendwie unheimlich. »Wir müssen den Brief wieder zukleben«, sagte ich ängstlich und sah mich nach allen Seiten um. Weit und breit keine Menschenseele. Karin wühlte in ihrer Jackentasche und fand einen gebrauchten Kaugummi, eingewickelt in Silberpapier. Geschickt zupfte sie winzige Partikel davon ab und benutzte sie als Kleister. Dann machten wir uns schleunigst davon.
Zum Glück war meine Bank am Rhein nicht besetzt. Wir ließen uns nieder und grübelten. Es ergab keinen Sinn, den Tod eines Onkels in einem Starenkasten zu annoncieren! Handelte es sich vielleicht um einen Geheimcode?
»Weißt du noch die Zahl?«, fragte ich.
Karin nickte. Im Gegensatz zu mir konnte sie sich Telefonnummern und Geburtstage ausgezeichnet merken.
»Vielleicht eine Telefon- oder Tresornummer? Der 22.7. könnte aber auch ein Datum sein«, überlegte sie.
»Und 11.45 eine Uhrzeit«, sagte ich, und wir grinsten uns stolz an. So schlau wie der unbekannte Absender waren wir allemal, aber das half uns auch nicht weiter. Oder doch? Ich zählte die Tage an den Fingern ab.
»Heute ist der Neunzehnte – also ist der 22. Juli {36}am nächsten Sonntag!«, sagte ich. »Wie ich es auch drehe und wende, dieser Wisch bleibt mir ein Rätsel! Man kann Hermanns Tod doch nicht für den kommenden Sonntag vorhersagen, noch dazu auf die Minute genau!«
Karin tätschelte Rüdigers Kopf.
»Der Pudel meiner Kusine heißt Theo. Am Ende ist Hermann ein Hund, der eingeschläfert werden soll – aber am Sonntag hat keine Tierarztpraxis geöffnet. Falls es jedoch um einen Menschen geht, soll der Komplize vielleicht Punkt 11.45 Uhr das Zielfernrohr auf den armen Onkel richten!«, überlegte sie. »Es könnte sich um ein geplantes Attentat handeln! Heißt irgendein Politiker Hermann? Oder ist das nur ein Deckname? Wir müssen recherchieren, ob wieder eine Hoheit wie Kaiserin Soraya erwartet wird! Ich meine, Nehru ist demnächst fällig oder sogar die Queen!«
»Sollten wir nicht lieber zur Polizei gehen?«
»Bloß nicht! Wir würden uns nur lächerlich machen. Aber wir werden die Sache im Auge behalten und für den nächsten Brief eine Tube Uhu bereithalten.«
Wir kicherten ein wenig, aber ganz wohl war uns bei der Sache nicht. Ich begleitete Karin schließlich bis zum gräflichen Anwesen, wo wir am Törchen stehen blieben und weiter Spekulationen anstellten. {37}Rüdiger wurde es langweilig, er riss sich los und sauste in die Einfahrt hinein, wo die blaue Vespa parkte. Schon wieder benahm er sich recht eigenartig, schlich knurrend und schnüffelnd um den Roller herum und stützte schließlich das erhobene Hinterbein am Schutzblech ab, um ausgiebig zu urinieren.
»Hoffentlich guckt der Jäger nicht gerade aus dem Fenster«, sagte ich etwas verlegen, schnappte mir die Leine und trollte mich. Von da an nannte ich meinen Begleiter Rüdiger nur noch Rüpel.
Meine Enkelin Laura kommt gerade aus einer Teambesprechung und ist völlig ausgepowert, wie sie meint. Zügig zieht sie sich die Stiefel aus, schmeißt sie in die Ecke und sich auf mein Sofa. Seit langem ist sie Sushi-süchtig – sie hat einen Faltkarton mit diesem japanischen Zeug mitgebracht und scheint es zu genießen, ich ekle mich vor kaltem Reis und rohem Fisch und lehne dankend ab. Wie im alten Rom fläzt sie sich zum Essen auf das Sofa. Beim Kauen und Schlucken hört sie mir aufmerksam zu, während ich wie gebannt auf ihre Fingernägel starre. Sie sind nur an den Spitzen rot lackiert, so dass sie an die blutigen Krallen eines Raubtiers erinnern. Angeblich sind es mehrere Schichten, damit es länger hält. Auch Karin und ich experimentierten {38}