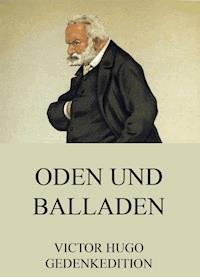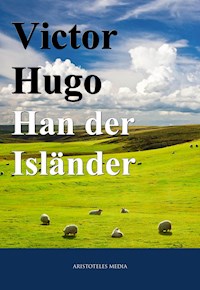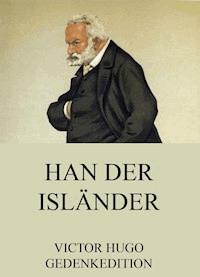
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hugos Erstlingswerk "Han der Isländer", eine in Norwegen angesiedelte Geschichte eines Liebespaares, gehört zu den Klassikern der Literaturgeschichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 436
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Han der Islaender
Victor Hugo
Inhalt:
Victor Hugo – Biografie und Bibliografie
Han der Islaender
Band 1
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Kapitel XVIII
Kapitel XIX
Kapitel XX
Kapitel XXI
Kapitel XXII
Band 2
Kapitel XXlll.
Kapitel XXlV.
Kapitel XXV.
Kapitel XXVI.
Kapitel XXVII.
Kapitel XXVIII.
Kapitel XXIX.
Kapitel XXX
Kapitel XXXI.
Kapitel XXXII.
Kapitel XXXIII.
Kapitel XXXIV.
Kapitel XXXV.
Kapitel XXXVI.
Kapitel XXXVII.
Kapitel XXXVIII.
Kapitel XXXIX.
Kapitel XL.
Kapitel XLI.
Kapitel XLII.
Kapitel XLIII.
Kapitel XLIV.
Kapitel XLV.
Kapitel XLVI.
Kapitel XLVII.
Kapitel XLVIII.
Kapitel XLIX.
Han der Isländer, V. Hugo
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849628383
www.jazzybee-verlag.de
Victor Hugo – Biografie und Bibliografie
Victor Marie Hugo, berühmter franz. Dichter, geb. 26. Febr. 1802 in Besançon, gest. 22. Mai 1885 in Paris, war der Sohn eines Offiziers, Sigisbert H., der sich in der Folge zum General und Grafen des Kaiserreichs emporschwang, und der royalistisch gesinnten Tochter eines Reeders von Nantes, Sophie Trébuchet. Für die militärische Laufbahn bestimmt, begleitete er den Vater auf dessen wechselvollen Zügen nach Italien und Spanien. Seine erste Gedichtsammlung, die »Odes et ballades« (1822–26, 3 Bde.), die ihn noch als königstreuen Katholiken zeigt, läßt noch häufig die hergebrachten Muster erkennen, aber der hinreißende Schwung der Sprache, die Kühnheit der Bilder und die ungewohnte Behandlung des Verses verkündigen bereits den künftigen poetischen Revolutionär. Vom König Ludwig XVIII. mit einer Pension von 1000 (später 2000) Frank bedacht, verheiratete sich H. 1822 mit Adéle Foucher (vgl. »Victor H., lettres à la fiancée, 1820–1822«, Par. 1901) und ließ zunächst zwei Romane: »Han d'Islande« (1823) und »Bug Jargal« (1825), erscheinen, worin er sich schon entschlossener von der klassischen Richtung losriß und, wenn zunächst auch nur durch die Vorliebe für das Schauerliche, Mißgeformte und Ungeheure, das Signal zu der großen romantischen Bewegung gab. deren oberster Vertreter er in den nächsten 20 Jahren sein sollte. Weiterhin folgten: das die Verhältnisse eines Bühnenabends weit überschreitende Trauerspiel »Cromwell« (1827), in dessen Vorrede (diese hrsg. von Souriau, 1897) er zugleich sein damaliges ästhetisch-philosophisches Glaubensbekenntnis ablegte; die »Orientales« (1828), Gedichte, welche die Erhebung Griechenlands feiern u. den Zauber des Orients in farbenglühenden Strophen preisen; und die Dramen: »Marion de Lorme« (1829), die Verherrlichung einer durch Liebe rein gewaschenen und verklärten Kurtisane, und »Hernani«, das 1830 zur ersten Ausführung kam und zu einer offenen Schlacht zwischen den Klassizisten und Romantikern Veranlassung gab. Das Stück ist der eigentliche Prototyp des Hugoschen Drama s mit all seinen Gebrechen und Absonderlichkeiten, aber auch mit seinem über alle Bedenken hinwegreißenden Schwung der Sprache und seinen grellen, jedoch durch die Form geadelten Effekten. Mit wechselndem Erfolg lösten sich in den nächsten Jahren auf dramatischem Gebiet ab: »Le roi s'amuse« (1832), nach der ersten Vorstellung verboten; »Marie Tudor« und »Lucrèce Borgia« (1833); »Angelo« (1835); »Ruy Blas« (1838) u. die Trilogie »Les Burgraves« (1843), welch letztere dem Dichter eine so empfindliche Niederlage bereitete, daß er dem Theater für lange Zeit den Rücken kehrte. Fast nur »Hernani« und »Ruy Blas« haben sich auf der Bühne gehalten Von sonstigen Werken fallen noch in diese Periode: der Roman »Notre Dame de Paris« (1831), ein zuweilen absonderliches, aber farbenreiches Kulturgemälde des mittelalterlichen Paris; sodann »Le dernier jour d'un condamné« (1829), ein ergreifendes Plaidoyer gegen die Todesstrafe, dem sich »Claude Gueux« (1834) mit gleicher Tendenz anschloß; die »Feuilles d'automne« (1831), eine Sammlung von Gedichten, in denen die politische und sogar die revolutionäre Saite schon ziemlich vernehmlich anklingt; die »Etudes sur Mirabeau« (1834); die »Chants du crépuscule« (1835) mit dem berühmten Liederzyklus an die Vendômesäule (»A la colonne«); ferner: »Les voix intérieures« (1837); »Les rayons et les ombres« (1840) und »Le Rhin«, Reiseerinnerungen (1842, 2 Bde.). Viele seiner Liebeslieder sind an die schöne Schauspielerin Juliette Gauvain (Frau Drouet) gerichtet, deren Gesichtszüge in dem Standbilde der Straßburg auf dem Concordeplatz verewigt sind, und die H. in der Prinzeß Negroni (in »Lucrèce Borgia«) zu schildern suchte. Das Liebesverhältnis, das von Frau H. geduldet wurde, hat lange Jahre bestanden. Inzwischen war H. 1841 zum Mitgliede der französischen Akademie erwählt worden, und im April 1845 ernannte ihn Ludwig Philipp zum Pair von Frankreich. In politischer Hinsicht war er mehr und mehr zum Liberalismus übergegangen und stand eine Zeitlang den Bonapartisten nahe. Als Mitglied der Konstituierenden Nationalversammlung von 1848 nahm er trotzdem anfangs seinen Sitz auf der Rechten, bis er mit einem kühnen Satz ins Lager der äußersten Linken übertrat. Nach dem Staatsstreich vom 2. Dez. 1851 als einer der ersten proskribiert, zog sich H. mit seiner Familie nach der Insel Jersey, einige Zeit später nach Guernsey zurück und veröffentlichte von hier aus 1852 das Pamphlet »Napoléon le Petit« und 1853 die haßerfüllten Gedichte »Les Châtiments«. In der Verbannung nahm Hugos Lyrik vorwiegend philosophische Tendenzen an, denen er seitdem in zahlreichen, an Wert ungleichen Dichtungen Ausdruck gegeben hat. Dahin gehören: »Les Contemplations« (1856, 2 Bde.); »Chansons des rues et des bois« (1865); »La légende des siècles«, in tühnen, oft dunkeln Visionen alle Zeitalter und Formen der menschlichen Zivilisation umfassend (1859, zweite Serie 1877, letzte 1883); »Le Pape« (1878); »Religions et religion« (1879); »L'âne« (1880), sämtlich in den Jahren des Exils entstanden. Auf dem Felde des Romans kultivierte er um diese Zeit die sozialen Fragen in »Les Misérables« (1862, 10 Bde.), »Les travailleurs de la mer« (1866, 3 Bde.) und »L'homme qui rit« (1869, 4 Bde.). Außerdem entstand damals sein Buch »William Shakespeare« (1864). Gegen das Kaiserreich bis zuletzt unversöhnlich, kehrte er erst nach dessen Sturz 1870 nach Paris zurück, beschenkte die belagerte Stadt mit zwei Geschützen und wurde im Februar 1871 in die Nationalversammlung von Bordeaux gewählt, wo er gegen den Friedensschluß protestierte, jedoch bald darauf austrat. Bei einer zweiten Kandidatur 1872 in Paris unterlag er infolge seiner Sympathien für die Kommune, dagegen wurde er 1876 von den Vertretern der Hauptstadt in den Senat gewählt. Seit seiner Rückkehr publizierte er noch: »L'année terrible« (1872), voll von Rachedurst und den ausschweifendsten Zornergüssen gegen Napoleon III. und gegen die Deutschen; »Quatrevingt-treize«, einen in der Vendée spielenden Roman mit leider ganz falscher Lokalfarbe (1874); »Mes fils«, Gedenkblatt für seine früh verstorbenen Söhne (in Charles Hugos »Hommes de l'esprit«, 1874); »Actes et paroles, 1841–1876« (1875–76, 3 Bde.; deutsch, Berl. 1875–77, 3 Bde.); »L'histoire d'un crime«, die Geschichte des Staatsstreichs vom 2. Dez, nach persönlichen Erlebnissen erzählt (1877); »L'art d'être grand-père«, ein lyrisches Familienbild (1877), und »La pitié suprême«, ein Schlußplaidoyer für die Amnestie der Kommuneverbrecher (1879).
H. ist in den Augen der Franzosen ihr größter und universellster Dichter. Was ihn insbes. über die besten seiner Zeitgenossen erhebt, ist die bei Dichtern so seltene Eigenschaft: Kraft. Gewaltig ist er in der Schilderung menschlicher Leidenschaft wie großer Naturerscheinungen, in der Behandlung der nationalen Sprache, die er nachgerade verjüngt hat, wie in der Struktur des spröden französischen Verses, den er um ungeahnte Modulationen bereichert hat. Auf der andern Seite kann H. den Hang des Romanen zum Überschwenglichen, Schwülstigen und Betäubenden, zum grob materiellen Effekt nie verleugnen. Humor ward ihm kaum verliehen, und witzig ist er nie gewesen. So versinnlicht H. in seiner öffentlichen wie in seiner schriftstellerischen Laufbahn die vollkommenste Form des Franzosen des 19. Jahrhunderts. Nach seinem Tod erschienen: »Théâtreen liberté« (1886) und »La fin de Satan« (1886). Seit 1837 war H. Offizier der Ehrenlegion. Eine Gesamtausgabe seiner Werke (»Ne varietur«) erschien 1880–89 in 48,1889 ff. in 70 Bänden. In deutscher Übersetzung hat man von ihm: »Sämtliche Werke, übersetzt von mehreren« (3. Aufl., Stuttg. 1858–62, 21 Bde.); »Poetische Werke«, übersetzt von L. Seeger (unvollendet; das. 1860–62, 3 Bde.), und eine Auswahl von Hugos Gedichten, übersetzt von Freiligrath (Frankf. a. M 1815). In »Victor H., raconté par un témoin de sa vie« (1863) hat der Dichter seiner eignen Frau die Feder geführt. Sein Briefwechsel erschien in 2 Bänden: »Correspondance 1815–1835« (Par. 1896) und »Correspondance 1836–1882« (das. 1898).Vgl. außerdem Rivet, Victor H. chez lui (1878); P. de Saint-Victor, Victor H. (1885); Barbou, V. H. et son temps (1881; deutsch von Weber, Leipz. 1881); Asseline, V. H. intime (1885); Ulbach, La vie de V. H. (1886); Biré, V. H. avant 1830 (1883), V. H. après 1830 (1891, 2 Bde.) und V. H. après 1852 (1894; Biré ist Reaktionär und ein heftiger Gegner Hugos); E. Dupuy, V. H., l'homme et le poète (3. Aufl. 1898) und La jeunesse de V. H. (1902); Mabilleau, V. H. (3. Aufl. 1902); Renouvier, V. H., le poète (1893) und V. H., le philosophe (1900); Theys, Métrique de V. H. (Lüttich 1895); Claretie, V. H., souvenirs intimes (1902); P. Stapfer, V. H. et la grande poésie satirique (1901); »Victor H., leçons faites à l'École normale« (hrsg. von Brunelière, 1902, 2 Bde.); Glachaut, Essai critique sur le théàtre de V. H. (1902); »Legay, V. H., jugé par son siècle« (1902); T. Gautier, V. H. (1902); Lesclide, V. H. intime (1902); Dannehl, Victor H. (Berl. 1886); Martin Hartmann, Chronologische Auswahl der Gedichte Hugos (Leipz.1884) und Zeittafel zu Hugos Leben und Werken (Oppeln 1886); Möll, Entstehung der »Orientales« (Heidelb. 1901); Sleumer, Die Dramen V. Hugos (Berl. 1901); Barnett Smith, V. H., his life and works (Lond. 1885); Swinburne, A study of V. H. (das. 1886; Swinburne ist Hugos Hauptnachahmer in England); Nichol, V. H. (das. 1893); P. Ahlberg, V. H. och det nyare Frankrike (Stockh. 1879–80, 3 Bde.); Levin, V. H. (Kopenh. 1902, 2 Bde.).
Von Hugos Söhnen ist Charles (geb. 1826), der an der Seite seines Vaters publizistisch wirkte und auch einige jetzt vergessene Romane schrieb, 15. März 1871 in Bordeaux, der zweite, François (geb. 1828), Verfasser einer lobenswerten Übersetzung von Shakespeares sämtlichen Dramen und Sonetten, 25. Dez. 1873 in Paris gestorben. – Von seinen Töchtern starb Adele in einer Irrenanstalt; Leopoldine ertrank 1843 mit ihrem Gatten, einem Bruder des Schriftstellers Vacquerie, in der Seine. Die Witwe Charles Hugos hat sich 1877 mit dem Politiker Edouard Lockroy (s. d.) wieder verheiratet. Die Tochter Charles', Jeanne, die im »Art d'être grand-père« verherrlicht ist, ist mit dem Sohn A. Daudets vermählt.
Han der Islaender
Band 1
Kapitel I
»Dahin führt die Liebe, Nachbar Niels; diese arme Guth Stersen würde nicht auf diesem großen schwarzen Stein da ausgestreckt liegen, wie ein Seefisch, den die Ebbe zurückgelassen hat, wenn sie nie an etwas Anderes gedacht hätte, als die Bretter am Nachen ihres Vaters festzunageln oder seine Netze zu flicken. Möge St. Usuph der Fischer unsern alten Kameraden in seinem Leide trösten!«
»Und ihr Bräutigam,« fiel eine heisere zitternde Stimme ein, »Gill Stadt, dieser schöne, junge Mensch, der neben ihr liegt, würde nicht da sein, wenn er, statt diese Guth zu lieben und in den verfluchten Bergwerken von Roeraas sein Glück zu suchen, an der Wiege seines jungen Bruders, die an den rauchigen Balken seiner Hütte hängt, sitzen geblieben wäre.«
Der Nachbar Niels unterbrach sie: »Euer Gedächtnis, altert mit Euch, Mutter Olly. Gill hat niemals einen Bruder gehabt, und deßhalb muß der Schmerz der armen Wittwe Stadt um so bitterer sein, denn ihre Hütte ist jetzt ganz einsam und verlassen. Wenn sie zum Himmel aufblicken will, um dort Trost zu suchen, so findet sie zwischen ihren Augen und den Wolken ihr altes Dach, an dem noch die leere Wiege ihres Kindes hängt, das ein großer Jüngling geworden und dann gestorben ist.«
»Arme Mutter!« sagte die alte Olly. »Was den jungen Menschen betrifft, so ist er selbst Schuld, warum ist er Bergknappe in den Minen von Roeraas geworden?«
»Ich glaube in der That,« sagte Niels, »daß diese höllischen Minen für jeden Centner Kupfer, den sie uns geben, uns einen Menschen nehmen. Was meint Ihr, Gevatter Braal?«
»Die Bergleute sind Narren,« erwiederte der Fischer. »Wenn der Fisch leben will, darf er nicht aus dem Wasser, und wenn der Mensch leben will, so soll er nicht unter den Boden.«
»Aber,« fragte ein junger Mensch unter dem Hausen, »wenn es für Gill Stadt nöthig war, in den Minen zu arbeiten, um seine Braut zu bekommen?.. .«
»Man muß,« unterbrach ihn Olly, »man muß niemals sein Leben aussetzen für Neigungen, die es nicht werth sind. Ein schönes Brautbett, das Gill für seine Guth gewonnen hat!«
»Dieses junge Mädchen,« fragte ein Neugieriger, »hat sich also aus Verzweiflung über den Tod des jungen Menschen ertränkt?«
»Wer sagt das?« rief mit starker Stimme ein Soldat aus, der durch den Haufen gedrungen war. »Dieses junge Mädchen, das ich wohl kenne, war allerdings die Braut eines jungen Bergmanns, den kürzlich ein Felsstück in den unterirdischen Gängen der Storwaadsgrube bei Roeraas zerschmettert hat; aber sie war zugleich die Geliebte eines meiner Kameraden, und als sie vorgestern sich zu Munckholm einschleichen wollte, um dort mit ihrem Liebhaber den Tod ihres Bräutigams zu feiern, strandete ihr Nachen an einer Klippe, und sie ist er» trunken.«
Ein Geräusch verwirrter Stimmen erhob sich. »Unmöglich, Herr Soldat!« schrieen die alten Weiber; die jungen schwiegen, und der Nachbar Niels wiederholte boshafterweise dem Fischer Braal seinen bedeutsamen Spruch: »Dahin führt die Liebe!«
Der Soldat begann im Ernst auf seine weiblichen Gegner böse zu werden, und nannte sie bereits alte Hexen aus der Grotte von Quiragoth, welche grobe Beschimpfung sie nicht geduldig hinzunehmen geneigt waren, als plötzlich eine kreischende Stimme in gebietendem Tone rief: » Stille! Stille» ihr Plaudertaschen!« Alles schwieg. Der Auftritt, dessen Erzählung wir hier begonnen haben ging in einem jener traurigen Gebäude vor, welche das öffentliche Mitleid und die staatsgesellschaftliche Umsicht für die unbekannten Leichname erbaut haben, diesem letzten Zufluchtsorte von Todten, die meistens unglücklich gelebt haben, und wo sich der gleichgültige Neugierige, der grämliche oder wohlwollende Beobachter, und oft trauernde Verwandte und Freunde drängen, denen eine lange und unerträgliche Unruhe nur noch eine einzige klägliche Hoffnung übrig gelassen hat. In der von uns bereits weit entfernten Epoche und in dem wenig civilisirten Lande, wo diese Geschichte spielt, war man noch nicht, wie in unsern Städten von Koth und Gold, auf den Gedanken gekommen, aus diesen Orten künstlich furchtbare und elegant traurige Monumente zu machen. Der Tag fiel nicht durch die hohe Wölbung auf eine Art von Ruhebetten, wo man den Todten einige der Bequemlichkeiten des Lebens lassen zu wollen schien, und wo ein Kopfkissen, wie für Schlafende, vorhanden ist. Wenn die Thüre des Wächters sich öffnete, konnte sich nicht, wie heutzutage, das von dem Anblick nackter und scheußlicher Leichname ermüdete Äuge durch den Anblick kostbarer Geräthschaften und freundlicher Kinder erholen. Dort war der Tod in seiner ganzen Häßlichkeit, in seinem ganzen Schrecken, und man hatte noch nicht versucht, sein fleischloses Skelett mit Putz und Bändern zu verzieren.
Der Saal, in welchem sich die handelnden Personen befanden, war geräumig und dunkel, wodurch er noch geräumiger erschien: er erhielt sein Licht bloß durch eine niedere, viereckige Thüre, die sich aus den Hafen von Drontheim öffnete, und durch eine plumpe Oeffnung in der Decke, durch welche mit dem Regen, dem Hagel und Schnee, je nach der Jahreszeit, ein bleiches Licht auf die Leichname herabfiel, hie sich unmittelbar darunter befanden. Dieser Saal war in seiner Breite durch ein eisernes Gitter von halber Manneshöhe in zwei Hälften getheilt. Das Publikum trat durch die viereckige Thüre in die erste Hälfte ein: in der zweiten Hälfte sah man sechs lange steinerne Lager, in paralleler Richtung, für die Leichname. Eine kleine Seitenthüre diente dem Wächter und seinem Gehülfen, deren Wohnung den hintern Theil des hart an das Meer stoßenden Gebäudes einnahm, zum Eingang. Aus zweien dieser steinernen Betten lagen der Bergmann und seine Braut. Der Leichnam des Mädchens ging bereits in Verwesung über; die Züge des Mannes schienen hart und düster, und sein Körper war furchtbar verstümmelt.
Vor diesen entstellten menschlichen Leichnamen hatte die Unterhaltung begonnen, welche wir so eben erzählt haben.
Ein langer, ausgetrockneter alter Mann, der indem dunkelsten Winkel des Saals mit gesenktem Haupt auf einem halb zerfallenen Schemel saß, hatte bis zu dem Augenblicke, wo er sich plötzlich mit dem Ruf: » Stille! Stille! ihr Plauder» laschen!« erhob, dem Gespräch gar keine Aufmerksamkeit zu schenken geschienen.
Alle schwiegen, der Soldat wandte sich um, und als er das eingefallene Gesicht, die wenigen schmutzigen Haare, die hagere, ganz in Rennthierfelle gekleidete Gestalt des Alten erblickte, brach er in lautes Lachen aus. In den Reihen der im ersten Augenblicke bestürzten Weiber erhob sich jetzt ein Gemurmel: »Das ist der Wächter des Spladgest! – Dieser höllische Thürsteher der Todten! – Dieser teuflische Spiagudry! Dieser verfluchte Hexenmeister!«
»Stille! Stille, ihr Plaudertaschen! Wenn es heute Hexen-Sabbath ist, so holt eure Besen, sonst stiegen sie allein fort. Lasset diesen geehrten Abkömmling des Gottes Thor in Ruhe!«
Mit diesen Worten wandte sich Spiagudry dem Soldaten zu und sprach mit einer freundlichen Grimasse: »Ihr sagtet so eben, mein Tapferer, daß dieses elende Weibsbild ....«
»Der alte Schacher!« murmelte Olly. »Ja, freilich, wir sind in seinen Augen elende Weibsbilder, weil unsere Leichname, wenn sie in seine Klaue fallen, ihm nach der Taxe bloß dreißig Pfennige eintragen, wahrend er für das Gerippe eines Mannes vierzig bekommt.«
»Stille, ihr alten Hexen!« wiederholte Spiagudry. »Diese verdammten Weiber sind wie ihre Kessel; wenn sie heiß werden, fangen sie an zu pfeifen. Sagt mir doch, mein tapferer Degenknopf, Euer Kamerad, dessen Geliebte diese Guth war, wird wohl aus Verzweiflung über ihren Verlust einen Selbstmord begehen? ...«
Hier erfolgte der lange zurückgehaltene Ausruf: »Hört ihr den Schacher, den alten Heidenkopf?» schrieen zwanzig kreischende, mißtönende Stimmen. »Erwünscht einen Lebenden weniger wegen der vierzig Pfennige, die ihm ein Todter einträgt!«
»Und wenn es so wäre?« fuhr der Wächter des Spladgest fort. »Unser gnädigster König und Herr, Christiern der Fünfte, erklärt sich auch zum geborenen Beschützer aller Bergleute, damit sie bei ihrem Tode seinen königlichen Schatz mit ihrem lumpigen Nachlaß bereichern.«
»Ihr erweist dem König viel Ehre,« sagte der Fischer Braal, »daß Ihr seinen königlichen Schatz mit Eurer Bettelbüchse und Euch mit ihm vergleicht, Nachbar Spiagudry.«
»Nachbar!« wiederholte der Wächter des Spladgest, den diese Vertraulichkeit ärgerte. »Euer Nachbar! Sagt lieber, Euer Wirth, denn, mein lieber Schiffmann, es könnte wohl eines Tages geschehen, daß ich Euch auf einem meiner sechs steinernen Betten beherbergte.«
»Im Uebrigen,« fügte er lachend hinzu, »wenn ich von dem Tode dieses Soldaten sprach, so geschah es bloß, um in den großen und tragischen Leidenschaften, welche die Weiber einflößen, den löblichen Gebrauch des Selbstmords verewigt zu sehen.«
»Nun, großer Leichnam, der Du Leichname hütest,« sagte der Soldat, »wohin zielst Du denn mit Deiner liebenswürdigen Grimasse, die dem letzten Lachen eines Gehenkten gleicht?«
»Wohl gesprochen, mein Tapferer!« antwortete Spiagudry. »Ich war immer der Meinung, daß unter dem Helm des Waffenmannes Thurn, der den Teufel mit Schwert und Zunge überwand, mehr Verstand stecke, als unter der Mütze des Bischofs Isleif, der die Geschichte von Island verfaßt, und unter der Schlafhaube des Professors Schönning, der unsere Hauptkirche beschrieben hat.«
»In diesem Falle, mein alter Ledermann, rathe ich Dir, die Einkünfte Deiner Fleischbank im Stiche zu lassen und Dich in das Naturalienkabinet des Vicekönigs zu Bergen zu verkaufen. Ich schwöre Dir bei Sankt Belphegor, daß man dort die seltenen Thiere mit Gold auswägt. Jetzt aber sage mir erst, was Du denn eigentlich von mir willst?«
»Wenn die Leichname, die man uns bringt, im Wasser gefunden worden sind, so müssen wir die Hälfte der Taxe den Fischern abgeben. Ich wollte Euch demnach bitten, erlauchter Nachkomme des Waffenmannes Thurn, Euern unglücklichen Kameraden zu vermögen, daß er sich nicht ersäufe, sondern irgend eine andere Todesart wähle. Das kann ihm ja ganz einerlei sein, und wenn ihn doch einmal seine unglückliche Liebe zu dieser Handlung treibt, so wird er einem unglücklichen Christen, der seinen Leichnam gastfreundlich ausnimmt, im Sterben kein Unrecht zufügen wollen.«
»Hierin, mein gastfreundlicher Wirth, irrt Ihr Euch gewaltig, mein Kamerad bedankt sich für die Ehre, in Eure appetitliche Herberge mit den sechs Betten aufgenommen zu werden. Meint Ihr denn, er habe sich für den Verlust dieses Liebchens da nicht bereits durch ein anderes entschädigt? Ich schwöre Euch bei meinem Bart, daß er Eurer Guth längst übersatt war.«
Bei diesen Worten brach das Ungewitter, das Spiagudry einen Augenblick auf sein Haupt abgelenkt halte, stürmischer als je über den unverschämten Kriegsmann los.
»Wie, elender Taugenichts!« schrieen die alten Weiber. »So leicht vergeht Ihr uns! Jetzt gebt euch mehr mit diesen Schlingeln ab!«
Die jungen Weiber und Mädchen schwiegen fortwährend. Mehrere von ihnen sahen diesen Taugenichts an und fanden ihn nicht so übel.
»Oh! Oh!« sagte der Soldat, »sind wir denn auf dem Hexentanz? Das ist eine harte Zugabe für Freund Beelzebub, daß er allwöchentlich einen solchen Chorus hören muß!«
Man weiß nicht, auf welche Weise sich dieser Sturm zuletzt noch entladen haben würde, wenn nicht die allgemeine Aufmerksamkeit durch ein von Außen kommendes Geräusch in Anspruch genommen worden wäre. Das Geräusch nahm allmählig zu, und bald stürmte ein Schwarm halbnackter Buben, um eine von zwei Männern getragene und bedeckte Tragbahre herum laufend und schreiend, in den Spladgest herein.
»Woher kommt das?« fragte der Wächter die Träger.
»Vom Strande von Urchthal.«
»Oglypiglap!« rief Spiagudry.
Aus einer Seitenthüre trat ein kleiner, in Leder gekleideter Lappländer herein, und gab den Trägern ein Zeichen, ihm zu folgen. Spiagudry begleitete sie, und die Thüre schloß sich wieder, ehe noch die neugierige Menge an der Länge des auf der Tragbahre liegenden Leichnams errathen konnte, ob es ein Mann oder ein Weib sei.
Um diesen Gegenstand drehte sich das allgemeine Gespräch, als Spiagudry und sein Gehülfe wieder erschienen und den Leichnam eines Mannes auf einem der steinernen Betten niederlegten.
»Es ist schon lange her, daß ich keine so schöne Kleider mehr berührt habe,« sagte Oglypiglap, schüttelte den Kopf, stellte sich auf die Spitze der Zehen und hängte eine prächtige Hauptmannsuniform über dem Todten auf. Der Kopf des Leichnams war entstellt und die übrigen Glieder mit Blut bedeckt. Der Wächter begoß ihn mehrmals aus einer alten halb zerbrochenen Wasserrinne.
»Bei St. Beelzebub!« rief der Soldat, »das ist ein Offizier von meinem Regiment. Laßt sehen! Ist es vielleicht der Hauptmann Bollar, aus Schmerz, seinen Oheim verloren zu haben? Bah! Er erbt ja. Der Baron Randmer? Er hat gestern sein Gut im Spiele verloren, aber er wird es morgen nebst dem Schlosse seines Gegners wieder gewinnen. Oder der Hauptmann Lory, dessen Hund ersoffen ist? Oder der Zahlmeister Stunk, dessen Weib untreu ist? In der That, Alles das ist kein Grund, sich eine Kugel vor den Kopf zu schießen.«
Die Menge nahm mit jedem Augenblicke zu. Ein junger Mann ritt am Hafen vorüber, sah das Zuströmen des Volks, stieg vom Pferde, warf den Zügel seinem Bedienten zu und trat in den Spladgest herein. Er trug ein einfaches Reisekleid, war mit einem Säbel bewaffnet und in einen weiten grünen Mantel gewickelt. Eine schwarze Feder, die mit einer diamantenen Schnalle an seinem Hut befestigt war, fiel auf sein edles Gesicht herab und wogte auf seiner hohen, von langen braunen Haaren beschatteten Stirne. Seine mit Koth bespritzten Stiefel und Sporen bewiesen, daß er einen weiten Weg gemacht hatte.
Als er eintrat, sagte eben ein kleiner untersetzter Mann, der, gleich ihm, in einen Mantel gewickelt war und seine Hände, in großen Handschuhen stecken hatte, zu dem Soldaten: »Und wer sagt Euch denn, daß er sich selbst umgebracht hat? Dieser Mann da, dafür stehe ich Euch, hat sich eben so wenig selbst umgebracht, als das Dach Eurer Hauptkirche sich von selbst entzündet hat.«
»Unsere Hauptkirche!« sagte Niels, »man deckt sie jetzt mit Kupfer. Dieser elende Han der Isländer hat, wie es heißt, das Feuer eingelegt, um den Bergleuten Arbeit zu schaffen, unter denen sich sein Schützling Gill Stadt befand, der jetzt hier liegt.«
»Zum Teufel!« rief seinerseits der Soldat, »mir, dem zweiten Arquebusier der Garnison von Munckholm, ins Angesicht zu behaupten, daß dieser Mann da sich nicht vor den Kopf geschossen habe!«
»Dieser Mensch ist ermordet worden,« erwiederte der kleine Mann ruhig.
»Höre einmal, Du Orakel! Deine kleinen grauen Augen sehen nicht heller, als Deine Hände unter den großen Handschuhen da, womit Du sie mitten im Sommer bedeckst.«
Ein Blitz schoß aus den Augen des kleinen Mannes: »Soldat! Bitte Deinen Schutzpatron, daß nicht eines Tages diese Hände da ihre Spuren auf Deinem Gesichte zurücklassen mögen!«
»Heraus denn!« rief der zornige Soldat. »Doch nein,« fügte er plötzlich hinzu, »vor Todten soll man nicht von einem Zweikampfe sprechen.«
Der kleine Mann murmelte einige Worte in einer fremden Sprache und verschwand.
Eine Stimme rief: »Am Strande von Urchthal hat man ihn gefunden.«
»Am Strande von Urchthal?« sagte der Soldat, »dort sollte diesen Morgen der Hauptmann Dispolsen, der von Kopenhagen kommt, sich ausschiffen.«
»Der Hauptmann Dispolsen ist noch nicht zu Munckholm angekommen,« rief eine andere Stimme. »Es heißt,« fuhr ein Dritter fort, »daß sich Han der Isländer jetzt dort herumtreibt.«
»In diesem Falle,« sagte der Soldat, »ist es möglich, daß dieser Mann der Hauptmann Dispolsen ist, wenn ihn Han umgebracht hat, denn Jedermann weiß, daß dieser Isländer auf eine so teuflische Art mordet, daß seine Schlachtopfer oft wie Selbstmörder aussehen.«
»Was ist denn das für ein Mensch, dieser Han?« fragte Jemand.
»Ein Riese,« sagte der Eine.
»Ein Zwerg,« sprach der Andere.
»Hat ihn denn noch Niemand gesehen?« fragte eine Stimme.
»Wer ihn zum ersten Mal sieht, hat ihn auch zum letzten Mal gesehen.«
»Stille!« sagte die alte Olly; »es gibt nur drei Personen, die jemals menschliche Worte mit ihm gewechselt haben: dieser Heide Spiagudry da, die Wittwe Stadt und ... aber sein Leben und Tod war unglücklich ... dieser arme Gill, den ihr da liegen seht. Stille!«
»Stille!« wiederholte man von allen Seiten.
»Jetzt,« rief plötzlich der Soldat, »jetzt weiß ich gewiß, daß es wirklich der Hauptmann Dispolsen ist, ich erkenne die Stahlkette, welche ihm unser Gefangener, der alte Schuhmacher, bei seiner Abreise geschenkt hat.«
Der junge Mann mit der schwarzen Feder fiel ihm heftig ins Wort: »Ihr wißt gewiß, daß dies der Hauptmann Dispolsen ist?«
»Gewiß, so wahr es einen Beelzebub gibt!« versicherte der Soldat.
Der junge Mann ging rasch hinaus.
»Eine Barke nach Munckholm!« sagte er zu seinem Diener.
»Aber, gnädiger Herr, und der General? ...«
»Du bringst ihm die Pferde. Ich komme morgen zu ihm.
Bin ich mein Herr oder nicht? Vorwärts, der Tag neigt sich, und ich habe Eile, eine Barke also!«
Der Diener gehorchte und folgte eine Zeit lang mit den Augen dem Nachen, in welchem sein junger Herr saß, und der sich mit schnellem Ruderschlag vom Ufer entfernte.
Kapitel II
Der Leser weiß, daß wir uns zu Drontheim, einer der vier größten Städte Norwegens, obwohl nicht der Residenz des Vicekönigs, befinden. Zur Zeit, in welcher diese Geschichte vorging – im Jahre 1699 – gehörte das Königreich Norwegen noch zu Dänemark, und wurde von Vicekönigen regiert, deren Sitz zu Bergen, einer größeren, schöneren und südlicher gelegenen Stadt, als Drontheim, war.
Drontheim bietet einen angenehmen Anblick dar, wenn man es von dem Golf aus betrachtet, dem diese Stadt ihren Namen gegeben hat. Der Hafen ist ziemlich breit und die Stadt liegt in einer wohlbebauten Ebene. Mitten im Hafen, einen Kanonenschuß vom Ufer, erhebt sich, auf einer von Wogen umspülten Felsenmasse, die einsame Feste Munckholm, ein düsteres Gefängniß, in welchem damals der durch sein langes Glück sowohl, als durch seine schnelle Ungnade so berühmte Staatsgefangene saß.
Schuhmacher, ein Mann von niederer Geburt, war von seinem König erst mit Gunstbezeugungen überhäuft, dann plötzlich von seinem Sitze eines Großkanzlers von Dänemark und Norwegen auf die Bank der Staatsverräther gebracht, sofort aufs Schaffot geschleift und zuletzt aus Gnade in einen einsamen Kerker an der äußersten Grenze der beiden Königreiche gebracht worden. Seine eigenen Kreaturen hatten ihn gestürzt, und er hatte nicht einmal das Recht, über Undank zu klagen. Durfte er klagen, wenn er Sprossen der Leiter, die er bloß so hoch gestellt hatte, um auf ihnen hinaufzusteigen, unter seinen Füßen brechen sah?
Der Mann, welcher den Adel in Dänemark gegründet hatte, mußte aus seinem Verbannungsorte sehen, wie die Großen, die er geschaffen, seine eigenen Würden unter sich vertheilten. Der Graf Ahlfeldt, sein Todfeind, war sein Nachfolger als Großkanzler; der General Arensdorf verfügte als Feldmarschall über die Armee, sowie der Bischof Spollyson über Geistlichkeit und Schulen. Der einzige seiner Feinde, der ihm seine Erhebung nicht verdankte, war der Graf Ulrich Friedrich Guldenlew, natürlicher Sohn des Königs Friedrich des Dritten, Vicekönig von Norwegen, und dieser war der edelmüthigste von Allen.
Gegen diesen traurigen Felsen von Munckholm steuerte die Barke, die den jungen Mann mit der schwarzen Feder trug. Die Sonne ging eben unter.
Kapitel III
»Andrew, in einer halben Stunde soll man die Thorglocke läuten. Sorsyll soll Duckneß am großen Fallgatter ablösen und Maldivius auf die Plattform des großen Thurmes steigen. Beim Kerker des Löwen von Schleswig soll streng aufgepaßt werden. Nicht zu vergessen, um sieben Uhr eine Kanone zu lösen, damit die Kette im Hafen aufgezogen werde; doch nein, man erwartet noch den Hauptmann Dispolsen; man muß im Gegentheil die Leuchte auf dem Thurm anzünden und nachsehen, ob der Leuchtthurm von Walderhog brennt, wie heut der Befehl dazu ertheilt worden ist; vor Allem sind Erfrischungen für den Hauptmann bereit zu halten. Und daß ich es nicht vergesse, man notire für Toric-Belfast, zweiten Arquebusier des Regiments, zwei Tage Arrest; er war den ganzen Tag abwesend.«
So sprach der Sergent der Wache unter dem schwarzen und rauchigen Gewölbe der Thorwache von Munckholm, die unter dem Thurm gelegen ist, welcher das erste Thor des Schlosses beherrscht.
Die Soldaten, an welche seine Befehle gerichtet waren, legten die Karten weg oder erhoben sich vom Lager, um sie zu vollziehen.
In diesem Augenblicke hörte man von Außen das gleichförmige Geräusch der Ruder.
»Ohne Zweifel kommt endlich der Hauptmann Dispolsen!« sagte der Sergent und öffnete das kleine vergitterte Fenster, das auf den Hafen geht.
Eine Barke legte unten an der eisernen Pforte an.
»Wer da?« rief der Sergent mit rauher Stimme.
»Oeffnet!« war die Antwort. »Friede und Sicherheit!«
»Eingang verboten! Habt Ihr Eingangsrecht?«
»Ja!«
»Das will ich erst untersuchen. Lügt Ihr, so will ich Euch das Wasser des Golfs zu kosten geben.«
Er schloß das Fenster, wandte sich zur Wache und sagte: »Immer noch nicht der Hauptmann!«
Ein Licht glänzte hinter der eisernen Pforte, die verrosteten Riegel kreischten, die Eisenstangen hoben sich, das Thor ging auf, und der Sergent untersuchte ein Pergament, das ihm der Ankömmling darbot.
»Einpassirt!« sagte er. »Halt!« fügte er rasch hinzu, »laßt Eure Hutschnalle außen. Man darf nicht mit Kleinodien in ein Staatsgefängniß. Hievon sind nach dem Reglement bloß ausgenommen: »Der König und die Mitglieder der königlichen Familie, der Vicekönig und die Mitglieder seiner Familie, der Bischof und die Befehlshaber der Besatzung.« Ihr habt ohne Zweifel keine von all diesen Eigenschaften?«
Statt aller Antwort nahm der junge Mann die Hutschnalle ab und warf sie dem Schiffer, der ihn geführt hatte, an Zahlungsstatt zu. Dieser, welcher fürchtete, der Andere möchte seine Freigebigkeit bereuen, stieß schnell vom Ufer, um das Wasser der Bucht zwischen den Wohlthäter und die Wohlthat zu legen.
Während der Sergent, über die Unklugheit der Kanzlei murrend, welche auf solche Art die Eingangspässe verschwende, die schweren Riegel wieder vorschob, schritt der junge Mann, den Mantel über die Schulter zurückgeworfen, eilends durch den dunkeln Bogen und kam über den Waffenplatz an das große Fallgatter, das nach Prüfung seines Passes gehoben wurde. Dann schritt er, von einem Soldaten begleitet, wie Jemand, der des Wegs wohl kundig ist, dem Kerker zu, das Schloß des Löwen von Schleswig genannt, weil Rolf der Zwerg weiland seinen Bruder Jotham den Löwen, Herzog von Schleswig, darin gefangen halten ließ.
An einem der innern Thürme schlug der junge Mann mit einem kupfernen Hammer, den ihm der Wächter am Fallgatter gegeben hatte, heftig an die Thüre. »Oeffnet!« rief von Innen eine laute Stimme, »das wird wohl dieser verfluchte Hauptmann sein!«
Als die Thüre sich öffnete, erblickte der Ankömmling im Innern eines schwach beleuchteten gothischen Saals einen jungen Offizier, der nachlässig auf einem Haufen Mäntel und Rennthierhäute lag. Neben ihm stand ein dreiarmiger Leuchter, den er von der Zimmerdecke abgenommen und neben sich gestellt hatte. Seine reiche und ausgesucht elegante Kleidung stand in schroffem Gegensatz zu dem nackten Saal und den plumpen Geräthschaften. Er hielt ein Buch in der Hand und wandte sich mit halbem Leibe dem Ankömmlinge zu:
»Das ist der Hauptmann!« sagte er. »Guten Abend, Herr Hauptmann! Schon lange warte ich auf Ihre Ankunft, obwohl ich nicht das Vergnügen habe, Sie zu kennen. Doch was das betrifft, so werden wir uns bald kennen lernen, nicht wahr, lieber Hauptmann? Vor allen Dingen statte ich Ihnen meine Beileidsbezeugung zu Ihrer Rückkehr in dieses alte verfluchte Nest ab. Wenn ich noch einige Zeit hier verweile, werde ich so abschreckend werden, wie eine Nachteule, die man als Vogelscheuche an eine Thüre nagelt, und wenn ich zur Vermählung meiner Schwester nach Kopenhagen zurückkomme, so will ich verdammt sein, wenn mich unter hundert Damen nur vier wieder erkennen. Sagen Sie mir doch, ob die rosenrothen Bänder noch immer in der Mode sind? Ist kein neuer Roman von Demoiselle Scudery aus dem Französischen übersetzt worden? Hier habe ich gerade Clelia in der Hand. Man wird das zu Kopenhagen auch noch lesen. Das ist mein Codex der Galanterie, jetzt, wo ich seufze, ferne von so vielen schönen Augen; denn so schön auch die Augen unserer jungen Gefangenen sind, Sie wissen, wen ich meine, so bleiben sie doch immer stumm für mich. Ha! Wenn meines Vaters Befehl nicht wäre! ... Ich muß Ihnen im Vertrauen sagen, Herr Hauptmann, aber behalten Sie es bei sich, daß mich mein Vater beauftragt hat, Schuhmachers Tochter zu ... Sie verstehen mich schon, aber ich verliere Zeit und Mühe, das ist kein Mädchen von Fleisch und Bein, sondern eine steinerne Bildsäule, sie weint immer und sieht mich niemals an.«
Der junge Mann, der bei der Geläufigkeit der Zunge des Offiziers bisher nicht hatte zum Wort kommen können, stieß jetzt einen Schrei der Verwunderung aus. »Wie! Was sagen Sie? Beauftragt die Tochter dieses unglücklichen Schuhmacher zu verführen! ...«
»Verführen? Meinetwegen, wenn man das gegenwärtig zu Kopenhagen so nennt; aber das würde selbst dem Teufel nicht gelingen. Als ich vorgestern die Wache hatte, zog ich, ausdrücklich für sie, eine prächtige französische Halskrause an, die man mir unmittelbar von Paris geschickt hatte. Können Sie es glauben, daß sie nicht einmal einen Blick auf mich warf, obwohl ich drei bis viermal durch ihr Zimmer ging und meine neuen Sporen, deren Räder so breit sind, als eine lombardische Dukate, nicht schlecht klingen ließ? Diese Sporen werden wohl noch immer in der Mode sein?«
»Mein Gott! Mein Gott!« sagte der junge Mann und schlug sich vor die Stirne, »das verwirrt mich so ...«
»Nicht wahr?« fuhr der Offizier fort, der sich über den wahren Sinn dieses Ausrufs täuschte. »Nicht einen einzigen Blick auf mich zu werfen! So unglaublich das auch ist, so ist es doch wahr.«
Der junge Mann ging in heftiger Aufregung im Zimmer auf und ab.
»Wollen Sie etwas genießen, Hauptmann Dispolsen?« rief ihm der Offizier zu.
»Ich bin nicht der Hauptmann Dispolsen.«
»Wie?« sagte der Offizier in ernstem Tone und richtete sich sitzend in die Höhe, »und wer sind Sie denn, daß Sie es wagen, um diese Stunde hier zu erscheinen?«
Der junge Mann hielt ihm seine Einlaßkarte hin: »Ich will den Grafen Greiffenfeld ... ich will sagen, Ihren Gefangenen sehen.«
»Grafen! Grafen!« murmelte der Offizier mißvergnügt. »Aber wirklich, die Karte ist in Ordnung, da steht die Unterschrift des Vicekanzlers Grummond von Knud: Vorweiser dies kann immer und zu jeder Zeit alle königlichen Gefängnisse besuchen. Grummond von Knud ist der Bruder des alten Generals Levin von Knud, der zu Drontheim befehligt, und Sie werden wissen, daß dieser alte Herr meinen künftigen Schwager erzogen hat ...«
»Ich danke Ihnen für die Mittheilung Ihrer Familienangelegenheiten, Herr Lieutenant. Meinen Sie nicht, daß Sie mir bereits genug davon mitgetheilt haben?«
»Das ist ein unverschämter Kerl, aber er hat, weiß Gott, Recht,« murmelte der Lieutenant für sich und biß sich in die Lippen.
»Holla! Thürschließer, Kerkermeister, Holla!« rief er, »führt diesen Fremden da zu Schuhmacher und zankt nicht, daß ich Euern dreiarmigen Leuchter, in dem nur ein einziges Licht steckt, von der Decke genommen habe! Ich wollte dieses alte Stück näher betrachten, das sich ohne Zweifel noch aus den Zeiten Sciolds des Heiden, oder Havars des Kopfspalters herschreibt, und überhaupt man hängt heutzutage nur noch Kronleuchter von Krystall an der Decke auf.«
Der junge Mann entfernte sich mit dem Kerkermeister, und der Offizier nahm sein Buch wieder zur Hand, um die verliebten Abenteuer der Amazone Clelia und Horatius des Einäugigen zu lesen.
Kapitel IV
Während dieser Zeit war ein Diener mit einem Handpferd in den Palasthof des Gouverneurs von Drontheim eingeritten. Er war mit Kopfschütteln und mißvergnügter Miene abgestiegen und machte sich eben fertig, die Pferde in den Stall zu führen, als plötzlich Jemand ihn barsch am Arm ergriff.
»Wie!« rief ihm eine Stimme zu, »Du kommst allein, Paul! Wo ist denn Dein Herr?«
So fragte der alte General Levin von Knud, der von seinem Fenster aus den Bedienten ohne seinen Herrn hatte ankommen sehen und in den Hof herbeigeeilt war.
»Excellenz,« erwiederte der Diener mit einer tiefen Verbeugung, »mein Herr ist nicht mehr in Drontheim.«
»Wie? Er war also da? Er ist wieder fort, ohne seinen alten Freund zu sehen? Und seit wann denn?«
»Er ist diesen Abend angekommen und diesen Abend wieder fort.«
»Diesen Abend? Diesen Abend! Wo ist er denn abgestiegen? Wohin ist er denn?«
»Er ist im Spladgest abgestiegen und hat sich nach Munckholm eingeschifft.«
»Hm! Ich glaubte ihn bei den Gegenfüßlern. Was Teufels hat er denn in dem alten Schlosse zu thun? Was machte er denn im Spladgest? Das ist ja ein wahrer fahrender Ritter! Ich bin freilich selbst Schuld daran, warum habe ich ihn so erzogen? Ich wollte ihn frei wissen, trotz der Fesseln seines Ranges ...«
»Ei!« fiel Paul ein, »er kümmert sich auch verdammt wenig um die Etikette.«
»Wenn er nur etwas mehr Herr seiner Launen wäre! Nun, er wird schon kommen. Laß Dir inzwischen nichts abgehen, Paul! Nun, seid ihr weit miteinander in der Welt herumgezogen?«
»Mein Herr General, wir kommen gerade von Bergen. Mein Herr war traurig.«
»Traurig! Was hat es denn zwischen ihm und seinem Vater gegeben? Will ihm diese Heirath nicht einleuchten?«
»Ich weiß es nicht, aber Seine Erlaucht will es nun einmal so haben.«
»Will es so haben! Der Vicekönig will es so haben! Will denn Ordener nicht?«
»Ich weiß nicht, Excellenz! Er scheint traurig.«
»Traurig! Wie hat ihn sein Vater empfangen?«
»Das erste Mal, das war im Lager bei Bergen. Seine Erlaucht sagte: Ich sehe Dich nicht oft, mein Sohn! – Desto besser für mich, mein gnädiger Vater, erwiederte mein Herr, das ist ein Zeichen, daß Sie mich vermissen. – Hierauf erzählte er von unsern Reisen in dem Norden, worauf Seine Erlaucht sagte: Das ist gut! – Am andern Morgen, als mein Herr von seinem Vater kam, sagte er: Man will mich verheirathen, ich muß aber erst meinen zweiten Vater, den General Levin sprechen. – Dann habe ich die Pferde gesattelt, und jetzt sind wir hier.«
»Wirklich,« sagte der alte General gerührt, »wirklich, er hat mich seinen zweiten Vater genannt?«
»Ja, Euer Excellenz.«
»Wehe mir, wenn ihm diese Heirath zuwider ist, denn ich will lieber bei dem König in Ungnade fallen, als dazu helfen. Inzwischen, die Tochter des Großkanzlers beider Königreiche ... Höre, Paul, weiß Dein Herr, daß seine künftige Schwiegermutter, die Gräfin Ahlfeldt, seit gestern incognito hier ist, und daß der Graf erwartet wird?«
»Ich weiß nicht, mein General!«
»Ja wohl!« dachte der alte General, »er muß es wissen, sonst hätte er nicht gleich bei seiner Ankunft zum Rückzug geblasen.«
Der General nickte gegen Paul und die Schildwache, die das Gewehr vor ihm präsentiert hatte, wohlwollend mit dem Kopf und ging in den Palast zurück.
Kapitel V
Als der junge Mann ins Zimmer des Gefangenen trat, klang es abermals in seine Ohren: »Ist es endlich der Hauptmann Dispolsen?«
Diese Frage machte ein alter Mann, der, den Rücken der Thüre zugewendet, an einem Tische saß, die Ellenbogen auf den Tisch gestützt und den Kopf in beiden Händen. Er trug eine Art Schlafrock von schwarzer Wolle, und über einem Bette, das in einem Winkel des Zimmers stand, erblickte man ein zerbrochenes Wappen, um welches die ebenfalls zerbrochenen Elephanten- und Danebrogsorden hingen; unterhalb des Wappens war eine umgekehrte Grafenkrone, und die beiden Bruchstücke einer Hand der Gerechtigkeit machten das Ganze dieser seltsamen Zierathen vollständig. Dieser Greis war der Staatsgefangene Schuhmacher.
»Nein, gnädiger Herr,« antwortete der Kerkermeister. Hierauf sagte er zu dem Fremden: »Hier ist der Gefangene!«
Mit diesen Worten schloß er die Thüre, ehe er noch die Antwort des Gefangenen hören konnte, der in verdrießlichem Tone sagte: »Wenn es nicht der Hauptmann ist, so will ich Niemand sehen.«
Der Fremde blieb an der Thüre stehen, und der Gefangene, der sich allein glaubte, denn er hatte nicht einmal aufgeblickt, fiel wieder in seine vorige Träumerei zurück.
Plötzlich rief er aus: »Gewiß hat mich dieser Hauptmann auch verrathen und verlassen! Die Menschen ... Ha! die Menschen sind wie das Stück Eis, das jener Araber für einen Edelstein hielt: er packte es sorgfältig in seinen Ranzen, und als er es suchte, fand er nicht einmal mehr einen Tropfen Wasser.«
»Ich gehöre nicht zu diesen Menschen,« sagte der Fremde.
Schuhmacher erhob sich rasch: »Wer ist hier? Wer hört mir zu? Irgend ein elender Scherge dieses Guldenlew?«
»Reden Sie nicht übel von dem Vicekönig, Herr Graf!«
»Herr Graf! Wollen Sie mir schmeicheln, daß Sie mich so nennen? Sie geben sich verlorene Mühe, ich bin nicht mehr mächtig.«
»Der, welcher mit Ihnen spricht, hat Sie nie in Ihrer Macht gekannt und ist doch Ihr Freund.«
»So hofft er noch irgend Etwas von mir. Die Erinnerung an Unglückliche knüpft sich stets an Hoffnungen, die noch übrig sind.«
»Ich sollte mich über Sie beklagen, Herr Graf, denn ich habe mich Ihrer erinnert, und Sie haben mich vergessen. Ich bin Ordener.«
Ein Strahl der Freude überzog die düstern Züge des Gefangenen.
»Willkommen, Ordener!« sagte er. »Willkommen, der aus der Ferne kommt und sich des Gefangenen noch erinnert!«
»Und Sie hatten mich vergessen?« fragte Ordener.
»Ich hatte Sie vergessen,« erwiederte Schuhmacher, der wieder in seinen düstern Ton zurückfiel, »wie man den vorüberstreichenden Wind vergißt, der uns die Wangen kühlt. Glücklich noch, wenn es kein Sturmwind wird, der uns unter Trümmern begräbt!«
»Graf Greiffenfeld,« fuhr der Fremde fort, »Sie glaubten also nicht an meine Rückkehr?«
»Der alte Schuhmacher glaubte nicht daran; es ist aber hier ein junges Mädchen, die mich heute erst daran erinnerte, daß Sie am letztverflossenen achten Mai vor einem Jahr abgereist sind.
Ordener bebte vor Freude: »Wie, mein Gott! Ist dieses junge Mädchen, das sich meiner erinnerte, Ihre Ethel?«
»Und wer sonst?«
»Ihre Tochter hat die Monate seit meiner Abreise gezählt! Wie viele traurige Tage habe ich inzwischen nicht verlebt! Ich habe ganz Norwegen bereist, von Christiania bis Wardhus; aber immer zog es mich wieder nach Drontheim hin.«
»Benützen Sie Ihre Freiheit, junger Mann, so lange Sie sich ihrer erfreuen. Aber sagen Sie mir endlich einmal, wer Sie sind. Ich möchte Sie unter einem andern Namen kennen. Der Sohn eines meiner Todfeinde heißt auch Ordener.«
»Vielleicht, Herr Graf, fühlt dieser Todfeind mehr Wohlwollen für Sie, als Sie für ihn.«
»Sie weichen meiner Frage aus. Doch behalten Sie Ihr Geheimniß; ich würde vielleicht erfahren, daß die von Außen lockende Pflanze tödtliches Gift enthält.«
»Herr Graf!« sagte Ordener mit Entrüstung. »Herr Graf!« wiederholte er im Tone mitleidigen Vorwurfs.
»Kann ich Ihnen denn trauen, da Sie immer mir gegenüber die Parthie des unversöhnlichen Guldenlew nehmen?«
»Der Vicekönig,« unterbrach ihn der junge Mann feierlich, »hat eben erst Befehl ertheilt, daß Sie im Innern des ganzen Schlosses des Löwen von Schleswig künftig frei und ohne Wache sein sollen. Ich habe dies zu Bergen erfahren und man wird es Ihnen ohne Zweifel bald bekannt machen.«
»Das ist eine Gunst, die ich nicht zu erlangen hoffte, und so viel ich mich erinnere, habe ich von meinem Wunsche nur mit Ihnen gesprochen. Uebrigens vermindert man das Gewicht meiner Eisen, so wie das meiner Jahre sich vermehrt, und wenn die Gebrechlichkeiten des Alters mich hinfällig gemacht haben werden, so wird es ohne Zweifel heißen: Jetzt bist Du frei!«
Bei diesen Worten lächelte der Greis bitter und fuhr fort: »Und Sie, junger Mann, haben Sie noch immer Ihre thörichten Gedanken von Unabhängigkeit?«
»Hätte ich sie nicht, so wäre ich nicht hier.«
»Wie sind Sie nach Drontheim gekommen?«
»Wie? Zu Pferd!«
»Wie nach Munckholm?«
»In einem Nachen.«
»Armer Thor! Sie glauben frei zu sein, und Sie bedürfen eines Rosses und einer Barke! Das sind nicht die Glieder deines Leibes, die deinen Willen thun, sondern ein Thier und ein lebloser Stoff, und das nennst du Willen!«
»Ich zwinge Wesen, mir zu gehorchen.«
»Ueber gewisse Wesen das Recht auf Gehorsam üben, heißt Andern das Recht auf Befehl geben. Unabhängigkeit ist nur in Vereinzelung.«
»Sie lieben die Menschen nicht?«
Der Greis lächelte traurig: »Ich weine, daß ich Mensch bin, und ich lache über den, der mich tröstet. Sie werden es erfahren, wenn Sie es noch nicht wissen, das Unglück macht mißtrauisch, wie das Glück undankbar. Sagen Sie mir, da Sie von Bergen kommen, ob der Hauptmann Dispolsen guten Wind gehabt hat? Es muß ihm etwas Glückliches begegnet sein, weil er mich vergißt.«
Ordener wurde verlegen und traurig.
»Dispolsen, Herr Graf! Um mit Ihnen über ihn zu sprechen, kam ich heute. Ich weiß, daß er Ihr ganzes Vertrauen besaß ...«
»Sie wissen es?« unterbrach ihn der Gefangene mit Unruhe. »Sie irren sich. Kein menschliches Wesen besitzt mein Vertrauen. Dispolsen hat allerdings sehr wichtige Papiere von mir in Händen. In meinen Angelegenheiten ging er nach Kopenhagen zum König. Ich gestehe sogar, daß ich ihm mehr traute, als jedem Andern, denn so lange ich mächtig war, habe ich ihm nie eine Gunst erwiesen.«
»Herr Graf, ich habe ihn heute gesehen ...«
»Ihre Verwirrung sagt mir das Uebrige, er ist ein Verräther.«
»Er ist todt.«
»Todt!«
Der Gefangene ließ das Haupt sinken und kreuzte die Arme über die Brust, dann hob er das Auge und starrte den jungen Mann an: »Als ich Ihnen sagte, daß ihm etwas Glückliches begegnet sei ...«
Jetzt wandte sich sein Blick der Mauer zu, an welcher die Trümmer seiner vergangenen Größe hingen, und er winkte mit der Hand, als ob er den Zeugen eines Schmerzes, den er zu überwinden suchte, entfernen wollte.
»Nicht ihn beklage ich,« sagte er, »es ist nur ein Mensch weniger auf der Welt. Nicht mich beklage ich, was habe ich zu verlieren? Aber meine Tochter, mein unglückliches Kind! Ich werde das Opfer dieser schändlichen Umtriebe werden, und was wird aus meinem Kinde werden, wenn man ihm den Vater nimmt?«
Der Greis kehrte sich lebhaft Ordener zu: »Wie ist er gestorben? Wo haben Sie ihn gesehen?«
»Ich sah ihn im Spladgest; man weiß nicht, ob er durch Selbstmord oder durch Meuchelmord umgekommen ist.«
»Daran liegt Alles. Ist er ermordet worden, so weiß ich, woher der Schlag kommt. Dann ist Alles verloren. Er überbrachte mir die Beweise des Complotes, das sie gegen mich spinnen. Diese Beweise hätten mich retten und sie verderben können ... Sie wußten sie zu vernichten! Unglückliche Ethel!«
»Herr Graf, ich werde Ihnen morgen sagen, ob er ermordet worden ist.«
Ohne zu antworten, folgte Schuhmacher dem hinausgehenden Ordener mit einem Blicke, worin sich die Ruhe der Verzweiflung malte, die schrecklicher ist, als die Ruhe des Todes.
Ordener trat in das einsame Vorzimmer des Gefangenen, ohne zu wissen, nach welcher Seite er sich wenden sollte. Es war Nacht, der Saal dunkel. Er öffnete eine Thüre und befand sich in einem großen Vorplatz, der bloß durch das helle Licht des Mondes beleuchtet war. Er ging einem röthlichen Scheine zu, der vom äußersten Ende des Corridor ihm entgegen leuchtete.
Durch eine halb offene Thüre erblickte er ein junges schwarzgekleidetes Mädchen auf den Knieen vor einem einfachen Altar. Sie hatte schwarze Augen und lange schwarze Haare. Beides eine Seltenheit im hohen Norden. Ordener bebte, er erkannte die Betende.
Das Mädchen betete für ihren Vater, für den gestürzten Gewaltigen, für den verlassenen Gefangenen. Sie betete noch für einen Andern, dessen Namen sie nicht nannte. Ordener entfernte sich, das einsame Gebet der Jungfrau ehrend.
Das Gebet war zu Ende. Die Jungfrau kam mit dem Licht in der Hand durch den Corridor. Ordener drückte sich an die Mauer.
»Mein Gott!« rief sie, als sie ihn erblickte.
Die Lampe entfiel ihrer Hand. Ordener stürzte herbei, die Ohnmächtige zu halten.
»Ich bin es!« sagte er mit sanfter Stimme.
»Ordener ist es!« flüsterte sie. Sie hatte den Ton dieser Stimme im Lauf eines Jahres nicht vergessen.
Sie wand sich, schüchtern und verwirrt, aus seinen Armen los und sagte: »Herr Ordener ist es!«
»Er selbst, Gräfin Ethel!«
»Warum nennen Sie mich Gräfin?«
»Warum nennen Sie mich Herr?«
Die Jungfrau schwieg lächelnd. Der Jüngling schwieg und seufzte.
Sie unterbrach zuerst das Stillschweigen: »Wie sind Sie denn hieher gekommen?«
»Verzeihen Sie, wenn meine Gegenwart Sie belästigt. Ich kam, um mit dem Grafen, Ihrem Vater, zu sprechen.«
»Also,« sagte die Jungfrau mit bewegter Stimme, »also sind Sie nur meines Vaters wegen gekommen?«
Der junge Mann senkte das Haupt, denn diese Worte dünkten ihn sehr ungerecht.
»Sie sind ohne Zweifel,« fuhr die Jungfrau im Tone des Vorwurfs fort, »Sie sind ohne Zweifel schon lange zu Drontheim? Ihre Abwesenheit aus dieser Festung wird Ihnen nicht lange vorgekommen sein.«
Ordener, tief gekränkt, antwortete nicht.
»Ich verdenke es Ihnen nicht,« fuhr das Mädchen mit einer Stimme fort, die vor Schmerz und Zorn zitterte; »aber ich hoffe, Herr Ordener,« fügte sie in stolzem Tone hinzu, »daß Sie mir nicht zugehört haben, als ich mein Gebet verrichtete.«
»Doch, Gräfin, ich habe Ihnen zugehört.«
»Ah! Herr Ordener! Es ist nicht schicklich zu horchen.«
»Ich habe nicht gehorcht, sondern gehört.«
»Ich betete für meinen Vater,« sagte die Jungfrau, ihn starr anblickend, als ob sie auf so einfache Worte eine Antwort erwarte.
Ordener schwieg.
»Ich habe auch,« fuhr sie unruhig fort, »für Jemand gebetet, der Ihren Namen führt, für den Sohn des Vicekönigs, des Grasen Guldenlew; denn man muß für Jedermann beten, selbst für seine Widersacher ...«
Die Jungfrau erröthete, weil sie die Unwahrheit sagte, aber sie war erbittert über den Jüngling und glaubte in ihrem Gebet seinen Namen genannt zu haben.
»Ordener Guldenlew,« sagte der Jüngling, »ist sehr zu bedauern, wenn Sie ihn unter Ihre Widersacher zählen; inzwischen fühlt er sich glücklich, eine Stelle in Ihrem Gebet zu finden.«
»Nicht doch,« sagte die Jungfrau, bestürzt über den kalten Ton des Jünglings, »ich habe nicht für ihn gebetet ... Ich weiß nicht was ich that, nicht was ich sage. Den Sohn des Vicekönigs, den verabscheue ich ... ich kenne ihn nicht ... Sehen Sie mich nicht so finster an! Habe ich Sie denn beleidigt? Können Sie denn einer armen Gefangenen nichts verzeihen, Sie, der seine Tage bei irgend einer schönen Edeldame verlebt, die frei und glücklich ist, wie Sie!«
»Ich, Gräfin!« rief Ordener aus.
Der Jungfrau stürzten die Thränen aus den Augen. Der Jüngling sank ihr zu Füßen.
»Hatten Sie mir nicht selbst gesagt,« fuhr sie durch Thränen lächelnd fort, »daß Ihnen Ihre Abwesenheit kurz vorgekommen ist?«
»Wer, ich? Gräfin!«
»Nennen Sie mich nicht so, ich bin für Niemand mehr Gräfin, am wenigsten für Sie.«
Der Jüngling sprang vom Boden auf und drückte sie an seine Brust.
»Angebetetes Wesen!« rief er im Taumel der Leidenschaft, »nenne mich Deinen Ordener! Sprich, liebst Du mich?«