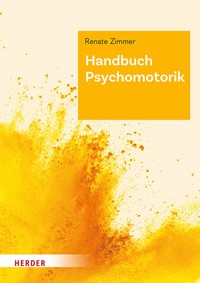
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Körper- und Bewegungserfahrungen bilden bei Kindern die Basis für den Aufbau von Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl. In diesem Handbuch stellt Renate Zimmer ihren Ansatz der Psychomotorik vor. Sie erläutert die theoretischen Grundlagen und gibt Hinweise auf eine psychomotorische Entwicklungsdiagnostik. Die Erfahrung von Selbstwirksamkeit wird als einer der wichtigsten Wirkfaktoren psychomotorischer Förderung beschrieben. Anhand vieler Beispiele wird die Umsetzung in die Praxis verdeutlicht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 297
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Neuausgabe 2025
(16. Gesamtauflage)
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 1999
Hermann-Herder-Straße 4, 79104 Freiburg
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Verlag Herder
Umschlagabbildung: © Grafner/GettyImages
Fotos im Innenteil: Nadine Vieker, Renate Zimmer
Abbildungen: Hans Zimmer
Layout, Satz und Gestaltung: Arnold & Domnick, Leipzig
Herstellung: Herstellung: DZS Grafik, Ljubljana
E-Book-Konvertierung: Newgen Publishing Europe
ISBN Print 978–3-451–07410-3
ISBN EBook (EPUB) 978–3-451–83759-3
ISBN EBook (PDF) 978–3-451–83721-0
Inhalt
Einleitung
1. Entwicklungen und Tendenzen in der Psychomotorik
1.1 Entstehungsgeschichte und Weiterentwicklung
1.1.1 »Lehrjahre« der Psychomotorik
1.1.2 Die Institutionalisierung der Psychomotorik
1.1.3 Psychomotorik – Motopädagogik – Mototherapie
1.1.4 Ziele und Inhalte der Psychomotorik
1.2 Das Menschenbild in der Psychomotorik
1.2.1 Humanistisches Menschenbild
1.2.2 Das Kind als aktiver Gestalter seiner Entwicklung
1.3 Psychomotorik als ganzheitliche Gesundheitsförderung
1.3.1 Salutogenese – Wie entsteht Gesundheit?
1.3.2 Risiko- und Schutzfaktoren in der kindlichen Entwicklung
1.3.3 Stärkung personaler Ressourcen
2. Konzeptionelle Ansätze in der Psychomotorik
2.1 Von der »psychomotorischen Übungsbehandlung« zur ganzheitlichen Entwicklungsförderung
2.2 Der handlungsorientierte Ansatz
2.3 Die sensorische Integrationsbehandlung
2.4 Kindzentrierte psychomotorische Entwicklungsförderung
2.5 »Verstehende« Psychomotorik
2.6 Systemisch-konstruktivistische und systemischökologische Positionen in der Psychomotorik
2.7 Konsequenzen für die Praxis der Psychomotorik
3. Selbstkonzept und Identität – Schlüsselbegriffe psychomotorischer Förderung
3.1 Kognitive und emotionale Anteile des Selbstkonzeptes
3.1.1 Selbstwahrnehmung und Selbstbewertung
3.1.2 Kompetenzen und Fähigkeiten
3.2 Die Bedeutung des Selbstkonzeptes für die Entwicklung
3.2.1 Subjektive Interpretationen
3.2.2 Selbstkonzept als generalisierte Selbstwahrnehmung
3.2.3 Zuordnung von Eigenschaften durch andere
3.3 Körpererfahrungen sind Selbsterfahrungen
3.3.1 Zur Entwicklung des Selbst
3.3.2 Das »Körperselbst«
3.3.3 Das Selbstempfinden
3.4 Selbstwirksamkeit und Kontrollüberzeugung
3.5 »Erlernte Hilflosigkeit«
3.6 Ursachenerklärung von Erfolg und Misserfolg
3.7 Die Rolle von Bezugsnormen für die Selbstwahrnehmung
3.8 Möglichkeiten zur Veränderung eines negativen Selbstkonzeptes
4. Die Bedeutung des Spiels in der Psychomotorik
4.1 Zum Symbolgehalt von Bewegungshandlungen
4.2 Merkmale des Spiels in der Psychomotorik
4.2.1 Individuelle Sinngebung und Bedeutungsoffenheit
4.2.2 Umkehrung üblicher Einfluss- und Machtbeziehungen
4.2.3 Entscheidungsfreiheit und Freiwilligkeit
4.2.4 Ambivalenz– Angst-Lust-Gefühle
4.3 Bedeutung des Symbolspiels für die Selbstentwicklung des Kindes
4.4 Handeln in sinnhaften Zusammenhängen
5. Psychomotorische Entwicklungsdiagnostik
5.1 Veränderungen in der Auffassung diagnostischen Denkens
5.2 Methoden der psychomotorischen Diagnostik
5.2.1 Motoskopie – Beobachtung als Basis der Diagnostik
5.2.2 Motometrische Verfahren
5.2.3 Zur Integration quantitativer und qualitativer Verfahren in der psychomotorischen Diagnostik
5.3 Zur Praxis der psychomotorischen Entwicklungsdiagnostik
5.3.1 Anamnese– die Entwicklungsgeschichte des Kindes
5.3.2 Strukturierte Beobachtung von Wahrnehmung und Bewegung
5.3.3 Verhalten bei Spiel- und Bewegungsangeboten
5.3.4 Sozialverhalten
5.3.5 Selbstkonzept-Einschätzung
5.3.6 Ressourcenorientierte Beobachtung psychomotorischer Kompetenzen
5.3.7 Einsatzmöglichkeiten motorischer Testverfahren
5.4 Verlauf der psychomotorischen Entwicklungsdiagnostik
5.5 Zur Effektivität psychomotorischer Fördermaßnahmen
6. Rahmenbedingungen psychomotorischer Förderung
6.1 Allgemeine Prinzipien psychomotorischer Förderung
6.2 Der äußere Rahmen
6.2.1 Bewegungsräume
6.2.2 Geräte und Materialien
6.2.3 Zeitlicher Rahmen
6.3 Die Gestaltung der Psychomotorik-Stunden
6.3.1 Einstieg in die psychomotorische Förderung
6.3.2 Die Auswahl der Inhalte
6.3.3 Rituale
6.4 Die Förderung in einer Gruppe
6.4.1 Bedeutung der Gruppe
6.4.2 Gruppenzusammensetzung
6.4.3 Geschlossene und halboffene Gruppen
6.4.4 Gruppengröße
6.5 Zum Verhalten der pädagogischen Fachkraft
6.5.1 Rolle der Pädagogin
6.5.2 Verhaltensmerkmale für die Leitung von Gruppen
6.5.3 Team-Teaching
6.6 Interventionsstrategien
6.6.1 Umgang mit Störverhalten
6.6.2 Paradoxe Intentionen
6.7 Die Einbindung der Familie
6.7.1 Eltern-Kind-Gruppen
6.7.2 Zusammenarbeit mit Eltern in der Psychomotorik
7. Zielgruppen und Einsatzbereiche psychomotorischer Förderung
7.1 Psychomotorik in der Frühförderung
7.2 Psychomotorik in Kindertageseinrichtungen
7.2.1 Der Bewegungskindergarten
7.2.2 Psychomotorische Kindergärten
7.2.3 Psychomotorisch orientierte Bewegungserziehung
7.2.4 Psychomotorik als Beitrag zur Inklusion
7.3 Bewegungsorientiertes Lernen in der Schule
7.3.1 Psychomotorik als Bereicherung und Ergänzung des Sportunterrichts
7.3.2 Psychomotorik als spezielle Förderung von Kindern mit Lern- und Entwicklungsbeeinträchtigungen
7.3.3 Psychomotorik als grundlegendes, fachübergreifendes Arbeitsprinzip
7.4 Neue Konzepte des Sportförderunterrichts
7.5 Elternvereine und Selbsthilfegruppen
8. Beispiele zur Praxis psychomotorischer Förderung
8.1 Einstiegsspiele
8.2 Themenspezifische Spiel- und Bewegungsangebote
8.3 Miteinander spielen
8.4 Zur Ruhe kommen
9. Professionalisierung und Ausbreitung der Psychomotorik
9.1 Hochschulstudiengänge und Fachschulausbildungen
9.2 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
9.3 Verbände und Vereinigungen für Psychomotorik
Anhang
Literatur
Medien
Über die Autorin
Über das Buch
Einleitung
Psychomotorik – ein Wundermittel mit Breitbandwirkung?
Es hat sich mittlerweile in unserer Gesellschaft eingebürgert, dass wir für jedes Problem eine spezielle Fördermethode haben – eine Förderung bei Sprachschwierigkeiten, gegen Konzentrationsmangel, zur Behebung von Bewegungsauffälligkeiten, für das hyperaktive wie für das gehemmte und ängstliche Kind. Für jedes Abweichen vom Normalverhalten gibt es ein Programm, so wie es für jeden Schmerz das entsprechende Medikament gibt.
Und nun taucht seit einiger Zeit eine Richtung auf, die sich Psychomotorik nennt und die auf einen Schlag alles »heilen« will, von der motorischen Ungeschicklichkeit über die Sprachstörung bis hin zum Schulversagen. Psychomotorik – ein Wundermittel mit Breitbandwirkung sozusagen, das in einem großen Rundumschlag das Kind zum Funktionieren auf allen Ebenen bringen will? Ein Allroundmittel für alle möglichen Probleme, dessen Wirkungsweise sich so vielseitig liest wie der Beipackzettel eines Breitbandantibiotikums? Wie ist die Wirkungsweise einzuschätzen, und gibt es nicht auch – wie bei jedem Medikament – Nebenwirkungen?
Mit dem Begriff Psychomotorik werden also ebenso hohe Erwartungen wie widersprüchliche Vorstellungen verbunden. Spezialtherapie oder alltägliches Bewegungsangebot – mit ganz bestimmten Geräten und Materialien, die in den Katalogen von Spiel- und Sportgeräteherstellern meist auf einer Seite zu finden sind? Dreimal täglich Pedalo fahren, und die Kindheit wird befreit von allen Übeln krankmachender Lebensbedingungen und persönlicher Belastungen?!
Das vorliegende Buch soll zur Klärung beitragen. Die wesentlichen Grundgedanken der Psychomotorik werden vorgestellt, ihre Entstehungsgeschichte beschrieben und unterschiedliche konzeptionelle Ansätze diskutiert. Im Zentrum des in diesem Buch vertretenen Ansatzes einer kindzentrierten psychomotorischen Entwicklungsförderung steht die Frage nach der Bedeutung von Bewegung im Kontext kindlicher Entwicklung. Eine wichtige Rolle spielt hierbei das Selbstkonzept eines Kindes, die Art und Weise, wie es sich selbst wahrnimmt, ob es eine eher positive oder negative Sicht auf die eigene Person hat. Daher befasst sich ein großer Teil des Buches mit den Bedingungen für den Aufbau eines positiven Selbstkonzeptes. Darüber hinaus werden auch praktische Hinweise für eine psychomotorische Entwicklungsdiagnostik gegeben und die konkreten Rahmenbedingungen psychomotorischer Förderpraxis beschrieben.
Ein Buch über Psychomotorik ohne Praxisbeispiele wäre ein nur unvollständiges Werk. Die hier getroffene Auswahl an Beispielen erfolgte unter dem Kriterium ihrer Umsetzbarkeit in der Praxis. Es werden Themen, Spielideen und Spielszenen beschrieben, die für PsychomotorikGruppen erarbeitet bzw. in ihnen erfunden wurden. Zwar wurden die organisatorischen Vorbereitungen von den Erwachsenen, den Leitungen der Gruppen getroffen, das Thema und die Spielhandlung wurden aber meistens von den Kindern selbst definiert.
Die in diesem Buch beschriebenen Spielideen sollen einerseits zu einer Erweiterung der Bewegungs- und Handlungsmöglichkeiten der Kinder beitragen, andererseits sollen sie auch möglichst viele Gelegenheiten zum Erleben der eigenen Wirksamkeit geben und damit auch zu einer veränderten Selbstwahrnehmung führen. Neben den inhaltlichen und organisatorischen Angaben werden daher auch Hinweise auf die individuelle Bedeutsamkeit, die die Spielthemen für Kinder haben können, gegeben. Gleichzeitig ist aber immer noch ausreichend Spielraum für die Übertragung in die eigene Praxis der Leserin und des Lesers vorhanden.
Allgemeine Überlegungen zur psychomotorischen Förderung werden in diesem Buch ergänzt durch Erfahrungen und konkrete Fallbeschreibungen, wie sie sich in unseren Psychomotorik-Gruppen ereignet haben. Alle Fallbeispiele beruhen auf realen Begebenheiten, allerdings wurden die Namen und die persönlichen Daten, die eine Identifizierung der Kinder oder ihrer Familien ermöglichen könnten, geändert.
Viele Gedanken und Überlegungen, die in diesem Buch vorgestellt und diskutiert werden, sind in der konkreten Arbeit mit Kindern und aus der Reflexion der dabei gewonnenen Erkenntnisse entstanden. Ich danke all denen, die jahrelang die psychomotorische Förderung von Kindern mit mir zusammen durchgeführt haben, Kollegen und Mitarbeiterinnen, mit denen ich gemeinsam Konzepte entwickelt und erprobt, Problemsituationen durchgesprochen sowie Lösungswege gesucht habe. Allen voran meinem Kollegen Meinhart Volkamer, mit dem ich gemeinsam in Osnabrück Therapiegruppen für Kinder mit Entwicklungsbeeinträchtigungen aufgebaut habe und der immer ein kritisch-konstruktiver Begleiter meiner Arbeiten war. Durch die Einrichtung der Forschungsstelle »Bewegung und Psychomotorik« am Niedersächsischen Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung (nifbe), das zunächst als An-Institut an der Universität Osnabrück gegründet worden war und dessen Leitung ich über lange Jahre innehatte, ergaben sich viele Möglichkeiten, um die Praxis der Psychomotorik in einem interdisziplinär zusammengesetzten Team auch wissenschaftlich weiter zu fundieren. Aus diesem Team der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen Fiona Martzy und Peter Keßel hervorgehoben werden, da sie als erfahrene Motologen die professionelle Arbeit mit den Kindern und ihren Familien in besonderem Maße mitgestaltet haben.
In unserem Team wirkten weiter mit: Anne Bischof, Marina Kuhr, Stefan Schache, Elisabeth König, Sophie Reppenhorst, Anna Tönnissen, Nadine Madeira Firmino, Nadine Matschulat, Ursula Licher-Rüschen, Stefanie Rieger, Britte Ruploh, Jutta Trautwein und Nadine Vieker. Sie brachten aus ihren jeweiligen beruflichen Hintergründen als Psychologinnen, Motologen, Ärztinnen, Rehapädagoginnen, Sprachwissenschaftlerinnen und Sprachtherapeutinnen, Erziehungs- und Sportwissenschaftlerinnen und Kunstpädagoginnen ganz unterschiedliche Kompetenzen mit, die es möglich machten, die Entwicklung der Kinder aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und die Gestaltung der Förderangebote wissenschaftlich zu begleiten.
Nicht zuletzt waren auch die Kinder an der Entstehung dieses Buches beteiligt. Die vielen Erfahrungen, die ich mit ihnen machen konnte, die gelösten und die ungelösten Probleme, haben mich immer wieder aufs Neue herausgefordert, nach den möglichen Wirkfaktoren psychomotorischer Förderung zu fragen. Das Erleben, hier etwas wirklich Sinnvolles zu tun, die Entwicklung der Kinder begleiten und ihre Fortschritte beobachten zu können, war für mich ein großes Geschenk, für das ich sehr dankbar bin. Den Kindern und ihren Eltern gilt daher ebenso mein Dank; sie gaben mir oft die Rückmeldung, dass die Psychomotorik-Stunden zu den schönsten Stunden der Woche gehören, die sie unter keinen Umständen versäumen wollten. »Na, was habt ihr denn heute gemacht?« fragte eine Mutter ihr Kind beim Abholen. »Och«, meinte Alexander, »nichts haben wir gemacht. Wir haben nur gespielt.«
Um den Text leserfreundlich zu gestalten, wurde auf umständliche, geschlechtsspezifische Sprachverwendung verzichtet.
1. Entwicklungen und Tendenzen in der Psychomotorik
Die Vielfalt der Erscheinungsformen, die sich heute bei der Durchsicht der Fachliteratur oder beim Besuch von Fortbildungsveranstaltungen zur Psychomotorik präsentiert, zeigt, dass es »die Psychomotorik« gar nicht mehr gibt. Es sind höchst unterschiedliche Vorstellungen, die sich aus pädagogischer wie therapeutischer Sicht mit dem Medium Bewegung verbinden. Dabei unterscheiden sich nicht nur die dargebotenen Inhalte, sondern auch die verschiedenen Arten der Vermittlung. Vielfach sind es auch rein äußere Merkmale, von denen darauf geschlossen wird, ob ein Bewegungsangebot nun ein psychomotorisches ist oder nicht.
»Psychomotorik machen wir auch …«
Zwei pädagogische Fachkräfte unterhalten sich auf einer Fortbildung: »Psychomotorik, das hat doch was mit diesen Pedalos und den bunten Rollbrettern zu tun.« – »Ja, Psychomotorik machen wir auch, wir haben uns erst vor Kurzem Rollbretter und ein Schwungtuch angeschafft, damit wir jetzt noch mehr Psychomotorik in unserer Kita anbieten können.«
In einem meiner Seminare zur Psychomotorik an der Universität stellen zwei Studierende eine Übungseinheit zur psychomotorischen Praxis vor. Mit viel Engagement und schriftlich ausgearbeiteten Unterlagen beschreiben sie den Weg zum Pedalofahren: vom Leichten zum Schweren, vom Einfachen zum Komplexen – so, wie es in den Methodikbüchern zur Vermittlung sportlicher Fertigkeiten nachzulesen ist. Als krönenden Höhepunkt führen sie zum Schluss einen Handstand auf dem Pedalo vor. Und in dieser Position schaffen sie es, eine ganze Bahn durch die Halle zu fahren.
Wenn die psychomotorischen Geräte schon keine Garanten sind für das, was Psychomotorik ausmacht – woran soll man sich dann orientieren? Auch die Begriffe Psychomotorik, Motopädagogik und Bewegungserziehung stiften mehr Verwirrung, als dass sie für Klarheit sorgen. So lohnt es sich, einen Blick in die Geschichte zu werfen, um zu sehen, wie die psychomotorische Idee entstanden ist, wie sie erweitert wurde und sich etabliert hat.
Im Folgenden werden die Ursprünge der Psychomotorik – ihre »Lehrjahre« – beschrieben und ihr Weg zur Institutionalisierung aufgezeigt. Da sich auch die Terminologie ausdifferenziert hat und zeitweise die Begriffe »Motopädagogik« und »Mototherapie« in Konkurrenz zur Psychomotorik standen, soll hier eine Klärung – auch unter internationalen Gesichtspunkten – versucht werden.
Schließlich kann auch eine Erweiterung der Perspektive auf Nachbardisziplinen, die sich ebenfalls um das psycho-physische Wohlbefinden des Menschen bemühen, von Vorteil sein. Von den Gesundheitswissenschaften wird zunehmend die Bedeutung personaler Ressourcen für die Gesundheit des Menschen betont. Da hier durchaus Parallelen zu dem in diesem Buch vorgestellten Ansatz von Psychomotorik zu erkennen sind, werden abschließend salutogenetische Auffassungen von Gesundheit und ihr Bezug zu psychomotorischen Zielvorstellungen diskutiert.
1.1 Entstehungsgeschichte und Weiterentwicklung
Die deutsche Psychomotorik ist eng verknüpft mit Ernst J. Kiphard (1923–2010), der oft auch als »Gründervater« der Psychomotorik bezeichnet wird. Da in vielen Veröffentlichungen über die Ursprünge der Psychomotorik eine enge Verflechtung von Person und Verfahren deutlich wird, bezeichnete Seewald (1991) die Psychomotorik als »Meisterlehre«. Die im folgenden Abschnitt nachgezeichneten ersten Versuche Kiphards, Bewegung in die Therapie behinderter, verhaltensauffälliger und entwicklungsgestörter Kinder einzubringen, sollen daher als »Lehrjahre« der Psychomotorik bezeichnet werden.
1.1.1 »Lehrjahre« der Psychomotorik
Ursprünge der Psychomotorik
Die Wurzeln der deutschen Psychomotorik lassen sich bis ins Jahr 1955 verfolgen. In einem persönlichen Rückblick über die Entwicklungsgeschichte des Aktionskreises Psychomotorik beschreibt Kiphard (1998) die erste Begegnung zwischen ihm als jungem Sportstudenten und dem Kinderpsychiater Helmut Hünnekens. In einer Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Gütersloh erkannte er gemeinsam mit Hünnekens die therapeutischen Möglichkeiten einer auch psychisch wirksamen Bewegungstherapie. Er stellte schnell fest, dass die Kinder mit sportlichen Übungen überfordert waren.
An die Stelle des Leistungsprinzips setzte er daher das » … freie bzw. unmerklich gelenkte Spielgeschehen. Statt des üblichen agonalen Gegeneinanders versuchte ich, die Kinder zum fröhlichen Miteinander zu führen« (Kiphard 1998, S. 88).
Ausgehend von der Beobachtung, dass sich Gefühle und Affekte sowie jede Art des psychischen Erlebens bei den Kindern und Jugendlichen nach außen in ihrem Bewegungsverhalten ausdrücken, wurde für die beiden Seiten des Geschehens der Begriff »Psychomotorik« gewählt. Die erste Veröffentlichung aus dieser Arbeit trug den Titel »Bewegung heilt. Psychomotorische Übungsbehandlung bei entwicklungsrückständigen Kindern« (Hünnekens & Kiphard 1960).
Ingrid Schäfer, die gemeinsam mit Kiphard in einem Team arbeitete, fasst die inhaltlichen Schwerpunkte zusammen: »Mit dem Ziel, über die Motorik eine leibseelische Harmonisierung und Stabilisierung der Gesamtpersönlichkeit zu bewirken, wurden Übungen zur Sinnesschulung, Körper-, Raumwahrnehmung, Behutsamkeit, Selbstbeherrschung, rhythmisch-musikalischen Schulung und zum Körper- / Bewegungsausdruck spielerisch motivierend in Kindergruppen durchgeführt« (Schäfer 1998, S. 82).
Beeinflusst wurde die praktische Arbeit durch die rhythmisch-musikalische Erziehung, vertreten durch Charlotte Pfeffer und Mimi Scheiblauer, durch die Sinneserziehung von Maria Montessori sowie die Erfahrungen mit dem Orff-Schulwerk. Zum ersten Mal wurde hier auch das Trampolin als ein bewegungs- und koordinationsschulendes Gerät eingesetzt und die Bandbreite seiner bewegungsdiagnostischen Möglichkeiten genutzt. Forschungsaufträge führten in dieser Zeit zur Entwicklung diagnostischer Verfahren, wie zum Beispiel dem Trampolin-Koordinations-Test (TKT) und dem Körperkoordinations-Test für Kinder (KTK).
Psychomotorische Übungsbehandlung
So entstand in der klinisch-heilpädagogischen Praxis die sogenannte »psychomotorische Übungsbehandlung«. Kiphard beschreibt das Anliegen der Psychomotorik folgendermaßen: »Statt einer Leistungs- und Produktorientiertheit, die häufig an den Bedürfnissen der Kinder vorbeigeht, statt einer Defektorientiertheit, die nur Makel, Störungen und Defizite sieht, setzen wir eine Erlebnis- und Persönlichkeitsorientierung, bei denen sich die Kinder spielerisch, frei und ungezwungen handelnd äußern und entwickeln können« (Kiphard 1994, S. 12).
Er definierte die Psychomotorik als »eine ganzheitlich-humanistische, entwicklungs- und kindgemäße Art der Bewegungserziehung«. Damit sollte einer weitgehend funktional-mechanistischen Betrachtungsweise von Motorik ein neues bewegungspädagogisches Leitbild entgegengesetzt werden.
1.1.2 Die Institutionalisierung der Psychomotorik
Aktionskreis Psychomotorik
Veröffentlichungen, Vorträge und Tagungen führten dazu, dass die »psychomotorische Idee« ein immer größer werdendes Interesse bei der Fachwelt auslöste. So entstand 1974 eine interdisziplinäre Interessengemeinschaft, ein »Arbeitskreis spezielle Bewegungspädagogik und psychomotorische Therapie«, die zwei Jahre später zur Gründung des »Aktionskreis Psychomotorik e. V.« führte (Schäfer 1998). Es handelte sich um einen Zusammenschluss von Pädagogen, Psychologen, Ärzten und Therapeuten, die sich für die Entfaltung und Förderung der kindlichen Psychomotorik als Grundlage einer harmonischen Persönlichkeits- und Sozialentwicklung einsetzten und sich, damit verbunden, die Information, Beratung, Veranstaltung von Fortbildungen und die Entwicklung beruflicher Ausbildungsgänge zur Aufgabe machten, wie es in der Satzung des Vereins formuliert wurde.
Der Wunsch und die Nachfrage nach Lehrbarmachung der Psycho motorik führten dazu, dass von nun an in Kommissionen und Arbeitsgruppen versucht wurde, eine einheitliche Terminologie zu finden, Fortbildungskonzepte zu entwerfen und Curricula für die Einrichtung von Ausbildungsgängen zu erstellen. Auf der Grundlage der Erkenntnisse unterschiedlicher Theorieansätze – unter anderem aus der Entwicklungs- und Wahrnehmungspsychologie – wurde das Gebäude der »Motologie« entworfen (siehe Kapitel 1.1.3). Der Begriff Psychomotorik geriet ab diesem Zeitpunkt in den Hintergrund und wurde zum Teil ersetzt durch den der »Motopädagogik« bzw. der »Mototherapie«, die als praktische Anwendungsfelder der Motologie beschrieben wurden.
Ausbildungs- und Studiengänge
Die Arbeit der Curriculum-Kommissionen mündete darin, dass eine einjährige Zusatzausbildung zum staatlich geprüften Motopäden an der Fachschule für Bewegungstherapie – Motopädie in Dortmund und ein Aufbaustudiengang zum Diplom-Motologen an der Universität Marburg eingerichtet werden konnten. So gibt es seit 1977 das Berufsbild des Motopäden und seit 1983 das des Diplom-Motologen. Diese Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten sind in der Zwischenzeit auf weitere Ausbildungsstätten ausgeweitet worden (siehe Kapitel 9.2) und wurden den Bachelor- und Masterabschlüssen angepasst.
Seit der Entstehung der Psychomotorik haben sich ihre Anwendungsgebiete und ihre Lerninhalte erweitert. Aufgrund der in der praktischen Arbeit mit Kindern beobachteten positiven Auswirkungen bewegungsorientierter Fördermaßnahmen wurde sie nicht nur rehabilitativ, sondern auch als Prävention eingesetzt.
Einsatzbereiche
Heute kommt die Psychomotorik in unterschiedlichen Handlungsfeldern zum Einsatz: In der Frühförderung und in Kindertageseinrichtungen kann sie zum Beispiel als Grundlage jeglicher Entwicklungsförderung gelten (Bender, Martzy & Schache 2013; Fischer 2019; Jost & Beins 2015; Herm 2021; Zimmer 2020, 2022); in der Grundschule und Förderschule hat sie nicht nur den Sportunterricht verändert, sondern wird zunehmend auch fachübergreifend als Arbeitsprinzip verstanden (Beins 2007; Höhne 2004; Köckenberger 2016; Rösner & Schlüss 2023; Zimmer & Cicurs 1999).
Auch die Zusammenarbeit mit den Familien der Kinder kann durch psychomotorische Angebote bereichert werden (Broxtermann & Martzy 2024; Richter-Mackenstein & Eckert 2013). In den letzten Jahren wurden darüber hinaus Konzepte zur Einbeziehung von psychomotorischen Inhalten in die Arbeit mit Erwachsenen (Haas 1999; Haas, Golmert & Kühn 2014) und älteren Menschen (»Motogeragogik«) vorgelegt (Philippi-Eisenburger 1990; Eisenburger 2016; Krus 2012; Eisenburger & Zak 2013).
1.1.3 Psychomotorik – Motopädagogik – Mototherapie
Nicht nur Außenstehende, sondern auch »eingeweihte« Psychomotorikerinnen haben oft Schwierigkeiten bei der Unterscheidung der Begriffe »Psychomotorik«, »Motopädagogik« und »Motologie«. Daher soll im Folgenden versucht werden, die Begriffe zu definieren bzw. abzugrenzen und ihre unterschiedlichen Bezugssysteme herauszustellen.
Motologie
Der Terminus »Motopädagogik« entstand im Zuge der Professionalisierung der Psychomotorik. Im Zusammenhang mit der Konzeption des Fachgebietes wurde die »Motologie« als »Lehre von der Motorik als Grundlage der Handlungs- und Kommunikationsfähigkeit des Menschen, ihrer Entwicklung, ihrer Störungen und deren Behandlung« (Schilling 1981, S. 187) als Oberbegriff eingeführt.
Motopädagogik
Als Anwendungsbereiche gelten Motopädagogik und Mototherapie: Motopädagogik wird als »ganzheitlich orientiertes Konzept der Erziehung durch Wahrnehmung, Erleben und Bewegen« (Kiphard 1980) verstanden. Mototherapie wird von Schilling (1986, S. 64) definiert als »bewegungsorientierte Methode zur Behandlung von Auffälligkeiten, Retardierungen und Störungen im psychomotorischen Verhaltens- und Leistungsbereich«.
Mototherapie
Der Begriff »Motopädagogik« schien zunächst den der »Psychomotorik« zu ersetzen, heute werden jedoch beide Begriffe gleichrangig, wenn auch nicht immer gleichbedeutend, gebraucht. Man kann sagen, dass Motopädagogik und Mototherapie im Sinne der Psychomotorik arbeiten. Unter internationalen Gesichtspunkten tritt der Begriff »Psychomotorik« immer mehr in den Vordergrund und findet in den verschiedenen Sprachen seine entsprechende Übersetzung (Psychomotricity, Psychomotricité, Psicomotricidad etc.).
Dem Begriff »Psychomotorik« wird auch in diesem Buch der Vorzug gegeben, da der Terminus »Psyche« ausdrücklich auf den Anteil des Wahrnehmens, Erlebens, Fühlens und Denkens bei Bewegungshandlungen hinweist und die Notwendigkeit, Bewegungshandlungen immer als ganzheitliche Äußerungen des Menschen zu betrachten, deutlich macht.
Abb. 1: Aufbau des Fachgebietes Motologie (Schilling 1981, S. 187)
Nun ist aber auch der Begriff »Psychomotorik« nicht frei von Missverständnissen. Mal wird er als Eigenschaftswort (»psychomotorisch«) verwendet und verweist auf einen allgemeinen Zusammenhang körperlicher und seelischer Prozesse, mal wird er als Bezeichnung für eine Richtung oder ein Konzept genutzt, das in der Folge der Kiphardschen Tradition steht.
Der Begriff »Psychomotorik« ist allerdings nicht neu und wurde auch nicht von Kiphard erfunden. Er existierte bereits um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert und hatte in der Fachliteratur zur Bewegungslehre und Motorikforschung eine wiederum im Vergleich zu heute unterschiedliche Bedeutung. Folgende Sichtweisen müssen daher berücksichtigt werden:
Begriffsklärungen
■ Mit Psychomotorik bezeichnete man bereits zum Ausgang des 19. Jahrhunderts einen bestimmten Arbeitsbereich experimenteller psychologischer Wahrnehmungsforschung. Er findet auch heute noch in der Psychologie Anwendung, wenn die kognitiven Antriebs- und Steuerungskräfte des (motorischen) Verhaltens angesprochen werden (z. B. Rüssel 1976).
■Psychomotorik kann als Einheit körperlich-motorischer und psychisch-geistiger Prozesse verstanden werden. Jeder Mensch ist eine solche psychomotorische Einheit, denn, streng genommen, gibt es gar keine Bewegung ohne Beteiligung psychischer oder gefühlsmäßiger Prozesse. Kindliche Entwicklung ist daher auch immer psychomotorische Entwicklung. Psychomotorik ist demnach als eine spezifische Sicht menschlicher Entwicklung zu verstehen, nach der Bewegung als wesentliches Ausdrucksmedium des Menschen gesehen wird. An der Bewegungshandlung ist immer die ganze Person beteiligt. In jede Handlung gehen also kognitive, motivationale und emotionale Aspekte ein, ebenso werden Kognitionen, Emotionen und Motivation von den Bewegungshandlungen beeinflusst. Die Auffassung der kindlichen Bewegung als Einheit von Erleben, Denken, Fühlen und Handeln legt nahe, dass zwischen diesen Bereichen nicht nur Zusammenhänge, sondern auch Wechselwirkungsprozesse bestehen.
Psychomotorik als Konzept
■Psychomotorik ist aber auch die Bezeichnung für ein pädagogischtherapeutisches Konzept, das die Wechselwirkung psychischer und motorischer Prozesse nutzt. Über Bewegung wird versucht, eine Beziehung zum Kind (bzw. zum Erwachsenen) aufzubauen, seine psychische Befindlichkeit positiv zu beeinflussen und seine Gesamtentwicklung zu unterstützen. Ein solches Konzept basiert auf theoretischen Vorannahmen über die Ganzheitlichkeit des Menschen.
Der Begriff »psychomotorisch« kennzeichnet die funktionelle Einheit psychischer und motorischer Vorgänge, die enge Verknüpfung des Körperlich-Motorischen mit dem Geistig-Seelischen.
Psychomotorische Förderung verfolgt damit einerseits das Ziel, über Bewegungserlebnisse zur Stabilisierung der Persönlichkeit beizutragen – also das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu stärken; andererseits soll auch eine Bearbeitung motorischer Beeinträchtigungen, aber auch der Probleme eines Kindes in der Auseinandersetzung mit sich selbst und seiner Umwelt ermöglicht werden.
1.1.4 Ziele und Inhalte der Psychomotorik
Während sich die Medizin und die ihr angegliederten medizinischen Heilhilfsberufe (z. B. die Physiotherapie) primär auf die Behebung körperlich-muskulärer Störungen konzentrieren und die psychotherapeutischen Verfahren vor allem auf das Seelenleben, die Emotionen und psychischen Befindlichkeiten ausgerichtet sind, wendet sich die Psychomotorik an genau jene Überschneidungsbereiche, in denen die wechselseitige Beeinflussung von Bewegung, Wahrnehmung, Verhalten und Selbsterleben deutlich wird. Diesen Überschneidungsbereich füllt die Psychomotorik zwischen Therapie und Pädagogik durch ihre Ausrichtung auf das Paradigma der Förderung.
Unter dem Anspruch einer ganzheitlichen Vorgehensweise steht die Förderung der gesamten Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes durch das Medium Bewegung im Vordergrund.
Ziele
Ziel psychomotorischer Förderung ist es,
■ die Eigentätigkeit des Kindes zu fördern, es zum selbstständigen Handeln anzuregen,
■ durch Erfahrungen in der Gruppe zu einer Erweiterung seiner Handlungskompetenz und Kommunikationsfähigkeit beizutragen,
■ die Selbstwahrnehmung des Kindes zu stärken,
■ dem Kind Gelegenheiten zu geben, die eigenen Ressourcen zu erfahren und sich als kompetent und selbstwirksam zu erleben.
Psychomotorische Förderung beinhaltet spezielle Fördermöglichkeiten vor allem in den Bereichen der Wahrnehmung, des Körpererlebens und der Körpererfahrung und des sozialen Lernens, die gerade für Kinder mit Entwicklungsbeeinträchtigungen integrierend wirken können und ihnen den Zugang zur Bewegung – wieder – erschließen helfen.
Bekannt wurde die Psychomotorik auch durch spezifische, die Wahrnehmung und das Gleichgewicht ansprechende Geräte, wie zum Beispiel Pedalos, Balancierkreisel und Rollbretter, die zunächst für die Förderung entwicklungs- und bewegungsauffälliger Kinder bestimmt waren, dann aber zunehmend auch in die Sport- und Bewegungserziehung Eingang fanden. Aber nicht allein die Verwendung eines Schwungtuches oder das Spiel mit einem Rollbrett machen ein Bewegungsangebot schon zur psychomotorischen Erziehung. Zwar haben diese Materialien die Vielfalt der kindlichen Bewegungserlebnisse erheblich bereichert. Viel wichtiger als der Einsatz bestimmter Geräte ist jedoch die Art und Weise, wie Kinder sie entdecken und mit ihnen umgehen können, in welchem Sinnzusammenhang die Bewegungsangebote für sie stehen, wie sie sich selbst im Umgang mit ihnen erleben.
Inhalte
Zu den klassischen Inhalten der Psychomotorik zählen:
■Körper-Erfahrungen / Selbst-Erfahrungen
Auseinandersetzung mit sich selbst, mit dem eigenen Körper, zum Beispiel den eigenen Körper wahrnehmen und erleben, Sinneserfahrungen, Körperbewusstheit, Umgang mit den eigenen körperlichen Ausdrucksmöglichkeiten; Erfahrung von Selbstwirksamkeit
■Material-Erfahrungen
Auseinandersetzung mit den räumlichen und dinglichen Gegebenheiten der Umwelt, Erfahren physikalischer Gesetzmäßigkeiten (z. B. Gleichgewicht, Schwerkraft, Widerstand, Fliehkraft), sich den materialen Eigenschaften der Objekte anpassen bzw. sie sich passend machen, erkundendes und experimentierendes Lernen über Bewegung
■Sozial-Erfahrungen
Auseinandersetzung mit der sozialen Umwelt, zum Beispiel mit anderen über Bewegung kommunizieren, Regeln aufstellen und flexibel mit ihnen umgehen, Erfahren von Nähe und Distanz, von Kooperation und Konkurrenz
Im Vordergrund stehen erlebnisorientierte Bewegungsangebote, die dem Kind die Möglichkeit geben, sich selbst als wichtiges Mitglied der Gruppe zu erfahren, die den Aufbau eines positiven Selbstkonzeptes unterstützen und ihm Erfahrungen von Selbstwirksamkeit vermitteln.
Der heutige Ansatz der Psychomotorik kann nicht mehr als übungszentriert beschrieben werden, er ist eher als erlebnisorientiert zu bezeichnen (siehe Kapitel 8). Das Bild des Kindes als eigenständiges, aktives und selbstbestimmtes Wesen, das sich die Welt über Bewegung sinnlich aneignet, prägt die praktische Vorgehensweise in der Psychomotorik.
Psychomotorische Erziehung lässt Raum für individuelle Interessen, weckt die Neugierde, unterstützt das Bedürfnis nach neuen Erfahrungen und berücksichtigt die unterschiedlichen Bedeutungen, die Bewegung für Kinder haben kann.
Erlebnisreiche Bewegungsangebote zur Förderung der sinnlichen Wahrnehmung gehören zu den grundlegenden Inhalten psychomotorischer Erziehung. Wahrnehmungsförderung nimmt allerdings nicht die Form eines Funktionstrainings an; im Sinne psychomotorischer Förderung sollte sie eher in erlebnisreiche Bewegungsangebote oder spannende Spielhandlungen eingebunden werden (Beins 2020; Biermann 2022; Herm 2021; Köckenberger 2010; Quante 2015; Zimmer 2023a, 2025).
Gerade die »psychomotorischen Geräte« (Rollbretter, Pedalos, Schwungtuch, Physiobälle, Balancierkreisel etc.) fordern die Aktivität der Wahrnehmungssysteme heraus. Sie lassen sich aber auch von den Kindern individuell deuten und ermöglichen eine eigene Sinngebung, sodass sie gut in komplexe Spielhandlungen eingebunden werden können (siehe Kapitel 4).
1.2 Das Menschenbild in der Psychomotorik
Jedem theoretischen Konzept, aber auch jedem praktischen Handeln liegt ein ganz bestimmtes Bild des Menschen zugrunde. Dabei handelt es sich um Annahmen über das Wesen des Menschen, die aus philosophischen oder auch naturwissenschaftlichen Überzeugungen abgeleitet werden. Oft sind Menschenbilder nur verdeckt vorhanden, trotzdem fließen sie in das praktische Handeln ein und wirken normativ (wertend).
Orientierung für das praktische Handeln
Menschenbilder können unterschiedlich sein und sich sogar gegenseitig ausschließen. So verträgt sich ein Bild, bei dem das Kind als ein von äußeren Reizen bestimmtes Wesen aufgefasst wird, nicht mit der Vorstellung des Kindes als aktivem, sich selbst steuerndem Wesen.
Menschenbilder haben auch für das praktische Handeln Orientierungsfunktion: Werden Verhaltensauffälligkeiten eines Kindes zum Beispiel als Folge einer Wahrnehmungsstörung betrachtet, so liegt dieser Auffassung ein Menschenbild zugrunde, nach dem das kindliche Verhalten als das Produkt einer intakten Verarbeitung (Integration) von Sinnesreizen verstanden wird. Es liegt auf der Hand, dass in einem solchen Fall auch die praktischen Konsequenzen für eine Fördermaßnahme anders aussehen, als wenn die Verhaltensprobleme als Ausdruck einer gestörten Beziehung des Kindes zu seiner sozialen Umwelt oder einer tiefgreifenden Selbstwertproblematik angesehen werden (vgl. Kapitel 2).
1.2.1 Humanistisches Menschenbild
Der im vorliegenden Buch beschriebene psychomotorische Ansatz fühlt sich einem Menschenbild, wie es in der humanistischen Psychologie beschrieben wird, verpflichtet. Die zentralen Grundgedanken dieses Menschenbildes können folgendermaßen zusammengefasst werden (Völker 1980, S. 15 ff.):
Autonomie und soziale Interdependenz
Zu Beginn seines Lebens ist jeder Mensch in hohem Maße von seiner Umwelt abhängig, mit wachsender Beherrschung seines Körpers strebt er jedoch nach Unabhängigkeit von äußerer Kontrolle. Er entwickelt ein aktives Selbst, das in zunehmendem Maße in die eigene Entwicklung eingreifen und die Verantwortung für das eigene Leben übernehmen kann. Diese Tendenz wird als Streben nach Autonomie bezeichnet; der Mensch strebt danach, sich selbst und die Umwelt zu beherrschen und dadurch unabhängig von äußerer Kontrolle zu werden. Autonomie heißt aber auch, sozialverantwortlich zu handeln.
»Nur ein Individuum, das für sich selbst verantwortlich ist, kann Verantwortung für die Gemeinschaft übernehmen. Eine Person, die entdeckt hat, dass sie sich selbst verändern kann, wird auch zu notwendigen Veränderungen der Umwelt beitragen« (Völker 1980, S. 17).
Autonomie muss daher immer auch im Zusammenhang mit sozialer Interdependenz gesehen werden: Wir sind eingebunden in eine soziale Gemeinschaft, die Familie, den Freundeskreis etc. – und nur im Austausch mit ihr kann sich die autonome Persönlichkeit entwickeln.
Selbstverwirklichung
Der Mensch wird als aktives, lebendiges, unternehmungslustiges We sen betrachtet. Er hat das Bedürfnis, seine Umwelt zu erforschen, nach Wissen zu streben und seine schöpferischen Fähigkeiten zu entfalten. Diese Tendenz wird als Selbstverwirklichungsstreben bezeichnet; sie gilt als grundlegende Antriebskraft, die sich in ständigem Austausch mit der sozialen Umwelt entfaltet. Nun entwickeln sich die Anlagen und Fähigkeiten eines Menschen nicht automatisch und ganz von selbst, es sind auch Umgebungsbedingungen erforderlich, die diesen Prozess unterstützen und fördern.
Ziel- und Sinnorientierung
Der Mensch strebt nicht nur nach Selbsterhaltung und Bedürfnisbefriedigung, sondern nach einem sinnvollen und erfüllten Dasein. Voraussetzung dafür ist, dass elementare Bedürfnisse nach Sicherheit und Liebe befriedigt sind.
Ganzheit
Der Mensch wird als Ganzheit gesehen: Psychische, kognitive, emotionale, soziale und somatische Prozesse sind aufeinander bezogen. An jeder Handlung ist immer der ganze Mensch beteiligt; Leib und Seele, Gefühl und Vernunft werden als Einheit betrachtet. Aus humanistischer Sicht ist der Mensch ein handelndes Subjekt, ein biologisches, psychisches und soziales Wesen.
Ein solches Menschenbild verweist implizit auf die besondere Rolle, die Körper- und Bewegungserfahrungen für die Entwicklung des Kindes haben:
■ Der Körper ist der Mittler von Selbstständigkeit. Das Streben nach Unabhängigkeit wird dem Kind über die körperlich-motorischen Erfahrungen bewusst. Die Umwelt beherrschen und über sich selbst verfügen können – hierzu ist Bewegung ein hervorragendes Mittel.
■ Auch im Hinblick auf das Streben nach Selbstverwirklichung nehmen Bewegungssituationen eine wesentliche Rolle ein: Sie enthalten viele Gelegenheiten, in denen sich die schöpferischen Kräfte eines Kindes entfalten können, in denen es auf seine Umwelt einwirkt und sie nach seinen Vorstellungen gestalten kann.
■ Bewegungserfahrungen vermitteln dem Kind die Erfahrung sinnvol len Handelns, ohne Zweckbestimmung und ohne auf die möglichen Ergebnisse des Tuns zu achten. Bewegung und Spiel sind Tätigkeiten, die um ihrer selbst willen ausgeführt werden und in sich selbst belohnend wirken.
■ Schließlich werden Bewegungshandlungen aus der Sicht der Psychomotorik immer auch hinsichtlich ihrer Verflochtenheit mit emotio nalen, kognitiven und sozialen Anteilen gesehen. Bewegung ist Ausdruck der Gesamtbefindlichkeit des Kindes und darf daher nie zum Beispiel nur unter biomechanischen Aspekten betrachtet werden. An jeder Bewegungshandlung ist immer der ganze Mensch beteiligt.
1.2.2 Das Kind als aktiver Gestalter seiner Entwicklung
Bestreben nach
Beobachtet man ein Kleinkind beim Spielen, dann lässt sich nicht übersehen, wie früh schon der Wunsch vorhanden ist, etwas selbst zu tun, sich selbst zu helfen und immer unabhängiger und selbstständiger zu werden. Das Kind bemüht sich um Kompetenz; das Bestreben nach Autonomie und Selbstständigkeit ist offensichtlich ein wesentliches Motiv kindlicher Entwicklung.
Autonomie und Selbstständigkeit
Das Selbstständigkeitsstreben des Kindes äußert sich in seiner Aktivität und seinem Bedürfnis nach schöpferischer Gestaltung. Deswegen muss auch den aktiven und kreativen Kräften, die der menschlichen Entwicklung innewohnen, ein besonderer Stellenwert beigemessen werden.
Das Kind ist ein schöpferisches Wesen, das sein Selbst-Werden aktiv betreibt.
Deswegen stellt erzieherisches Handeln auch keine einseitige kausale Einwirkung dar, bei der durch gezielte Maßnahmen ganz bestimmte Wirkungen erreicht werden. Es handelt sich vielmehr um ein interaktives Geschehen, bei dem ein prinzipiell selbstbewusstes, selbsttätiges Subjekt alle erzieherischen Maßnahmen interpretiert, bewertet und verarbeitet und damit auch in der Lage ist, sämtliche erzieherischen Intentionen zu durchkreuzen (Göppel 1997).
Für die psychomotorische Förderung bedeutet dies, dass das Kind sich nur durch seine eigene Aktivität entwickelt und so nur solche Maßnahmen und Anregungen zu Fortschritten in der Entwicklung führen, die der Motivation und den Handlungsmöglichkeiten des Kindes entsprechen. Das Kind muss also Gelegenheit haben, selbst – wie Kautter u. a. (1998) dies ausgedrückt haben – »der Akteur seiner Entwicklung« zu sein.
Eine ganzheitliche Sichtweise hat auch ein spezifisches Verständnis von Bewegungs- und Verhaltensauffälligkeiten zur Folge: Wenn Kinder nicht als Träger bestimmter Bewegungsstörungen oder Verhaltensauffälligkeiten gesehen werden, sondern als individuelle Personen mit einer eigenen Lebensgeschichte und spezifischen Bedürfnissen, Hoffnungen und Ängsten, ergeben sich daraus auch ganz konkrete Konsequenzen für eine Förderung.
Befähigung zum möglichst selbstständigen Handeln
In der Psychomotorik wird das Kind als handelndes Subjekt verstanden, das Verantwortung übernehmen und in bestimmtem Ausmaß auch für sich selbst entscheiden kann. Seine Entscheidungen werden vom Erwachsenen ernst genommen. Damit wird selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Handeln nicht nur zum Ziel, das irgendwann am Ende einer erfolgreichen Förderung steht, sondern es wird gleichermaßen bereits Methode der Fördermaßnahme.
Im Mittelpunkt steht die Frage, wie die pädagogische Fachkraft dem Kind helfen kann, sich seinen Möglichkeiten entsprechend mit vorhandenen Problemen besser zurechtzufinden, seine Handlungskompetenz zu erweitern und sie richtig einzusetzen. An die Stelle einer Behandlung tritt die Befähigung zum möglichst selbstständigen Handeln – sowohl auf motorischer als auch auf sozialemotionaler und kognitiver Ebene.
Durch die Bevorzugung des Mediums Bewegung, die Orientierung an der kindlichen Erlebnisfähigkeit und die Unterstützung der Eigenaktivität des Kindes wird die Fördermaßnahme von ihm selbst eher als selbst gesteuertes Spiel denn als »Behandlung« wahrgenommen.
Oberstes Anliegen der Psychomotorik ist es, die Kinder zu stärken, ihre Potenziale zu wecken und ihre Ressourcen aufzudecken. Jeder Mensch hat Ressourcen, die aber oft verborgen bleiben oder sich unter den jeweiligen Lebensbedingungen nicht entfalten können bzw. konnten.
1.3 Psychomotorik als ganzheitliche Gesundheitsförderung
Die hier beschriebene Auffassung von psychomotorischer Förderung kann auch als Basis von Gesundheit und Bildung von Kindern betrachtet werden. Die von allen Bundesländern herausgegebenen Bildungspläne für die pädagogische Arbeit in Kindertagesstätten machen deutlich: Gesundheit ist ein wichtiges Thema in der frühkindlichen Bildung; dabei überwiegt eine ressourcenorientierte Sichtweise, die weniger die Krankheitsrisiken der ersten Lebensjahre in den Vordergrund rückt, sondern eher die Bedingungen beschreibt, unter denen Gesundheit sich entwickeln kann. Wird der Blick auf die Stärkung der Ressourcen von Kindern gerichtet, mit Stress und Belastungsfaktoren (die z. T. unumgänglich sind) umzugehen, einen aktiven, gesunden Lebensstil zu entwickeln und ein positives Bild von der eigenen Person aufzubauen, dann sind es vor allem Körper- und Bewegungserfahrungen, die hierzu einen wesentlichen Beitrag liefern können (Zimmer 2020).
Im Folgenden soll daher die Beziehung zwischen dem Konzept der Psychomotorik und einer veränderten Auffassung von Gesundheit näher beschrieben werden.
1.3.1 Salutogenese – Wie entsteht Gesundheit?
Schutzfaktoren – Risikofaktoren
In den Gesundheitswissenschaften hat sich in den letzten Jahren ein Wandel hinsichtlich des Denkens und Forschens über Gesundheit eingestellt. Die traditionelle Perspektive der Risikofaktoren, die unsere Gesundheit beeinträchtigen, trat zurück hinter die Perspektive der Schutzfaktoren, die uns vor den tagtäglichen Belastungen bewahren bzw. uns befähigen, mit ihnen umzugehen.
An die Stelle der Pathogenese mit der Kernfrage »Was lässt die Menschen krank werden?« rückte die Salutogenese mit der viel entscheidenderen Frage: »Was lässt den Menschen trotz außerordentlicher Belastungen gesund bleiben?« Angestoßen wurde dieses Umdenken durch den Gesundheitswissenschaftler Antonowski (1993), der in den 1960er Jahren entsprechend der medizinischen Tradition nach Faktoren suchte, die dazu beitragen, dass manche Menschen eher krank werden als andere.
Die Umorientierung des Gesundheitsdenkens im salutogenetischen Sinne führte 1986 auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) dazu, in ihrer Programmatik zur Gesundheitsförderung die Entwicklung »Personaler Kompetenzen« als eines von fünf wichtigen Handlungsfeldern zu benennen: »Gesundheitsförderung unterstützt die Entwicklung von Persönlichkeit und sozialen Fähigkeiten durch Information, gesundheitsbezogene Bildung sowie die Verbesserung sozialer Kompetenzen und lebenspraktischer Fertigkeiten.«
Gesundheit wird dabei nicht als ein passiv und statisch erlebter Zustand betrachtet, sondern als ein » … aktuelles Ergebnis der jeweils aktiv betriebenen Herstellung und Erhaltung der sozialen, psychischen und körperlichen Aktionsfähigkeit eines Menschen im gesamten Lebenslauf« (Hurrelmann 1990, S. 62). Im Sinne Antonowskys kann es so nicht darum gehen, jede Erkrankungserfahrung zu vermeiden und Risiken ganz zu umgehen. Auch der Umgang mit Erkrankungen und Risiken bietet ein Entwicklungspotenzial, da hier Bewältigungsstrategien aufgebaut werden können, auf die später immer wieder zurückgegriffen werden kann.
Brodtmann (1997, S. 34) sieht Gesundheit als Balanceleistung an: »Ein Mensch fühlt sich umso gesünder, je besser es ihm gelingt, die ständig mit unterschiedlicher Intensität und Zahl auf ihn einwirkenden ›Stressoren‹ auszubalancieren.« Nach Antonowsky sind die Fähigkeiten zum Ausbalancieren von Belastungen einerseits davon abhängig, ob wir über ausreichende Widerstandsressourcen verfügen. Dazu gehören unter anderem Strategien zur Stressbewältigung (z. B. Entspannungstechniken), ein intaktes Immunsystem und das Vorhandensein sozia ler Unterstützung. Andererseits sind sie aber auch davon abhängig, wie stark der »Kohärenzsinn« eines Menschen ausgeprägt ist. Mit dem Kohärenzsinn ist die Gewissheit über die Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns gemeint, die Überzeugung, dass die Aufgaben, die man zu bewältigen hat, sinnvoll sind und es sich lohnt, sich dafür zu engagieren – die wichtigste Grundlage von Lebenskraft und Lebensmut (Brodtmann 1997).
1.3.2 Risiko- und Schutzfaktoren in der kindlichen Entwicklung
Die bekannteste und meistzitierte Längsschnittstudie, die sich mit der Wirkung von Risiko- und Schutzfaktoren und der Balance von Verwundbarkeit und Widerstandskraft befasst, ist die »Kauai-Studie« von Emmy E. Werner (Werner & Smith 1992). Alle im Jahr 1955 geborenen Kinder auf der zu Hawaii gehörenden Insel Kauai wurden in die Untersuchung einbezogen und über 30 Jahre lang in ihrer Entwicklung begleitet.
Risiko-Kinder





























