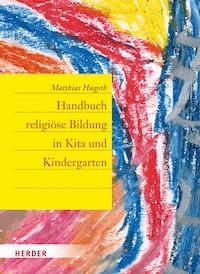
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Das Handbuch zeigt auf, dass und wie religiöse Bildung Kinder für ein Leben in dieser Gesellschaft stärkt. Es sticht besonders durch seine Konzentration auf die Kinder und ihre Bedürfnisse sowie auf die Erzieherinnen hervor, denen die Lektüre des Buches Grundlagen und Handlungsperspektiven für ihre Arbeit bringen soll.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Matthias Hugoth
Handbuch religiöse Bildung in Kita und Kindergarten
Impressum
Titel der Originalausgabe: Handbuch religiöse Bildung
in Kita und Kindergarten
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2012
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2014
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlagkonzeption: R.M.E Roland Eschlbeck/Rosemarie Kreuzer
Umschlaggestaltung: Verlag Herder
Umschlagabbildung: Rahel Fähndrich
Fotos im Innenteil: Hartmut W. Schmidt, Freiburg
E-Book-Konvertierung: epublius GmbH, Berlin
ISBN (E-Book): 978-3-451-80485-4
ISBN (Buch): 978-3-451-32296-9
Inhalt
Vorwort
Zur Einführung
Erster Teil Die Kinder und ihre Welt – Religion in der Welt der Kinder
1 Aufwachsen in dieser Zeit
1.1 Unterschiedliche Einstellungen und Werthaltungen
1.2 Familien – nicht immer Ort der Geborgenheit und Stabilität
1.3 Institutionen und schulische Lernorte
1.4 Die mobile Gesellschaft
1.5 Omnipräsente Medien
1.6 Riskante Kindheit: Kinder in materiell unsicheren, in prekären und bedrohlichen Lebenssituationen
1.7 Diversität und ungleiche Lebenswelten
1.8 Aufwachsen in einer kolonisierten und einer befreiten Kindheit
1.9 Aufwachsen in einer Welt, in der sich Erwachsene für Kinder engagieren
1.10 Aufwachsen in einer Welt, in der sich die meisten Kinder als glücklich bezeichnen
Aufwachsen der Kinder in Deutschland – Schlussfolgerungen für die religiöse Bildung in Kindertageseinrichtungen
2 Religion in der Welt der Kinder
2.1 Zur Präsenz der Religion in der Lebenswelt der Kinder
2.2 Konfessionslose und der Welt der Religion entfremdete Kinder
2.3 Die Erfahrung der Kinder, dass es unterschiedliche Religionen gibt
3 Herausforderungen für die religiöse Bildungsarbeit
3.1 Überdenken der bisherigen Praxis
3.2 Anhaltspunkte für eine veränderte Religionspädagogik im Elementarbereich
4 Religion in Kindergarten und Kita – die Interessen der Akteure
4.1 Religiöse Bildung im Interesse der Eltern
4.2 Die Interessen der Erzieherinnen
4.3 Religiöse Bildung der Kinder – Gewinn für die Gesellschaft
4.4 Religiöse Bildung der Kinder – die Interessen der Kirchen
Zwischenstopp
Zweiter Teil Gründe und Motive für die religiöse Bildung in Kindergarten und Kita
5 Vom Kind her argumentiert: die anthropologische Perspektive
5.1 Religiöse Bildung in Verbindung mit Sinn- und Wertebildung
5.2 Religiöse Bildung – systematisch vom Kind her begründet
6 Die theologische Perspektive
6.1 Das christliche Bild vom Kind
6.2 Die Kirchen als Mitgestalterinnen der frühkindlichen Erziehung und Bildung
6.3 Sammlung und Sendung: theologische Merkmale christlich ausgerichteter Kindergärten und Kitas
7 Wie argumentieren die Kirchen?
7. 1 Stellungnahmen und Positionspapiere der Evangelischen Kirche Deutschlands
7.2 Stellungnahmen und Positionspapiere der katholischen Kirche
7.3 An einem Strang: Die Kirchen und die Politik
Dritter Teil Eine religionspädagogische Didaktik für den Elementarbereich: Ansätze und Methoden
8 Religionspädagogische Ansätze im Überblick
8.1 Religiöse Erziehung als Vermittlung religiöser Inhalte und Praktiken (katechetischer Ansatz)
8.2 Religiöse Erziehung als Erzeugung und Festigung des Glaubens der Kinder (moralisch-kerygmatischer Ansatz)
8.3 Religiöse Erziehung als Basisausstattung für eine Mitgliedschaft in der bürgerlichen Gesellschaft
8.4 Religiöse Bildung als Religions- und Kulturkunde
8.5 Religiöse Erziehung als neutrales sachbezogenes Unterfangen – »Kaufladenpädagogik«
9 Neue Perspektiven einer Didaktik religiöser Bildung in Kindergarten und Kita
9.1 Der subjektorientierte Ansatz
9.2 Der kompetenzorientierte Ansatz
10 Methoden der religiösen Bildung in Kindergarten und Kita
10.1 Mit Kindern theologisieren – praktisch
10.2 Auch mit muslimischen Kindern theologisieren?
10.3 Eine integrative Didaktik für die religiöse Bildung in Kindergarten und Kita
10.4 Interkulturelles und interreligiöses Lernen
10.5 Kindergarten und Kita als Lernorte von Religion und Glauben für Kinder und Erwachsene
11 Erforderliche Haltungen und Kompetenzen der pädagogischen Fachkräfte
11.1 Setzt religiöse Erziehung Glauben voraus?
11.2 Was ist mit religiöser Kompetenz gemeint?
11.3 Wie kann religiöse Kompetenz erworben werden?
12 Spiritualität von Erzieherinnen
12.1 Bewusst leben
12.2 Religiöse Spiritualität
12.3 Persönlichkeitsbereiche als Quellorte der eigenen Spiritualität
12.4 Eine eigene spirituelle Heimat finden
13 Die eigene Resilienz stärken: Anregungen für Erzieherinnen
13.1 Die Frage der Einstellung zu mir selbst
13.2 Weitere Kraftquellen und Bereiche der Selbstsorge
Schluss
Literatur
Vorwort
Diese Buch ist aus dem Dialog mit der Praxis und mit der Aus- und Fortbildung von Fachkräften von Kindertageseinrichtungen gleichermaßen entstanden. Dabei zeigte sich: Bücher und Materialien für die religionspädagogische Arbeit mit Kindern in Kindergarten und Kita gibt es in einem umfangreichen Maß – von A wie Advent feiern mit Kindern bis Z wie Zimtsterne backen, von Liedern, Gebeten, Texten und Spielen zu religiösen Themen bis zur Kirchen- und Moscheenpädagogik, von Bibelarbeit bis zu Gottesdienstfeiern. Für jeden Bedarf scheint es etwas zu geben – weniger allerdings zu dem Bedarf, grundsätzliche Fragen zu den Gründen und Zielen, den Interessen und Absichten, zu den Einstellungen und Kompetenzen der Fachkräfte, zur Einbindung religiöser Bildungsarbeit in das gesamte Bildungsgeschehen in Kindergarten und Kita.
Auf diese Nachfragen aus der Praxis von Erzieherinnen und Trägern gleichermaßen – wie auch aus den Bereichen der Aus- und Fortbildung reagiert dieses Buch. Es geht also in erster Linie um eine umfassende »Theorie der religiösen Bildung in Kindergarten und Kita«–aber stets mit Blick auf die Kinder und ihre Lebenswelt, mit Blick auf die Lebens- und Lernorte Kindergarten und Kita und mit Blick auf die Erzieherinnen und Erzieher selbst und ihre grundsätzlichen und praxisbezogenen
Fragen.
Ich danke allen meinen Gesprächspartnerinnen und Mitstreiterinnen aus den zahlreichen Kindertageseinrichtungen, in deren Leben und Arbeiten ich Einblick gewinnen konnte. Ich danke den Kolleginnen und Kollegen aus den Fachschulen und -akademien, die mir einen Zugang zu den Themen ihrer Schülerinnen und Schüler ermöglichten. Ich danke schließlich meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern aus dem Verband Katholischer Kindertageseinrichtungen (KTK) – Bundesverband in Freiburg, meiner alten Wirkstätte, die mir immer wieder die Notwenigkeit aufzeigten, eine »sozialpädagogisch orientierte« Religionspädagogik zu entwerfen.
Mein besonderer Dank gilt dem Verlag Herder, der bereit war, in seine Handbuchreihe dieses Buch aufzunehmen. Vor allem danke ich dem Lektor dieses Werkes, Herrn Jochen Fähndrich, der die Arbeit an diesem Buch geduldig und zugleich mit viel Interesse und fachkundigem Rat unterstützte – obwohl es ein Wagnis ist, einen solchen Entwurf einer »sozialpädagogisch orientierten Religionspädagogik für den Elementarbereich« der Fachwelt vorzulegen.
Matthias Hugoth
Freiburg, im November 2011
Zur Einführung
Für wen wurde dieses Buch geschrieben?
Adressaten
Dieses Buch richtet sich in erster Linie an die pädagogischen Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen, also an die Erzieherinnen und Erzieher, die sich täglich dem Auftrag der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Vor- und Grundschulalter stellen.
Das Buch soll ferner den Personen Anhaltspunkte und Vorlagen bieten, die in der religionspädagogischen Aus- und Fortbildung von Erzieherinnen und Erziehern tätig sind: für diese Frauen und Männer dürften vor allem die grundsätzlichen Überlegungen zu einer kindzentrierten Religionspädagogik für den Elementarbereich und die Ausführungen zu den erforderlichen Kompetenzen der Fachkräfte von Interesse sein.
Schließlich werden als Adressaten des Buches auch die Träger von Kindertageseinrichtungen mitbedacht: Ihnen soll es eine Einsicht in die Gründe, Motive und Ziele religiöser Bildungsarbeit in Kindertageseinrichtungen und einen Überblick über die Praxis bieten, aber auch Aufschluss darüber geben, welche Anforderungen diese Praxis an die Fachkräfte stellt und wo diese Hilfe und Unterstützung – nicht zuletzt durch ihre Träger – brauchen.
Welche Anliegen verfolgt dieses Buch?
Das Buch ist hauptsächlich als Handbuch für die Praxis der religiösen Bildungsarbeit in Kindertageseinrichtungen geschrieben worden. Es geht also nicht in erster Linie um eine differenzierte wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Theorien und Ansätzen einer Religionspädagogik für den Elementarbereich; diese Ansätze sowie aktuelle Forschungsbefunde werden jedoch in zentralen Punkten referiert und in ihrer Bedeutung für die Praxis aufbereitet.
Ziele
Ziel ist es, den pädagogischen Fachkräften sowohl eine wissenschaftlich fundierte Basis für religionspädagogische Arbeit als auch zahlreiche Anhaltspunkte für diese Praxis zu bieten. Dabei stehen die Fachkräfte und die Kinder im Mittelpunkt des Interesses: Die Fachkräfte sollen eine Orientierung für ihre Arbeit wie auch für sich persönlich erhalten, den Kindern sollen die Überlegungen dieses Buches zugute kommen, indem sie eine religiöse Bildung begründen und praxisrelevant konzipieren, die sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung voranbringt und für das Leben in dieser Gesellschaft stark macht.
Dieser letzte Gesichtspunkt stellt einen der Leitfäden dieses Buches dar: religiöse Bildung von der Frage her zu begründen und zu konzipieren, was Kinder stark für das Leben macht und was sie brauchen, um in dieser Gesellschaft bestehen zu können.
Dieser funktionale Blick, der von der Frage bestimmt wird, was und wie religiöse Erziehung zur Stärkung der Persönlichkeit und zur Befähigung zu einem selbstbestimmten, für sich und andere verantwortlichen Leben angesichts der Herausforderungen unserer Gesellschaft beitragen kann, wird ergänzt durch den Blick aus zwei weiteren Perspektiven: zum einen aus der Perspektive von Erzieherinnen, die überzeugt sind, dass sie den Kindern keinen Bereich des menschlichen Lebens, also auch den Bereich der Religion, vorenthalten dürfen, unabhängig davon, ob sie diesen Bereich für sich selbst als relevant ansehen; die also davon überzeugt sind, dass Religion zu den elementaren Bereichen der Bildung in Kindertageseinrichtungen gehört. Zum anderen aus der Perspektive von Erzieherinnen, die sich aufgrund ihrer eigenen religiösen Überzeugung dazu berufen und verpflichtet sehen, den Kindern einen Zugang zur Welt der Religion zu ermöglichen, die davon überzeugt sind, dass der Glaube und die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft von Glaubenden das Leben des Menschen bereichern kann. Es ist die Perspektive des Zeugnisses und der Teilhabe an dem, woraus gläubige Menschen leben.
Diese zwei Perspektiven von Erzieherinnen bieten sowohl denjenigen, die sich selbst zu keiner Religion zugehörig verstehen, für die aber religiöse Bildung in Kindergarten und Kita durchaus sinnvoll erscheint, wie auch jenen Erzieherinnen, für die Religion auch persönlich relevant ist, einen Ausgangspunkt für ihre praktische Arbeit.
Dieses Buch ist also sowohl für die Erzieherinnen geschrieben, für die religiöse Bildung selbstverständlich zu ihrer pädagogischen Arbeit in ihren Einrichtungen dazugehört, als auch für die Erzieherinnen, die diese spezifische Bildungsarbeit nicht zu ihrem »Kerngeschäft« zählen, die also eher skeptisch sind und überzeugt werden müssen: Das Buch ist somit nicht nur für die pädagogischen Fachkräfte in konfessionellen Kindergärten und Kitas gedacht, sondern auch für die Erzieherinnen in kommunalen Einrichtungen und in Einrichtungen anderer nichtkonfessioneller Träger.
Welche Inhalte werden in diesem Buch behandelt?
Themen
Die Inhalte dieses Buches konzentrieren sich auf drei Themenkreise:
auf das Kind und die Frage, wie sein Vertrauen in das Leben und seine Lebenstüchtigkeit durch religiöse Bildung gestärkt werden können;
auf die Erzieherinnen und Erzieher, ihre Einstellungen und Haltungen und ihre Kompetenzen für die religiöse Bildungsarbeit in ihren Einrichtungen;
auf die Praxis der religiösen Bildung in Kindertageseinrichtungen, die Zusammenarbeit mit den Eltern, mit den Gemeinden und mit den Personen und Institutionen, von denen Hilfe und Unterstützung für diese Praxis zu erwarten sind.
Was macht den besonderen Charakter dieses Buch aus?
Pluralitätsfähige Religionspädagogik
Es geht um die Konzeption einer pluralitätsfähigen Religionspädagogik für Kindertageseinrichtungen. Diese geht von der profanen Lebenswelt der Kinder und der Fachkräfte aus und ebnet von hier aus einen Zugang zur Welt der Religion; zum anderen verfolgt sie die Perspektive des Glaubens:
die Perspektive einer Botschaft, in der Zuspruch und Anspruch Gottes an jeden einzelnen Menschen und die Menschheit enthalten sind,
die Perspektive des Zeugnisses in Wort und Tat,
die Perspektive der Dynamik des Glaubens, die handlungsleitend ist und dem Leben eine Richtung gibt.
Das Buch ist also mit unterschiedlichen Perspektiven konzipiert:
ausanthropologischer Perspektive, weil es das Kind in seiner Gesamtheit in den Blick nimmt und fragt, welche religiöse Bildung das Kind braucht bzw. worauf es ein Recht hat;
aus theologischer Perspektive, weil der Glaube selbst – in diesem Buch in erster Linie der christliche Glaube– Vorgaben für eine religiöse Bildung enthält: seine Inhalte, die nicht beliebig auszulegen sind, seine Zusagen und Verheißungen, die letztlich nur zeugnishaft nahegebracht werden können, seine Verpflichtungen zu Einstellungen und Handlungsweisen;
aus systemischer Perspektive, weil die Beschäftigung mit Inhalten und Vollzugsweisen des Glaubens für das Kind nur dann wirklich
»gewinnbringend« ist, wenn sie mit Bezug auf seine Lebens- und Erfahrungswelt erfolgt;
schließlich ist das Buch multiperspektivisch angelegt, weil es unterschiedliche Ansätze der religiösen Bildung aufzeigt, um den ersten drei Perspektiven gerecht werden zu können.
DerSchwerpunkt dieses Handbuchesliegt auf der Grundlegung – also der Begründung, Herleitung und Plausibilisierung – religiöser Bildung in Kindergarten und Kita sowie auf der Darlegung und kritischen Sichtung herkömmlicher und neuer Ansätze einer Religionspädagogik im Elementarbereich. Es geht also zunächst und ausführlich umeine theoretische Verortung der religiösen Bildung in die Bildungsarbeit von Kindertageseinrichtungen. Dabei werden allerdings stets bereitsKonsequenzen und konkrete Anhaltspunkte für die Praxisaufgezeigt.
Bei diesen grundsätzlichen Ausführungen handelt es sich jedoch um eine »Theoriebildung in praktischer Absicht« (Dommel 2007, S.31). Deshalb erfolgt im dritten Teil dieses Handbuches (s. Kap. 8) eine Übersicht über die didaktischen Ansätze für eine religionspädagogische Praxis sowie eine Entfaltung einiger Ansätze; so wird beispielhaft aufgezeigt, wie eine solche Praxis konkret aussehen kann.
Warum es um religiöse Bildung geht – und was ist mit der religiösen Erziehung?
In älteren Büchern und Handreichungen zur religionspädagogischen Arbeit von Kindertageseinrichtungen ist in der Regel von »religiöser Erziehung« die Rede. Damit wurde die Absicht signalisiert, dass man den Kindern religiöse Inhalte und Handlungsweisen beibringen und sie zu einem angemessenen Verhalten als Christen in Kirche und Gesellschaft anleiten wollte. Dahinter stand das Verständnis des Kindes als eines kleinen Menschen, dem man vieles in Sachen Religion vermitteln, mit dem man religiöse Verhaltensweisen einüben muss, damit es einmal als verantwortungsvoller Christ sein Leben gestalten und von seinem Glauben Zeugnis geben kann.
Bildung: Kind als Akteur
Der Bildungsbegriff signalisiert dagegen, dass es sich um Lern- und Erfahrungsprozesse handelt, bei denen das Kind als Akteur verstanden wird; es ist in der Lage, sich unter Anleitung und Begleitung von Erzieherinnen religiöse Themen zu erschließen, es bestimmt selbst, was es interessiert und was es wissen will, es entwickelt schon früh eigene Vorstellungen von »Gott und der Welt« und vermag religiöse Inhalte und Verhaltensweisen mit anderen Bildungsinhalten und entsprechenden Handlungen – etwa aus dem Bereich der Wertebildung – zu verbinden. Unser Bildungsbegriff geht vom Kind als Akteur, als Subjekt aus und er ist integral ausgerichtet, indem religiöse Bildung nicht – wie dies bei der religiösen Erziehung oftmals der Fall war und ist – einen Sonderbereich darstellt, in dem Glauben, Wissen und Verhalten losgelöst von anderen Bildungsbereichen und vom »profanen« Leben erworben und eingeübt werden; religiöse Bildung stellt vielmehr einen integralen Bestandteil der Bildungsarbeit mit Kindern dar, die darauf abzielt, Kinder zu einem eigenständigen, eigen- und sozialverantwortlichen Leben zu befähigen.
Warum ist durchgängig von Erzieherinnen die Rede?
Da der weitaus größte Teil der pädagogischen Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen aus Frauen besteht und weil es zu einer besseren Lesbarkeit beiträgt, wird im Folgenden stets nur von »Erzieherinnen« die Rede sein; die männlichen Fachkräfte sind dabei jedoch stets mitgemeint. An den Stellen, an denen zwischen Frauen und Männern ausdrücklich unterschieden werden sollte – etwa in dem Kapitel, in dem es um die Spiritualität der Fachkräfte geht (s. Kap. 12)–, wird eine solche Unterscheidung vorgenommen werden.
Warum es um Kindergarten und Kita geht
Im Titel dieses Buches wird zwischen Kindergarten und Kita unterschieden. Grundsätzlich gilt: Kitas, Kindertageseinrichtungen, umfassen auch Kindergärten. Unter diesem Sammelbegriff sind alle Einrichtungen der Kinderbetreuung zusammengefasst – von der Krippe über den Kindergarten bis zum Hort (vgl. Hugoth 2011, S.502f.). Da jedoch die meisten Kitas aus Kindergärten bestehen, beziehen sich viele Ausführungen dieses Buches ausdrücklich auf diese Einrichtungen und auf die Kinder, die hier leben und lernen, also auf Kinder von drei bis sechs Jahren. Wenn von Kindertageseinrichtungen die Rede ist, sind Kinder im Vor- und Grundschulalter generell gemeint.
Warum von »unseren Kindern« gesprochen wird
In diesem Buch wird immer wieder die Formulierung »unsere Kinder« verwandt. Damit bringt der Autor zum Ausdruck, dass die Kinder das gemeinsame Anliegen aller sind, die in der praktischen Arbeit in Kindertageseinrichtungen wie auch in der theoretischen Reflexion dieser Arbeit den Kindern gerecht zu werden versuchen. Beide Seiten, die »Praktikerinnen« und die mit ihnen diese Praxis reflektierenden und mit Forschungswissen untermauernden »Theoretikerinnen und Theoretiker« wissen allerdings darum, dass dieses Bemühen um ein »gerecht werden« nur in ständiger Vergewisserung bei den Kindern selbst erfolgen kann: wo immer sie sich zu Wort melden und sagen und signalisieren, was sie fühlen und denken, was sie umtreibt, was sie glauben und für gut und gerecht halten, was sie wissen wollen und was sie brauchen, muss dies ernst genommen und in die Überlegungen einbezogen werden.
Vergewisserung bei Kindern
Deshalb waren bei den Ausführungen dieses Buches die Kinder stets »dabei«–wie auch die Erzieherinnen, denen der Autor nicht nur theoretisches Basis- und konkretes Praxiswissen anbieten, sondern auch Anhaltspunkte für ihren persönlichen Weg zur Welt des Glaubens aufzeigen will.
Erster Teil Die Kinder und ihre Welt– Religion in der Welt der Kinder
Wenn es darum geht zu begründen, warum religiöse Bildung in Kindertageseinrichtungen praktiziert werden soll, richtet sich der Blick in der Regel zunächst auf das Kind, auf seine Bedürfnisse und Fragen, seine Gedanken und Vorstellungen und auf die Art und Weise, wie es sich die Welt erschließt. Beim Kind als lernendem Individuum setzen fast alle an, die einen bestimmten Bereich der Bildung und Erziehung von Kindern im Vor- und Grundschulalter begründen wollen. So gehen auch alle Bundesländer vor, die ausdrücklich die religiöse Bildung in ihre Bildungspläne für Kindertageseinrichtungen aufgenommen haben.
In diesem Handbuch werden wir ebenfalls der Frage nachgehen, ob das Kind Religion braucht bzw. was es bedeutet, wenn man ihm den Bereich der Religion vorenthält.
Zunächst jedoch nehmen wir eine andere, eine systemische Perspektive ein, die die gängige individualistische Sichtweise ergänzt: Wir setzen diesmal nicht zuerst beim Individuum Kind an, sondern bei dem, was es für Kinder heißt, heute in diesem Land aufzuwachsen. Was bestimmt das Leben der Kinder hier und heute? Unter welchen Bedingungen wachsen sie auf? Was brauchen sie, um mit den Herausforderungen fertig zu werden, die das Heranwachsen an sich und das alltägliche Leben in dieser Gesellschaft im Besonderen an sie stellen? Für welches Leben in welcher Gesellschaft sollen Erziehung und Bildung Kinder kompetent und stark machen? Und welche Rolle nimmt dabei die religiöse Bildung in Kindergarten und Kita ein? Was kann sie dazu beitragen, dass die Kinder Vertrauen in das Leben gewinnen und zu starken Persönlichkeiten heranwachsen, die über ein gutes Fundament für ihr Leben verfügen und in der Lage sein werden, für sich und andere Verantwortung zu übernehmen? Soll religiöse Bildung unsere Kinder sogar befähigen, kritisch und widerständig zu werden und sich gegen Unrecht zur Wehr zu setzen? Zielt religiöse Bildung am Ende also darauf, dass die Kinder Alternativen zu dem von der Erwachsenenwelt oft erwarteten Anpassungsverhalten lernen?
Die Leserinnen und Leser erfahren, dass über die Frage nach den religiösen Bedürfnissen und Fragen der Kinder hinaus auch aus der Einsicht in die Lebensherausforderungen der Kinder Gründe und konkrete Anhaltspunkte für die religiöse Bildung abgeleitet werden können.
1Aufwachsen in dieser Zeit
Wer sich Gedanken darüber macht, ob es sinnvoll ist, Kinder im Vor- und Grundschulalter religiös zu erziehen, wer sich also fragt, ob eine solche Erziehung dem Kind und seiner Persönlichkeitsentwicklung gut tut, der muss auch in Betracht ziehen, in welcher Welt die Kinder heute leben, was es heißt, in diesem Land aufzuwachsen (vgl. Hugoth 2009).
Im Folgenden wird das Aufwachsen unserer Kinder im Spiegel der Erwachsenenwelt beschrieben, und zwar im Spiegel dessen, wie die Erwachsenen ihr Leben verstehen und gestalten. Und im Spiegel der Stimmungen, der Atmosphäre, die dadurch das Lebensgefühl der Menschen und besonders der Kinder bestimmen. Aus den Bedürfnissen der Kinder, die bei ihnen aufgrund dieser Erfahrungen entstehen, und aus den Reaktionen, die sie zeigen, lassen sich erste Anhaltspunkte für die religiöse Bildungsarbeit ableiten.
Dabei ist die Frage leitend: Was kann die religiöse Bildung in Kindertageseinrichtungen dazu beitragen, dass die Kinder mit den Herausforderungen, aber auch mit den Chancen, die aus den ihre Alltagswelt bestimmenden Faktoren erwachsen, gut zurechtkommen? Es geht in diesem ersten Teil der Begründung religiöser Bildung also um einefunktionale Sicht, die sich so auf den Punkt bringen lässt: Welchen »Gewinn« bringt religiöse Bildung den Kindern für sie persönlich und für ihre Lebensbewältigung?
Die Formulierungen bei den Abschnitten »Erste Anhaltspunkte für die religiöse Bildung« erfolgen bewusst in einer Erwachsenensprache: Die Schlussfolgerungen aus der Erörterung der Bedingungen des Aufwachsens für die religiöse Bildung müssen zuerst von den Erzieherinnen nachvollziehbar und für sie einsichtig sein; dann erst können sie entsprechende Konsequenzen für die religiöse Bildungsarbeit mit den Kindern ziehen und werden dabei die hier aufgezeigten »Anhaltspunkte für die religiöse Bildung« für die Erzieherin-Kind-Interaktion in einfache Sprache übersetzen.
Entwicklungen und Stimmungen in der Erwachsenenwelt– Auswirkungen auf das Kinderleben
Die folgenden Ausführungen basieren auf Befunden der modernen Kindheitsforschung (Wittmann 2011; Robert 2011, Andresen & Hurrelmann 2010, Bamler u.a. 2010, Leyendecker 2010, Honig 2009, Brinkmann 2008, Alt 2007, Alt 2005–2008). Der Titel »Kindheitsforschung« steht sowohl für die Erforschung des Kindes wie auch die Erforschung des Aufwachsens von Kindern und des Kindseins in unterschiedlichen gesellschaftlichen Kontexten. Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich auf die Befunde der Erforschung des Kindseins in Deutschland und der Bedingungen, unter denen Kinder ihr Kindsein leben.
(Die moderne Kindheitsforschung setzte im 18.Jahrhundert ein. Allerdings firmiert sie hier noch als Kinderforschung, da sich das Interesse – vor allem der Psychologie – in erster Linie auf die Kinder als Individuen bezieht. Der Begriff der Kindheitsforschung hat sich als Fachbegriff erst Ende des 20.Jahrhunderts etabliert und durchgesetzt.)
Lesetipp
Es empfiehlt sich, die folgenden Ausführungen, die von der Sache her recht abstrakt formuliert sind, so zu lesen, dass stets Bezüge sowohl zu den eigenen Beobachtungen bei den Kindern in der eigenen Einrichtung wie auch bei den Kindern, wie sie an anderen Orten und vermittelt durch die Medien in der persönlichen Wahrnehmungswelt auftreten, hergestellt werden: Wo finde ich bei unseren Kindern im Kindergarten bzw. der Kita und in den anderen Bereichen, in denen ich auf Kinder stoße, Entsprechungen zu dem, was hier generell über das Kindsein in unserer Gesellschaft gesagt wird?
Die folgenden Ausführungen folgen zwar »roten Fäden« und bauen aufeinander auf. Zugleich sind die einzelnen Kapitel aber so konzipiert, dass sie als eine vorläufig abgeschlossene Einheit gelesen und diskutiert werden können.
1.1Unterschiedliche Einstellungen und Werthaltungen
Aufwachsen in einer pluralistischen Gesellschaft
Die Kinder wachsen hierzulande in einer Welt auf, die durch eine Pluralität von Einstellungen und Werthaltungen, von Lebensformen, sozialen Beziehungen, religiösen Überzeugungen und Praktiken bestimmt ist. Auch die Ansichten, die sie bei den Erwachsenen in ihrer unmittelbaren Lebenswelt über die grundsätzlichen und praktischen Fragen des Lebens beobachten, unterscheiden sich häufig deutlich voneinander: Die Mutter denkt manchmal anders über eine Person oder Sache als der Vater, die Erzieherinnen im Kindergarten halten etwas für ganz wichtig, was die Eltern ablehnen, und die Kinder unterscheiden sich untereinander in dem, was sie jeweils von den Erwachsenen an Meinungen und Einstellungen übernommen haben.
Solche Erfahrungen von Pluralität, die es zwar immer schon gab, die aber heute deutlich zugenommen hat und vielfältiger geworden ist, können Kinder irritieren und schon früh damit konfrontieren, dass man über dieselbe Sache unterschiedlicher Meinung sein kann. Sie müssen demnach schon recht bald lernen, sich selbst Gedanken zu machen und zu Meinungen zu kommen. Auch in Fragen der Religion und der Werte.
Diese Notwendigkeit wird noch dadurch verstärkt, dass die Ansichten und Meinungen, die in der Erwachsenenwelt aktuell diskutiert werden und für das momentane Verhalten und Handeln bestimmend sind, recht schnell wechseln und von neuen Auffassungen und Lebensweisen – und oft auch von neuen Moden – abgelöst werden. Kinder werden von der Beschleunigung der Themen und Alltagspraktiken der Erwachsenen nicht verschont. Das verstärkt oft noch die Irritationen der Kinder und somit ihren Orientierungsbedarf.
Dilemmasituationen
Solche divergierenden Erfahrungen – die sich auch in den Kindern zugänglichen Medien spiegeln – können Kinder durchaus in belastende Dilemmasituationen bringen, indem sie sich zwischen den unterschiedlichen Meinungen von Erwachsenen entscheiden müssen, zu denen sie aber oft jeweils eine starke Beziehung aufgebaut haben. Kinder erleben solche Entscheidungen zwischen unterschiedlichen Meinungen als Entscheidungen zwischen den Menschen, die sie lieb haben und die ihnen wichtig sind.
Aufgrund des Orientierungsbedarfs, der für Kinder aus den Erfahrungen der Vielfalt von Ansichten, Standpunkten, Bewertungen, religiösen und ethischen Überzeugungen erwächst, die sich zudem immer wieder verändern, und aufgrund der Notwendigkeit, eine eigene Sicherheit in dem zu gewinnen, woran sie sich halten sollen, ist es berechtigt und sinnvoll, den Bildungsbereich »Religion« in den Katalog der Bildungsarbeit in Kindertageseinrichtungen aufzunehmen. Denn bei der eingehenden Beschäftigung mit religiösen Themen – das belegt die Praxis immer wieder – erhalten die Kinder die Gelegenheit, sich mit Inhalten, mit Bildern und Symbolen, mit Personen und Handlungsweisen aus der Welt der Religion zu befassen und dabei Zuordnungspunkte für das zu gewinnen, was sie an unterschiedlichen Glaubenshaltungen, Meinungen und Handlungsweisen der Erwachsenen erleben.
Damit die Kinder die ambivalenten bis widersprüchlichen Situationen, die sich oft im Zusammenhang mit den großen und kleinen Fragen des Lebens ergeben, besser bewältigen können, ist es wichtig, dass sie den Umgang mit solchen Fragen lernen. Dafür ist das Feld der religiösen Bildung ausgezeichnet geeignet. Denn wenn Kinder erfahren und lernen, wie »glauben geht«, und wenn sie lernen, Ansichten und Meinungen zu unterscheiden und sich selbst welche zu bilden und zu begründen, können sie daraus eine wachsende Sicherheit gewinnen.
Erste Anhaltspunkte für die religiöse Bildung
Bedürfnis nach Orientierung und Sicherheit
Die Beschäftigung der Kinder mit Themen aus der Welt der Religion kann sie etwas entdecken lassen, woran sie glauben und sich orientieren können. Es kann sie aber auch kompetenter machen in dem, wie sie das Denken und Glauben der Menschen unterscheiden, wie sie eigene Auffassungen gewinnen, wie sie diese artikulieren und vor anderenvertreten können. Religiöse Bildung kann schließlich bestimmend sein für die Gestaltung von Beziehungen der Kinder zu den Menschen um sie herum. Vor allem können die Kinder Sicherheit gewinnen, wenn sie folgende Erfahrungen machen:
die Erfahrung, dass man Gott vertrauen kann;
die Erfahrung von Menschen, Kindern wie Erwachsenen, die dasselbe glauben und ebenso vertrauen;
die Erfahrung, dass dieser gemeinsame Glaube und dieses Vertrauen Menschen zusammenführt;
die Erfahrung, dass sie dem, was sie verbindet, in Bildern und Symbolen, in Festen und Feiern, in Gebet und Gottesdienst Ausdruck geben;
die Erfahrung schließlich, dass gläubige Menschen aus ihrem Glauben an Gott, an seinen Zuspruch und seine Verheißungen wie auch seine Weisungen Verantwortung für sich, für die Mitmenschen und für die Schöpfung ableiten.
1.2Familien – nicht immer Ort der Geborgenheit und Stabilität
Noch immer wachsen fast alle Kinder hierzulande in Familien oder familienähnlichen Lebensformen auf. Etwa 80% der Kinder leben in Zwei-Eltern-Familien; zusätzlich 7% mit unverheirateten Elternteilen (Stange 2006, S.42f.). Deshalb trifft die Rede von der »Familienkindheit« auch heute noch zu. Allerdings haben sich die Strukturen der Familien, die Formen des Familienlebens und die Rollen und Funktionen der Familienmitglieder gegenüber der Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg merklich verändert.
Veränderte Organisationsformen von Familie
Was die Strukturen und Organisationsformen des Familienlebens anbelangt, so haben sich neben den traditionellen Formen, nach denen Familien aus Vater, Mutter und mindestens einem Kind bestehen, heute die Ein-Eltern-Familien (ca. 20% aller Familien mit Kindern), die Patchworkfamilien (Kinder von unterschiedlichen Vätern oder Müttern leben mit einem Elternpaar zusammen, das sich momentan als das zuständige definiert) und binationale Familien mit z. T. clanartigen Familienverbänden entwickelt. In jüngster Zeit beanspruchen auch gleichgeschlechtliche Paare das Recht, Kinder adoptieren zu können und als Erziehungsberechtigte im Familienverbund anerkannt zu werden.
Labilisierung der Beziehungen in der Familie
Wir haben es also mit einer zunehmenden Pluralisierung familialer Lebensformen zu tun. Dies wird auch durch die deutliche Zunahme der Ehescheidungen forciert (etwa jede dritte Ehe in Deutschland wird geschieden), weil die ehemaligen Partner in der Regel neue Beziehungen eingehen und neue familienähnliche Lebensgemeinschaften gründen. Die Ausdifferenzierung der familialen Konstellationen führt oft zu einer Labilisierung, einer Verunsicherung und Instabilität des Familienlebens; dies kann die Kinder belasten, weil sie sich von alten Familienarrangements verabschieden und auf neue Arrangements einlassen und in diesen Fuß fassen müssen. Die Bindungsforschung hat die Bedeutung der frühen Bindungen für die Persönlichkeitsentwicklung und die Entwicklung sozialer Kompetenzen nachgewiesen. Problematisch wird die Labilisierung familialer Lebensformen deshalb vor allem dann, wenn den Kindern das Eingehen von konsistenten, also sicheren und beständigen Beziehungen zu festen Bezugspersonen erschwert oder gar verwehrt wird.
Status der Kinder
Ferner hat sich der Status der Kinder in den Familien verändert. Kinder werden eher als Partner der Erwachsenen angesehen, als Persönlichkeiten, die bereits früh eigene Vorstellungen von ihrem Leben entwickeln, die nach ihren Bedürfnissen, Meinungen und Standpunkten gefragt werden, die sich aber auch schon im Vorschulalter mit der Notwendigkeit konfrontiert sehen, sich zwischen verschiedenen Lebensgestaltungsmomenten entscheiden zu müssen.
Erziehungsstil der Eltern
Schließlich hat sich auch der Erziehungsstil der Eltern verändert. Der ehemals vorherrschende autoritäre Stil, der Kindern vor allem Gehorsam und Anpassung abverlangte, wurde weitgehend von einem antiautoritären oder permissiven, mit wenig Verpflichtungen und Vorgaben agierenden Stil abgelöst: verbindlich ist, was vereinbart wurde. Diese Vereinbarungen richten sich in erster Linie nach den Interessen und Vorstellungen der Familienmitglieder und erst dann nach dem, was von außen an Ansprüchen an die Familie und speziell an die Kinder herangetragen wird. Die Interessen aller Familienmitglieder werden als prinzipiell gleichwertig anerkannt und aufeinander abgestimmt. Deshalb spricht man heute auch oft von einem »Verhandlungshaushalt«.
Die Großzügigkeit und Liberalität, die viele Eltern ihren Kindern gegenüber praktizieren, ist zum einen auf eine klare Entscheidung für einen solchen Beziehungs- und Erziehungsstil zurückzuführen; oft ist das Gewährenlassen aber auch die Folge von Verunsicherungen hinsichtlich der Frage nach den angemessenen Erziehungszielen und -stilen oder Folge der Resignation angesichts der zahlreichen außerfamilialen Einflüsse, denen die Kinder ausgesetzt sind und denen die Eltern oft nichts entgegenzusetzen haben. Es zeigt sich zunehmend, dass Eltern Rat und Hilfe und eine Stärkung ihrer Erziehungskompetenz benötigen, was beispielsweise Baden-Württemberg dazu veranlasst hat, das Projekt »Stärkung der Erziehungskraft der Familie durch und über den Kindergarten« aufzulegen (vgl. Hartmann u.a. 2007).
Zeitliche Reduzierung des Familienlebens
Auffallend ist die zeitliche und räumliche Reduzierung des Familienlebens. Das bedeutet: Die Zeit, die Eltern und Kinder miteinander verbringen, verringert sich stetig; zudem findet dieses Miteinander nicht mehr ausschließlich in der Wohnung der Familie statt, da Kinder viel mehr als früher unterwegs sind und zumindest im Vorschulalter von einem Elternteil zwischen unterschiedlichen Aktionsorten transportiert werden.
Entscheidend für die Entwicklung der Kinder sind die Möglichkeiten und Formen, mit primären Bezugspersonen in der Familie Bindungen einzugehen und eine Bindungssicherheit zu gewinnen. Diese ist für die Entwicklung eines starken Selbstwertgefühls und einer stabilen Resilienz (Widerstands- und Selbstbehauptungskraft) sowie für die Lern- und Bildungsprozesse der Kinder von ausschlaggebender Bedeutung (vgl. Jungmann & Reichenbach 2009, Becker-Stoll 2009a, Posth 2010). Schließlich zeigen über die Bindungsforschung hinaus auch die aktuellen Befunde der Neurobiologie, wie bedeutsam konsistente und tragende Beziehungen für die Entwicklung des Gehirns sind (vgl. Hüther 2010).
Erste Anhaltspunkte für die religiöse Bildung
Bedürfnis nach Zusammenhalt und verlässlichen Beziehungen
Familien gelten zwar noch immer als primärer Ort des Aufwachsens von Kindern und sind deshalb für diese von enormer Bedeutung. Doch die Kinder machen unterschiedliche Erfahrungen mit ihren Familien – auch damit, wie hier über Gott und andere religiöse Themen gesprochenwird oder auch nicht. Diese Erfahrungen erfolgen zunehmend in Form von Vereinzelungen: jede Familie macht es so, wie sie es für richtig hält bzw. wie es in die Alltagsthemen und die Alltagspraxis hineinpasst. Es gibt immer weniger die Erfahrung von kollektiven Werthaltungen und einer religiösen Lebensführung in Verwandtschafts- und Nachbarschaftskonstellationen.
Aus der Beschäftigung mit dem unterschiedlichen Aufwachsen von Kindern in Familien können Anhaltspunkte gewonnen werden für die Frage, ob und auf welche Weise familienbezogene Bilder und Sprachformen bei der religiösen Erziehung verwendet werden können, inwieweit die positiv besetzten Inhalte wie die Botschaft von dem alle Kinder liebenden Gottvater in der realen Erfahrungswelt der Kinder auf eine vertraute oder eine andere Folie treffen.
Religiöse Bildung in Kitas kann aber auch das, was in den Familien an Stabilität durch religiöses Leben vermittelt wird, vertiefen, wie sie auf der anderen Seite auch das Fragile und Verunsichernde aufgrund eines Mangels an klaren Überzeugungen und Haltungen kompensieren kann.
1.3Institutionen und schulische Lernorte
In den letzten Jahrzehnten ist hierzulande das System der schulischen und außerschulischen Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder in einem hohen Maß ausgebaut worden. Eine Folge des Ausbaus dieser Institutionen besteht darin, dass sich die Zeit, die Kinder außerhalb der Familie in Einrichtungen und Diensten der Kinderhilfe, der Schule und außerschulischen Bildung und der Freizeitgestaltung verbringen, enorm ausgedehnt hat. Deshalb wird das Kinderleben zu Recht als eine »institutionalisierte Kindheit« charakterisiert.
Aufwachsen in Institutionen
Die Auswirkungen des Aufwachsens in Institutionen auf die Kinder und auf die Gestaltung des Kinderlebens bestehen zunächst darin, dass Kinder sich auf neue Beziehungen einlassen müssen, die sich sowohl in dem, was Kinder daraus für sich gewinnen, als auch in dem, was diese Beziehungen von den Kindern fordern, von den Beziehungen daheim in der Familie unterscheiden. Aufwachsen in Institutionen ist demnach ein Erfahrungs- und Lernfeld im Blick auf die Gestaltung neuer Beziehungen. Das kann das Leben der Kinder komplexer und damit oft auch anspruchsvoller machen; es kann aber auch die Chancen der Kinder erweitern, neue Erfahrungen mit sich selbst und mit anderen Menschen im Bereich zwischenmenschlicher Beziehungen zu sammeln und ihre sozialen Kompetenzen zu vertiefen und weiterzuentwickeln.
Das Aufwachsen in Institutionen hat auf jeden Fall Auswirkungen auf das Bindungsverhalten der Kinder. Denn die Kinder suchen sich neben den Bezugspersonen in der Familie auch in diesen Einrichtungen und Diensten weitere Bezugspersonen, die für ihre Entwicklung eine besondere Bedeutung haben. Das kann gelegentlich zu mehr oder weniger offenen Konkurrenzen und Spannungen zwischen den beteiligten Erwachsenen führen. Oder – wie bereits gezeigt – zu Dilemmasituationen für die Kinder, wenn die Standpunkte der Bezugspersonen divergieren und die Kinder sich entscheiden müssen, welcher Meinung sie sich anschließen. Dies ist dann oft mit der Angst verbunden, die Zuneigung der Bezugsperson zu verlieren, deren Position die Kinder nicht gefolgt sind.
Peer-Beziehungen
Das Aufwachsen in Institutionen eröffnet den Kindern auch die Chance zu neuen Beziehungen zu anderen Kindern in etwa dem gleichen Alter. Solche Peer-Erfahrungen und Peer-Beziehungen sind vor allem für die Kinder bedeutsam, die ohne Geschwisterkinder aufwachsen (das sind etwa ein Fünftel der Kinder in Deutschland). Die moderne Entwicklungspsychologie und Bindungsforschung hat nachgewiesen, wie wichtig die Beziehungen zwischen Gleichaltrigen sind; Kinder lernen durch Kinder, und dazu erhalten sie in Einrichtungen und Diensten der Erziehung, Bildung und Betreuung außerhalb der Familie oft mehr Gelegenheiten als zu Hause (vgl. Brandes 2008).
Diversitätserfahrungen
Dabei ist besonders der Umstand hervorzuheben, dass diese Einrichtungen und Dienste eine Erfahrung ermöglichen, die in den Familien der Kinder kaum stattfindet – die Erfahrung von Kindern (und deren Familien), die aus anderen Ländern kommen, einer anderen Kultur und einer anderen Religion angehören. Die Multikulturalität der Gesellschaft spiegelt sich in den Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen der Kinderhilfe und des Bildungssystems für Kinder wider. In diesen Institutionen lernen die Kinder, mit Diversität umzugehen und sie lernen in interkulturellen Lernprozessen die ethnischen und kulturellen Faktoren kennen, die die eigene Identität im Vergleich zu der anderer Kinder bestimmen (vgl. Vielfalt bereichert 1999; Religion für alle Kinder? 2003; Hugoth 2003; Habringer-Hagleitner 2006; Fleck & Leimgruber 2011).
Das Aufwachsen in Institutionen konfrontiert Kinder ferner mit Regeln und Normen, die das Leben und Arbeiten in den Einrichtungen und Diensten bestimmen und steuern. Sie erleben meist noch stärker als in ihren Familien, dass es gilt, zwischen einer Anpassung an die Strukturen, Organisationsformen und Gesetzmäßigkeiten der Einrichtungen auf der einen und den eigenen Bedürfnissen, Wünschen und Vorstellungen auf der anderen Seite einen Weg zu finden. Vor allem die Einrichtungen und Dienste außerhalb der Schule sind jedoch bemüht, den Kindern möglichst viele Gelegenheiten dafür zu bieten, dass sie an der Festlegung von Regeln und Normen beteiligt werden, dass sie die Lebens- und Lernformen mitgestalten und Verantwortung übernehmen, dass sie sich mit ihrer Einrichtung zumindest teilweise identifizieren.
Der Begriff »Institutionen- und Schulkindheit« zeigt an – so lassen sich die bisherigen Überlegungen auf den Punkt bringen–, dass neben der Familie die Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen zu bedeutsamen Sozialisationsinstanzen geworden sind, die zeitweise stärkeren Einfluss auf die Entwicklung der kindlichen Persönlichkeiten haben als die Eltern. Der Begriff zeigt ferner an, dass die öffentliche Verantwortung für das Aufwachsen der Kinder größer geworden ist.
Erste Anhaltspunkte für die religiöse Bildung
Herausforderungen an das Kind und Chancen
Das Aufwachsen in Institutionen stellt die Kinder vor neue Herausforderungen, es bietet ihnen aber auch zahlreiche Chancen.
Bedürfnis nach selbstbestimmter Verortung und Mitgestaltung
Zu den Herausforderungen gehört die Notwendigkeit, dass jedes Kind im Kindergarten, in der Kita, in der Schule seinen Platz finden und eine Geltung in der Gruppe erringen muss. Das muss nicht immer dramatisch ablaufen, kann aber für einzelne Kinder zu einer Belastung werden. Für andere ist es eine Chance, sich zu profilieren und sich Geltung zu verschaffen, also stark zu werden. Ferner kann das Aufwachsenin Institutionen zu Diskrepanzen zwischen Einrichtung und Elternhaus führen – wenn etwa die Auffassungen über Erziehungs- und Bildungsziele und -methoden zwischen pädagogischen Fachkräften und Eltern auseinandergehen, wenn die Erwartungen der Eltern von den Fachkräften nicht erfüllt werden, wenn Kinder zwischen die Stühle geraten, weil sie sowohl ihre Eltern lieben als auch ihre Erzieherinnen mögen.
Positive Auswirkungen der religiösen Bildung auf das Leben und Lernen in der Kita
Religiöse Bildung kann zum einen zu einer Beheimatung der Kinder in der Einrichtung beitragen (ich gehöre zu denen, die sich mit religiösen Themen und Praktiken befassen), sie kann ein spirituelles Klima schaffen, das den Kindern das Gefühl von Beheimatung, von Zusammengehörigkeit durch eine Verbindung im Glauben und Handeln ermöglicht. Religiöse Bildung in Kindertageseinrichtungen lässt diese aber auch als Orte erfahren, an denen man über religiöse Themen diskutiert, streitet, nach Lösungen sucht.
Religiöse Bildung kann ferner ein Brückenthema zwischen Kita und Familie darstellen – entweder indem man Annäherungen und Übereinstimmungen findet oder indem man Religion zum Thema der Auseinandersetzung und der Suche nach Verständigung macht.
Generell gilt – und dies besonders auch für die religiöse Bildung: damit es nicht zu einer Entfremdung zwischen den Familien und den Kitas kommt, müssen neue Organisationsformen entwickelt werden, die Familien und Institutionen stärker miteinander vernetzen. Den Kindertageseinrichtungen ist jetzt bereits gesetzlich aufgetragen, konsequenter Erziehungs- und Bildungspartnerschaften mit den Eltern einzurichten. Das gilt auch für die religiöse Bildung. Wenn diese in Institutionen wie Kindergarten und Kita erfolgt, dann muss dabei bedacht werden, welche pädagogischen Settings hier üblich sind, ob sich diese von der Lebenswelt der Kinder stark unterscheiden – im Kindergarten Religion, außerhalb das »wahre Leben«–und wie Verbindungen, Korrelationen hergestellt werden können.
Schließlich kann auch die Kindertageseinrichtung zu einem Lernort des Glaubens für Kinder und Erwachsene– Erzieherinnen und Eltern – werden, wenn sie zusammen mit den Kindern religiöse Inhalte besprechen, religiöse Bilder und Symbole erschließen, nach den Konsequenzen für das Leben miteinander fragen.
1.4Die mobile Gesellschaft
Kinder haben heute mehr als in jeder Epoche zuvor die Gelegenheit, in relativ kurzer Zeit die Orte zu wechseln, an denen sie ihren Aktivitäten nachgehen. Je jünger die Kinder sind, umso mehr wird dieser Ortswechsel von den Eltern vorgenommen, die ihr Kind in den Kindergarten bringen, von dort zu einer der Einrichtungen, in denen es Sport treiben, musizieren, singen, basteln oder einer anderen Beschäftigung nachgehen kann. Dann wird das Kind zum Einkaufen mitgenommen, zu Freunden oder Verwandten gebracht, es begleitet schließlich die Mutter, den Vater bei dem, was sie bzw. er an unterschiedlichen Orten zu erledigen hat. Oder die Eltern sind aufgrund fehlender Mittel oder weil sie berufstätig sind und sich tagsüber nicht um ihre Kinder kümmern können, darauf angewiesen, dass die Einrichtungen und Dienste die Kinder zu den unterschiedlichen Orten bringen, an denen sie spezifischen Beschäftigungen wie schwimmen, musizieren, turnen usw. nachgehen. Auf jeden Fall sind viele Kinder viel unterwegs und wechseln mehrmals am Tag ihre Lebens- und Aktionsorte (allerdings gibt es auch eine große Zahl von Kindern, deren Eltern aufgrund prekärer Lebenslagen kaum die Wohnung verlassen und deshalb ihren Kindern auch wenige Möglichkeiten der Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben bieten; diese Kinder empfinden den ständigen Aufenthalt an einem Ort oft als Einengung und Zwang, ihnen wird die Buntheit der Welt vorenthalten; hier muss religionspädagogisch anders reagiert werden, doch dazu später mehr).
Die Mobilität, die den Alltagsrhythmus der Zeitgenossen generell bestimmt, ist auch zu einem Kennzeichen der heutigen Kindheit geworden.
Auswirkungen der Mobilität
Diese Mobilität hat Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinder wie auch auf die Art und Weise, wie sie ihre sozialen Beziehungen und ihren Alltag gestalten. Auf der einen Seite kann die verstärkte Mobilität sich eher negativ auf das Aufwachsen von Kindern auswirken, indem die beschleunigten Alltagprozesse der Kinder es diesen erschweren, sich für eine längere Zeit an vertrauten Orten einzurichten und zu verwurzeln, Konsistenz in ihren Beziehungen zu anderen und in ihren Spiel- und Lernprozessen zu erfahren. Dies kann zu einer Verflachung von Erlebnissen, Erfahrungen, Beziehungen und Bindungen führen. Mobilität erschwert oder verhindert gar Verortung und Beheimatung, Kontinuitäts- und Konsistenzerfahrungen und führt somit zu einer Labilisierung der Kindheit heute.
Kaum unmittelbare Erfahrungen mehr
Zu den eher negativen Auswirkungen zählt auch die Tatsache, dass Kinder meist in Fahrzeugen von einem Ort an einen anderen gelangen. Das hat zur Folge, dass Kinder immer weniger die Erfahrung von Aufbruch, Unterwegssein und Ankommen durch ihren eigenen Körper erleben, da sie sich nicht mehr eigenständig bewegen müssen. Dies hat auch zur Folge, dass die Kinder die Umgebung nicht unmittelbar wahrnehmen, durch die sie unterwegs sind – weder die Natur am Rande des Weges noch die Witterung noch die Geräusche von Vögeln und anderen Tieren. Der Lebensraum der Kinder wird von diesen nicht mehr in sukzessiven Schritten erschlossen und angeeignet. »Der ganzheitliche Lebensraum schrumpft und wird durch eine Ansammlung von Funktionsräumen ersetzt. Diese Zersplitterung wird auch als ›Verinselung des Lebensraumes‹ gekennzeichnet« (Stange 2006, S.49).
Zeitempfinden verändert
Zu den bedenklichen Auswirkungen der Mobilität gehört auch der Einfluss, den sie auf das Zeitempfinden der Kinder hat. Das Tempo, in dem der Weg von einem Ort zum anderen durch Fahrzeuge zurückgelegt wird, ist deutlich höher, als wenn dieser Weg zu Fuß bestritten wird. Diese Beschleunigung setzt sich häufig bei den Aktivitäten fort, die an diesem und an jenem Ort durchgeführt werden: Da diese innerhalb schmaler Zeitfenster erfolgen, kann etwas oft nicht so ergiebig und intensiv getan und eine Beziehung nicht so prozesshaft gestaltet werden, als wenn es im Alltag des Kindes weniger Programm geben würde.
Die von pädagogischen Fachkräften in Kindertageseinrichtungen und Schulen immer wieder bestätigte Zunahme von psychomotorischen Auffälligkeiten der Kinder, die sich in Bewegungsunruhe, Konzentrationsmangel, Lautstärke und hektischem Verhalten zeigen, dürften unter anderem auch auf die Mobilität der Kinder zurückzuführen sein; diese Beobachtungen sind signifikante Merkmale einer »bewegten Kindheit«.
Positive Folgen
Auf der anderen Seite hat die »bewegte Kindheit« auch positiv zu bewertende Folgen: Die Kinder werden bereits früh auf das mobile Gesellschaftsleben vorbereitet, sie entwickeln Flexibilität, Anpassungsfähigkeiten und eine für häufigere Ortswechsel erforderliche Beweglichkeit und Gewandtheit. Außerdem erhalten sie in relativ kurzer Zeit Einsichten in unterschiedliche Lebens- und Aktionswelten. Die Kehrseite der Reduzierung länger anhaltender sozialer Beziehungen und Prozesse besteht darin, dass es zu weniger konflikthaften zwischenmenschlichen Situationen kommt.
Die Verinselung von Beziehungs- und Aktionsbereichen hat schließlich auch zur Folge, dass Beziehungen, die dem Kind wichtig und wertvoll sind, bewusster ausgewählt, geplant und gestaltet werden müssen. Kinder können dazu eine spezifische Beziehungskompetenz entwickeln und erste Erfahrungen mit unterschiedlichen Formen eines »Beziehungsmanagements« machen. Somit kann die »bewegte Kindheit« die Einlösung des Imperativs zur Selbstverantwortung und -gestaltung des Lebens begünstigen, der schon früh an die Kinder gerichtet wird.
Erste Anhaltspunkte für die religiöse Bildung
Bedürfnis nach Bewegung, Ruhe und Beständigkeit
Religiöse Bildung ist auf ein prozesshaftes Erschließen von Glaubensinhalten, von Bildern und Symbolen angelegt, sie bietet den Kindern die Möglichkeit, sich selbst und gemeinsam mit anderen zu diesen Inhalten und Symbolen, aber auch zu den Personen, die für die Religion eine bedeutende Rolle spielen, in Beziehung zu setzen. Religiöse Bildung lässt dem Fragen, dem Ergründen, dem Erklären den gebührenden Raum; auch zum Ausprobieren und Einüben von Riten und Ritualen und von Verhaltensweisen, die aus den Glaubensauffassungen folgen.
Religiöse Bildung ist nicht leistungsorientiert (output) und will auch nicht für den Zugang zu anderen Lern- und Bildungsbereichen qualifizieren. Sie ist person- und sachorientiert und nimmt sich Zeit für Lernprozesse, in die das Kind stets individuell einbezogen ist. Sie nimmt das Tempo heraus, schafft eine Balance zwischen Beständigkeit und Dynamik (Weiterentwicklung) und hilft dem Kind, sich bei aller Mobilität in einer spirituellen Heimat zu verorten. Dazu gehören unter anderem:
religiöse Bauten wie Kirchen, Kapellen und Wegkreuze,
die immer wieder im Rhythmus etwa eines Kirchenjahres wiederkehrenden Feste und Bräuche,
die symbolische Verbundenheit mit den Menschen, die vor uns gelebt und ihrem Glauben einen Ausdruck in alten Gebeten, Liedern, liturgischen Feiern gegeben haben,
das Hören alter und zugleich »jung gebliebener« Texte wie der biblischen Geschichten.
All das kann die Erfahrung von Beständigkeit, Verbundenheit und Verlässlichkeit ermöglichen.
Mit diesen Formen religiöser Bildung kann diese einen Kontrapunkt setzen gegenüber der Mobilität, Beschleunigung und Hektik des Lebens, kann sie Möglichkeiten der Verankerung und Beheimatung bieten.
Zugleich kann religiöse Erziehung auf die »Überbrückung von Räumen und Entfernungen«, die charakteristisch für die mobile und beschleunigte Gesellschaft ist, konstruktiv reagieren, indem sie Beziehungen zu anderen Religionen und Kulturen, zu den Glaubensinhalten und der religiösen Lebenswelt der Menschen herstellt, die einer anderen Religion angehören als der, die in der Kita in der Hauptsache thematisiert wird.
Eine Konzeption und Praxis interkultureller und interreligiöser Bildung werden durch die mobile Gesellschaft unverzichtbar; darin kann auch eine Chance für neue Ansätze einer religiösen Bildung liegen.





























