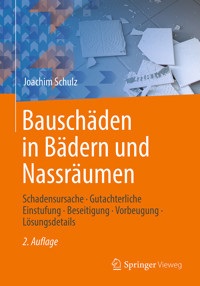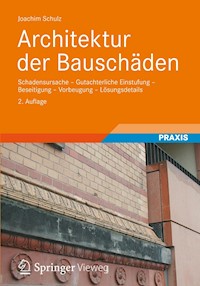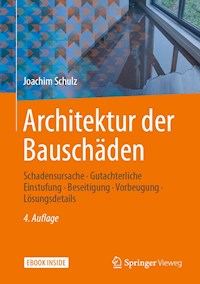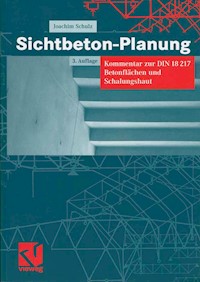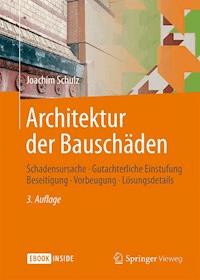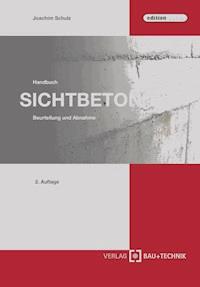
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Bau+Technik
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: edition beton
- Sprache: Deutsch
Sichtbeton und deren Bewertung erfordern umfangreiche Fachkenntnisse in Baukonstruktion, Bauchemie und Baustoffkunde. Der Titel vermittelt das hierzu notwendige Fachwissen und beschreibt sinnvolle Vorgehensweisen. So fordert der Autor Planer und Bauherr auf, bereits im Vorfeld der Erstellung ein Anforderungsprofil zu erarbeiten. Nur so kann die Soll-Planung mit dem Ist-Ergebnis verglichen und ein sachgemäßes Urteil über die Sichtbeton-Qualität abgegeben werden. Zahlreiche Beispiele sowie ein Kommentar zum Merkblatt "Sichtbeton" ergänzen die Ausführungen und stellen den Bezug zur Praxis her. Insgesamt bietet diese Arbeitshilfe planenden, ausführenden und prüfenden Beteiligten Unterstützung zur Beurteilung und Abnahme von Sichtbeton. Die überarbeitete Auflage des Handbuchs wurde auf den neuesten Stand der Technik sowie der nationalen und internationalen Regelwerke gebracht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 176
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
VLB-Meldung
Schulz, Joachim
Handbuch Sichtbeton – Beurteilung und Abnahme
2., überarbeitete und erweiterte Auflage
Erkrath: Verlag Bau+Technik GmbH, 2016
ISBN 978-3-7640-0610-5
eISBN 978-3-7640-0732-4
© by Verlag Bau+Technik GmbH, Erkrath 2010
Gesamtproduktion: Verlag Bau+Technik GmbH,
Steinhof 39, 40699 Erkrath
www.verlagbt.de
Druck: B.O.S.S Medien GmbH, 47574 Goch
Handbuch Sichtbeton – Beurteilung und Abnahme
Dipl.-Ing. Joachim Schulz
2., überarbeitete und erweiterte Auflage 2016
Kontaktadresse
Dipl.-Ing. Joachim Schulz
ö.b.u.v. Sachverständiger IHK
für Sichtbeton
Ulmenallee 53
14050 Berlin
www.sichtbeton-handbuch.de
Kapitel 9:
Rechtsanwalt Bernd R. Neumeier
BRN Baurecht Rechtsanwälte
Kurfürstendamm 30
10719 Berlin
www.baurecht-neumeier.de
Die Inhalte und Lösungsvorschläge in diesem Buch sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Hinsichtlich der Anwendung der Inhalte kann vom Autor und dem Verlag jedoch keine Gewähr übernommen werden. Das Buch ersetzt nicht die projektbezogene Planungsleistung. Sie entbindet nicht von der Pflicht zur Prüfung der Normvorgaben und ihrer Gültigkeit für den jeweiligen Anwendungsfall. Die Anwendung der Inhalte und Lösungsvorschläge berechtigt zu keinerlei Regressansprüchen gegenüber dem Autor und dem Verlag.
Die im Buch erwähnten Logos, Marken und Produktnamen sind markenrechtlich geschützt, auch wenn dies am Ort der Erwähnung nicht gesondert aufgeführt wird.
Die Inhalte und Abbildungen in diesem Buch unterliegen dem Urheberschutz. Eine Verwendung oder Vervielfältigung – auch auszugsweise – ist nur mit der Genehmigung des Verlags in jedem Einzelfall möglich.
Vorwort
1Einleitung
1.1Regeln
1.2Baukonstruktion
2Normen mit Sichtbeton-Relevanz
2.1Festlegungen in DIN EN 206-1/DIN 1045-2
2.1.1Expositionsklassen (Einwirkungen/Expositionen)
2.1.2Betondeckung
2.1.3Abstandhalter und Abhängung
2.1.3.1Abhängung der Bewehrung
2.1.4Schwindverhalten im Sichtbeton
2.2Schalungsanker für Betonschalungen
2.3Betonflächen und Schalungshaut gemäß DIN 18127
2.4Betonarbeiten gemäß DIN 18331
2.4.1Betonbauarbeiten, insbesondere für Sichtbeton
2.5Toleranzen im Hochbau (hier: Sichtbeton)
2.5.1Ebenheitsabweichungen
2.5.2Ebenheitsabweichungen nach DBV/VDZ-Merkblatt „Sichtbeton“
2.6Bauzeichnungen / Ausführungsplanung
2.6.1DIN 1356-1:1995-02 „Bauzeichnungen“ Teil 1
2.6.2HOAI 2013 § 34
2.6.3Urteile zum Thema Ausführungsplanung
2.7Leistungsbeschreibung
2.8Sichtbeton nach ÖNORM B 2211
2.9Sichtbeton nach SIA 118/262
3Merkblätter mit Sichtbeton-Relevanz
3.1DBV/VDZ-Merkblatt „Sichtbeton“
3.1.1Sichtbeton (Ortbeton)
3.1.1.1Sichtbetonklassen
3.1.1.1.1 Sichtbetonklasse SB 1 gem. DBV/VDZ-Merkblatt „Sichtbeton“
3.1.1.1.2 Sichtbetonklasse SB 2 gem. DBV/VDZ-Merkblatt „Sichtbeton“
3.1.1.1.3 Sichtbetonklasse SB 3 gem. DBV/VDZ-Merkblatt „Sichtbeton“
3.1.1.1.4 Sichtbetonklasse SB 4 gem. DBV/VDZ-Merkblatt „Sichtbeton“
3.1.1.1.5 Sichtbeton – Anforderungsprofil
3.1.1.1.6 Sichtbeton – Anforderungsprofil an die Planung
3.1.1.2Herstellungstechnische Grenzen
3.1.1.3Porigkeit (Lunker)
3.1.1.4Ebenheit (Toleranzen im Hochbau)
3.1.1.5Schalungsmusterplan
3.1.1.6Ausbildung von Stößen und Fugen
3.1.1.6.1 Arbeitsfugen (geplante)
3.1.1.6.2 Arbeitsfugen (ungeplante)
3.1.1.6.3 Schalhautstöße
3.1.1.7Musterflächen, Erprobungsflächen, Referenzflächen
3.1.1.8Mängelbeseitigung
3.1.2DBV-Merkblatt „Betonierbarkeit von Bauteilen aus Stahlbeton“
3.1.3DBV-Merkblatt „Abstandhalter nach Eurocode 2“
3.2FDB-Merkblätter „Betonfertigteilbau“
3.2.1FDB-Merkblatt Nr. 1 „Sichtbetonflächen von Fertigteilen aus Beton und Stahlbeton“
3.2.2FDB-Merkblatt Nr. 8 „Betonfertigteilen aus Architekturbeton“
3.3DAfStb-Richtlinie
3.3.1Oberflächenschutzsysteme gemäß DAfStb-Richtlinie „Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen“
3.4Richtlinien in Österreich
3.4.1„Sichtbeton – Geschalte Betonflächen“
3.4.2„Sichtbeton für Fertigteile aus Beton und Stahlbeton“
4Überprüfung des Erfolgs eines Sichtbeton-Projekts
4.1SOLL-Zustand
4.1.1Ungenaue Sichtbeton-Leistungsbeschreibung / Erwartungshaltung
4.1.2Sichtbeton-Ausschreibung: Hinweise
4.2IST-Zustand / Erfassung
4.2.1Einzelkriterien
4.2.1.1Beispiele für Sichtbeton-Bewertung: Einzelkriterien
4.2.2Gesamteindruck / Sichtflächenbetrachtung
4.2.2.1Betrachtungsabstand / „übliche Nutzung“
4.2.2.2Lichtquelle
4.3SOLL-IST-Vergleich
4.3.1Sichtbeton-Vergleich
4.3.2Mängelbewertung
4.3.3Optische Beanstandungen
4.3.4Gewichtung der Sichtbeton-Beanstandungen
4.3.5Minderung
4.3.6Berechnung der Minderung
4.3.6.1Verantwortlichkeit: Planung und Bauleitung
4.3.6.2Verantwortlichkeit: Checkliste „Weiße Wanne“
4.3.6.3Verantwortlichkeit: Quotelung
4.4Bauabnahme
5Fassaden
5.1Fassadenfunktion
5.2Fassaden-Verschmutzung
5.3Fensterbänke und andere Abdeckungen – die Notwendigkeit von „Tropfkanten“
6Risse im Sichtbeton
6.1Rissbreitenbegrenzung
6.2Rissbeschreibung
6.3Rissverläufe
6.4Rissursachen
6.4.1Kerbrisse
6.4.2Biegerisse
7Betonkosmetik – „Betonretusche“
7.1Beispiele
7.1.1Sporthalle
7.1.2Flächen komplett geschliffen und gespachtelt
7.1.3Treppen-Betonfertigteile
7.1.4Decken: sichtbare Abstandhalter
7.1.5Wände: sichtbare Abzeichnung der Stahlbewehrung
7.1.6Wände mit einer Farblasur
8Beispiele
8.1Ortbeton
8.1.1Sichtbetonklasse SB 2 erfüllt?
8.1.2Sichtbetonklasse SB 4 erfüllt?
8.1.3Minderung aufgrund Gewichtung
8.1.4Ripplings
8.1.4.1Ripplings: Schulneubau
8.1.4.2Ripplings: Einfamilienhaus
8.1.4.3Ripplings: Ursache
8.1.5Schalung
8.1.5.1Schalungsmatrizen
8.1.5.2Holz-Schalung
8.1.6Dichtigkeit der Schalhautstöße
8.1.6.1Betonkanten-Ausbildung
8.1.7Schuhabdrücke
8.1.8Treppen aus Ortbeton
8.1.8.1Innentreppen
8.2Fertigteile
8.2.1Sichtbeton – Beschaffenheitsvereinbarung
8.2.2Sichtbeton-Fertigteile
8.2.2.1Balkondecken
8.2.2.2Hauseingangsüberdachung
8.2.3Sichtbeton-Fertigteile: Farbabweichungen
8.2.3.1Fassade – Schulneubau
8.2.3.2Fassade – Wohngebäude
8.2.4Absätze und Höhensprünge
8.2.5Fugenbreite bei Betonfertigteilen, Toleranzen
8.2.5.1Balkon-Fertigteile
8.2.5.2Fassaden-Fertigteile
8.2.6Sichtbeton-Treppen – Fertigteile
8.2.6.1Innentreppen aus Sichtbeton
8.2.6.2Außentreppen aus Sichtbeton
8.3„Weiße Wanne“
8.3.1„Weiße Wanne“ aus WU-Beton als Sichtbeton
8.3.2Checklisten
8.3.2.1Sichtbeton – Konzept
8.3.2.2„Weiße Wanne“ – Konzept
8.4Sichtestrich
8.4.1Sichtestrich ungenau bzw. nicht definiert
8.4.2Sichtestrich, Strukturbeton
9Sichtbeton: Mängel und Haftung aus rechtlicher Sicht
9.1Überblick
9.2Sichtbeton – wann liegt ein Mangel vor?
9.3Mängelbeseitigung und Haftung
9.4Strategien zur Mängelvermeidung
9.4.1Vertragliche Vereinbarung
9.4.2Ausführung nach Musterflächen
9.4.3Qualifizierte Ausschreibung
9.4.4Qualitätsmanagement
9.5Zusammenfassung
10Sichtbeton Begriffe, Erklärungen / Glossar
11Schlusswort
12Literatur
12.1DIN-Normen
12.2Richtlinien, Merkblätter
12.3Fachbücher
12.4Fachaufsätze
12.5Fotos
12.6Links
13Stichwortverzeichnis
Bildnachweis Schmuckbilder
BetonBild / Engelhard Sellin
IGS Schulz
Verlag Bau+Technik
BetonMarketing Ost / Guido Erbring
BetonBild
BetonMarketing Ost / Guido Erbring
Verlag Bau+Technik
BetonBild / André Hack
BetonBild
Eric Spahn / BetonBild
Jens Kirchner
Vorwort
Wie kann man SICHTBETON besser beschreiben als mit diesen japanischen Worten:
Diese 2. Auflage wurde vollständig überarbeitet und erweitert, u.a. um:
– Kommentar zum neuen DBV/VDZ-Merkblatt „Sichtbeton“, Juni 2015
– Risse im Beton
– Betonkosmetik
– Hinweise vom Juristen: Haftung aus rechtlicher Sicht
– Weiße Wanne aus Sichtbeton
und vieles mehr.
Sichtbeton erhebt den höchsten Anspruch an sichtbaren Beton. Aber wie definiere ich „Sichtbeton“?
– Reicht der alleinige Hinweis auf entsprechende Merkblätter aus, um Streitigkeiten zu vermeiden?
– Ist Sichtbeton in SB 4 überhaupt möglich ohne Betonkosmetik?
– Wie viel Betonkosmetik ist zulässig, damit man überhaupt noch von Sichtbeton reden kann?
– Ist eine umfangreiche Betonkosmetik gleichwertig mit Sichtbeton und wenn nein, wie ermittle ich einen Minderungsbetrag?
– Was kann ich erwarten, wenn keine eindeutige Sichtbeton-Planung vorliegt?
– Was gilt im Streitfall: Die Ausschreibung oder die Ausführungsplanung?
Wir Architekten und Ingenieure haben einen tollen Beruf, jedoch müssen wir diesen beherrschen, und das durch Selbststudium.
Dank gebührt meinen Mitarbeitern für ihre Unterstützung während der Entstehung dieses Werks, insbesondere Jaqueline Dressel, Christine Silva und Matthias Herzig.
Dipl.-Ing. Joachim Schulz
Berlin, im Juli 2016
1Einleitung
„Planungs- und Ausführungsfehler als Ursache für Bauschäden werden nicht durch Normen, sondern durch Kenntnis naturbedingter Grundsätzlichkeiten vermieden.“
Alles, was
– man nicht messen, „wiegen“ kann,
– nicht in einer DIN-Vorschrift steht,
– nicht „eindeutig und erschöpfend“ zwischen Auftraggeber (AG) und Auftragnehmer (AN) vereinbart wurde,
muss subjektiv beurteilt werden!
Jede Ansichtsfläche ist hinsichtlich des Aussehens ein Unikat aufgrund
– zulässiger Maßtoleranzen,
– Witterungsbedingungen usw.
Die Bewertung, ob z.B. die Sichtbetonart „üblich“ ist und ob die Ausführung der Leistung entspricht, die der Auftraggeber „erwarten“ kann, bedarf eines erfahrenen Sichtbeton-Sachverständigen.
Begriffe, wie „Gebrauchstauglichkeit, Wert und zugesicherte Eigenschaften“, werden nicht mehr verwendet. Nach der VOB wird nach der „vereinbarten Beschaffenheit“ und der „vorauszusetzenden Verwendungseignung“ bewertet (siehe Kapitel 9 „Sichtbeton: Mängel und Haftung aus rechtlicher Sicht“).
Bild 1.1: Schüttlagen (Lehrzimmer)
Die Anforderung an eine „eindeutige und erschöpfende“ Beschreibung der zu erwartenden Bauleistung ist noch wichtiger, um gegebenenfalls über einen SOLL-IST-Vergleich eventuelle Mängel begründen zu können.
1.1Regeln
Die Bewertung einzelner Sichtbeton-Leistungen sowie die Bauabnahme erfolgt nach Regeln. Dabei ist zu berücksichtigen, dass bei jeder handwerklichen Leistung Unregelmäßigkeiten nicht völlig zu vermeiden sind. Für Beton gibt es diverse Merkblätter, Richtlinien oder technische Regelungen mit Empfehlungscharakter.
Ob man die Bezeichnung Regel, Regelwerk oder Norm benutzt, ist in letzter Konsequenz gleichgültig. Alle beinhalten den gleichen Grundgedanken: Die allgemein verbindliche Feststellung von Verhaltens- bzw. Ausführungsregeln.
Begriffe im Zusammenhang mit der Sichtbeton-Bauweise werden im Kapitel 10 erklärt.
Bild 1.2: Geplanter Sichtbeton?
Bild 1.3: Sichtbeton – Farbabweichungen
1.2Baukonstruktion
Heute ist fast alles im Internet nachlesbar. Erforderlich für das sichere Konstruieren ist aber das Lernen in der Praxis – nicht nur in der Theorie!
Viele Architekten-Kollegen malen anscheinend lieber bunte Bilder und diskutieren stundenlang über Farben, anstatt den bauausführenden Unternehmen konstruktive Detailzeichnungen zur Verfügung zu stellen. Sie verwechseln Bauwerke mit Bühnenbildern.
Es ist Aufgabe des Architekten, alle seine Erkenntnisse in Anforderungen umzusetzen und zu beschreiben, sei es mit Worten (im Leistungsverzeichnis) oder anhand von Zeichnungen (siehe Kapitel 2.6).
Gerade beim Sichtbeton muss berücksichtigt werden, dass bautechnische Anforderungen Vorrang vor gestalterischen und vegetationstechnischen Aspekten haben, u.a.:
„Bei bewitterten Ansichtsflächen muss eine kontrollierte Ableitung des Regenwassers geplant werden, um Schmutzfahnen auf der Betonoberfläche zu verhindern.“
(DBV/VDZ-Merkblatt „Sichtbeton“ [2.1.1], Abs. 5.1.3)
Ausführungsdetails sind u.a. dem „Sichtbeton-Atlas“ [3.3] zu entnehmen.
Bild 1.4: Sichtbeton-Fertigteile
2Normen mit Sichtbeton-Relevanz
Bis heute gibt es keine DIN-Norm, die ausdrücklich die Herstellung von Sichtbeton behandelt bzw. definiert! Auch die Betonnormen (z.B. DIN 1045, DIN 18217, DIN 18331 usw.) enthalten keine eindeutigen Sichtbeton-Aussagen.
Demzufolge ist der sichtbare Beton mit eigenen Worten zu planen, das Aussehen zu definieren und die Anforderungen eindeutig und erschöpfend zu beschreiben.
Auch wenn es DIN-Normen zum Thema Sichtbeton gäbe, sollte man immer bedenken, was auch der Bundesgerichtshof in einem Urteil vom 14.05.1998 (VII ZR 184/97) feststellte:
„Die DIN-Normen sind keine Rechtsnormen, sondern private technische Regelungen mit Empfehlungscharakter. Sie können die anerkannten Regeln der Technik wiedergeben oder hinter diesen zurückbleiben.“
1987 bemerkte das Bundesverwaltungsgericht im sogenannten: „Meersburg Urteil“, (Aktenzeichen 4 C-33-35/83):
„Zwar kann den DIN-Normen einerseits Sachverstand und Verantwortlichkeit für das allgemeine Wohl nicht abgesprochen werden. Andererseits darf aber nicht verkannt werden, dass es sich dabei zumindest auch um Vereinbarungen interessierter Kreise handelt, die eine bestimmte Einflussnahme auf das Marktgeschehen bezwecken. Den Anforderungen, die etwa an die Neutralität und Unvoreingenommenheit gerichtlicher Sachverständiger zu stellen sind, genügen sie deswegen nicht.”
Bild 2.1: Sichtbeton-Fassade
Baufehler als Ursache für Bauschäden werden nicht durch Normen, sondern durch Kenntnis naturbedingter Grundgesetzlichkeiten vermieden.
DIN-Normen können und wollen keine Kochbücher im Sinne von „man nehme…“ sein. Es nützt dem Planer oder Unternehmer im Streitfall nichts, wenn etwas in einer DIN-Norm steht oder aus Merkblättern übernommen wird oder das Produkt eine Zulassung besitzt, wenn trotzdem beim Einsatz ein Restrisiko verbleibt und daraus ein Schaden oder eine Abweichung entstehen kann.
Aus dem Werkvertrag heraus schuldet der Planer gemäß BGB den Erfolg, auch für Sichtbeton.
2.1Festlegungen in DIN EN 206-1/DIN 1045-2
Bauwerke gelten als dauerhaft, wenn sie während der vorgesehenen Nutzungsdauer ihre Funktion hinsichtlich Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit ohne wesentlichen Verlust der Nutzungseigenschaften bei einem angemessenen Instandhaltungsaufwand erfüllen, d.h. nach DIN EN 206-1 [1.10] über mindestens 50 Jahre!
Um das für Sichtbeton zu erreichen, sind eine Vielzahl von Maßnahmen in der Planung zu berücksichtigen, u.a. bezüglich:
– Rissbreitenbegrenzung,
– Betondeckung,
– Sicherung des Verbunds zwischen Bewehrung und Beton,
– Schutz der Bewehrung gegen Korrosion.
Sichtbetonbauteile sind so zu konstruieren, dass ein „normales“ Betonieren möglich ist (Querschnitt, Abmessung, Form usw.). Sind konstruktionsbedingt Beeinträchtigungen der Sichtbetonqualität zu erwarten, muss man ggf. umplanen oder die möglichen Konsequenzen mit dem Bauherrn vor der Ausführung abstimmen.
In DIN 1045-3:2008-08 [1.4.3] (zurückgezogen) ist folgender Hinweis zu finden:
DIN EN 13670:2011-03 [1.15] besagt:
8.8 Sichtflächen
(1) Anforderungen an das Erscheinungsbild von geschalten und ungeschalten Betonoberflächen sind, sofern festgelegt, in den bautechnischen Unterlagen anzugeben.
Bild 2.2: Sporthalle in Sichtbeton
DIN 1045-3:2012-03 ergänzt:
2.8.9 zu 8.8 Sichtflächen
Absatz (1) wird ergänzt durch:
(NA.1) Zur Beschreibung der Anforderungen an die Sichtflächen (Ansichtsflächen) sollte das DBV/VDZ-Merkblatt „Sichtbeton“ herangezogen werden.
2.1.1Expositionsklassen (Einwirkungen/Expositionen)
Um die Dauerhaftigkeit von Sichtbetonbauteilen zu gewährleisten, müssen sie u.a. gegenüber chemischen und physikalischen Einwirkungen aus der Umgebung widerstandsfähig sein. Die unterschiedlichen Einwirkungen aus der Umgebung werden in Expositionsklassen eingeteilt, für die folgende Abkürzungen verwendet werden:
– 0 für Zero Risk (kein Angriffsrisiko)
– C für Carbonation (Carbonatisierung)
– D für Deicing Salt (wechselfähige Chloride, z.B. Streusalz)
– S für Seawater (Meerwasser)
– F für Frost (Frost und Tausalz)
– A für Chemical Attack (chemischer Angriff)
– M für Mechanical Abrasion (Mechanischer Angriff – Abrieb, Verschleiß o.Ä.)
Tabelle 2.1: Auszug aus Tab. 1 der DIN 1045-2:2008-08 [1.4.2]
a) Bei Verwendung von Luftporenbeton, z.B. auf Grund gleichzeitiger Anforderungen aus der Expositionsklasse XF, eine Festigkeitsklasse niedriger. Diese Mindestbetonfestigkeitsklassen gelten für Luftporenbeton mit Mindestanforderungen an den mittleren Luftgehalt im Frischbeton nach DIN 1045-2 unmittelbar vor dem Einbau.
b) Bei langsam und sehr langsam erhärtenden Betonen (r < 0,30 nach DIN EN 206-1) eine Festigkeitsklasse im Alter von 28 Tagen niedriger. Die Druckfestigkeit zur Einteilung in die geforderte Betonfestigkeitsklasse ist auch in diesem Fall an Probekörpern im Alter von 28 Tagen zu bestimmen.
c) Erdfeuchter Beton mit w/z ≤ 0,40 auch ohne Luftporen.
2.1.2Betondeckung
Die Betondeckung ist in DIN EN 1992-1-1 [1.14] definiert als Abstand zwischen der Oberfläche eines Bewehrungsstabs, den Spanngliedern bei Vorspannung mit sofortigem Verbund oder der Hüllrohre von Spanngliedern bei Vorspannung mit nachträglichem Verbund und der nächstgelegenen Betonoberfläche. Eine ausreichende Betondeckung ist erforderlich, um die Bewehrung vor Korrosion (passiver Korrosionsschutz) und Brandeinwirkung zu schützen und um die Einleitung von Zugkräften aus dem Beton in den Bewehrungsstahl sicher zu stellen (Verbund). Die Mindestmaße für die Betondeckung richten sich dementsprechend nach den Expositionsklassen, nach dem Stabdurchmesser der Bewehrung sowie nach der geforderten Feuerwiderstandsdauer.
Die Mindestbetondeckung cmin ist am erhärteten Bauteil einzuhalten und setzt sich aus folgenden Einzelanforderungen zusammen:
– Ausreichender Verbund zwischen Bewehrung und Beton
→ Forderung cmin ≥ cmin,b cmin,b entspricht bei:
• Bewehrungsstabstahl dem Stabdurchmesser,
• Stabbündeln dem Vergleichsdurchmesser.
– Dauerhaftigkeit durch ausreichenden Korrosionsschutz der Bewehrung
→ Forderung cmin ≥ cmin,dur + Δcdur,y - Δcdur,st - Δcdur,add
Δcdur,y siehe Tabellen
Positiv wirkende Maßnahmen reduzieren cmin
(Nichtrostende Stähle: Δcdur,st / Zusätzliche Schutzmaßnahmen: Δcdur,add).
Der jeweils höhere Wert aus den Einzelanforderungen ist maßgebend. cmin muss immer mindestens 10 mm betragen. Das Nennmaß der Betondeckung cnom ergibt sich aus der Mindestbetondeckung cmin erhöht um das Vorhaltemaß Δcdev zu:
Auf den Bewehrungszeichnungen sollte das Verlegemaß der Bewehrung cv, das sich aus dem Nennmaß der Betondeckung cnom ableitet, sowie das Vorhaltemaß Δcdev der Betondeckung angegeben werden.
Tabelle 2.2: Mindestbetondeckung cmin,dur Anforderungen an die Dauerhaftigkeit von Betonstahl
Tabelle 2.3: Additives Sicherheitselement Δcdur,y für Betonstahl
Tabelle 2.4: Additives Sicherheitselement Δcdur,y für Spannglieder
Das Erreichen der erforderlichen Betondeckung ist u.a. möglich durch den Einsatz von Abstandhalter, Abhängungen etc. (siehe Kapitel 2.1.3).
Bild 2.3: Betondeckung
Bild 2.4: Beton- oder Stahlbau?
Bild 2.5: Abstandhalter für Betondeckung
2.1.3 Abstandhalter und Abhängung
Abstandhalter können sich an der Sichtbetonoberfläche abzeichnen. Daher ist eine systematische Verlegung/Planung erforderlich (siehe Kapitel 3.1.3).
Tabelle 2.5: Abstandhalter
Abstandhalter
Beispiel
Radform
punktförmig, nicht befestigt
punktförmig, befestigt
linienförmig, nicht befestigt 1)
linienförmig, befestigt 1)
flächenförmig, nicht befestigt
flächenförmig, befestigt
1) mit Längenbegrenzung (350 mm bzw. ≤ 2 h oder ≤ 0,25 b mit h – Bauteildicke und b – Bauteilbreite)
Eine Bemusterung der Abstandhalter sowie entsprechende Hinweise im Leistungsverzeichnis sind daher erforderlich und schriftlich zu vereinbaren.
2.1.3.1Abhängung der Bewehrung
Bei besonders hohen Sichtbetonanforderungen an Decken ist – zur Vermeidung eines „Abzeichnens der Abstandhalter“ – auch eine Abhängung der Bewehrung als „Besondere Leistung“ (Kosten) möglich.
Bild 2.6: Abstandhalter
Bild 2.7: Abstandhalter
Bild 2.8: Abstandhalter
Bild 2.9: Sichtbetonklasse SB 4, sichtbare Abstandhalter
Die DIN 1045-3:2013-07 „Bauausführung“ [1.4.3], Anwendungsregeln zu DIN EN 13670 [1.15] weist im Kapitel 2.6.1 auf Folgendes hin:
„Zur Sicherstellung der Mindestbetondeckung cmin am fertigen Bauteil (siehe z.B. DBV-Merkblatt „Betondeckung und Bewehrung“) nach DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA, sind die in den Bewehrungszeichnungen vorgegebenen Verlegemaße der Betondeckung cv, welche sich aus den Nennmaßen der Betondeckung cnomableiten, der Ausführung zu Grunde zu legen.
Das vorgeschriebene Nennmaß der Betondeckung ist durch geeignete Abstandhalter (siehe z.B. DBV-Merkblatt „Abstandhalter“) und geeignete Unterstützungen zur Lagesicherung der oberen Bewehrung (siehe z.B. DBV-Merkblatt „Unterstützungen“) sicherzustellen, die an der Betonoberfläche nicht korrodieren dürfen.“
Bild 2.10: Abhängung der Bewehrung
Bild 2.11: Abhängung der Bewehrung
2.1.4Schwindverhalten im Sichtbeton
In der DIN EN 13670:2011-03 [1.15] wird unter Abschnitt 8.5 u.a. darauf hingewiesen, dass junger Beton nachbehandelt und geschützt werden muss, um das Frühschwinden gering zu halten.
Alle Bauteile aus Baustoffen, die mit Wasser „angemacht“ werden, weisen ein mehr oder weniger großes Schwindverhalten auf. Aber auch die Form bzw. die Abmessungen haben Auswirkungen auf das Schwindverhalten am Sichtbeton. Das Bauteil versucht, sich zum Mittelpunkt zu ziehen, d.h. bei einem „Kreis“ gibt es die gleichmäßigsten Aufwölbungen aufgrund des gleichmäßigen Radius, siehe Bild 2.15, Pkt. 1
Danach folgt ein Acht- bzw. ein Sechseck (Bild 2.15, Pkt. 2).
Wer verbaut jedoch runde oder sechs- bzw. achteckige Bauteile?
Ungünstiger wirkt sich ein Quadrat und noch ungünstiger ein Rechteck auf das Schwindverhalten aus. Bei einem Rechteck ist die Diagonale weitaus länger als der kurze Radius (Bild 2.15, Pkt. 3).
Beispiel Beton-Fertigteile:
Aufwölbungen, verursacht aufgrund des Schwindverhaltens, treten im Eckbereich auf (Bild 2.13). An der Fassade aus Betonfertigteilen 8,0 m x 1,20 m gab es Verwölbungen bis zu 3 cm (Bild 2.14).
Im FDB-Merkblatt Nr. 1 „Sichtbetonflächen von Fertigteilen aus Beton und Stahlbeton – Ausgabe 06/2015“ (siehe Kapitel 3.2.1) wird darauf hingewiesen, dass „geringe Verwölbungen“ zu tolerieren sind.
Wie viel – dies ist vom Sachverständigen zu bewerten.
Bild 2.12: Extrem ungünstig ist das Schwindverhalten von Seitenverhältnissen > 2:1
Bild 2.13: Sichtbeton-Fertigteile mit Verwölbungen
Bild 2.14: Sichtbeton-Fertigteile mit Verwölbungen
Pkt.
Beschreibung
Text
1
Quadrat
Bei quadratischen Platten weist die Krümmung stets in eine Richtung, parallel zu einer Seitenkante.
2
Kreis, Achteck
3
Rechteck
Bei Rechteckflächen weist die Krümmung stets in Richtung der längeren Seitenkante. Es sei denn, durch konstruktive Maßnahmen ist eine Verkrümmung in diese Richtung verhindert.
Bild 2.15: Schwindverhalten
2.2Schalungsanker für Betonschalungen
Ein Schalungsanker hat die Aufgabe zwei Schalelemente zu halten.
Zwischen den zwei Schalungselementen wird ein Leerrohr angeordnet, das sowohl ein Abstandhalter der beiden Schalelemente ist und durch das ein Gewindestab (Zugstab) geführt wird, der die Schalelemente hält, sobald der Druck beim Einbringen des Betons entsteht. Geregelt sind diese Bauteile in DIN 18216 „Schalungsanker für Betonschalungen – Anforderungen, Prüfung und Verwendung“ [1.11].
Beim Ausschalen verbleibt ein „Ankerloch“, das unterschiedlich verschlossen werden kann. Das „Ankerloch“ ist die verbleibende Öffnung in der Sichtbetonoberfläche an der Ankerstelle.
Bild 2.16: Prinzipskizze eines Schalungsankers
Bild 2.17: Schalungsanker
Bild 2.18: Anschlusskonus
Bild 2.19: Ankerstelle einer Rahmenschalung
Bild 2.20: Kone MARO
Bild 2.21: Kone MARO
Bild 2.22: Ankerloch
Bild 2.23: geschlossenes Ankerloch
2.3Betonflächen und Schalungshaut gemäß DIN 18217
DIN 18217 „Betonflächen und Schalungshaut“ [1.2] beschreibt treffend die Zusammenhänge:
„Betonflächen sind das Spiegelbild der Schalungshaut oder das Ergebnis nachträglicher Bearbeitung und/oder Behandlung.“
und
„Betonflächen mit Anforderungen an das Aussehen sind sichtbar bleibende Betonflächen, für die eine eindeutige und praktisch ausführende Beschreibung vorliegen muss.“
Bild 2.24: Höchste Sichtbeton-Anforderungen (Bundeskanzleramt, Berlin)
Der Kommentar zur DIN 18217 ist im Buch „Sichtbeton-Planung“ [3.1] enthalten. Er enthält Empfehlungen zur Leistungsbeschreibung und gibt eine Hilfestellung sowohl in planungstechnischer, arbeitsvorbereitender wie auch ausführungsbezogener Hinsicht.
Empfehlung:
Eine eindeutige und praktische Beschreibung muss vorliegen. Der alleinige Hinweis auf das DBV/VDZ-Merkblatt „Sichtbeton“ ersetzt dies nicht!
2.4Betonarbeiten gemäß DIN 18331
In der DIN 18331:2015-08 VOB/C „Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (ATV) – Betonarbeiten“ [1.3] wird darauf hingewiesen, dass in der Leistungsbeschreibung nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben sind:
0.2
Angaben zur Ausführung
0.2.4
Bei sichtbar bleibenden Betonflächen u.a.
– Klassifizierung der Ansichtsflächen,
– Oberflächentextur, erforderlichenfalls Beschreibung des Schalungs- und Schalhautsystems, Oberflächenausbildung nicht geschalter Teilflächen,
– Farbtönung,
– Flächengliederung,
– Ausbildung von Fugen, Kanten, Ankern und Ankerlöchern sowie Schalungsstößen,
– Anzahl der Erprobungsflächen, Auswahl der Referenzfläche.
4.2
Besondere Leistungen sind ergänzend zur ATV DIN 18299, Abschnitt 4.2, z.B.:
4.2.4
Leistungen zur Erfüllung erhöhter Anforderungen an die Ebenheit und Maßhaltigkeit (siehe Abschnitt 3.1.2).
4.2.18
Leistungen zum Erzielen einer Betonoberfläche über die Anforderungen des Abschnitts 3.3 hinaus. Herstellung von Erprobungs- und Referenzflächen.
Im FDB-Merkblatt Nr. 1 „Sichtbetonflächen von Fertigteilen aus Beton und Stahlbeton – Ausgabe 06/2015“ wird ein Hinweis gegeben bezüglich der Anforderungen an die Einfüllseite von Betonfertigteilen (siehe Kapitel 3.2.1).
Empfehlung:
Anfoderungen an die Sichtbeton-Oberfläche sind genauestens zu planen und zu beschreiben!
Der alleinige Hinweis auf das DBV/VDZ-Merkblatt „Sichtbeton“ ersetzt dies nicht!
2.4.1Betonbauarbeiten, insbesondere für Sichtbeton
In der DIN EN 1992-1-1:2011-01 „Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau“ [1.14] wird u.a. hingewiesen auf:
8.2Stababstände von Betonstählen
(1)Der Stababstand muss mindestens so groß sein, dass der Beton ordnungsgemäß eingebracht und verdichtet werden kann, um ausreichenden Verbund sicherzustellen.
(2)Der lichte Abstand (horizontal und vertikal) zwischen parallelen Einzelstäben oder in Lagen paralleler Stäbe darf in der Regel nicht geringer als das Maximum von (k1 • Stabdurchmesser; dg + k2 mm; 20 mm) sein. Dabei ist dg der Durchmesser des Größtkorns der Gesteinskörnung.
Anmerkung:
Die landesspezifischen Werte k1 und k2 dürfen einem Nationalen Anhang entnommen werden. Die empfohlenen Werte sind 1 bzw. 5.
Bild 2.25: Betonarbeiten
Bild 2.26: Rüttelgassen?
In der DIN EN 13670:2011-03 „Ausführung von Tragwerken aus Beton“ [1.15] wird u.a. hingewiesen auf:
8.2Arbeiten vor dem Betonieren
(1)Sofern in den bautechnischen Unterlagen gefordert, ist ein Betonierplan aufzustellen.
(2)Sofern in den bautechnischen Unterlagen gefordert, sind Probebetonagen (Vorversuche) vor Ausführungsbeginn durchzuführen und die Ergebnisse sind aufzuzeichnen.
(3)Vorbereitende Arbeiten müssen vor Beginn des Betoneinbaus abgeschlossen, überwacht und dokumentiert sein, wie für die jeweilige Überwachungsklasse gefordert.
(4)Arbeitsfugen