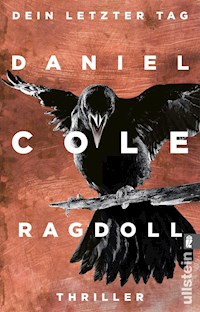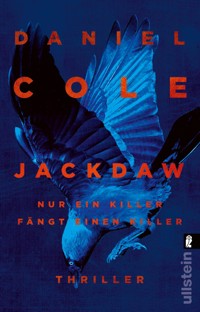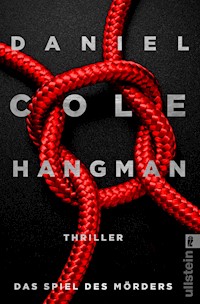
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
ER WILL RACHE. ER WILL CHAOS. ER HAT NICHTS ZU VERLIEREN. Vom Autor des Spiegel-Bestsellers Ragdoll. Dein letzter Tag. An den Stahlseilen der New Yorker Brooklyn Bridge hängt ein Toter. Das Wort »Köder« ist mit tiefen Schnitten in seine Brust geritzt. Das lässt nur einen Schluss zu: Ein Killer kopiert die berühmten Londoner Ragdoll-Morde. Chief Inspector Emily Baxter wird sofort von den US-Ermittlern angefordert. Als beinahe täglich weitere Tote auftauchen – darunter auch Polizisten – geraten der Fall und die Medien außer Kontrolle. Baxter und ihre Kollegen von FBI und CIA werden zum Spielball des grausamen Mörders – wer kann seinen Irrsinn stoppen? Und wer hält im Hintergrund die Fäden in der Hand?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 518
Veröffentlichungsjahr: 2018
Sammlungen
Ähnliche
Das Buch
Ein Killer versetzt London in Angst. Dein Name steht auf seiner Liste. Dein letzter Tag ist nah. und Fliehen zwecklos.
Der Autor
Daniel Cole wurde 1983 geboren. Seine Romane erscheinen in 34 Ländern. Bevor er mit dem Schreiben begann, hat er als Sanitäter, Tierschützer und Seenotretter gearbeitet. Cole lebt im sonnigen Bournemouth in Südengland.
DANIEL COLE
HANGMAN
DAS SPIEL DES MÖRDERS
THRILLER
Aus dem Englischen von Conny Lösch
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-1698-7
Deutsche Erstausgabe im Ullstein Taschenbuch
1. Auflage Januar 2018
2. Auflage 2018
© für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2018
© 2018 by Daniel Cole
Titel der englischen Originalausgabe: Hangman(Trapeze/Orion, London)
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
Titelabbildung: Getty Images/© Jorg Greuel
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
»Und wenn es doch einen Gott gibt?
Und wenn es doch einen Himmel gibt?
Und eine Hölle?
Und was, wenn … was, wenn … wir alle längst dort sind?«
PROLOG
Mittwoch, 6. Januar 20169.52 Uhr
»Es gibt keinen Gott. Punkt.«
Detective Chief Inspector Emily Baxter betrachtete sich in dem verspiegelten Fenster des Vernehmungsraums, lauschte möglichen Reaktionen ihres Publikums nebenan auf diese unpopuläre Wahrheit.
Nichts.
Sie sah furchtbar aus: eher wie fünfzig als fünfunddreißig. Dicke schwarze Fäden hielten ihre Oberlippe zusammen, spannten beim Sprechen und erinnerten sie an Dinge, die sie lieber vergessen hätte, alte und neue. Die Schürfwunde auf ihrer Stirn wollte nicht heilen, ihre gebrochenen Finger waren geschient, und unter ihrer leicht feuchten Kleidung verbargen sich noch mindestens ein Dutzend weitere Verletzungen.
Demonstrativ gelangweilt drehte sie sich zu den beiden Männern um, die ihr am Tisch gegenübersaßen. Keiner von beiden sagte etwas. Sie gähnte und fuhr sich mit den unversehrten Fingern durch ihr langes braunes, leicht verfilztes Haar, dem die drei Tage Trockenshampoo anzusehen waren. Dass Special Agent Sinclair ihre letzte Antwort ganz offensichtlich nicht gefiel, war ihr egal. Der beeindruckend glatzköpfige Amerikaner notierte etwas auf einem Blatt mit aufwendigem Briefkopf.
Atkins, der Kontaktbeamte von der Metropolitan Police, wirkte neben dem elegant gekleideten Ausländer eher unscheinbar. Baxter hatte die vorangegangenen fünfzig Minuten größtenteils damit verbracht, zu überlegen, welche Farbe sein beiges Hemd ursprünglich einmal gehabt haben mochte. Seine Krawatte saß locker, als hätte ein menschenfreundlicher Henker sie ihm gebunden – leider bedeckte sie nicht den relativ frischen Ketchupfleck.
Atkins verstand das Schweigen als Stichwort und schaltete sich ein:
»Das muss Thema einiger recht interessanter Gespräche mit Special Agent Rouche gewesen sein«, bemerkte er.
Atkins lief Schweiß seitlich am rasierten Schädel herunter. Grund waren die Lampen und die heiße Heizungsluft, die bereits vier Paar verschneite Stiefelabdrücke auf dem Linoleumboden in dreckige Pfützen verwandelt hatte.
»Soll heißen?«, fragte Baxter.
»Das soll heißen, dass laut seiner Akte …«
»Scheiß auf seine Akte!«, unterbrach Sinclair Atkins. »Ich habe mit Rouche zusammengearbeitet und weiß ganz sicher, dass er ein gläubiger Christ ist.«
Der Amerikaner blätterte in einem mit Einlegeblättern fein säuberlich unterteilten Ordner zu seiner Linken und entnahm ihm ein Dokument mit Baxters Handschrift. »Genau wie Sie, jedenfalls geht das aus den Unterlagen hervor, mit denen Sie sich auf Ihre aktuelle Stelle beworben haben.«
Er hielt Baxters Blick stand, kostete es aus, die streitsüchtige Frau eines Widerspruchs überführt zu haben. Jetzt da er bewiesen hatte, dass sie in Wirklichkeit denselben Glauben hatte wie er und ihn lediglich hatte provozieren wollen, war seine Welt wieder im Lot. Baxter jedoch guckte so gelangweilt wie zuvor.
»Ich bin der Überzeugung, dass Menschen im Allgemeinen Idioten sind«, fing sie an, »und viele davon hängen der irrigen Vorstellung an, es gäbe einen Zusammenhang zwischen hirnloser Gutgläubigkeit und einem gefestigten Moralverständnis. Mir ging es eigentlich nur um die Gehaltserhöhung.«
Sinclair schüttelte angewidert den Kopf, als wollte er seinen Ohren nicht trauen.
»Dann haben Sie gelogen? Das spricht allerdings auch nicht gerade für ein gefestigtes Moralverständnis.« Er lächelte dünn, machte sich weiter Notizen.
Baxter zuckte mit den Schultern:
»Sagt aber einiges über hirnlose Gutgläubigkeit.«
Sinclairs Lächeln verschwand.
»Wollen Sie mich bekehren oder was?«, fragte sie, konnte der Versuchung nicht widerstehen, die Geduld ihres Gegenübers weiter zu strapazieren. Plötzlich sprang Sinclair auf und beugte sich über den Tisch.
»Ein Mann ist tot, Chief Inspector!«, brüllte er.
Baxter zuckte nicht mit der Wimper.
»Viele sind tot … nach allem, was passiert ist«, murmelte sie, aber dann wurde auch sie wütend, »und aus unerfindlichen Gründen verschwenden Sie und Ihre Leute Ihre Zeit mit der einzigen Person, die den Tod verdient hat!«
»Wir fragen«, schaltete Atkins sich ein, versuchte die Situation zu entschärfen, »weil neben der Leiche entsprechende Hinweise gefunden wurden … religiöser Art.«
»Die können von jedem x-Beliebigen stammen«, sagte Baxter.
Die beiden Männer warfen sich einen Blick zu, dem sie entnahm, dass es noch mehr gab, das sie ihr nicht mitteilen wollten.
»Haben Sie Informationen darüber, wo Special Agent Rouche sich aktuell aufhält?«, fragte Sinclair sie.
Baxter schnaubte: »Soviel ich weiß, ist Agent Rouche tot.«
»Wollen Sie wirklich dabei bleiben?«
»Soviel ich weiß, ist Agent Rouche tot«, wiederholte Baxter.
»Sie haben also seine Lei…«
Die vierte Person an dem kleinen Tisch, die Psychologin Dr. Preston-Hall, bei der Metropolitan Police in beratender Funktion tätig, räusperte sich laut, und Sinclair verstummte, verstand die unausgesprochene Warnung. Er lehnte sich zurück und machte eine Geste in Richtung des verspiegelten Fensters. Atkins kritzelte etwas in sein Notizbuch und schob es Dr. Preston-Hall zu.
Sie war eine gepflegte Frau Anfang sechzig, deren teures Parfüm lediglich eine zarte Blütenduftnote setzte, ohne den überwältigenden Gestank der durchnässten Schuhe zu übertünchen. Sie hatte mit ihrer unangestrengten Autorität bereits deutlich gemacht, dass sie die Vernehmung sofort beenden würde, sollte sie den Eindruck haben, die Befragung sei der Genesung ihrer Patientin abträglich. Langsam nahm sie das mit Kaffee bekleckerte Notizbuch und las die Mitteilung mit der Miene einer Lehrerin, die eine Geheimbotschaft ihrer Schüler abgefangen hat.
Fast die gesamte Stunde über hatte sie geschwiegen und offensichtlich auch jetzt nicht das Bedürfnis, etwas zu sagen, denn sie schüttelte nur den Kopf.
»Was steht da?«, fragte Baxter.
Die Therapeutin ignorierte sie.
»Was steht da?«, fragte Baxter erneut und wandte sich an Sinclair: »Stellen Sie Ihre Frage.«
Sinclair wirkte verunsichert.
»Stellen Sie Ihre Frage«, verlangte Baxter.
»Emily!«, fuhr die Therapeutin sie an. »Kein Wort, Mr. Sinclair.«
»Fragen Sie einfach«, ermunterte Baxter ihn mit raumgreifender Stimme. »Die Station? Sie wollen mich nach der Station fragen.«
»Die Vernehmung ist beendet!«, verkündete Dr. Preston-Hall und erhob sich.
»Fragen Sie!«, fiel Baxter ihr laut ins Wort.
Sinclair beschloss, die Gelegenheit zu ergreifen und sich über die Konsequenzen hinterher Gedanken zu machen:
»Sie haben ausgesagt, dass Sie Special Agent Rouche für tot halten.«
Dr. Preston-Hall riss empört die Hände hoch.
»Das war keine Frage«, sagte Baxter.
»Haben Sie ihn tot gesehen?«
Zum ersten Mal merkte Sinclair, dass Baxter stockte, doch anstatt sich darüber zu freuen, hatte er ein schlechtes Gewissen. Bei der Erinnerung an die U-Bahn-Station wurde ihr Blick glasig.
Als sie flüsternd antwortete, brach ihr die Stimme:
»Ich hätte ihn doch gar nicht erkannt, oder?«
Erneut herrschte angespannte Stille, als den Anwesenden bewusst wurde, wie irritierend dieser schlichte Satz war.
Schließlich platzte Atkins mit einer halbdurchdachten Frage heraus: »Wie kam er Ihnen vor?«
»Wer?«
»Rouche.«
»Inwiefern?«
»In emotionaler Hinsicht.«
»Wann?«
»Als Sie ihn zum letzten Mal gesehen haben.«
Sie dachte kurz über ihre Antwort nach, dann lächelte sie aufrichtig:
»Erleichtert.«
»Erleichtert?«
Baxter nickte.
»Es scheint, als hätten Sie ihn sehr gerngehabt«, fuhr Atkins fort.
»Nicht besonders. Er war intelligent, ein sehr fähiger Kollege … trotz seiner offensichtlichen Macken«, setzte sie hinzu.
Sie beobachtete Sinclairs Reaktion aus ihren großen braunen Augen, die durch das starke Make-up noch betont wurden. Er biss sich auf die Lippen und schaute erneut in den Spiegel, als wollte er denjenigen hinter der Scheibe, der ihm diese Aufgabe zugeschoben hatte, zum Teufel wünschen.
Atkins übernahm jetzt die Vernehmung. Unter seinen Achseln hatten sich dunkle Schweißflecken gebildet. Ohne dass er es gemerkt hatte, waren beide Frauen jeweils einige Zentimeter unauffällig mit ihren Stühlen zurückgerutscht, um dem Geruch halbwegs zu entgehen.
»Sie haben das Haus von Agent Rouche durchsuchen lassen«, sagte er.
»Das ist richtig.«
»Also haben Sie ihm nicht vertraut.«
»Nein.«
»Und auch jetzt fühlen Sie sich ihm gegenüber in keiner Weise zu Loyalität verpflichtet?«
»In keiner Weise.«
»Erinnern Sie sich an das Letzte, das er zu Ihnen gesagt hat?«
Baxter wirkte unruhig: »Sind wir nicht fertig?«
»Fast. Beantworten Sie bitte die Frage.«
Er blieb sitzen, der Stift schwebte über dem Notizbuch.
»Ich möchte jetzt gehen«, sagte Baxter zu ihrer Therapeutin.
»Natürlich«, erwiderte Dr. Preston-Hall scharf.
»Gibt es einen Grund, weshalb Sie diese einfache Frage nicht beantworten können?« Sinclairs Worte durchschnitten den Raum, sie hatten etwas Anklagendes.
»Na schön«, Baxter wirkte wütend. »Ich antworte.« Sie dachte kurz nach, beugte sich dann über den Tisch und fixierte den Amerikaner mit ihrem Blick.
»Es … gibt … keinen … Gott«, sagte sie boshaft grinsend.
Sinclair erhob sich abrupt und ließ dabei seinen Metallstuhl geräuschvoll zu Boden krachen, dann stürmte er aus dem Raum. Atkins schleuderte seinen Stift über den Tisch.
»Toll«, seufzte er müde. »Danke auch für Ihren Einsatz, Detective Chief Inspector. Jetzt sind wir fertig.«
Fünf Wochen zuvor …
KAPITEL 1
Mittwoch, 2. Dezember 20156.56 Uhr
Der zugefrorene Fluss knirschte, als würde er sich unter der funkelnden Metropole im Schlaf umdrehen. Im Eis gefangene und vergessene Schiffe, versanken nach und nach im Schnee. Das Festland war vorübergehend mit der Inselstadt vereint.
Als die Sonne über den überladenen Horizont kroch und die Brücke in orangefarbenes Licht tauchte, fiel ein dunkler Schatten auf das Eis weiter unten: Zwischen einem der imposanten Torbögen hatte sich über Nacht etwas in dem Geflecht aus mit Schnee gepuderten Stahlseilen verfangen.
Verheddert und verdreht, wie eine Fliege nach dem verzweifelten Versuch, sich selbst aus dem Spinnennetz zu befreien, hing der tote Körper von William Fawkes im Gegenlicht der Sonne …
KAPITEL 2
Dienstag, 8. Dezember 201518.39 Uhr
Die Nacht drückte an die Fenster von New Scotland Yard, die Lichter der Stadt verschwammen hinter den beschlagenen Scheiben.
Seit ihrer Ankunft am Morgen hatte Baxter, abgesehen von zwei kurzen Pinkelpausen und einem Gang zur Materialkammer, ihr schrankgroßes Büro in der Abteilung für Mord und Schwerstkriminalität nicht verlassen. Sie starrte den Papierstapel an, der sich bedenklich hoch am Rand ihres Schreibtischs neben dem Papierkorb auftürmte, und musste dabei ihren Impuls unterdrücken, ihm einen kleinen Stups in die richtige Richtung zu geben.
Mit vierunddreißig war sie eine der jüngsten weiblichen Chief Inspectors bei der Metropolitan Police überhaupt, allerdings hatte sie mit dieser rasanten Karriere weder gerechnet noch sich besonders darüber gefreut. Dass eine leitende Position frei geworden und sie auf diese Stelle befördert worden war, lag einzig und allein an dem Ragdoll-Fall und der Festnahme des berüchtigten Serienkillers.
Ihr Vorgänger, Chief Inspector Terrence Simmons, war aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig in den Ruhestand getreten, wobei allgemein vermutet wurde, dass der Commissioner ihm die Entscheidung mit der Drohung erleichtert hatte, ihn zu feuern, sollte er sich nicht freiwillig aus dem aktiven Dienst verabschieden – eine durchaus übliche Verfahrensweise, um die Öffentlichkeit zu besänftigen: Man opferte Unschuldige.
Baxter schloss sich der Einschätzung ihrer Kollegen an. Sie war entsetzt darüber, ihren Vorgänger als Sündenbock missbraucht zu sehen, letztlich jedoch erleichtert, dass nicht sie selbst hatte dran glauben müssen. Von alleine wäre sie nicht auf die Idee gekommen, sich auf die frei gewordene Stelle zu bewerben, aber der Commissioner hatte ihr gesagt, sie könne den Job haben, wenn sie ihn haben wolle.
Jetzt schaute sie sich in ihrer Spanplattenzelle um, betrachtete den schmutzigen Teppichboden und den verbeulten Aktenschrank (Gott weiß welch wichtige Dokumente für immer in der untersten Schublade, die sich nicht mehr öffnen ließ, begraben lagen), und fragte sich, was zum Teufel sie sich eigentlich dabei gedacht hatte.
Im Hauptbüro wurde gejubelt. Baxter bemerkte es gar nicht, denn inzwischen widmete sie sich einem Beschwerdebrief. Einem gewissen Detective Saunders wurde vorgeworfen, er habe den Sohn des Beschwerdeführenden mit obszönen Begriffen bedacht. Sollte Baxter Zweifel gehabt haben, so höchstens hinsichtlich der Harmlosigkeit des angeblich verwendeten Schimpfworts. Sie begann, eine offizielle Antwort zu formulieren, verlor aber bald die Lust, zerknüllte das Schreiben und warf es Richtung Papierkorb.
Verhalten klopfte es an der Tür, dann kam eine unscheinbare Beamtin hereingehuscht. Sie sammelte Baxters rings um den Papierkorb verstreute Fehlwürfe ein, entsorgte sie und demonstrierte anschließend ihr rekordverdächtiges Jenga-Talent, indem sie ein weiteres Schreiben oben auf den wackeligen Papierturm legte.
»Tut mir leid, wenn ich störe«, sagte sie, »aber Detective Shaw hält gleich seine Rede. Ich dachte, Sie wollen vielleicht dabei sein.«
Baxter fluchte laut und legte ihren Kopf auf den Schreibtisch.
»Geschenk!«, fiel es ihr mit einem Stöhnen wieder ein.
Die nervöse junge Frau wartete betreten auf weitere Anweisungen. Kurz darauf verließ sie, unsicher, ob Baxter überhaupt noch wach war, leise den Raum.
Baxter erhob sich widerwillig und ging in das Hauptbüro, wo sich eine Gruppe um Detective Sergeant Finlay Shaws Schreibtisch versammelt hatte. Ein zwanzig Jahre altes Plakat, das Finlay irgendwann einmal selbst für einen längst vergessenen Kollegen gekauft hatte, war an der Wand befestigt worden:
»Schade, dass du gehst!«
Neben ihm stapelten sich unappetitliche Donuts aus dem Supermarkt. Die »Reduziert«-Aufkleber auf der Verpackung wiesen darauf hin, dass der Inhalt in weniger als drei Tagen ungenießbar sein würde.
Höfliches Gelächter begleitete die heiser, mit schottischem Akzent vorgetragene Drohung des Detective, Saunders vor seinem Eintritt in den Ruhestand doch noch mal richtig eine reinzuhauen. Jetzt lachten alle, obwohl beim letzten Mal eine Nasen-OP und zwei Disziplinarverfahren die Folge gewesen waren und Baxter stundenlang Formulare hatte ausfüllen müssen.
Sie hasste das: so peinlich, so aufgesetzt, ein so lahmer Abschied nach Jahrzehnten im Dienst, nach so vielen brenzligen Situationen und schrecklichen Erinnerungen, die sich nicht auslöschen ließen. Baxter stand etwas abseits und lächelte ihrem Freund aufmunternd zu. Er war der letzte wahre Verbündete, den sie hier noch hatte, das einzig verbliebene freundliche Gesicht. Jetzt hörte er auf, und sie hatte ihm nicht mal eine Karte gekauft.
In ihrem Büro klingelte das Telefon.
Sie beachtete es nicht, sah zu, wie Finlay kläglich scheiterte, so zu tun, als sei die Flasche Whisky, für die zusammengelegt worden war, seine Lieblingsmarke.
Am liebsten trank er Jameson – genau wie Wolf.
Baxter verlor sich in Gedanken, erinnerte sich daran, wie sie Finlay auf einen Drink eingeladen hatte, als sie sich das letzte Mal nach Feierabend getroffen hatten. Fast ein ganzes Jahr war das her. Er hatte gesagt, er habe es nie bedauert, nicht ehrgeizig zu sein. Er hatte sie gewarnt, dass die Rolle als DCI nicht das Richtige für sie sei und der Job sie langweilen und frustrieren würde. Sie hatte nicht auf ihn gehört. Finlay hatte nicht begriffen, dass sie weniger auf eine Beförderung aus war als auf Ablenkung – Veränderung … ein Entkommen.
Erneut klingelte das Telefon in ihrem Büro, und sie schaute böse zu ihrem Schreibtisch. Finlay las die vielen Varianten von »Schade, dass du gehst« vor, die die Kollegen auf die Gemeinschaftskarte geschrieben hatten. Vorne drauf waren Minions abgebildet, da anscheinend jemand irrtümlich geglaubt hatte, Finlay möge sie.
Baxter sah auf die Uhr, sie wollte zur Abwechslung mal nicht zu spät Feierabend machen.
Finlay legte die Karte schmunzelnd beiseite und begann mit seiner rührenden Abschiedsrede. Er wollte sich so kurz wie möglich fassen, da er nie gerne öffentlich gesprochen hatte.
»Aber mal ganz im Ernst, danke. Ich war schon dabei, als das funkelnagelneue New Scotland Yard eröffnet wurde, die meisten von euch haben da noch in den Windeln gesteckt …«
Er machte eine Pause, hoffte, wenigstens einer würde lachen. Sein Vortrag war schrecklich und er hatte gerade seinen besten Scherz versemmelt. Aber er machte trotzdem weiter, wusste, dass es nur noch bergab gehen konnte.
»Der Laden hier und die Leute waren für mich immer mehr als ein Job, ihr seid so was wie meine zweite Familie.«
Eine Frau in der ersten Reihe fächelte sich Tränen aus den Augen. Finlay versuchte sie anzulächeln und ihr zu signalisieren, dass er ebenso empfand und zumindest eine vage Ahnung davon hatte, wer sie überhaupt war. Er blickte wieder auf, suchte die einzige Person, an die seine Abschiedsrede wirklich gerichtet war.
»Ich hatte das Vergnügen, einige von euch hier reinwachsen zu sehen«, er merkte, das auch seine Augen jetzt brannten, »hab beobachtet, wie aus aufmüpfigen Auszubildenden starke, unabhängige, schöne und tapfere junge Frauen … und Männer wurden«, ergänzte er hastig aus Angst, offenbahrt zu haben, wem seine Rede in Wirklichkeit galt. »Es war mir ein großes Vergnügen, mit euch arbeiten zu dürfen, und ich bin wirklich stolz auf euch … Danke.«
Er räusperte sich und lächelte seine applaudierenden Kollegen an, entdeckte endlich auch Baxter. Sie stand hinter der halbgeschlossenen Tür in ihrem Büro am Schreibtisch und telefonierte wild gestikulierend. Er lächelte erneut, dieses Mal traurig, als sich die Menge auflöste und er seine Sachen alleine packte, um die Räumlichkeiten für immer zu verlassen.
Erinnerungen holten ihn ein, während er die Fotos einpackte, die seit Jahren an seinem Arbeitsplatz gestanden hatten – vor allem ein zerknittertes und vergilbtes Bild nahm seine Gedanken gefangen:
Weihnachtsfeier im Büro. Finlay mit Papierkrone auf dem spärlichen Haar, sehr zur Belustigung seines Freundes Benjamin Chambers, der einen Arm um Baxter gelegt hatte. Wahrscheinlich handelte es sich um das einzige Foto überhaupt, auf dem sie tatsächlich lächelte. Und ebenfalls mit dabei, kläglich gescheitert bei dem Versuch, Finlay hochzuheben, Will … Wolf. Sorgfältig verstaute er das Bild in seiner Jackentasche und packte seine restlichen Sachen ein.
Auf dem Weg nach draußen zögerte Finlay. Er hatte es nicht richtig gefunden, den vergessenen Brief, den er ganz hinten in seiner Schreibtischschublade entdeckt hatte, mitzunehmen. Er überlegte, ob er ihn liegenlassen oder zerreißen sollte, schließlich legte er ihn doch in die Kiste zu den anderen Sachen und ging zu den Aufzügen.
Vermutlich war er ein weiteres Geheimnis, das er würde hüten müssen.
***
Um 19.49 Uhr saß Baxter immer noch an ihrem Schreibtisch. Sie hatte alle zwanzig Minuten eine SMS geschickt, sich für ihre Verspätung entschuldigt und versprochen, so schnell wie möglich Schluss zu machen. Commander Vanita war nicht nur schuld daran, dass sie Finlays Abschiedsrede verpasst hatte, jetzt sabotierte sie auch noch ihre erste echte Abendverabredung seit Monaten. Vanita hatte darauf bestanden, dass Baxter bis zu ihrem Eintreffen bliebe.
Die beiden Kolleginnen hatten nicht viel füreinander übrig. Vanita, das medientaugliche Aushängeschild der Metropolitan Police, hatte sich offen gegen Baxters Beförderung ausgesprochen. Sie hatten bei den Ragdoll-Morden zusammengearbeitet, und Vanita hatte dem Commissioner hinterher erklärt, Baxter sei streitsüchtig, rechthaberisch und habe ein Autoritätsproblem. Ganz zu schweigen davon, dass sie sie immer noch für den Tod eines der Opfer verantwortlich machte. Baxter hielt Vanita im Gegenzug für eine PR-versessene Schlange, die schon beim ersten Anzeichen von Schwierigkeiten nicht gezögert hatte, Simmons als Sündenbock hinzustellen.
Zu allem Überfluss erhielt Baxter jetzt auch noch eine automatische E-Mail aus dem Archiv, die sie zum x-ten Male daran erinnerte, dass Wolf noch immer mehrere Akten zurückzugeben habe. Sie überflog die lange Liste, dachte wieder an ein paar der Fälle.
Bennett, Sarah: die Frau, die ihren Ehemann im Swimmingpool ertränkt hatte. Baxter war ziemlich sicher, dass ihr die Akte im Besprechungsraum hinter den Heizkörper gerutscht war.
Duboid, Leo: Was zunächst nach einer schlichten Messerstecherei ausgesehen hatte, hatte sich allmählich als einer der kompliziertesten, mehrere Abteilungen betreffenden Fälle der vergangenen Jahre entpuppt – Drogenschmuggel, illegaler Waffen- und Menschenhandel.
Wolf und sie hatten viel Spaß damit gehabt.
Sie bemerkte Vanita, die mit zwei anderen Personen im Schlepptau das Hauptbüro betrat, was ihre Hoffnung, vor 20 Uhr gehen zu können, augenblicklich schmälerte. Sie machte sich nicht die Mühe aufzustehen, als Vanita bei ihr hereinspazierte und sie so routiniert freundlich begrüßte, dass sie es ihr beinahe abgekauft hätte.
»DCI Emily Baxter, Special Agent Elliot Curtis vom FBI«, stellte Vanita vor und warf ihr dunkles Haar in den Nacken.
»Ist mir eine Ehre, Ma’am«, sagte die große schwarze Frau und streckte Baxter eine Hand entgegen. Sie trug einen maskulinen Anzug, hatte die Haare so streng zurückgebunden, dass man dachte, sie hätte sich den Schädel rasiert, und war nur minimal geschminkt. Obwohl sie wie Anfang dreißig aussah, vermutete Baxter, dass sie jünger war.
Ohne sich von ihrem Stuhl zu erheben, gab sie Curtis die Hand, während Vanita ihr den anderen Gast vorstellte, der sich scheinbar sehr viel mehr für den verbeulten Aktenschrank interessierte als für die Person, deren Bekanntschaft er machen sollte.
»Und das ist Special Agent …«
»Wie special kann so ein Agent sein, frage ich mich«, fiel Baxter ihr ins Wort, »wenn jetzt schon zwei hier stehen?«
Vanita überging die Bemerkung:
»Wie gesagt … Special Agent Damien Rouche von der CIA.«
»Rooze?«, fragte Baxter.
»Rouch?«, versuchte Vanita es noch einmal, war jetzt aber selbst unsicher geworden.
»Ich denke, es heißt Rouche, wie ›whoosh‹«, fügte Curtis hinzu und wandte sich hilfesuchend an den Betreffenden.
Baxter machte ein verdutztes Gesicht, als der zerstreut wirkende Mann sie höflich lächelnd mit einem Fistbump begrüßte und sich anschließend wortlos auf einen Stuhl pflanzte. Sie schätzte ihn auf Ende dreißig. Er war glattrasiert, seine Haut teigig und die Tolle im graumelierten Haar fast schon herausgewachsen. Grinsend warf er einen Blick auf den schiefen Papierturm zwischen ihnen und dann auf den erwartungsfroh darunter harrenden Papierkorb. Die beiden obersten Knöpfe seines weißen Hemdes waren offen, dazu trug er einen abgenutzten, aber gut sitzenden marineblauen Anzug.
Baxter wandte sich an Vanita und wartete.
»Curtis und Rouche sind heute Abend aus den Staaten eingetroffen«, sagte Vanita.
»Alles klar«, erwiderte Baxter geduldiger als beabsichtigt. »Ich hab’s heute Abend allerdings ein bisschen eilig, also …«
»Darf ich, Commander?«, fragte Curtis Vanita höflich, dann wandte sie sich an Baxter. »Chief Inspector, Sie haben natürlich von dem Toten gehört, der vor knapp einer Woche gefunden wurde. Also …«
Baxter zuckte ahnungslos mit den Schultern, noch bevor Curtis richtig losgelegt hatte.
»New York … Brooklyn Bridge?«, fragte Curtis erstaunt. »Hing an den Metallstreben? Der Fall war weltweit in den Nachrichten.«
Baxter musste ein Gähnen unterdrücken.
Rouche kramte in seiner Jackentasche. Curtis erwartete, dass er etwas hervorzog, das ihnen weiterhalf, stattdessen riss er eine Familienpackung Jelly Babies auf. Als er ihren wütenden Gesichtsausdruck sah, bot er ihr welche an.
Curtis beachtete ihn nicht weiter, öffnete ihre Tasche und zog eine Akte hervor. Sie entnahm einige vergrößerte Fotos, die sie vor Baxter auf den Schreibtisch legte.
Plötzlich dämmerte ihr, weshalb die beiden sich auf den weiten Weg gemacht hatten, um mit ihr zu sprechen. Das erste Foto war unten von der Straße aus aufgenommen worden. Vor den Lichtern der Stadt zeichnete sich die Silhouette eines Körpers ab, der dreißig Meter weit oben an den Stahlseilen hing. Die Gliedmaßen waren zu einer unnatürlichen Pose verzerrt.
»Wir haben es noch nicht öffentlich gemacht, aber der Name des Opfers ist … William Fawkes.«
Einen Augenblick lang verschlug es Baxter den Atem. Sie hatte sich sowieso schon ganz elend gefühlt, weil sie nichts gegessen hatte, aber jetzt fürchtete sie, ohnmächtig zu werden. Ihre Hand zitterte, als sie die Umrisse der verzerrten Gestalt berührte. Sie spürte die Blicke der anderen, die sie beobachteten und möglicherweise erneut Zweifel hegten an Baxters ungenauer Darstellung der dramatischen Ereignisse am Ende der Ermittlungen zu den Ragdoll-Morden.
Curtis fuhr mit neugieriger Miene fort.
»Aber nicht der William Fawkes«, sagte sie langsam und zog das oberste Foto vom Stapel. Das Bild eines nackten, übergewichtigen und ihr nicht bekannten Opfers in Großaufnahme war zu sehen.
Baxter hielt sich die Hand vor den Mund, sie war noch zu erschüttert, um etwas zu erwidern.
»Er hat für P. J. Henderson gearbeitet, die Investment Bank, verheiratet, zwei Kinder … anscheinend will uns jemand damit etwas sagen.«
Baxter hatte die Fassung so weit wiedererlangt, dass sie die verbliebenen Fotos durchschauen konnte, auf denen der Tote aus allen möglichen Blickwinkeln zu sehen war. Ein Körper, keine Nähte. Ein nackter Mann Mitte fünfzig. Der linke Arm baumelte herab, das Wort »Köder« war mit tiefen Schnitten in die Brust geritzt. Schließlich gab sie die Fotos Curtis zurück.
»Köder?«, fragte sie und sah von einem Agenten zum anderen.
»Vielleicht verstehen Sie jetzt, dass wir Sie informieren wollten«, sagte Curtis.
»Nicht wirklich«, erwiderte Baxter, die schon fast wieder sie selbst war.
Fassungslos wandte sich Curtis an Vanita:
»Ich hätte eigentlich erwartet, dass Ihre Abteilung, mehr als jede andere, bemüht sein würde …«
»Wissen Sie, mit wie vielen Nachahmungstätern wir es im vergangenen Jahr nach den Ragdoll-Morden in Großbritannien zu tun hatten?«, unterbrach Baxter sie. »Sieben … von denen ich weiß, dabei gebe ich mir wirklich Mühe, möglichst nichts davon mitzubekommen.«
»Und beunruhigt Sie das nicht?«, fragte Curtis.
Baxter sah nicht ein, weshalb ihr diese spezielle Gräueltat größeres Kopfzerbrechen bereiten sollte als die fünf anderen, die sie allein an jenem Vormittag auf den Tisch bekommen hatte.
Sie zuckte mit den Schultern: »Freaks sind Freaks.«
Rouche hätte sich beinahe an einem Jelly Baby mit Orangengeschmack verschluckt.
»Hören Sie, Lethaniel Masse war ein hochintelligenter, einfallsreicher und sehr umtriebiger Serienkiller. Die anderen sind kranke Typen, die Tote verunstalten, bevor sie festgenommen werden.«
Baxter fuhr ihren Computer herunter und packte ihre Tasche, um zu gehen:
»Vor sechs Wochen habe ich einer ein Meter großen Ragdoll Smarties geschenkt, als sie an Halloween vor meiner Haustür stand. Irgend so ein Lackaffe mit Baskenmütze hatte die Idee, ein paar tote Tiere zusammenzuflicken. Das Ding steht jetzt in der Tate Modern und wird täglich von unzähligen Besuchern bewundert und zwar von Lackaffen mit Baskenmütze.«
Rouche lachte.
»Irgendein krankes Arschloch hat sogar eine Fernsehsendung draus gemacht. Die Ragdoll ist Allgemeingut, sie ist überall, und wir müssen lernen, damit zu leben«, schloss sie.
Sie wandte sich an Rouche, der in seine Tüte Jelly Babies stierte.
»Spricht der nicht?«, fragte Baxter Curtis.
»Er hört lieber zu«, erwiderte diese leicht verbittert, als hätte sie nach nur einer Woche der Zusammenarbeit bereits die Nase voll von ihrem exzentrischen Kollegen.
Baxter sah wieder Rouche an.
»Wurden die verändert?«, murmelte er schließlich, den Mund voller Farben, weil ihm bewusst wurde, dass alle drei Frauen auf seinen Gesprächsbeitrag warteten.
Baxter stellte erstaunt fest, dass der CIA-Agent mit makellosem englischem Akzent sprach.
»Wie was verändert?«, fragte sie und hörte genau hin, falls er so gesprochen hatte, um sie zu verarschen.
»Jelly Babies«, sagte er und pulte sich etwas aus den Zähnen. »Die schmecken nicht mehr wie früher.«
Curtis fuhr sich verlegen und frustriert über die Stirn. Baxter hob die Hände und sah Vanita ungeduldig an.
»Ich muss noch wohin«, sagte sie freiheraus.
»Wir haben Anlass zu der Vermutung, dass es sich nicht um einen harmlosen Nachahmungstäter handelt, Chief Inspector«, beharrte Curtis und zeigte auf die Fotos, um das Gespräch wieder in die richtigen Bahnen zu lenken.
»Da haben Sie recht«, sagte Baxter. »Nicht mal das. Es wurde nichts zusammengeflickt.«
»Es gab aber noch einen zweiten Mord«, blaffte Curtis, um dann wieder in ihren professionellen Tonfall zurückzufallen. »Vor zwei Tagen. Der Tatort war … günstig insofern, als wir verhindern konnten, dass Informationen an die Medien gelangen, zumindest vorläufig. Realistisch betrachtet gehen wir aber nicht davon aus, dass wir in der Lage sind, der Welt einen Fall dieser …« Sie sah Rouche hilfesuchend an.
Nichts.
»… dieser Art länger als einen weiteren Tag vorzuenthalten.«
»Der Welt?«, fragte Baxter skeptisch.
»Wir haben eine kleine Bitte an Sie«, sagte Curtis.
»Und eine große auch«, ergänzte Rouche, der mit leerem Mund noch akzentfreier sprach.
Baxter bedachte Rouche mit einem Stirnrunzeln, Curtis ebenso. Dann sah Vanita Baxter warnend an, bevor diese dazu kam, etwas darauf zu erwidern. Rouche, schon um der Ausgewogenheit willen, sah Vanita warnend an, und Curtis wandte sich erneut an Baxter:
»Wir möchten Lethaniel Masse vernehmen.«
»Deshalb wurden sowohl FBI wie auch CIA eingeschaltet?«, fragte Baxter. »Amerikanischer Mord – britischer Verdächtiger. Na schön, tun Sie, was Sie nicht lassen können«, erwiderte sie schulterzuckend.
»Natürlich in Ihrer Anwesenheit.«
»Ganz bestimmt nicht. Aus welchem Grund sollten Sie mich dort brauchen? Sie können auch alleine Fragen von einer Karte ablesen … ich glaube fest an Sie.«
Der sarkastische Unterton entlockte Rouche ein Grinsen.
»Natürlich werden wir Ihnen, sofern es in unserer Macht steht, sehr gerne behilflich sein, nicht wahr, Chief Inspector?«, sagte Vanita, die Augen vor Wut weit aufgerissen. »Die freundschaftlichen Beziehungen sowohl zum FBI wie auch zur CIA sind uns sehr wichtig und …«
»Herrgott!«, platzte es aus Baxter heraus. »Na schön. Ich komme mit und halte Händchen. Und wie lautet jetzt die kleine Bitte?«
Rouche und Curtis sahen einander an, und selbst Vanita trat verlegen von einem Fuß auf den anderen, bevor jemand es wagte, erneut das Wort zu ergreifen.
»Das war … die kleine Bitte«, sagte Curtis schließlich leise.
Baxter sah aus, als wollte sie jeden Moment explodieren.
»Wir wollen mit Ihnen den Tatort sondieren«, fuhr Curtis fort.
»Fotos?«, fragte Baxter heiser.
Rouche schob seine Unterlippe vor und schüttelte den Kopf.
»Ich habe Ihre vorübergehende Versetzung nach New York bereits vom Commissioner genehmigen lassen und werde Sie persönlich während Ihrer Abwesenheit vertreten«, teilte Vanita ihr mit.
»Da haben Sie sich aber ganz schön was vorgenommen«, erwiderte Baxter schnippisch.
»Ich komme schon klar … irgendwie«, für einen kurzen, seltenen Moment gewährte Vanita einen Blick hinter ihre professionelle Fassade.
»Das ist lächerlich! Was zum Teufel glauben Sie eigentlich, was ich auf der anderen Seite der Welt zu einem Fall beitragen kann, der in keinerlei Zusammenhang zu meiner sonstigen Arbeit steht?«
»Gar nichts«, erwiderte Rouche ehrlich und entwaffnend. »Das ist absolute Verschwendung unser aller Zeit … unserer Zeit … äh, unser aller Zeiten?«
Curtis übernahm wieder:
»Ich denke, mein Kollege wollte sagen, dass die amerikanische Öffentlichkeit diesen Fall anders sieht als wir. Dort wird man an die Ragdoll-Morde hier denken, die Ähnlichkeit mit den Morden bei uns erkennen und verlangen, dass die Person, die den Ragdoll-Killer überführt hat, sich auch dieses Mal wieder auf die Jagd nach den neuen Monstern macht.«
»Dem Monster … wieso Monstern?«, fragte Baxter.
Diesmal runzelte Rouche die Stirn. Die Kollegin hatte mehr verraten, als zu diesem frühen Zeitpunkt verabredet gewesen war. Der darauffolgenden Stille entnahm Baxter, dass Curtis sich wieder im Griff hatte.
»Dann geht es also nur um PR?«, fragte Baxter.
»Mag sein«, sagte Rouche grinsend, »aber ist das nicht bei allem so, was wir tun, Chief Inspector?«
KAPITEL 3
Dienstag, 8. Dezember 201520.53 Uhr
»Hallo? Tut mir leid, ich bin viel zu spät«, rief Baxter aus dem Flur, trat ihre Stiefel in die Ecke und ging ins Wohnzimmer. Die Küchentür war geöffnet, und zusammen mit der kalten Luft drang eine Vielzahl köstlicher Düfte in den Raum. Aus dem iPod-Lautsprecher in der Ecke dudelte die belanglose Musik des Singer-Songwriters, der in dieser Woche bei Starbucks beworben wurde.
Der Tisch war für vier Personen gedeckt, die flackernden Teelichter tauchten den Raum in orangefarbenes Licht, das Alex Edmunds’ schwer zu bändigende rote Haare noch intensiver leuchten ließ. Ihr schlaksiger ehemaliger Kollege stand verlegen da, eine leere Bierflasche in der Hand.
Obwohl Baxter selbst recht groß war, musste sie sich auf die Zehenspitzen stellen, um ihn zu umarmen.
»Wo ist Tia?«, fragte sie ihren Freund.
»Telefoniert mit dem Babysitter … schon wieder«, erwiderte er.
»Em? Bist du das?«, rief eine Stimme aus der Küche.
Baxter schwieg. Sie war viel zu erledigt, um sich für Hilfsdienste in der Küche rekrutieren zu lassen.
»Ich hab Wein hier!«, ergänzte die Stimme gutgelaunt.
Das lockte sie dann doch in die Vorzeigeküche, in der mehrere hochwertige Pfannen und Töpfe bei gedämpftem Licht vor sich hin blubberten. Ein Mann in elegantem Hemd mit langer Schürze wachte über alles, rührte gelegentlich um oder drehte die Temperatur höher. Sie ging zu ihm und drückte ihm ein Küsschen auf die Lippen.
»Hab dich vermisst«, sagte Thomas.
»Hast du nicht was von Wein gesagt?«, erinnerte sie ihn.
Er lachte und schenkte ihr ein Glas aus einer bereits geöffneten Flasche ein.
»Danke. Das brauche ich jetzt«, sagte Baxter.
»Bedank dich nicht bei mir. Der ist von Alex und Tia.«
Sie hoben ihre Gläser Richtung Edmunds, der in der Tür stand, anschließend trat Baxter an die Arbeitsfläche, um Thomas beim Kochen zuzusehen.
Acht Monate zuvor hatten sie sich in der Rushhour kennengelernt, als die Londoner U-Bahn mal wieder bestreikt wurde. Thomas hatte sich eingemischt, als Baxter unangemessenerweise einen Mitarbeiter festnehmen wollte, der für höhere Löhne und sichere Arbeitsbedingungen demonstrierte. Er hatte ihr klargemacht, dass sie sich theoretisch des Straftatbestands der Entführung schuldig machen würde, sollte sie tatsächlich darauf bestehen, dem Herrn in der reflektierenden Sicherheitsweste Handschellen anzulegen und ihn gegen seinen Willen zu zwingen, gemeinsam mit ihr die zehn Kilometer nach Wimbledon zu Fuß zurückzulegen. Stattdessen hatte sie dann Thomas verhaftet.
Thomas war ein sanfter und anständiger Mann. Er war so gutaussehend, wie auch sein Musikgeschmack okay war, und er war zehn Jahre älter als sie. Er bot ihr Sicherheit. Er wusste, wer er war und was er wollte: ein geordnetes, angenehm ruhiges und behagliches Leben. Außerdem war er Anwalt. Sie musste grinsen bei dem Gedanken daran, wie sehr Wolf ihn gehasst hätte. Häufig fragte sie sich, ob es gerade das war, was sie an Thomas so anziehend fand.
Das elegante Townhouse, in dem das Abendessen stattfand, gehörte ihm. Er hatte Baxter in den letzten Monaten mehrfach gebeten, zu ihm zu ziehen. Obwohl sie begonnen hatte, einige Sachen dort zu lassen, und sie sogar gemeinsam das Schlafzimmer frisch gestrichen hatten, hatte sie es kategorisch abgelehnt, ihre Wohnung in der Wimbledon High Street aufzugeben, und hielt weiterhin Echo dort, ihre Katze, um immer wieder nach Hause fahren zu können.
Die vier Freunde setzten sich zum Essen. Sie genossen es ebenso sich die Geschichten, die sie sich erzählen, die mit zunehmendem Zeitabstand vielleicht ungenauer, dafür aber amüsanter geworden waren. Sie interessierten sich gegenseitig für die Antworten auch auf die banalsten Fragen zu ihren Jobs, zur richtigen Art Lachs zuzubereiten und zum Kinderkriegen. Edmunds hielt Tias Hand, als er von seiner Versetzung ins Betrugsdezernat berichtete und immer wieder betonte, dass er jetzt viel mehr Zeit mit seiner wachsenden Familie verbringen konnte. Als man sie nach ihrer Arbeit fragte, verzichtete Baxter darauf, den Besuch ihrer Kollegen aus Übersee und die lästige Aufgabe zu erwähnen, die sie am darauffolgenden Morgen erwartete.
Um 22.17 Uhr schlief Tia auf dem Sofa. Thomas war zum Aufräumen in die Küche verschwunden und hatte Baxter und Edmunds im schwindenden Licht der flackernden Teelichter am Tisch sitzen lassen. Letzterer war inzwischen auf Wein umgestiegen und hatte ihre Gläser aufgefüllt.
»Und wie ist es so im Betrugsdezernat?«, fragte sie leise, schaute zum Sofa, um sich zu vergewissern, dass Tia wirklich schlief.
»Hab ich dir doch gesagt … toll«, sagte Edmunds.
Baxter wartete geduldig.
»Was? Alles gut«, sagte er und verschränkte trotzig die Arme.
Baxter schwieg weiter.
»Die sind da ganz okay. Was soll ich dazu sagen?«
Als sie mit seiner Antwort immer noch nicht zufrieden war, musste er schließlich grinsen.
Sie kannte ihn einfach viel zu gut.
»Es ist arschlangweilig. Aber es ist nicht so … nicht so, dass ich es bedaure, nicht mehr bei der Mordkommission zu sein.«
»Klingt aber so«, meinte Baxter. Jedes Mal, wenn sie sich sahen, versuchte sie, ihn zu überreden zurückzukommen.
»Aber ich hab jetzt viel mehr vom Leben. Ich habe sogar Zeit für meine Tochter.«
»Reine Verschwendung«, sagte Baxter und meinte es ernst. Offiziell hatte sie den berüchtigten Ragdoll-Killer überführt. Inoffiziell aber hatte Edmunds den Fall gelöst. Nur er allein hatte im Gegensatz zu ihr und den anderen im Team das ganze Netz aus Lügen und Betrügereien durchschaut.
»Ich sag dir was, wenn du mir eine Stelle als Detective mit einer Arbeitszeit von neun bis fünf anbietest, dann unterschreib ich noch heute Abend den Vertrag«, grinste Edmunds und wusste, dass das Gespräch damit beendet war.
Baxter gab sich geschlagen und trank ihren Wein, Thomas klapperte weiterhin geschäftig in der Küche.
»Morgen geh ich zu Masse«, erzählte sie freiheraus, als wäre der Besuch von Serienkillern etwas ganz Alltägliches für sie.
»Was?!« Edmunds prustete den Angebots-Sauvignon aus. »Wieso?«
Er war der Einzige gewesen, dem sie anvertraut hatte, was wirklich an dem Tag geschehen war, an dem sie Lethaniel Masse festgenommen hatte. Keiner von ihnen beiden wusste genau, woran Masse sich erinnerte. Er war brutal zusammengeschlagen worden und beinahe gestorben, aber sie hatte immer Angst gehabt, dass er doch noch mehr erinnerte und sie ohne weiteres ruinieren konnte, sollte er dies in seinem psychotischen Gehirn beschließen.
Baxter erzählte ihm von ihrem Gespräch mit Vanita und den »Special« Agents und dass sie dazu verdonnert worden war, die beiden nach New York zu begleiten.
Edmunds hörte ihr schweigend zu und wurde zusehends ungehaltener, je mehr sie erzählte.
»Ich dachte, das alles sei vorbei«, sagte er, als sie fertig war.
»Ist es ja auch. Das ist nur wieder ein Trittbrettfahrer, genau wie die anderen.«
Er schien sich nicht so sicher zu sein.
»Was?«
»Du hast gesagt, dem Opfer hat man das Wort ›Köder‹ in die Brust geritzt.«
»Ja?«
»Ein Köder für wen? Das ist die Frage.«
»Du denkst, ich bin gemeint?«, schnaubte Baxter verächtlich.
»Der Typ kennt Wolfs Namen, und jetzt, siehe da, wirst du auch noch mit reingezogen.«
Baxter lächelte ihren Freund liebevoll an.
»Das ist nur ein Trittbrettfahrer, wie die anderen. Du musst dir keine Sorgen um mich machen.«
»Mach ich aber.«
»Kaffee?«, fragte Thomas für beide überraschend. Er stand in der Tür und trocknete sich die Hände an einem Küchenhandtuch.
»Schwarz, bitte«, sagte Edmunds.
Baxter lehnte dankend ab, und Thomas verschwand wieder in der Küche.
»Hast du was für mich?«, flüsterte sie.
Edmunds schien sich unbehaglich zu fühlen. Mit Blick zur geöffneten Küchentür zog er widerwillig einen weißen Umschlag aus der Tasche seines Jacketts, das hinter ihm auf der Stuhllehne hing.
Er legte ihn auf seine Seite des Tisches und versuchte zunächst, sie zum ungezählten Mal zu überreden, ihn nicht anzunehmen.
»Du brauchst das nicht.«
Baxter griff nach dem Umschlag, aber Edmunds schob ihn noch weiter von ihr weg.
Sie schnaubte.
»Thomas ist ein guter Mann«, sagte er leise. »Du kannst ihm vertrauen.«
»Du bist der Einzige, dem ich vertraue.«
»Du wirst niemals eine richtige Beziehung mit ihm haben, wenn du so weitermachst.«
Als sie aus der Küche Geschirrklappern hörten, schauten beide zur Tür. Baxter stand auf, entriss Edmunds den Umschlag und setzte sich genau in dem Augenblick wieder, als Thomas mit dem Kaffee ins Zimmer kam.
Als Edmunds Tia kurz nach 23 Uhr sanft wach rüttelte, entschuldigte sie sich tausendfach. Beim Verabschieden vor der Haustür umarmte Edmunds Baxter.
»Tu dir selbst einen Gefallen und mach ihn nicht auf«, flüsterte er ihr ins Ohr.
Sie drückte ihn, antwortete aber nicht.
Kaum waren die beiden gegangen, trank Baxter ihren Wein aus und zog ihren Mantel an.
»Du willst doch jetzt nicht gehen, oder?«, fragte Thomas. »Wir haben uns kaum gesehen.«
»Echo wird hungrig sein«, sagte sie und zog ihre Stiefel an.
»Ich kann dich nicht fahren. Ich hab zu viel getrunken.«
»Ich nehme ein Taxi.«
»Bleib doch.«
Sie beugte sich so weit vor, wie sie konnte, blieb mit den nassen Stiefeln aber auf der Fußmatte stehen. Thomas schenkte ihr einen Kuss und ein enttäuschtes Lächeln.
»Gute Nacht.«
***
Kurz vor Mitternacht öffnete Baxter die Tür zu ihrer Wohnung. Da sie nicht im Geringsten müde war, fläzte sie sich mit einer Flasche Rotwein aufs Sofa. Sie schaltete den Fernseher ein, zappte wahllos hin und her, und als sie nichts fand, scrollte sie die Liste ihrer bereits gestreamten Weihnachtsfilme runter.
Schließlich entschied sie sich für Kevin allein zu Haus 2, da es ihr eigentlich egal war, ob sie während des Films einschlief oder nicht. Der erste Film war insgeheim einer ihrer absoluten Lieblingsfilme, den zweiten hielt sie für eine uninspirierte Kopie. Man hatte den uralten Fehler gemacht zu glauben, die Fortsetzung würde erfolgreicher und besser, wenn man dieselbe Geschichte einfach nach New York City verlagerte.
Sie schenkte sich den Rest Wein ins Glas und sah Macaulay Culkin halbherzig dabei zu, wie er fröhlich mehrere Mordversuche unternahm. Dann fiel ihr der Umschlag in ihrer Manteltasche wieder ein. Als sie ihn in der Hand hielt, dachte sie an Edmunds’ Bitte, ihn nicht zu öffnen.
Acht Monate lang hatte er seine Karriere aufs Spiel gesetzt und seine Befugnisse im Betrugsdezernat überschritten, indem er Baxter jede Woche mit detaillierten Angaben über Thomas’ Finanzen versorgte und dessen Konten auf verdächtige und betrügerische Vorgänge überprüfte.
Sie wusste, dass sie zu viel von ihm verlangte. Und sie wusste, dass er Thomas für einen Freund hielt, dessen Vertrauen er missbrauchte. Aber sie wusste auch, weshalb Edmunds es trotzdem für sie tat und auch weiterhin tun würde. Er wollte, dass sie glücklich war. Seit sie zugelassen hatte, dass Wolf aus ihrem Leben verschwand, zehrte die Frage, wem sie überhaupt vertrauen konnte, so sehr an ihren Kräften, dass Edmunds überzeugt war, sie würde Thomas verlassen, wenn er ihr nicht permanent Beweise für die Integrität ihres neuen Freundes vorlegte.
Sie warf den ungeöffneten Umschlag auf den Sofatisch vor sich und versuchte, sich auf den Film zu konzentrieren. Als die Haare eines der Banditen mit einer Fackel in Brand gesetzt wurden … roch sie verbranntes Fleisch. Und erinnerte sich an die Schmerzensschreie der Opfer.
Der Mann im Fernsehen zog seinen verletzten Kopf aus dem Klo und machte anschließend weiter, als wäre nichts gewesen.
Alles war gelogen, man durfte niemandem vertrauen.
Sie trank ihr Glas in drei großen Zügen leer und riss den Umschlag auf.
KAPITEL 4
Mittwoch, 9. Dezember 20158.19 Uhr
London war über Nacht eingefroren.
Die Wintersonne schien schwach und weit entfernt, ein verhaltenes kaltes Licht, das dem frostigen Morgen nichts anhaben konnte. Baxters Finger wurden schon ganz taub, als sie draußen in der Wimbledon High Street stand und darauf wartete, abgeholt zu werden. Sie sah auf die Uhr: zwanzig Minuten Verspätung – die Zeit hätte sie auch vor einer heißen Tasse Kaffee in ihrer gemütlichen Wohnung verbringen können.
Sie hüpfte auf der Stelle, um sich warm zu halten, die kalte Luft in ihrem Gesicht brannte. Sie war sogar so weit gegangen, die alberne Bommelmütze mit den dazu passenden Handschuhen anzuziehen, die Thomas ihr auf dem Camden Lock Market gekauft hatte.
Das Gehwegpflaster war mit einer glitzernden Silberschicht überzogen, auf der die Leute ängstlich vorwärtswankten in dem Bewusstsein, dass sie sich jederzeit die Beine brechen konnten. Sie beobachtete zwei Männer, die sich über die Straße anschrien – die Dunstwolken, die sie mit ihrem Atem erzeugten, stiegen wie Sprechblasen über ihre Köpfe.
Als ein Doppeldeckerbus an der Ampel hielt, entdeckte sie sich auf dessen beschlagenen Scheiben. Verlegen zog sie sich die knallorangefarbene Mütze vom Kopf und stopfte sie in die Tasche. Über ihrem Spiegelbild zog sich Werbung mit einem vertrauten Gesicht um das Fahrzeug:
Andrea Hall: Die Bauchrednerpuppe. Botschaften eines Mörders
Sie war ganz offensichtlich nicht zufrieden mit dem Reichtum und dem Ruhm, der ihr durch das Leid anderer zugeflossen war, als sie im Zuge der Ragdoll-Morde als Nachrichtensprecherin darüber berichtet hatte. Nun war Wolfs Ex tatsächlich auch noch so anmaßend, eine autobiographische Darstellung der Ereignisse zu veröffentlichen.
Als der Bus wieder anfuhr, lächelte Andrea von dem riesigen Foto auf Baxter herunter. Sie wirkte jünger und attraktiver denn je, trug ihre auffälligen roten Haare so modern kurz, wie Baxter es sich nie getraut hätte. Bevor Andreas selbstgefällige Visage außer Reichweite rollte, öffnete Baxter ihre Tasche, nahm ihre Lunchbox heraus, holte den entscheidenden Bestandteil ihres Tomatensandwichs heraus und ließ diesen zu ihrer Zufriedenheit auf dem blöden Riesengesicht der blöden Riesenfrau explodieren.
»Chief Inspector?«
Baxter zuckte zusammen.
Sie hatte den großen schwarzen Transporter gar nicht gesehen, der hinter ihr an der Bushaltestelle gehalten hatte. Schnell ließ sie ihre Lunchbox wieder in ihrer Tasche verschwinden, drehte sich um und sah Special Agent Curtis, die sie besorgt anschaute.
»Was machen Sie da?«, fragte Curtis vorsichtig.
»Ach, nur …« Baxter verstummte, hoffte, der tadellosen und professionellen jungen Frau würde dies als Erklärung ihres ungewöhnlichen Verhaltens genügen.
»… einen Bus mit Gemüse bewerfen?«, half Curtis ihr auf die Sprünge.
»Genau.«
Als Baxter sich dem Transporter näherte, öffnete Curtis die Schiebetür. Das geräumige Innere hinter den getönten Scheiben kam zum Vorschein.
»Amerikaner«, flüsterte Baxter leise und verächtlich.
»Wie geht’s uns denn heute Morgen?«, fragte Curtis höflich.
»Keine Ahnung, wie’s uns geht, aber ich frier mir den Arsch ab.«
»Oh,verzeihen Sie bitte die Verspätung, wir hatten nicht mit so viel Verkehr gerechnet.«
»Das ist London«, sagte Baxter nüchtern.
»Rein mit Ihnen.«
»Sicher, dass genug Platz ist?«, fragte Baxter sarkastisch und stieg ungelenk in das Fahrzeug. Das cremefarbene Leder knarzte, als sie sich auf einem der Sitze niederließ. Sie fragte sich, ob sie darauf hinweisen sollte, dass das Leder und nicht sie das Geräusch gemacht hatte, beruhigte sich dann aber damit, dass es wohl jedem Mitfahrenden beim Hinsetzen so erging.
Dann grinste sie Curtis an.
»Verzeihung sagt man«, meinte die Amerikanerin, schloss die Tür und rief dem Fahrer zu, wohin sie wollten.
»Heute kein Rouche?«, fragte Baxter.
»Wir sammeln ihn unterwegs auf.«
Während sie dank der Heizung allmählich auftaute, fragte Baxter sich trotzdem noch fröstelnd, weshalb die beiden Agenten nicht auf die Idee gekommen waren, Zimmer in ein und demselben Hotel zu buchen.
»Daran werden Sie sich gewöhnen müssen, fürchte ich. In New York liegt ein halber Meter Schnee.« Curtis kramte in ihrer Aktentasche und zog eine schicke schwarze Wollmütze heraus, ähnlich der, die sie selbst trug. »Hier.«
Sie gab sie Baxter, die sich darüber freute, bis sie entdeckte, dass vorne auf der Mütze dick und fett in gelben Buchstaben »FBI« stand – eine scharfschützenfreundlichere Zielmarkierung konnte es kaum geben.
Sie warf sie Curtis zurück.
»Danke, aber ich hab selbst eine«, sagte sie, holte die orangefarbene Augenkrankheit wieder aus ihrer Tasche und zog sie sich über den Kopf.
Curtis zuckte mit den Schultern und sah aus dem Fenster auf die vorüberhuschende Stadt.
»Haben Sie ihn seitdem noch mal gesehen?«, fragte sie schließlich. »Masse?«
»Nur vor Gericht«, erwiderte Baxter und versuchte zu erraten, wohin sie fuhren.
»Ich bin ein bisschen nervös«, grinste Curtis.
Einen Augenblick lang war Baxter wie gebannt von dem perfekten Filmstarlächeln der jungen Agentin. Dann bemerkte sie den makellosen, dunklen Teint, sie konnte nicht einmal sagen, ob sie sich dafür überhaupt hatte schminken müssen. In einem Anflug von Unsicherheit fingerte Baxter an ihren Haaren herum und starrte aus dem Fenster.
»Masse ist schließlich eine lebende Legende«, fuhr Curtis fort. »Ich habe gehört, sein Fall ist schon in der Akademie Thema. Ich bin sicher, eines Tages wird sein Name in einem Atemzug mit Bundy und John Wayne Gacy genannt. Es ist … es ist eigentlich eine Ehre, oder? Auch wenn das vielleicht nicht der passende Ausdruck ist …«
Baxter sah die junge Frau mit großen, wütenden Augen an.
»Dann überlegen Sie sich einen passenden Ausdruck«, blaffte sie. »Dieser kranke Scheißkerl hat einen meiner Freunde ermordet und verstümmelt. Glauben Sie, das wird ein Spaß? Glauben Sie, Sie bekommen ein Autogramm?«
»Ich wollte Ihnen nicht zu nahe …«
»Sie verschwenden Ihre Zeit. Sie verschwenden meine Zeit. Und Sie verschwenden die Zeit dieses Mannes«, sagte Baxter und zeigte auf den Fahrer. »Masse kann nicht mal sprechen. Erst neulich habe ich gehört, dass sein Unterkiefer immer noch runterhängt.«
Curtis räusperte sich und setzte sich aufrecht hin.
»Ich möchte mich für meine Bemerkung entschuldigen …«
»Sie können sich entschuldigen, indem Sie den Mund halten«, sagte Baxter und beendete das Gespräch.
Den Rest der Fahrt über schwiegen die beiden Frauen. Baxter betrachtete Curtis’ Spiegelbild im Fenster. Sie schien weder wütend noch empört zu sein, nur frustriert über ihre unüberlegte Bemerkung. Baxter sah, dass sie lautlos die Lippen bewegte, als wollte sie eine Entschuldigung einstudierten oder sich auf den nächsten unvermeidbaren Wortwechsel vorbereiten.
Baxter bekam allmählich ein schlechtes Gewissen wegen ihres Ausbruchs und erinnerte sich an ihre ungezügelte Freude, nur anderthalb Jahre zuvor, als sie die Ragdoll zum ersten Mal gesehen hatte. Wie ihr bewusstgeworden war, dass sie in etwas Ungeheuerliches hineingeraten war, und wie sie sich ausgemalt hatte, inwiefern sich dies auf ihre Karriere auswirken würde. Sie wollte gerade etwas sagen, als das Fahrzeug um eine Ecke bog und in einem grünen Vorortviertel vor einer großen Doppelhaushälfte hielt. Sie hatte keine Ahnung, wo sie überhaupt waren.
Verwirrt starrte sie auf das Pseudo-Tudor-Gebäude, das gleichzeitig heimelig und verwahrlost wirkte. Beeindruckende Unkrautgewächse wucherten in den tiefen Rissen der steilen Auffahrt. Eine weihnachtliche Lichterkette ohne Stromanschluss klammerte sich verzweifelt an die Rahmen der stumpf gewordenen Fenster, träge stieg Rauch aus einem Schornstein, der von einem Vogelnest verstopft war.
»Komisches Hotel«, bemerkte sie.
»Rouches Familie lebt hier«, erklärte Curtis. »Ich glaube, ab und zu kommen sie ihn besuchen, und er fährt her, so oft er kann. Er hat mir erzählt, in den Staaten lebt er vorwiegend in Hotels. Das bringt unser Job wohl mit sich. Man bleibt nie wirklich lange an einem Ort.«
Rouche kam aus dem Haus und aß eine trockene Scheibe Toast. Er schien mit dem frostkalten Morgen zu verschmelzen: Sein weißes Hemd und der blaue Anzug passten zu den Wolkenfetzen, die über den Himmel zogen, seine silbrigen Haarsträhnen glitzerten wie der vereiste Asphalt.
Curtis stieg aus, um ihn zu begrüßen, als er ihnen mit dem Toast voran über die Auffahrt entgegen schlitterte.
»Verdammt noch mal, Rouche!«, beschwerte sie sich.
»Was Größeres habt ihr wohl nicht gefunden?«, hörte Baxter ihn ironisch fragen, bevor beide einstiegen.
Er setzte sich Baxter gegenüber ans Fenster und bot ihr an, von seinem Frühstück abzubeißen. Er grinste, als er die orangefarbene Bescherung auf ihrem Kopf bemerkte.
Der Fahrer parkte aus und fuhr los. Curtis war mit Papierkram beschäftigt, während Baxter und Rouche die an ihnen vorbeiziehenden Gebäude betrachteten, die aufgrund des vibrierenden Motors zu einem einzigen unentschlüsselbaren Gebilde verwackelten.
»Gott, ich hasse diese Stadt«, entfuhr es Rouche, als sie den Fluss überquerten und sein starrer Blick auf die beeindruckende Aussicht fiel. »Der Verkehr, der Lärm, der Dreck, die Menschenmassen, die sich wie kurz vor einem Herzinfarkt durch die verstopften Verkehrsadern schieben. Alles, was sich einigermaßen in Reichweite befindet, ist mit Graffiti beschmiert.«
Curtis lächelte Baxter entschuldigend an, während Rouche fortfuhr:
»Erinnert mich irgendwie an meine Schulzeit: an die Party bei dem reichen Jungen zu Hause. Die Eltern sind nicht da, und in ihrer Abwesenheit werden die wertvollen Kunstgegenstände und Wände der preisgekrönten Architektenvilla verschandelt und beschmiert, um sie dem trivialen Leben derer anzupassen, die so etwas niemals schätzen werden.«
Es herrschte eine angespannte Stille zwischen ihnen. Der Transporter bewegte sich im Schneckentempo auf eine Kreuzung zu.
»Also, ich finde London toll«, sagte Curtis begeistert. »So viel Geschichte überall.«
»Also, eigentlich muss ich Rouche recht geben«, sagte Baxter. »Wie Sie ganz richtig gesagt haben: Geschichte überall. Sie sehen den Trafalgar Square: Ich sehe die winzige Gasse gegenüber, wo wir die Leiche einer Prostituierten aus der Mülltonne gefischt haben. Sie sehen das Parlamentsgebäude: Ich sehe eine wilde Verfolgungsjagd mit Booten auf der Themse, deretwegen ich … was Wichtiges verpasst habe … das ich nicht hätte verpassen dürfen. Das ist nun mal so, trotzdem ist das hier meine Heimat.«
Zum ersten Mal seit sie losgefahren waren, löste Rouche den Blick vom Fenster, um Baxter aufmerksam zu betrachten.
»Und wann sind Sie aus London weggezogen, Rouche?«, fragte Curtis, die anders als die anderen beiden die friedliche Stille offenbar nicht als wohltuend empfand.
»2005«, erwiderte er.
»Muss schwer sein, auf Dauer so weit von Frau und Kind entfernt zu leben.«
Rouche schien nicht in der Stimmung, darüber zu reden, antwortete aber trotzdem widerwillig.
»Ist es auch. Aber solange ich einmal täglich ihre Stimmen höre, sind sie nie wirklich weit weg.«
Baxter rutschte verlegen auf ihrem Platz hin und her, die aufrichtige Gefühlsäußerung war ihr ein bisschen peinlich, was Curtis mit ihrem unnötigen und falschen »Ooooch!« noch schlimmer machte.
Sie stiegen auf dem Besucherparkplatz des Gefängnisses Belmarsh aus und gingen von dort zum Haupteingang. Die beiden Agenten mussten ihre Waffen abgeben und sich Fingerabdrücke abnehmen lassen, dann wurden sie durch die Sicherheitstüren, die Röntgenkontrolle und den Metalldetektor geschleust sowie einer persönlichen Leibesvisitation unterzogen. Schließlich warteten sie auf den Gefängnisdirektor.
Rouche wirkte angespannt, als er die Umgebung musterte, Curtis entschuldigte sich, um »kurz auszutreten«. Wenig später war nicht zu überhören, dass er leise Hollaback Girl von Gwen Stefani vor sich hin sang.
»Geht’s noch?«, fragte Baxter.
»’tschuldigung.«
Baxter betrachtete ihn einen Augenblick lang argwöhnisch. »Ich singe immer, wenn ich nervös bin«, erklärte er.
»Nervös?«
»Ich mag keine abgeschlossenen Räume.«
»Wer mag die schon?«, erwiderte Baxter. »Das ist genauso, als würde man es nicht mögen, ins Auge gepikt zu werden: Ist doch selbstverständlich. Völlig sinnlos, so was überhaupt laut auszusprechen, niemand möchte irgendwo eingesperrt sein.«
»Danke für das Verständnis«, grinste er. »Apropos Nervosität, wie geht es Ihnen?«
Sie staunte, dass er ihre Unruhe spürte.
»Immerhin hätte nicht viel gefehlt, und Masse hätte Sie …«
»Umgebracht?«, half Baxter ihm. »Ich erinnere mich. Aber mit Masse hat das nichts zu tun, ich hoffe nur, Gefängnisdirektor Davies arbeitet nicht mehr hier. Er hat nicht viel für mich übrig.«
»Für Sie?«, fragte Rouche, was eigentlich, wie er (vergeblich) gehofft hatte, bestürzt hätte klingen sollen.
»Ja, für mich«, wiederholte Baxter fast schon eingeschnappt.
Was gelogen war. Baxters Beklommenheit rührte natürlich daher, dass ihr eine persönliche Begegnung mit Masse bevorstand: nicht aufgrund dessen, wer er war, sondern was er wissen und möglicherweise verraten könnte.
Nur vier Menschen kannten die Wahrheit, wussten, was sich im Gerichtssaal des Old Bailey zugetragen hatte. Sie hatte damit gerechnet, dass Masse ihrer hastig formulierten Version der Ereignisse widersprechen würde; tatsächlich aber hatte er nie Einspruch gegen ihre Aussage eingelegt. Und mit der Zeit wagte sie zu hoffen, dass seine Verletzungen, die er nach dem Kampf mit Wolf davongetragen hatte, zu schwer waren, um sich an ihr beschämendes Geheimnis zu erinnern. Jeden Tag hatte sie sich gefragt, ob die Vergangenheit sie einholen würde, und jetzt fürchtete sie, ihr Glück allzu sehr auf die Probe zu stellen, indem sie sich mit der einzigen Person, die sie im Handumdrehen vernichten konnte, an einen Tisch setzte.
In diesem Augenblick bog Direktor Davies um die Ecke. Sein Gesichtsausdruck veränderte sich schlagartig, als er Baxter wiedererkannte.
»Ich hole Curtis«, flüsterte sie Rouche zu.
Sie blieb an der Tür zum Toilettenraum stehen, weil sie Curtis’ Stimme von drinnen hörte. Baxter schien das eigenartig, da sie ihre Handys bei der Sicherheitskontrolle doch hatten abgeben müssen. Vorsichtig drückte sie die schwere Tür auf, bis sie die junge amerikanische Agentin sehen konnte, die mit sich selbst im Spiegel sprach:
»Keine dämlichen Bemerkungen mehr. Denk gefälligst nach, bevor du den Mund aufmachst. Du darfst dir vor Masse keine Fehler erlauben. ›Selbstvertrauen erfordert, dass andere einem vertrauen.‹«
Baxter klopfte laut und riss die Tür auf, Curtis erschrak.
»Der Direktor ist so weit«, verkündete sie.
»Komme.«
Baxter nickte und kehrte zu Rouche zurück.
Der Direktor führte die Gruppe zum Hochsicherheitstrakt.
»Wie Sie wohl wissen, hat Lethaniel Masse sich vor seiner Festnahme durch Detective Baxter langwierige Verletzungen zugezogen«, sagte er in dem Bemühen, freundlich zu sein.
»Detective Chief Inspector«, korrigierte sie ihn alles andere als entgegenkommend.
»Er hatte verschiedene chirurgische Eingriffe am Kiefer, der wahrscheinlich nie mehr voll funktionsfähig sein wird.«
»Aber wird er dann unsere Fragen beantworten können?«, wollte Curtis wissen.
»Nicht zusammenhängend, nein. Deshalb habe ich eine Dolmetscherin hinzugezogen, die während der Vernehmung anwesend sein wird.«
»Und die übersetzt unverständliches Genuschel ins Englische?«, konnte Baxter sich nicht verkneifen zu fragen.
»Gebärdensprache«, antwortete der Direktor. »Masse hat sie innerhalb weniger Wochen nach seiner Ankunft hier gelernt.«
Die Gruppe wurde durch eine weitere Sicherheitstür nach draußen in den auf unheimliche Weise verlassen wirkenden Freizeitbereich geleitet. Über das Lautsprechersystem wurde eine verschlüsselte Nachricht durchgegeben.
»Wie macht sich Masse so als Häftling?«, fragte Curtis betont interessiert.
»Vorbildlich«, erwiderte der Direktor. »Wenn sich doch nur alle so ausgezeichnet verhalten würden. Rosenthal!«, rief er einem jungen Mann am anderen Ende eines kleinen Fußballplatzes zu, woraufhin dieser auf sie zugerannt kam, dabei beinahe ausrutschte. »Was ist los?«
»In Block 3 gibt’s eine Schlägerei, Sir«, keuchte der junge Mann. Einer seiner Schnürsenkel hatte sich gelöst und schleifte über den Boden.
Der Direktor seufzte.
»Ich fürchte, Sie werden mich entschuldigen müssen«, sagte er zu der Gruppe. »Wir hatten diese Woche einige Neuzugänge, und in der Eingewöhnungsphase gibt es immer ein paar Kinderkrankheiten zu überstehen. Rosenthal hier wird Sie zu Masse bringen.«
»Zu Masse, Sir?«, der junge Mann schien sich wenig für seinen Auftrag zu begeistern. »Natürlich.«
Der Direktor eilte davon, während Rosenthal sie zu dem Gefängnis im Gefängnis führte, das erneut von Mauern und Zäunen umgeben war. Als sie das erste Sicherheitstor erreichten, klopfte er hektisch seine Taschen ab und wollte schon wieder umkehren.
Rouche tippte ihm auf die Schulter und gab ihm seine ID-Karte.
»Die haben Sie da hinten fallen lassen«, sagte er freundlich.
»Danke. Der Chef würde mich im wahrsten Sinne des Wortes umbringen, wenn ich die schon wieder verloren hätte …«
»Nicht wenn einer der geflohenen Massenmörder, für die Sie zuständig sind, Sie zuerst erwischt«, warf Baxter ein, woraufhin der junge Mann knallrot anlief.
»Tut mir leid«, sagte er, ließ sie passieren und brachte sie zu weiteren Sicherheitskontrollen und Leibesvisitationen.
Er erklärte, dass der Hochsicherheitstrakt in zwölf Einzelzellen unterteilt sei und Wärter hier nur maximal drei Jahre arbeiten durften, bevor sie wieder zurück ins Hauptgebäude versetzt wurden.
Die beigefarbenen Wände und Türen innen passten zu den terracottafarbenen Fußböden. Geländer, Türen und Treppen waren rot gestrichen. Über ihren Köpfen, zwischen den Laufgängen, waren Netze gespannt, die in der Mitte durchhingen. Hier sammelten sich Müll und andere, aerodynamischere Gegenstände.
Im Gebäude war es erstaunlich still, da die Gefangenen sich noch in ihren Zellen befanden. Ein weiterer Wärter führte sie in einen Raum im Erdgeschoss, in dem eine sehr unauffällig gekleidete Frau mittleren Alters bereits auf sie wartete. Sie wurde ihnen als die Gebärdensprachenexpertin vorgestellt. Anschließend erläuterte der Wärter die eigentlich selbstverständlichen Vorschriften, bevor er endlich die Tür aufschloss.
»Denken Sie dran, wenn Sie etwas brauchen, ich bin direkt hier draußen«, betonte er zweimal, dann stieß er die Tür auf, und sie sahen die beeindruckende Gestalt, die ihnen den Rücken zukehrte.
Baxter konnte das Unbehagen des Wärters in Gegenwart des berüchtigtsten Häftlings der Anstalt spüren. Masse trug einen dunkelblauen Overall, seine Handschellen waren mit einer langen Kette an einem Metalltisch befestigt, und über eine weitere Kette mit den Fußfesseln verbunden, die am Betonboden fixiert waren.
Auch wenn er sich nicht umdrehte, als sie hereinkamen, sondern ihnen weiterhin die tiefen Narben auf seinem kahlen Schädel zuwandte, so legte er doch den Kopf in den Nacken und schnupperte neugierig in die Luft, sog sie ein.
Die beiden Frauen sahen einander verunsichert an, während Rouche sich selbstlos auf den Platz setzte, der dem verurteilten Mörder am nächsten war.
Obwohl es Masse wegen seiner Fesseln und Ketten unmöglich war, den Raum zu verlassen, fühlte sich Baxter wie eingesperrt, als sich die schwere Tür hinter ihnen schloss und sie sich langsam dem Mann gegenübersetzte, der trotz seiner Gefangenschaft immer noch eine solche Bedrohung für sie darstellte.
Während Masse beobachtete, wie sie sich im Raum umsah, überall hinschaute, nur um dem Blickkontakt mit ihm zu entgehen, verzog sich sein zerstörtes Gesicht zu einem halbseitigen Grinsen.
KAPITEL 5
Mittwoch, 9. Dezember 201511.22 Uhr
»Das war vollkommene Zeitverschwendung«, seufzte Baxter, als sie erneut den Innenhof des Hochsicherheitstrakts betraten.
Masse hatte während Curtis’ halbstündigem Monolog nicht einmal versucht, auch nur eine einzige Frage zu beantworten. Es war, als hätte man ein Tier im Zoo besucht. Masse war nur vom Namen her anwesend gewesen – ein gebändigter und bezwungener Schatten des sadistischen Ungeheuers, das ihr nachts noch immer den Schlaf raubte und sich von einem Ruf nährte, dem er nicht mehr gerecht wurde.
Wolf hatte ihn gebrochen – an Körper und Seele.
Sie konnte nicht mit Gewissheit sagen, ob er seine Aufmerksamkeit immer wieder auf sie gerichtet hatte, weil er wusste, was sie getan hatte, oder weil sie diejenige war, der das Verdienst zugeschrieben wurde, ihn festgenommen zu haben. So oder so war sie heilfroh, als es vorbei war.
Rosenthal hatte »in der Blase« auf sie gewartet, dem Raum des Sicherheitspersonals am Ende des Zellengangs, und kam ihnen jetzt entgegen.
»Wir müssen Masses Zelle gründlich durchsuchen«, wies Curtis ihn an.
Der noch unerfahrene Wärter wirkte unsicher.