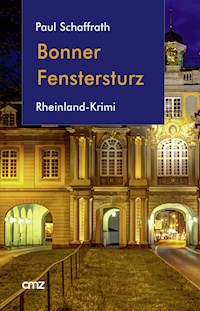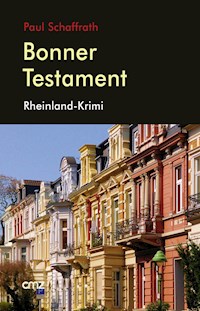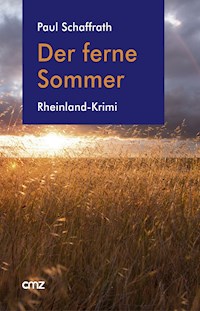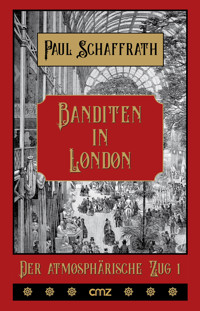Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: cmz
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Kaffee, Elbwasser und drei Leichen Der Inhaber einer Bonner Kaffeerösterei wird aus nächster Nähe erschossen; fast sieht es nach einer Hinrichtung aus. Einen Tag später ereilt den Teilhaber eines Delikatessengeschäfts in der Innenstadt das gleiche Schicksal. Kriminalhauptkommissar Krüger, auch bei seinem fünften Fall ohne Vornamen, soll die Fälle aufklären. Aber erst, als Krüger einen Zusammenhang mit einem dritten Toten in der Hamburger Speicherstadt sieht und bereit ist, sich einen lange verdrängten Abschnitt seines Lebens wieder in Erinnerung zu rufen, lichtet sich das Dunkel um die Toten aus der Feinkostbranche. Bonner General-Anzeiger zu "Hansen": "Ein menschliches, stimmungsvolles, persönliches Buch; und ein lesenswerter Krimi sowieso."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 367
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Von Paul Schaffrath sind bereits folgende Krimis erschienen:
KHK Krüger
Bonner Fenstersturz
Bonner Testament
Der Nebel von Avignon
Der ferne Sommer
KHK Max Harmsen
Die Drei Könige
Foto: Sarah Koska 2019
Winrich C.-W. Clasen, Jahrgang 1955, Studium der Romanistik, Evangelischen Theologie und Kunstgeschichte in Bonn; Verleger in Rheinbach. Seit 2011 schreibt er unter dem Pseudonym Paul Schaffrath Kriminalromane. Hansen ist sein sechster Roman.
Paul Schaffrath
Hansen
Kriminalroman
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikationin der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Datensind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2020 by cmz-VerlagAn der Glasfachschule 48, 53359 RheinbachTel. 02226-912626, [email protected]
Alle Rechte vorbehalten.
Lektorat:Beate Kohmann, Bonn
Schlußredaktion:Clemens Wojaczek, Rheinbach
Satz(Aldine 401 BT 11 auf 14,5 Punkt)mit Adobe InDesign CS 5.5:Winrich C.-W. Clasen, Rheinbach
Umschlagfoto (light-architecture-night-morning-building-city-633828):www.pxhere.com
Umschlaggestaltung:Lina C. Schwerin, Hamburg
eBook-Erstellung:Bookwire GmbH, Frankfurt am Main
ISBN 978-3-87062-317-3 (Paperback)ISBN 978-3-87062-327-2 (eBook)
001 • 20200117
www.cmz.de
www.paul-schaffrath.de
Remember me to one who lives thereShe once was a true love of mine
Bob Dylan
Inhalt
Die Hauptpersonen
Prolog
Der diensthabende Kapitän
Der Mann, der die Frauen liebt
Braune Bohnen
Zwei Meisterschüsse
Der Duft der weiten Welt
Über philanthropische Unternehmer
Statussymbole
Dolci
Keiner wäscht reiner
Genuß im Stil der neuen Zeit
Ein Beruf ohne Stechuhr
Über die Beachtung der DSGVO
Ein veraltetes Leistungsverzeichnis
Um Haaresbreite
Wo die Liebe hinfällt …
Ein sonniger Nachmittag
Haute Couture für Füße
Der Vorgang des Ertaubens nach dem Urknall
Das Geld der anderen
Ein Angestellter ohne Familiennamen
Die kleine Rasterfahndung
Geräusche der Kindheit
Das große Wasser
Und täglich grüßt …
Die pekuniäre Seite von Firmen
Whole Lotta Shakin’ Goin’ On
Wenn Götter sich einmischen
Der Ehrendoktor
Wiedersehen macht Freude
Haus Abendroth
Die Vorabendserie
Wehmut oder Wermut?
Retardierende Momente
Nebelkerzen
Die schönste Frau der Welt
Materialermüdung
Legenden
Latein
Epilog
Setlist
Nachbemerkungen
Die Hauptpersonen
Die Ermittler
Krüger, Erster Kriminalhauptkommissar – hadert mit seinem Vornamen
Carmen Rasche, Universitätssekretärin – ist beim Putzen unachtsam
Markus Schneider, Kriminaloberkommissar – liegt den Frauen zu Füßen
Die Kripo
Walther »mit th« Langenargen, Kriminaloberrat – benötigt keine Hörgeräte
Harald Kaul, Kriminalkommissar – hat alle Informationen
Roman Roselski, Polizeioberkommissar – haßt Hektik
Dieter Derenthal, Polizeikommissar – leidet an einer Halsentzündung
Die Opfer
Andreas Weyler, Firmenbesitzer – hat einen Buchstaben zuviel
Salvatore Contadino, Geschäftsinhaber – kann nicht abgeben
Hans Schmidt, Lagerarbeiter – bezahlt seine Neugier teuer
Die Täter
Michele Maria Modafferi, genannt Hinnerk – erledigt Aufträge
Alberto Modafferi, Onkel von Michele – legt selber Hand an
Raffaele Modafferi, Onkel von Alberto – ist Geldgeber
Der Arzt
Prof. Dr. Harald Altendorf, Rechtsmediziner – arbeitet an der Front
Die Angestellten
Fabian Schmücker, Praktikant – hat den Überblick
Marie Diepensiefen, Buchhalterin – macht sich Hoffnungen
Rolf Diepensiefen, Grundstücksbesitzer – wahrt seine Grenzen
Ruben »Speedy« Gonzales, Packer – braucht Geld
Anna Karenina, Packerin – lebt sich gerade ein
Lara Karenina, rechte Hand – darf bleiben
Die Hamburger
Konsul Harry Petersen, Firmenbesitzer – schwimmt in Geld
Andrea Russo, Teilhaber – hat familiäre Bande
Herr Konrad, Prinzipal – sorgt für Ordnung
Claus Möller, Lagerarbeiter – verliebt sich an der Elbchaussee
Christa Krüger, Kinderfräulein – fühlt sich sehr reif für ihr Alter
Die Zeit
April / Mai 1963
April 2019
Die Schauplätze
Bonn (auf beiden Seiten des Rheins), Hamburg (natürlich Blankenese und die Speicherstadt)
Prolog
Seinen linken Arm trug Krüger in einer Schlinge, als er ins Wohnzimmer des gemeinsamen Hauses am Bonner Venusbergweg trat.
»Da bist du ja endlich«, sagte Carmen. »Ist was passiert?«
»Das kannst du wohl sagen.« Der Kommissar stellte seinen kleinen Rollkoffer ab und ließ sich mühsam auf dem Biedermeiersofa nieder. Er stöhnte leicht. »Mir tut jeder einzelne Knochen weh.«
»Alle zweihundertsechs?« Carmen hatte in Biologie, im Gegensatz zu ihrem Freund, stets aufgepaßt.
Krüger dagegen interessierte sich für das Fach nur beruflich und nur dann, wenn er marginale Kenntnisse für Todesermittlungsverfahren benötigte. Meistens jedoch fragte er einfach den Rechtsmediziner am Bonner Stiftsplatz; Professor Altendorf wußte einfach alles. »So ungefähr«, antwortete er.
»Bist du in ein Gefecht geraten? Nicht in eines deiner üblichen mit Worten, sondern eines mit Kanonen?«
»So ähnlich.« Eigentlich hatte er keine Lust zum Reden, jedenfalls nicht sofort.
Sie legte ihren Kopf schief und betrachtete ihn aus der leicht verschobenen Perspektive zweifelnd. »Soll ich dir einen Kaffee kochen, damit du wieder auf Vordermann kommst?«
Als Antwort folgte ein zweites Stöhnen, dann sagte er: »Keinen Kaffee. Davon habe ich erst einmal genug, obwohl …« Der Kommissar beugte sich ächzend zum Koffer und zog mit einer Hand den Reißverschluß auf. Er holte ein Päckchen hervor und stellte es auf den niedrigen, mit Zeitungen und Zeitschriften sowie einem kleinen Bücherstapel bedeckten Tisch vor dem Sofa. »Ich hab dir aus Hamburg etwas mitgebracht.«
Carmen trat näher und öffnete mit geübten Griffen – schließlich brachte ihr Freund häufiger »etwas mit« – das Geschenk. Das Papier raschelte, und interessiert las sie die Aufschrift des Etiketts auf einer Packung Kaffeebohnen vor: »Guatemala La Esperanza Antigua – 100 % Arabica«. Sie warf Krüger einen spöttischen Blick zu. »Die konnten sich ja auch nicht entscheiden: Guatemala, Antigua, Arabica – was denn jetzt?«
Krüger lachte. Sein angeschossener Arm war momentan vergessen, und er wußte sehr gut, warum er so gerne nach Hause kam. »Hansen sagte, das sei der beste.«
»Wer ist Hansen?«
Und Krüger erzählte.
Der diensthabende Kapitän
Bonn, April 2019. Hinnerk war Philosoph. Einer von der stoischen, nicht der chaotischen Sorte, einer, der erst einmal alles auf sich wirken ließ, bevor er selbst handelte, einer, der das Leben so nahm, wie es gerade kam. Manchmal ließ er es auch nur an sich vorbeiziehen und sah ihm hinterher. Schade, dachte er dann, das wäre eine schöne Gelegenheit gewesen … Aber in der Regel – jedenfalls war das bisher immer der Fall gewesen – wiederholte sich eine solche Gelegenheit irgendwann, und beim zweiten Mal wußte er, daß er nun zugreifen mußte.
Hinnerk saß in der Nähe des Schlosses auf einer der Bänke unter den noch einigermaßen intakten Kastanienbäumen an der Poppelsdorfer Allee und studierte die Vortagesausgabe des Corriere della sera. Sogar in Italien nahm man das politische Geschehen im englischen Königreich zur Kenntnis und schrieb seitenweise vom Brexit. Das ging bestimmt nicht mehr lange gut. Die Südtiroler hatten seit dem Zweiten Weltkrieg einen »Tirexit« immer mal wieder versucht und waren sogar vor Bombenattentaten nicht zurückgeschreckt, was aber der erzwungenen Einheit von Südtirol und Norditalien keinen Abbruch getan hatte. Irgendwann hatte dann die zweite Generation ihre Bemühungen um Unabhängigkeit eingestellt. Und inzwischen prosperierte die Gegend sogar wieder. Mal sehen, wie lange es dauerte, bis auch die Briten begriffen, daß jede Art Abspaltung in der heutigen Zeit völlig sinnlos war. Sicher länger, als es dauerte, daß aus May December wurde.
Prüfend faßte Hinnerk in die Tasche seiner Barbourjacke. Die Glock 17 – Kaliber 9mm Parabellum – steckte dort, wo sie sein sollte, der Schalldämpfer daneben. Ursprünglich hatte er sich eine klassische Browning FN High Power besorgen wollen, die noch immer hergestellt wurde. Sie schoß ziemlich genau, war aber auch ziemlich schwer, und immer eine Keule in der Tasche zu tragen, das wollte er nun auch nicht.
Er blätterte die Zeitung um und wandte sich dem Sportteil zu. Es würde noch dauern, bis seine Zielperson auftauchte.
Hinnerk, das war doch ein schöner Name für einen blonden Hünen wie ihn, einen Meter neunzig groß, lange Haare, ein Dreitagebart, blaue Segeltuchhose, hellblaues Hemd, grauer Pullover, die Barbourjacke nicht zu vergessen, die ihm fast zu warm war. Wenn er ins Filmgeschäft gegangen wäre, wäre er bestimmt häufig als der Skipper vom Dienst beschäftigt worden. Er grinste.
Eigentlich hieß er nämlich Michele Maria Modafferi und war Italiener. Glücklicherweise waren seine Eltern zwei Jahre nach seiner Geburt nach Hamburg ausgewandert, um einem seiner zahlreichen Onkel beim Aufbau einer hanseatischen Pizzeriakette zur Seite zu stehen. Nachträglich hatte sich das als Glück herausgestellt, denn ein blonder Mann fiel im Norden entschieden weniger auf als in Süditalien. So galt er als waschechter Hamburger, was er ab und zu durch eingestreute Missingsch-Brocken bei seinen Unterhaltungen unterstrich: Zum Beispiel konnte er zu einer neuen Kellnerin im Restaurant seiner Eltern »Na, min seute Deern?« sagen und ihr freundlich aufs Hinterteil klopfen, was neuerdings leider nicht mehr ging, seit sie in Hollywood alle verrückt geworden waren und »#MeToo!« bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit schrien. Aber auch hier würde er stoisch abwarten, bis sich der Wind wieder zu seinen Gunsten gedreht hatte und die Wogen geglättet waren.
Jemand hupte.
Hinnerk sah auf.
Aber es war nur ein Taxi, das ungeduldig abwarten mußte, bis das Kaffeefahrrad, das immer vor dem Eingang zum Poppelsdorfer Schloß stand, von seinem Besitzer über die Straße geschoben worden war.
Hinnerk senkte den Kopf und vertiefte sich wieder in den Sportteil. Wo er seinen Auftrag ausführen sollte, hatte er bereits gestern überprüft: »Wwe. Arntz’ Feine Kaffeebohnen« hieß die Firma, die merkwürdigerweise nicht in einem Vorort lag, sondern fast im Zentrum, jedenfalls südwestlich davon, im großen Gründerzeitviertel, das sich Bonn Ende des neunzehnten Jahrhunderts geleistet und das Tausende neuer Arbeitsplätze und Familien zur Folge gehabt hatte. Die Kaffeerösterei in der Königstraße bestand aus dem großen Haupthaus, den Lagerräumen rechts davon, der Brennerei zum hinteren Grundstücksteil hinaus und der Packstation, wo die Ware für den Versand vorbereitet wurde – nicht zu vergessen die Räume für Buchhaltung und Geschäftsleitung. Die Fassaden der Gebäude war im blassen, über die Jahrzehnte mehrfach überstrichenen Mattweiß der Wende zum zwanzigsten Jahrhundert gehalten.
Die Villa von Andreas Weyler, dem Besitzer, lag um die Ecke in der Argelanderstraße, zwei Minuten entfernt. Der Mann hatte keine Familie, so daß nach Hinnerks, nun, Eingriff seine Räumlichkeiten ab morgen wieder frei sein würden.
Der Sportteil bot auch nichts wirklich Interessantes. Hinnerk wandte sich den Kulturnachrichten zu.
Von irgendwoher schlug eine Kirchturmuhr. Der Italiener von der Waterkant sah auf die Uhr. Schon sechs. In etwa zwei Stunden würde es dunkel sein. Wenn er Weyler im Lager erledigte, würde man ihn bestimmt erst morgen finden – Zeit genug, um in aller Seelenruhe aus Bonn zu verschwinden und die Heimreise anzutreten. Hinnerk fühlte in seiner anderen Jackentasche nach dem Magazin. Lieber auf Nummer sicher gehen. Der Behälter mit den siebzehn Patronen lag da, wo er sich schon bei den anderen viertelstündlichen Überprüfungen befunden hatte. Der blonde Hüne überlegte kurz, ob das Sich-Vergewissern Zeichen seiner Nervosität war, tat den Gedanken aber als unnütz ab. Er war einfach nur sorgfältig, wie immer. Sorgfalt verhalf zum Erfolg. Und bisher war alles stets gut ausgegangen. Der kölsche Satz »Et hätt noch immer jot jejange« hätte sicher in seine Philosophie Eingang gefunden, wenn er ihn gekannt hätte.
Ein leichter Wind war aufgekommen, und die Zeitung raschelte. Etwas wie Frösteln kannte Hinnerk nicht, dafür war es in Hamburg einfach immer zu zugig, so daß er abgehärtet war. Dauernd wehte dort ein leichter Wind aus Südwest, gegen den sich die Einheimischen mit einem Südwester zu schützen suchten – zumindest die, die mit einem Schiff unterwegs waren. Falls sie über Bord gingen, konnte man sie aufgrund der gelben Farbe des Kleidungsstücks rasch ausmachen – so hatte es ihm jedenfalls seine Mutter in einem ihrer seltenen Anfälle von Humor zu erklären versucht. Die andere Hälfte der Hanseaten ignorierte den Wind an der Elbe wie auch die meisten anderen Dinge im Leben: die Kaufleute aus Bremen beispielsweise, die sich nach Hamburg verirrt hatten, oder den Abstieg des HSV aus der Bundesliga, den man nach dem Wiederaufstieg einfach vergessen würde.
Ein Herr in Jeans und Lederjacke kam gerade aus Richtung der kleinen Straße gegenüber; Venusbergweg oder so ähnlich, hatte Hinnerk vorhin auf dem Straßenschild gelesen. Er stolperte über eine leere Bierdose, fing sich aber sofort wieder und setzte seinen Weg Richtung Innenstadt fort.
Der Hüne blätterte die Zeitung wieder um, warf einen Blick auf die nunmehr letzte Seite und faltete das Blatt zusammen. Mit einem eleganten Wurf versenkte er die Ausgabe der größten italienischen Tageszeitung im Papierkorb neben der Bank. Anschließend holte er sein Handy aus der Tasche, ein Smartphone neueren Datums von Motorola, und studierte die eingetroffenen E-Mails. Eine erregte seine Aufmerksamkeit. Sie war mit »Nachschub erbeten« überschrieben und enthielt nur ein paar Stichworte. »Keine Abreise aus Bonn. Anwesenheit vor Ort weiter erforderlich. Nähere Instruktionen folgen.« Zio Alberto war anscheinend dem Telegrammzeitalter noch immer nicht entwachsen. Aber ansonsten war sein Onkel schon in Ordnung.
Der Stoiker nickte unmerklich. Ein neuer Auftrag bedeutete neues Geld. Vielleicht konnte er sich dann wirklich in den kommenden Jahren zur Ruhe setzen und in Stade endlich ein italienisches Feinschmeckerrestaurant eröffnen. Das Glück ist mit den Tüchtigen!
Das Handy zeigte neunzehn Uhr. Irgendwie ähnelte die Wartezeit auf der Bank an der Poppelsdorfer Allee der im Wartezimmer einer Arztpraxis. Hatte man sich erst einmal damit abgefunden, daß das Warten viel länger als die Behandlung dauerte, war auch schon beides vorbei.
Hinnerk stand auf. Sich etwas umzusehen, konnte nicht schaden, rasch noch einen Blick auf das Haus, die Umgebung und den Fluchtweg werfen, bevor es losging.
In der Barbourjacke warteten die beiden Teile seiner Waffe geduldig auf ihren Einsatz.
Der Mann, der die Frauen liebt
Bonn, April 2019. Daß die Leute auch immer ihren Müll überall herumliegen ließen. Für die Bierdose hätte man doch noch das Pfandgeld zurückbekommen. Krüger überlegte kurz, sie aufzusammeln, entschied sich aber dagegen. Für fünfundzwanzig Cent klebrige Finger zu bekommen, wollte er nicht riskieren. Der Herr auf der Bank dagegen hatte es richtig gemacht: Mit einem knappen, kurz gezielten Wurf hatte er seine Zeitung in den Abfallbehälter in etwa anderthalb Meter Entfernung befördert. Es gab doch noch vernünftige Zeitgenossen.
Der Bonner Kriminalhauptkommissar befand sich auf dem Weg zu einem Treffen mit seinem Kollegen Schneider. Treffen bedeutete, man würde in einer der zahllosen Bonner Kneipen oder in einem Restaurant etwas trinken und vielleicht etwas essen – beziehungsweise heute bestimmt etwas essen, da seine Freundin Carmen ihren monatlichen Buchklubabend hatte und ihm daher keine Vorschriften über Menge und Art seines Abendessens machen konnte. (»Denk an deine Linie.«) Aber wahrscheinlich reichte ihre innere Anwesenheit aus, um Krüger zur Mäßigung anzuhalten.
Kurz nach sieben. Markus würde wie immer warten, wenn sein Freund und Vorgesetzter das akademische Viertel zur Gänze ausnutzte, denn zum verabredeten Zeitpunkt würde er es jetzt nicht mehr schaffen; bis zum »Treppchen« in der Weberstraße brauchte man schon eine Viertelstunde zu Fuß. Deutsche Küche einmal in der Woche war auch gut und in der Gaststätte von 1883 besonders.
Krüger lief das Wasser im Mund zusammen. Er hatte den ganzen Tag nichts Vernünftiges gegessen und statt dessen im eigenen Haus die Möbel umgeräumt. Carmens Vermieterin war vor einem halben Jahr gestorben, hatte aber vorher ihr Haus am Venusbergweg, in dem Kommissar und Universitätssekretärin zusammen wohnten, an die beiden verkauft, so daß Krüger endlich sein Domizil in der Adolfstraße über der Bäckerei, das er seit fast zwanzig Jahren bewohnt hatte, aufgegeben hatte und mit Sack und Pack bei Carmen eingezogen war. Immerhin hatte er sein neues Zimmer fast genauso wie das alte in der Nordstadt eingerichtet: Der alte Lehnstuhl stand neben dem niedrigen Tischchen, auf dem sich immer die Zeit-Ausgaben der letzten Wochen türmten; an der Wand hing ein großes Konzertfoto von Dylan und Santana, und eine Schlafcouch lud zu Pausen und Rückenentlastungen ein. An der Wand befand sich das alte Bücherbord mit Bildbänden von Hamburg und von seinen Reisen; die wenigen Kriminalromane waren nach dem Umzug noch nicht wieder sortiert. Innerlich würde er wohl zu einem kleinen Teil immer Junggeselle bleiben. Einen Rückzugsort brauchte jeder.
Der Kommissar wartete geduldig vor der Schranke am Bahnübergang Kaiserstraße. Er hatte keine Lust, durch die leicht angeschmuddelte Fußgängerunterführung zu gehen, und ließ sich lieber den durch einen überlangen Güterzug verursachten Wind um die Nase wehen. Mußte Schneider eben länger warten …
Das »Indochine« kurz hinter der Kreuzung von Weber- und Kaiserstraße war glücklicherweise dauerhaft geschlossen; er war vor langen Jahren einmal mit Carmen dort gewesen – die Cocktails waren gut, teilweise sogar sehr gut gewesen, aber das Essen hatte man vergessen können.
Krüger öffnete die Eingangstür zum »Treppchen« und stand sofort in dem holzgetäfelten Schankraum. Die Dielen knarrten, wie es sein sollte, und die ellenlange, an beiden Seiten gerundete Theke war gut besetzt. Schneider winkte ihm von einem der Holztische Richtung Wintergarten zu und deutete auf einen Platz neben sich.
Krüger war nicht zum ersten Mal hier, und dennoch betrachtete er erst wieder einige der gerahmten Genreszenen an der Wand, ehe er sich setzte. »Moin, moin, mein Lieber«, sagte er. »Lange nicht gesehen.«
Morgens hatten die beiden allerdings noch an der üblichen Lagebesprechung im Polizeipräsidium teilgenommen, aber wie bei jedem briefing in dieser Woche nichts Neues erfahren. Das Wetter Ende April 2019 war einfach zu schön für Schwerkriminalität: Die Bonner Rocker waren mit der friedlichen Vorbereitung der großen Beerdigung eines der ihren beschäftigt; die Drogendealer waren größtenteils vom Hofgarten zum Kaiserbrunnen abgewandert – in der Einkaufspassage unter dem neuen Maximiliancenter war es ihnen jetzt zu hell –, und illegale Autorennen konnten in Bonn zur Zeit nicht stattfinden, da der Cityring aufgrund der vielen Baustellen fast überall von zwei- auf einspurig verengt war. Die Polizei baute Überstunden ab, und die einzige Kriminalität im Polizeipräsidium fand momentan bei den Lesungen einiger »Kriminalschriftsteller« statt, wie sich das bunte Völkchen von haupt- und nebenberuflichen Autoren titulierte.
»Hallo«, gab Schneider zur Antwort. »Wir sind hier nicht an der Nordsee.«
»An der Küste heißt es nur moin«, sagte Krüger. »Einmal. Sonst gilt man als geschwätzig. Und als ehrbarer Hamburger darf ich doch wohl den Gruß, den ich seit Muttermilchzeiten beherrsche, überall verwenden.«
Manchmal nervte sein Freund, fand Schneider. Hamburger waren nicht automatisch die besseren Menschen. Aber dieser hier war schon ein besonderer Mensch, obwohl er einen Grammatikfimmel besaß. Mal sehen, wie lange es dauerte, bis eine entsprechende Bemerkung kam.
Die Kellnerin brachte die Speisekarten. Schneider warf sie einen freundlichen Blick zu.
Sein Freund war eben a ladies’ man, dachte Krüger. Irgendwie fielen die Frauen reihenweise auf seine dunkelbraunen, leicht zu langen Haare und sein schiefes Grinsen herein.
»Ich weiß schon«, sagte Schneider zu ihr.
»Der Nebensatz fehlt«, sagte Krüger. »Was ich nehme. Was ich gerne äße, wenn ich etwas bekäme. Wonach mir der Sinn steht. Der Varianten, korrektes Deutsch zu reden, gibt es viele.«
»Versteht dich eigentlich jemand, wenn du ihn verhörst?«
Statt einer Antwort vertiefte sich der Kommissar in die Lektüre der Speisekarte, um nach ausgiebigem Studium wie immer beim »Salat Bonner Markt mit Rindfleischstreifen« zu enden.
»Wenn du sowieso immer das Gleiche ißt – warum liest du dann überhaupt noch die Auflistung der Gerichte?«
»Ich gebe die Hoffnung nicht auf, daß irgendwann, plötzlich, unversehens, in der Rubrik Fisch eine Scholle Finkenwerder Art auftaucht.«
»Das kannst du dir abschminken. Hier in Bonn kriegst du höchstens Aal. Aus dem Rhein.«
Die Kellnerin kam von der Theke zurück und stellte ein großes Hefeweizen vor Schneider auf den Tisch. Ein zweiter, ziemlich freundlicher Blick folgte. Krüger bekam seinen Grauburgunder ohne Blick. »Wohlsein, die Herren.«
»Dazu sage ich jetzt nichts«, sagte er.
»Umgangssprache reicht in der Regel aus«, sagte Schneider, »um sich verständlich zu machen. Aber lassen wir das jetzt mal. Was gibt’s Neues?«
Krüger berichtete gehorsam vom Möbelräumen.
»Und heiraten wollt ihr nicht?«
»Warum? Wir wohnen doch ohnehin schon zusammen und teilen Tisch wie Bett.«
»Na ja. Erhöhtes Gehalt. Größere Rente. Krankenhausinfos über den Partner.«
»Bekomme ich auch so. Ich muß nur meine Dienstmarke vorzeigen.«
Sein Freund grinste. »Falls du dann aber an Oberschwester Hildegard gerätst, hast du schlechte Karten. Da kommst du nur mit einem Trauring weiter.«
Krüger lachte und nippte an seinem Wein. »Ich kann ja mal mit Carmen reden.« Daß seine Freundin das Thema regelmäßig aufs Tapet brachte, verschwieg er, weil er selber nicht wußte, was er wollte. Dabei hatte er sich nach neun Jahren mit seinem endgültigen Einzug in Carmens Wohnung beziehungsweise ins gemeinsame Haus eigentlich entschieden. Zu zweit alt zu werden, war einfach viel schöner. »Und bei dir?« versuchte er das Gespräch in ungefährlichere Gefilde zu lenken.
Markus war ein On-Off-Mann. Er entflammte rasch für eine neue Frau, für die er fast sein gesamtes vorheriges Leben aufzugeben bereit war. Daß es dabei ständig beabsichtigte oder unbeabsichtigte Kollateralschäden gab, schien ihn nicht sonderlich zu berühren. Nach seinem etwas längeren Intermezzo mit der wunderschönen Französin Élodie Marin aus und in Villeneuve-lés-Avignon, die seinetwegen von der Provence sogar nach Beuel gezogen war und für die Markus allen Ernstes überlegt hatte, seinen Bonner Beamtenstatus zugunsten einer Winzerkarriere an der Rhône aufzugeben, war er reumütig an den Rhein zurückgekommen. Eine Rückkehr an den mütterlichen Busen seiner früheren Freundin Lene war allerdings zu Recht gescheitert. So hielt er sich denn mit kleineren Affären über Wasser. Irgendwie tat er Krüger leid. Markus konnte wunderbar mit Kindern umgehen, aber er mußte lernen, den Adler auf dem Dach zugunsten des Kanarienvogels in der Hand zu vergessen.
»Och, nichts Neues«, sagte Schneider abwesend und betrachtete die Kellnerin hinter der Theke.
»Die ist zu jung für dich«, sagte Krüger, der dem Blick gefolgt war. »Wahrscheinlich eine Studentin. Jura oder so.«
»Dann hätten wir ja schon mal zumindest die Kenntnis der Gesetze gemeinsam.«
»Und was wollt ihr dann in dreißig Jahren machen, wenn du achtzig bist, alles vergessen hast und sie erst fünfzig?«
Schneider lachte. »Ganz so schlimm ist es nicht. Weißt du, was ich wirklich gerne machen würde?«
»Privat oder beruflich?«
»Letzteres natürlich. Eine richtig schöne kleine Mordermittlung durchführen. So herumzugammeln, bringt doch nichts. Zwar sind dann irgendwann die Aktenberge abgearbeitet, aber das wirkliche Leben findet doch draußen statt, an der frischen Luft!«
»Recht hast du«, pflichtete ihm Krüger bei, dessen letzter großer Fall der des ermordeten Eifelbauern 2016 gewesen war, wenn man die Geschichte mit dem goldenen Hörgerät vom letzten Frühjahr nicht mitzählte. »Ich würde mir aber dringend wünschen, beziehungsweise ich tue es jetzt ausdrücklich: In der nächsten Mordkommission möge doch bitte jemand die Herren Roselski und Derenthal ersetzen. Stell dir nur vor, wir müßten über die gesamte Dauer der Ermittlung ständig Liedzitate aus den siebziger Jahren anhören. Du erinnerst dich an den dicken Streifenpolizisten?«
Schneider seufzte. »Und ob. Aber was stört dich an der Musik?«
»Überhaupt nichts. Aber anzuhören ist sie nur, wenn sie von der Originalkapelle vorgetragen wird. Nicht von diesem Dilettanten.«
»Hoffen wir das Beste.« Schneider hob sein Glas. »Wie gesagt, eine kleine Mordermittlung.«
Die beiden konnten nicht ahnen, wie rasch ihr Wunsch in Erfüllung gehen würde.
Braune Bohnen
Bonn, April 2019. Ein gellender Schrei hallte durch das Lager der Kaffeerösterei. Marie Diepensiefen zitterte am ganzen Leib und deutete auf eine zusammengesunkene Gestalt zwischen den Jutesäcken mit den brasilianischen Kaffeebohnen. »Da, da, da …«, stotterte sie.
»Trio, oder?« sagte der Praktikant zu niemandem Bestimmten. Er interessierte sich für die Musik der Achtziger und nannte zu Hause schon eine beachtliche Vinyl-Sammlung sein eigen. Neugierig trat er näher.
Die Buchhalterin drehte sich um und barg ihren Kopf an der Brust des Praktikanten, der verlegen seine Arme um die ältere Frau legte und begütigend sagte: »Na, na, na.« Vorsichtig linste er über die ondulierten Haare von Frau Diepensiefen und versuchte, etwas im Halbdunkel zu erkennen. Plötzlich schaltete jemand die helle Deckenbeleuchtung ein, und er fuhr zusammen, woraufhin die Buchhalterin sich von ihm löste und aus der Halle rannte.
»Eins eins null«, rief sie laut. »Eins eins null. Ich erledige das.«
In der Tür kollidierte sie mit drei Packerinnen, die vom Lärm angelockt worden waren und nun, jeweils mit einer Hand über dem Mund, wie angewurzelt stehenblieben, als sie die Szene in sich aufgenommen hatten.
»Wer ist es denn?« fragte schließlich eine der drei Frauen und deutete auf die Leiche.
»Direktor Weyler«, sagte der Praktikant. Er war erfahrener Ego-Shooter. So schnell konnte ihn kein Toter aus dem Konzept bringen. »Kopfschuß. Vielleicht auch zwei. Nach meinem Dafürhalten jedenfalls.«
Eine der Packerinnen schluchzte auf und wischte sich mehrere Tränen aus den Augen.
Wahrscheinlich hat sie sich Hoffnungen gemacht, dachte der Praktikant. Junge mittellose Frau himmelt reichen Fabrikanten an und wird am Ende des Films von ihm erhört. Man liest das ja immer wieder. Daß er bei seinen Überlegungen verschiedene Genres durcheinanderwarf, störte ihn dabei nicht weiter.
»Was’n los?« fragte der untersetzte Mann, der gerade in die Halle gekommen war und sich an den Frauen vorbeidrängelte. Die Menge war inzwischen größer geworden; eigentlich war jede Art Abwechslung im eintönigen Packeralltag willkommen.
»Ey, Speedy«, sagte jemand zu ihm, »paß auf, wo du hintrittst!«
Ruben Gonzales richtete sich zu seiner vollen Größe von einem Meter fünfundsechzig auf und sagte: »Paß selber auf! Du stehst ja auch mitten im Weg. Und leg dich mit mir nicht an!« Befriedigt registrierte er, wie man ihm Platz machte. Vor der Leiche blieb er stehen. »Der ist tot«, sagte er fachmännisch. »Als ich noch in Kolumbien gearbeitet habe—«
»Kennen wir«, unterbrach ihn der Praktikant. »Du hast kistenweise weißes Pulver verpackt.«
Gonzales sah ihn empört an. »Du weißt gar nichts.«
Draußen war Sirenengeheul zu hören, und zwei Minuten später liefen zwei Streifenbeamte in die Halle. »Was’n los?« fragte der dickere der beiden.
»Ich mach das schon, Dieter«, sagte der jüngere Polizist.
»Okay, Roman, aber nur, weil du es bist.« Der Dicke machte bereitwillig Platz.
»Roman Roselski«, sagte der Jüngere. »Und das ist mein Kollege Dieter Derenthal.«
Der Praktikant verkniff sich ein Grinsen. »Zwei Rs, zwei Ds – R2D2«, flüsterte er Gonzales ins Ohr, der seinerseits grinste und dabei eine Reihe fleckiger, vom Tabak geschädigter Zähne zeigte.
Roselski betrachtete den Toten und beugte sich dann über ihn. »Sieht nach einem Schuß aus nächster Nähe aus.«
»Das Blut ist schon eingetrocknet«, sagte der Praktikant. »Ich würde mal sagen, der Schuß ist vor etwa«, er sah auf die große Wanduhr über dem Eingangstor, die acht Uhr zwanzig anzeigte, »zwölf Stunden abgegeben worden. Kann man am Rot der Wundränder sehen.« Er nickte energisch, wie um seinen Worten Nachdruck zu verleihen.
Derenthal sah ihn überrascht an. »Sind Sie vom Fach?«
»Nicht direkt«, antwortete der junge Mann. »Grand Theft Auto.«
Der dicke Polizist sah ihn verständnislos an. »Und das heißt?«
Roselski grinste. »Der junge Mann hat Erfahrung mit gewalttätigen Computerspielen.«
»Gewalttätig, naja«, sagte der Praktikant.
»Und jetzt?« Derenthal sah seinen Kollegen fragend an.
»Clear the lobby!« imitierte Roselski den Speaker des englischen Parlaments, auch mit der entsprechenden Lautstärke.
Derenthal, der kein ausländisches Fernsehen verfolgte, warf Roselski einen verständnislosen Blick zu.
»Los, los, Mann.« Manchmal wurde es dem jüngeren Beamten zu viel mit seinem Kollegen. »Räum mal die Halle.«
»Geht doch«, murmelte Derenthal. »Immer und überall alles auf Englisch … ts, ts. Der Deutsche redet deutsch.« Letzteres versickerte aber in seinem nicht vorhandenen Bart und war ohnehin nicht politisch gemeint. Dazu hatte der dicke Streifenbeamte eine viel zu exakte Meinung zu Zeitgenossen, die nicht nachdachten und nur mit Führer durch die Gegend laufen wollten. Er scheuchte die kleine Menge aus der Halle und befestigte dann ein polizeiliches Absperrband am offengebliebenen Tor. »Und jetzt?«
»Jetzt rufen wir Krüger an«, sagte Roselski. »Der wohnt doch hier um die Ecke. Er kann weitermachen. Und du bist exkulpiert.«
Derenthal schüttelte den Kopf. Irgendwann reichte es mit Fremdwörtern.
Krüger gähnte und streckte sich. Schon acht. Noch hatte er aber Zeit für ein kleines Frühstück mit Carmen und käme anschließend mit der Straßenbahn trotzdem pünktlich um neun ins Polizeipräsidium in Ramersdorf. Die morgendliche Besprechung, die allerdings gerade begonnen hatte, würde wie seit Tagen – oder waren es nicht schon Wochen? – unergiebig sein, so daß Walther »mit th« Langenargen, sein Chef, bestimmt darüber hinwegsehen würde, wenn er ihm sagte, daß er für einen alten Fall ins Bonner Stadtarchiv hatte fahren müssen. Notlügen seien erlaubt, das hatte zumindest Martin Luther gesagt, wenn das auch schon etwas länger her war.
Es duftete verheißungsvoll nach Kaffee, als Krüger sich an den neuen Eßtisch in der geräumigen Wohnküche setzte. Jetzt, wo sie zwei Stockwerke bewohnten, hatten sie endlich für ihren Lieblingsraum mehr Platz. Alle guten Feiern fanden ohnehin in der Nähe des Herdes statt. Eigentlich brauchte man nur eine gemütliche Küche und ein großes Bett zum Glücklichsein.
Carmen hatte Brötchen aufgebacken und reichte Krüger eines, das beim Durchschneiden noch dampfte. Sie fing seinen Blick auf und sagte: »Das heißt auf Indianisch: Wir graben das Kriegsbeil aus.« Sie verfolgte die kleine Wolke, die sich bis zum Erreichen der Zimmerdecke längst aufgelöst hatte, und fügte hinzu: »Nein, warte, ich korrigiere: Wir haben den falschen Hasen von gestern unter die Erde gebracht.«
Krüger lachte. Eine Ehe war doch ganz nett, zumal er durchaus an der langen Leine gehalten wurde und immer wieder alleine unterwegs sein konnte oder im Wohnzimmer seinen Lieblingswhisky trinken durfte. Wobei er nicht Brief und Siegel für das liederliche Zusammenleben ohne Trauschein mit Carmen benötigte. Andererseits … Vielleicht sollte doch einmal er über einen Antrag nachdenken, ehe sie die Zeichen der Zeit erkannte und ihn entweder vor die Tür setzte – bei den modernen Frauen von heute wußte man ja nie – oder ihm ihrerseits mit einem eigenen Antrag zuvorkam. Und das paßte ja nun gar nicht, fand Krüger. Anträge waren etwas für wahre Männer, die sich trauten, sich trauen zu lassen.
Als er gerade zu seiner zweiten Tasse Kaffee greifen wollte, klingelte es an der Haustür Sturm. »Jaja«, sagte der Kommissar. »Immer sutje; ich komme ja.«
Ein zweites Sturmklingeln folgte.
Krüger ging zur Tür und öffnete. Etwas verständnislos studierte er das rote Gesicht von Dieter Derenthal, der nach Luft japste. »Wollen Sie nicht hereinkommen? Sie sehen ja völlig erledigt aus; dabei hat der Tag erst angefangen.«
»Sie … müssen … sofort … kommen«, stieß der dicke Polizist hervor.
»Ich muß gar nichts«, sagte Krüger etwas schärfer als beabsichtigt.
»Doch.« Derenthal holte tief Luft. »Drüben, in der Kaffeerösterei.« Er schwieg und schien den Faden verloren zu haben.
»So«, sagte der Kommissar, »jetzt kommen Sie doch erst einmal herein, setzen sich und trinken ein Glas Wasser. Dann sehen wir weiter. In Ihrem jetzigen Zustand kann man ja gar nichts verstehen.« Er bugsierte Derenthal in die Küche, nötigte ihn auf einen Stuhl und ließ eiskaltes Wasser in ein Glas laufen. »Austrinken!«
Mit sinnvollen Befehlen war Derenthal schon immer gut klargekommen; dann mußte er nämlich nicht selbst denken. Er kam Krügers Aufforderung nach und leerte das Gefäß in einem Zug. Dann wischte er sich den Mund ab und sagte: »Tut mir leid, aber Aufregung – und gleichzeitig Sport – ist nichts mehr für mich.«
Krüger unterdrückte ein Grinsen. »Ihr Kollege hätte doch auch kommen können, oder?«
»Der hat schon die Spurensicherung verständigt und mit Ihrem Chef telefoniert.«
»Was ist denn eigentlich los?«
»Der Besitzer der Kaffeefirma ›Wwe. Arntz’ Feine Kaffeebohnen‹ ist erschossen worden.«
Carmen hörte aufmerksam zu und fragte dann: »Und wo soll ich jetzt meinen Kaffee kaufen?«
Zwei Meisterschüsse
Bonn, April 2019. Krüger trank seinen Kaffee im Stehen aus. Beeilen mußte er sich nicht wirklich, da der Tote tot war und Derenthal nichts von Verdächtigen, die möglicherweise noch in der Nähe herumlungerten, gesagt hatte. Zusammen mit dem dicken Polizisten ging der Kommissar das kurze Stück am Poppelsdorfer Weiher entlang, überquerte die Kreuzung von Königstraße und Venusbergweg, passierte das »Bistrot Sud«, in dem er vor neun Jahren, als der Laden noch »Rietbrocks Weinhaus« hieß, den ersten Abend mit Carmen verbracht hatte, und betrat schließlich das Gelände der Kaffeerösterei. Er konnte nur einen kurzen Blick auf die schöne Gründerzeitfassade werfen, die mit ihren Spitzbogenfenstern eher an eine neugotische Kirche denn an eine Firma erinnerte, weil er sofort von Roselski in Beschlag genommen wurde.
»Es sieht übel aus«, sagte der Streifenpolizist.
»Geht es etwas genauer?«
»Na ja, der Tote. Und so.« Roselski verstummte. Er fühlte sich immer unsicher, wenn die Hierarchie in der Nähe war.
Krüger beschloß, sich selbst ein Bild zu verschaffen. »Führen Sie mich bitte zum Leichenfundort.«
Daß die Leute immer die Terminologie der Lehrbücher verwendeten, dachte Roselski. Andererseits – Tatort klang nach Sonntagabendfernsehen. Wahrscheinlich hatte der Kommissar mit seiner nüchternen Sprache recht. Gehorsam marschierte er vorweg und dirigierte Krüger durch ein im Originalzustand belassenes Kontor aus dem neunzehnten Jahrhundert – samt erhöhtem Podest für den Oberbuchhalter – und durch die Rösterei mit ihren großen Maschinen, die glänzten, als ob sie erst gestern montiert worden waren, bis zu einer kleineren Lagerhalle mit ihren Jutesäkken und einer hölzernen Lastenkarre.
Der Kommissar kam sich vor, als ob er in einem Industriemuseum gelandet wäre. Aber »Wwe. Arntz’ Feine Kaffeebohnen«, eine Institution in der Südstadt seit 1837, die mehr oder minder unbeschadet zwei Weltkriege überstanden hatte, war höchst lebendig und bei den Bonnern, aber auch weit darüber hinaus, in ganz Deutschland, beliebt, der Kaffee hervorragend und die Preise fair. Auch er schätzte den Kaffee, den Carmen immer mal wieder im Werksverkauf erstand.
Also kein Museum.
Krüger schnupperte. Feinkostläden hatten es ihm schon immer angetan, und Kaffeeläden ganz besonders. Sie dufteten nämlich vielversprechend, anders als Teeläden, in denen man den Geruch des Tees erst wahrnahm, wenn man seine Nase tief in eine Dose mit den getrockneten, geschroteten Blättern steckte. Schon im Kontor roch es hier nach Kaffeeröstung: ein leichter Hauch von gebrannten Mandeln, ein oder zwei versehentlich zu schwarz getoastete Kaffeebohnen, heißer Zucker und die tatsächlich noch per Dampf betriebenen Maschinen. Und heißes Öl. Ihm lief das Wasser im Mund zusammen.
Vor der abgesperrten Halle warteten einige Angestellte gespannt darauf, wie es weiterging. Roselski zeigte auf den Praktikanten. »Der junge Mann ist der Meinung, daß der Tote schon seit gestern Abend, äh, tot ist.« Er wartete auf eine Reaktion seines Vorgesetzten.
Krüger aber nickte nur und näherte sich der Leiche.
Andreas Weyler war, wohl durch den Schuß bedingt, auf den Rücken gestürzt. Das Einschußloch befand sich in der linken Schläfe; die rechte Kopfhälfte war praktisch nicht mehr vorhanden, wie Krüger sah, als er sich vorsichtig über den Toten beugte. Wahrscheinlich hatte der Täter seine Patronen an der Spitze aufgebohrt, damit die Verletzung größer war. Wie hatte es im Handbuch für Waffenkunde geheißen? »Beim Einschlag in das Ziel pilzt die Geschoßspitze auf und zerlegt sich teilweise; dadurch wird die Energie sehr schnell abgegeben, und die Gefahr des Durchschlags durch das Zielmedium besteht nicht mehr.« Effiziente Arbeit, dachte er. Sieht nach einem Profi aus. Möglicherweise.
Am Tor entstand Unruhe, und Krüger drehte sich um.
»Wenn Sie mich bitte durchlassen wollen, damit ich meine Arbeit tun kann, oder?« Seine sonore Stimme verschaffte Professor Altendorf augenblicklich freie Bahn. Er bückte sich leicht, um unter dem Absperrband hindurchzutreten, und kam auf den Kommissar zu. »Herr Kriminalhauptkommissar, wie nett, Sie bei der Arbeit anzutreffen. Oder?«
Krüger war sich nie sicher, wieweit die Sätze des Bonner Rechtsmediziners reine Ironie waren. »Ganz meinerseits«, sagte er daher vorsichtig. »Sie kommen sogar persönlich!« Das war jetzt wieder stilistisch völlig mißglückt. Unpersönlich konnte man ja nicht kommen, außer vielleicht über Skype.
Altendorf überhörte Krügers Lapsus. »Es ist immer gut, regelmäßig selbst an der Verbrecherfront aufzutauchen, sonst verliert man den Bezug zur Realität.« Er trat an den Toten heran. »Hat schon jemand Bilder gemacht?« Er sah sich fragend um.
»Ich«, sagte der Praktikant, der, von der Hofseite kommend, unversehens hinter Krüger aufgetaucht war. Er hielt dem Kommissar sein Handy hin.
»Das geht ja nun gar nicht.« Krüger war wütend. »Und schon alles in die unsozialen Netzwerke hochgeladen, oder?«
Der Praktikant schüttelte den Kopf. »Dort treibe ich mich nicht herum. Facebook ist nur noch etwas für über Sechzigjährige«, er warf Krüger einen prüfenden Blick zu, »Instagram etwas für Kindergartenmütter, die die schönsten Kuchenbilder teilen wollen, Snapchat verstehe ich nicht, und Twitter … Wenn selbst die amerikanische Präsid-Ente dort ihren Müll absondert, ist das für mich ein Grund mehr, das Programm nicht zu benutzen.« Er zeigte auf sein Mobiltelefon. »Das hätte ich gerne zurück, wenn Sie’s nicht mehr brauchen.«
Krüger hatte die Galerie-App des Smartphones aufgerufen und scrollte durch etwa zwanzig Fotos von der Leiche, der Halle und der Schaulustigen. Die Bilder waren von einer bemerkenswerten Qualität.
Der Praktikant sah, wie der Kommissar anerkennend nickte, und sagte bescheiden: »Huawei.«
»Gesundheit«, sagte Derenthal, der das Handy neidisch betrachtete.
Roselski grinste.
Zwei Männer von der Spurensicherung in weißen Ganzkörper-Overalls kamen in die Halle gelaufen. »Macht Platz. Weg da. Nicht so dicht an die Leiche. Ihr kontaminiert die gesamte Szenerie!«
Zweistimmig klangen die Sätze sogar musikalisch, dachte Krüger. Gehorsam trat er zur Seite, um Altendorf und die Leute von der KTU ihre Arbeit machen zu lassen.
Der Rechtsmediziner kniete sich hin und deutete auf das Einschußloch. Dann sagte er etwas zu den beiden Männern, die ihn überrascht ansahen. Einer der beiden holte aus dem mitgebrachten Koffer ein Vergrößerungsglas und reichte es Altendorf. Dieser wiederum hielt es über die linke Schläfe des Toten, angelte einen Kugelschreiber aus seiner Brusttasche und stellte augenscheinlich die Verlängerung des Schußkanals nach – aus dem Kopf der Leiche in die Luft davor. Fragend sah er auf.
»Könnte sein«, sagte schließlich einer der beiden weißgekleideten Techniker.
Altendorf erhob sich wieder und drehte sich dem Kommissar zu. »Sie haben zugesehen?«
Krüger nickte. »Aber nichts verstanden.«
»Lehrling und Meister«, sagte der Rechtsmediziner jovial. »Ich verstehe.« Er zwinkerte Krüger zu. »Wenn mich nicht alles täuscht, sind zwei Schüsse gefallen. Der zweite war so genau gezielt, daß er fast den gleichen Weg wie der erste genommen hat. Genaueres kann ich erst nach der Obduktion sagen. Sagen wir um drei?«
Der Kommissar überlegte, ob er blaß werden sollte, entschied sich aber dagegen. Ihm würde bestimmt etwas einfallen, um seine Teilnahme an der Leichenöffnung zu umgehen. Die Nummer mit Schneiders rechtzeitigem Telefonanruf, um ihn zu einem dringenden Fall dazuzuholen, also von der Obduktion wegzurufen, funktionierte ja nicht mehr; Altendorf hatte ihn schon beim zweiten Mal durchschaut. Hoffentlich kam er auf einen neuen Ausweg. Es gab keine Hilfe – wie immer im Leben.
»Ein Profi«, sagte Schneider, der so leise hinter Krüger getreten war, daß dieser zusammenfuhr.
»Mann, mich so zu erschrecken«, sagte der Kriminalhauptkommissar und legte die Hand auf seine Brust, dorthin, wo er das Herz vermutete. »Du bist bloß Kriminalkommissar. Du darfst das Leben deines Vorgesetzten nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Mein Herz arbeitet nach Carmens Kaffee heute morgen zu Hause und dem Kaffeeduft hier ohnehin schon auf Hochtouren.«
»Soll ich einen Stuhl holen?« fragte Altendorf. Sein Grinsen war nur noch als dreckig zu bezeichnen.
Der Duft der weiten Welt
Hamburg, März 1963. Claus Möller hatte die Nase gestrichen voll. Das war jetzt die zweite Abmahnung in dieser Woche gewesen, die ihm sein Vorgesetzter verpaßt hatte. Und dabei hatte er sich nichts zu Schulden kommen lassen; er war nur wieder zu spät zur Arbeit gelangt. Und erneut hatte es nicht an ihm gelegen: Die Werkshalle von Menck & Hambrock in Ottensen, in der er arbeitete, war fußläufig in gut zehn Minuten von der S-Bahn-Station Bahrenfeld zu erreichen. Wenn ihm allerdings die Bahn in Othmarschen, weil sie zu früh gekommen war, vor der Nase davonfuhr, war das nicht seine Schuld. Er hatte bei einem Freund übernachtet und den Weg zur Haltestelle unterschätzt. Claus war einundzwanzig Jahre alt und dachte, die Welt stünde ihm offen.
Wütend hatte er auf dem Absatz kehrtgemacht und das Gelände der Maschinenfabrik verlassen. Etwas Besseres als den Tod fände er überall – und wenn er bei der Beseitigung der vielen Trümmergrundstücke half, die noch immer das Stadtbild prägten. Seiner Meinung nach machte der Hamburger Senat immerhin das Beste aus der Situation und verschaffte durch den Bau von Sozialwohnungen Tausenden der ausgebombten Familien ein vernünftiges Dach über dem Kopf. Seine Mutter und er hatten Glück gehabt – sie wohnten in einem der neuen Mehrfamilienhäuser aus den fünfziger Jahren am Bahrenfelder Kirchenweg. Er sammelte seine Gedanken und sah sich um.
Nachdem er nur noch aus Ottensen weggewollt hatte und in die nächste Bahn eingestiegen war, war er inzwischen irgendwie am Hafen gelandet, seinem Lieblingsort in Hamburg, genauer gesagt: an der Speicherstadt. Schon am Baumwall konnte man in der Regel den frischen Wind genießen, und es roch nach Abenteuern. Von der Elbe wehte die vertraute Mischung zu ihm herüber: Motoröl und Brackwasser, der Rauch einiger kleinerer Dampfschiffe, außerdem Teer und Fischbrötchen. Er stutzte. Fischbrötchen? Dann mußte er lachen, weil ein älterer Mann an der Backsteinmauer vor dem kleinen Binnenhafen lehnte und herzhaft in sein Mittagessen biß. Eine hungrige Möve hatte sich mit etwa anderthalb Metern Abstand zu ihm auf der Mauer niedergelassen und verfolgte wehmütig, wie das Brötchen immer kleiner wurde. Als es ganz verschwunden war, breitete sie die Flügel aus und flog Richtung Landungsbrücken davon. Fast schien es Claus, als habe sie zuvor noch mißbilligend den Kopf geschüttelt.
Ein Abenteuer, genau, das war es eigentlich. Einfach auf einem Schiff anheuern und nach Südamerika davonsegeln. Unter falscher Flagge sozusagen, denn seiner Mutter wollte er lieber nichts von seinen Sehnsüchten sagen und ihr schon gar nicht die Möglichkeit geben, ihn davon abzuhalten. Und dann darüber schreiben … Wie Gorch Fock, der die Jahre seines kurzen Lebens mit der Abfassung von Seefahrtsgeschichten verbracht hatte. Oder Lieder dichten … Musik war für Claus etwas, für das er viel zu wenig Zeit hatte. Aber wahrscheinlich hatte er für beides kein Talent. Seine Stimmung verdüsterte sich.
Vielleicht blieb er besser zu Hause. Mutter hatte schon genug durchgemacht in ihrem Leben: zuerst Kriegsbraut, dann – auf einem der wenigen Heimaturlaube ihres Mannes, bevor er wieder nach Rußland zurückbeordert worden war – werdende Mutter und schließlich Kriegswitwe, als ihr Mann bei der Schlacht um Stalingrad ums Leben kam. Frau Möller hatte nie wieder geheiratet.
Ohne es zu merken, stand der junge Mann inzwischen vor den hohen, aus braunen Backsteinen gemauerten Lagerhäusern auf Kehrwieder. Er war ein waschechter Hamburger und liebte die vielen sprechenden Namen der Stadt. Es war doch schön, sich auszumalen, wie in früheren Jahrhunderten – und heute wohl auch noch – die Matrosenliebchen an Kehrwieder den Seefahrern Glück und eine gute Heimkehr gewünscht hatten.
Wie üblich herrschte rege Geschäftigkeit vor der langen Häuserzeile. Stückgut wurde an langen Seilen, die aus den Außenwinden am Dachfirst herausliefen, in die Höhe gezogen und verschwand im Inneren der Lagerräume. Einige der großen Kisten trugen einen Aufdruck in englischer Sprache, einige waren französisch beschriftet und wieder andere schienen spanisch zu sein; jedenfalls hielt Claus sie dafür. Vor einem Handelskontor wurden gerade Jutesäcke mit einem dicken Hanftau umschlungen und dann zusammen an dem Transportseil befestigt. Wahrscheinlich Bohnen oder Tee, die von den Quartiersleuten verstaut werden würden.
Täuschte er sich oder bog gerade am Ende von Kehrwieder ein Pferdefuhrwerk auf die Brücke zum Sandtorkai? Claus war sich nicht sicher, da dieses alte Transportmittel allmählich aus der Stadt verschwand, aber es hatte schon sehr nach Hufen auf dem Kopfsteinpflaster geklungen.
Der junge Mann legte den Kopf in den Nacken und sah an den Backsteinfassaden hoch. Er hatte sich schon immer für Hamburgische Geschichte interessiert und manches Mal gewünscht, den Bau der »neuen« Speicherstadt Ende des neunzehnten Jahrhunderts miterlebt zu haben. Man mußte sich das mal vorstellen: erst einen ganzen Stadtteil abzureißen, um ihn danach – hochmodern – neu zu errichten. Und das Ganze obendrein auf den Inseln in der Norderelbe. Das hatte natürlich den Vorteil, daß die Warenanlieferungen auf der Rückseite der Speicher von den Fleets aus erfolgen konnten; ein pfiffiger Gedanke, wie Claus fand: Wasserstraßen und Steinstraßen zur Beförderung der Güter.
Die meisten Häuser der Speicherstadt umfaßten fünf Stockwerke und oft ein weiteres Geschoß unter dem Dach: die ersten beiden für die Kontorräume, darüber dann die Lageretagen. Und alles auf Pfählen im Untergrund der Fleetinseln. Innerhalb weniger Jahre hatte man die Speicher fertiggestellt, nachdem die alten, zum großen Teil noch mittelalterlichen Fachwerkhäuser beseitigt worden waren. Fertige Stahlskelette aus den Hochöfen des Ruhrgebiets hatten den Bau beschleunigt. Irgendwann war man trotzdem wieder zu Holzpfählen und Holzbalken zurückgekehrt, die einem Feuer länger standhalten konnten als Stahl. Und Wasser zum Löschen im Notfall gab es ja genug.
Irgendwo mitzubauen, das wäre auch ein schöner Beruf. Claus ging langsam weiter. Ein paarmal mußte er Schauerleuten ausweichen, die gerade ein kleineres Schiff im Binnenhafen entluden und Ballen auf einer Schulter zu einem Haus gegenüber schleppten. Die Sachen schienen schwer zu sein, denn regelmäßig nahmen die Männer ihre Schirmmützen ab und wischten sich über die Stirn.
Schließlich blieb er vor einem Gebäude stehen. Über dem doppelportaligen Haupteingang stand in goldenen Messingbuchstaben »Harry Petersen Kaffeeimport«. Am linken Torflügel aus poliertem schwarzen Holz war ein Stellenangebot befestigt: »Junger Mann für Lagerarbeiten und mehr gesucht. Bei Herrn Konrad (1. Stock) melden.« Die Tüchtigen werden schon Glück haben, dachte er, und stieß die Tür auf.
Konsul Petersen schob den Schreibtischstuhl zurück und stand aufgrund seines deutlich zu großen Bauches etwas mühsam auf. Er achtete nicht so sehr auf seine Figur, weil er gutes Essen liebte, was es ja endlich wieder gab. Endlich