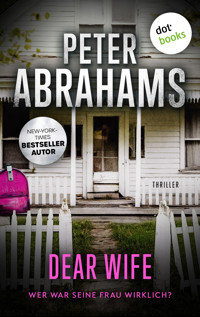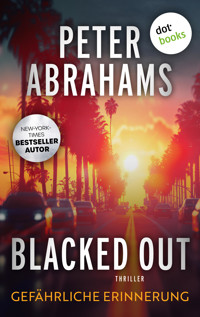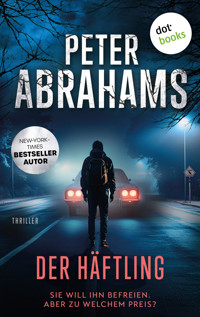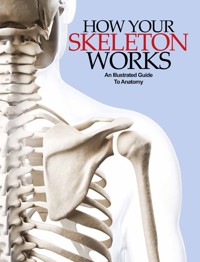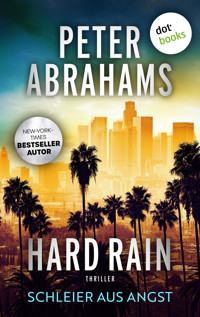
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Während die Welt vom Frieden singt, sucht eine junge Frau verzweifelt nach ihrer Tochter … Los Angeles, 1960er: In einer dunklen Nacht im November tritt für die alleinerziehende Mutter Jessi Shapiro der Albtraum ein: Ihre Tochter Kate kehrt nach einer Verabredung nicht nach Hause zurück. Sofort fällt ihr Verdacht auf Pat, ihren unzuverlässigen Ex-Mann, doch als sie zu seinem Haus in Venice Beach fährt, fehlt von den beiden jede Spur. Stattdessen bietet sich ihr ein seltsamer Anblick: kryptische Botschaften auf der Küchentafel und eine Wohnung, die hastig verlassen wirkt. Eine besorgniserregende Nachricht auf dem Anrufbeantworter bestätigt ihre schlimmste Befürchtung: Kate schwebt in Lebensgefahr. Panisch kontaktiert sie die Polizei, doch die Beamten erkennen den Ernst der Lage nicht. Jessi zieht die Konsequenz und macht sich allein auf die Suche, die sie quer durchs Land führt und Jahrzehnte zurück – nach Woodstock und in den tödlichen Dschungel Vietnams – bis hin zu einer schockierenden Wahrheit, die Jessi alles kosten könnte … »Abrahams schmückt seinen komplexen Plot mit glaubhaften, sympathischen Protagonisten, platziert sie vor einen Hintergrund aus 60er-Jahre-Musik, Drogen und auf den Kopf gestellten Idealen und schafft damit ein Meisterwerk.« – Publishers WeeklyEine düstere Verschwörung, die ihren Anfang 1969 auf dem legendären Woodstock Festival nahm … Ein rasanter Thriller für Fans von Lee Child!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 522
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über dieses Buch:
Los Angeles, 1960er: In einer dunklen Nacht im November tritt für die alleinerziehende Mutter Jessi Shapiro der Albtraum ein: Ihre Tochter Kate kehrt nach einer Verabredung nicht nach Hause zurück. Sofort fällt ihr Verdacht auf Pat, ihren unzuverlässigen Ex-Mann, doch als sie zu seinem Haus in Venice Beach fährt, fehlt von den beiden jede Spur. Stattdessen bietet sich ihr ein seltsamer Anblick: kryptische Botschaften auf der Küchentafel und eine Wohnung, die hastig verlassen wirkt. Eine besorgniserregende Nachricht auf dem Anrufbeantworter bestätigt ihre schlimmste Befürchtung: Kate schwebt in Lebensgefahr. Panisch kontaktiert sie die Polizei, doch die Beamten erkennen den Ernst der Lage nicht. Jessi zieht die Konsequenz und macht sich allein auf die Suche, die sie quer durchs Land führt und Jahrzehnte zurück – nach Woodstock und in den tödlichen Dschungel Vietnams – bis hin zu einer schockierenden Wahrheit, die Jessi alles kosten könnte …
Über den Autor:
Peter Abrahams ist ein renommierter amerikanischer Autor zu dessen weltweiter Leserschaft auch Stephen King gehört, der ihn als seinen »liebsten amerikanischen Spannungsromanautor« bezeichnet. Einige seiner Werke wurden mit hochkarätigen Stars wie Robert De Niro für die große Leinwand adaptiert.
Die Website des Autors: peterabrahams.com/peter-abrahams/
Bei dotbooks veröffentlichte der Autor seine Standalone-Thriller »Der Nachhilfelehrer«, »Der Häftling«, »Der ideale Ehemann«, »Das Wunschkind«, »Dear Wife«, »Blacked Out – Gefährliche Erinnerung«, »Missing Code – Verlorene Spur« und »Hard Rain – Schleier aus Angst«.
***
eBook-Neuausgabe März 2025
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1988 unter dem Originaltitel »Hard Rain« bei E. P. Dutton, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1991 unter dem Titel »Hard Rain« bei Lübbe.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1988 by Pas de Deux
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1991 für die deutschsprachige Ausgabe by Gustav Lübbe Verlag GmbH, Bergisch Gladbach
Copyright © der Neuausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98952-524-5
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. In diesem eBook begegnen Sie daher möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Diese Fiktion spiegelt nicht automatisch die Überzeugungen des Verlags wider oder die heutige Überzeugung der Autorinnen und Autoren, da sich diese seit der Erstveröffentlichung verändert haben können. Es ist außerdem möglich, dass dieses eBook Themenschilderungen enthält, die als belastend oder triggernd empfunden werden können. Bei genaueren Fragen zum Inhalt wenden Sie sich bitte an [email protected].
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Peter Abrahams
Hard Rain – Schleier aus Angst
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Blanca Dahms
dotbooks.
Motto
Everybody must give something back
for something they get.
»Fourth Time Around«
Bob Dylan
Widmung
Für Nana
Teil 1
Kapitel 1
Der Mann, den sie Bao Dai nannten, lebte in einer dreifarbigen Welt: Braun war die Farbe der Blutegel, Orange war die Farbe von Korporal Trinhs vermoderten Stiefeln, Grün war die Farbe des Dschungels und des Elends.
Bao Dais eigene Stiefel waren schon vor langer Zeit kaputtgegangen. Jetzt trug er Sandalen, die er aus Lastwagenreifen angefertigt hatte. Seine weiteren Besitztümer waren ein zerrissenes Hemd, ein Lendentuch und ein Blechnapf. Der Napf wurde dreimal am Tag gefüllt: bei Tagesanbruch Reis mit Sumpfgras, mittags Reis pur, abends Reis mit einer wäßrigen Soße. Diese Ernährung hatte eine Menge Männer das Leben gekostet. Bao Dai hatte sie sterben sehen. Bin hatte sie nicht getötet. Nicht einmal jetzt hatte er Hunger, vielleicht weil er glaubte, daß ohnehin jede Kost, die er zu sich nahm, nur die Würmer in ihm nährte.
Wie sein Namensvetter, der Playboy-Kaiser, träumte Bao Dai oft von seiner Flucht. Doch deshalb nannten sie ihn nicht Bao Dai – im Lager träumte jeder davon, zu fliehen. Er hatte den Namen bekommen, weil er ebenso runde Knie hatte wie der Kaiser, der im Lycée in Paris in kurzen Hosen fotografiert worden war. Korporal Trinh hatte besondere Freude daran gehabt, ihn Bao Dai zu nennen und sich manchmal vor ihm zu verbeugen, bevor er ihn in die Folterkammer führte. Doch inzwischen wußte niemand mehr, wie der Spitzname entstanden war – er hieß Bao Dai, weil kein Mensch seinen wirklichen Namen kannte. Und er hatte schon lange keine runden Knie mehr. Sein Körper war jetzt so sehnig wie der eines Bergbewohners.
Bao Dai hatte keine Hoffnungen mehr, aber seine Träume wiederholten sich immer wieder; Nacht für Nacht: Leuchtbomben und Raketen, die vom Himmel fielen, verhalfen ihm zur Flucht. Aber schließlich war es der Regen, der seine Träume wahr werden ließ – die heftigen Regenfälle des Spätsommer-Monsuns. Die Tropfen klatschten mit einer Wucht nieder, die nicht allein durch die Schwerkraft erklärbar war, prasselten mit stechendem Stakkato auf alles Lebendige ein und übertönten jedes andere Geräusch. Das Wasser stürzte wie eine Wand von den Bäumen und überflutete den Erdboden darunter.
Bao Dai arbeitete mit den anderen im Schlamm. Sie sollten eine Landungsbrücke am Fluß bauen, und ein Lastwagen brachte Steine bis zum Lager; dort endete die Straße. Sie zerkleinerten die Brocken mit Hämmern, packten die Stücke in große Körbe, die sie dann zum Fluß brachten. Zwischen dem Lager und dem Fluß lagen zwei Berge. Der erste war nicht so schwer zu bewältigen – er war einst als Hill 422 bekannt gewesen und noch nicht wieder vollständig belaubt. Der zweite war dicht bewaldet und viel steiler.
Bao Dai stapfte schwerbeladen auf dem glitschigen Pfad den zweiten Berg hinauf. Der Regenschleier, der ihn einhüllte, war nahezu undurchdringlich. Bao Dai konnte nur wenige Meter weit sehen und gerade noch die Waden von Nhu, der seine Frau ermordet hatte, ausmachen. An seinen Beinen spürte er den keuchenden Atem von Huong, der einmal zwei Taxis besessen hatte und jetzt umerzogen wurde. Huong hörte niemals auf zu weinen – irgendetwas war mit seinen Tränendrüsen nicht in Ordnung. Hinter ihnen ging Korporal Trinh, der außer seiner 9-mm-Makarow-Pistole und seiner selbstgeflochtenen Peitsche keine Last zu schleppen hatte.
Auf halber Höhe kamen sie zu einer kleinen Lichtung. Hier strömte das Wasser so kraftvoll vom Himmel, daß Bao Dai fast zu Boden gedrückt wurde. Er kämpfte, um den schweren Korb im Gleichgewicht zu halten, und versuchte verzweifelt, gleichmäßig einen Fuß vor den anderen zu setzen, damit sich die Ketten, mit denen seine Fußgelenke aneinandergefesselt waren, nicht verhedderten. Das leichte Ziehen an der Haut in seiner Kniekehle sagte ihm, daß sich ein Blutegel festgesaugt hatte. Er konnte sich nicht davon befreien – er brauchte beide Hände, um den Korb, der an einem Stirnriemen hing, auf dem Rücken zu halten.
Bao Dai stapfte weiter. Seine Füße sanken in den zähen Schlamm, der bei jedem Schritt schmatzende Geräusche von sich gab und faulige Gase verbreitete. Er hörte, wie der ehemalige Taxibesitzer ausrutschte und hinfiel, und nahm seine Bemühungen, wieder auf die Beine zu kommen, wahr. Huong war zu langsam. Korporal Trinhs Peitsche zischte durch die regenschwere Luft. Huong, der Taxibesitzer, schrie. Bao Dai versuchte schneller zu gehen. Er fühlte nur noch selten Schmerz, aber er haßte Korporal Trinhs Peitsche. Korporal Trinh hatte einen dreizackigen Angelhaken ans Ende des Lederriemens befestigt. Manchmal bohrten sich die spitzen Widerhaken ins Fleisch der Gefangenen – für Korporal Trinh war es ein Sport, die Peitsche so zu schwingen, daß sie die Haut der Männer aufriß.
Auf dem Weg bergab konnte Bao Dai weder von seinem Vordermann noch von den Männern hinter sich etwas hören. Er blieb stehen, stützte den Korb an einem Baum ab und tastete nach dem Blutegel in seiner Kniekehle. Korporal Trinh ging an ihm vorüber, die Makarow in der Hand. Vom Taximann war nichts zu sehen.
Bao Dai richtete sich unter seiner Last auf und trottete hinterher. Sie mußten zusammenbleiben – das war auch eine Vorschrift. Sein Rücken prickelte an der Stelle, auf der er zuletzt Korporal Trinhs Peitsche gespürt hatte. Bao Dai wußte, daß es nur noch schlimmer kam, wenn er versuchte, sich zu verstecken. Er hastete den Hügel hinunter und rutschte oft aus.
Ein Blitz zuckte am Himmel, und einen Herzschlag später dröhnte der Donner. Jemand schrie gellend auf. Als Bao Dai um eine Ecke bog, sah er, daß Nhu, der Mörder, unter einem umgefallenen Baum lag. Das Gewicht des Stammes hatte seinen Brustkorb eingedrückt, und sein Rückgrat wurde nach hinten über den Korb mit den Steinen gepreßt. Er war tot. Bao Dai schnupperte. Die Luft roch verbrannt.
Im ersten Moment bemerkte er Korporal Trinh nicht, weil der Korporal ein Stück weit entfernt gewesen war, als der Baum ihn erwischt hatte, und nun war er unter den mittleren Ästen eingeklemmt und teilweise unter Blättern verborgen. Blut tropfte aus einer Kopfwunde.
Korporal Trinh wand sich unter dem Baum, aber er konnte sich nicht aus eigenen Kräften befreien. Die Makarow lag in seiner Nähe im Schlamm, Korporal Trinh sah Bao Dai und zog seinen freien Arm unter einem Ast hervor – er streckte ihn, soweit er konnte, aus. Es reichte nicht. Bao Dai ging ein wenig näher, Korporal Trinhs Finger krallten sich in den Schlamm – seine Fingerspitzen waren nur wenige Zentimeter von der Waffe entfernt. Bao Dai hockte sich hin und hob die Pistole auf.
Er betrachtete die Pistole und den Baum, dann sah er in Korporal Trinhs Augen. Ein Pochen in seinem Kopf verdrängte jedes andere Geräusch, sogar das Trommeln des Regens. Bao Dai hörte lange auf dieses Pochen. Dann streifte er langsam den Steinkorb von seinen Schultern und ließ ihn auf den Boden fallen.
Korporal Trinh betrachtete ihn. In seinen Augen war keine Angst zu erkennen. Er war auf seinen Tod gefaßt, bevor Bao Dai richtig bewußt wurde, daß sich der Mann in seiner Gewalt befand.
Bao Dai baute sich vor Korporal Trinh auf. Der Regen spülte das Blut aus Korporal Trinhs Kopfwunde – es war eine tiefe Wunde, und Bao Dai konnte graues Gewebe darin erkennen. Er bückte sich, nahm die Schlüssel von Korporal Trinhs Gürtel und schloß seine Ketten auf. Dann riß er sich den Blutegel vom Bein, der sich sofort in seiner Hand zusammenrollte.
Bao Dai bemerkte, daß Korporal Trinhs Augen die Makarow fixierten, und ihm wurde bewußt, daß der Lauf auf Korporal Trinhs Kopf gerichtet war, daß sich sein Zeigefinger um den Abzug krümmte. Bao Dai ließ die Waffe sinken. Er hatte große Lust, Korporal Trinh zu töten – davon hatte er schon lange geträumt. Aber er sollte nicht auf diese Weise sterben, nicht durch eine Kugel, das wäre viel zu schnell gewesen. Aber Bao Dai blieb nicht viel Zeit.
Er kniete vor Korporal Trinh nieder und hielt den Blutegel dicht vor Korporal Trinhs Augen, damit er ihn sehen konnte. Dann drückte er ihn tief in die Kopfwunde. Korporal Trinh schrie. Bao Dai triumphierte – dieser Schrei eröffnete eine Welt voller Möglichkeiten und gab ihm Hoffnung.
Bao Dai drehte sich um und stolperte und rutschte zum Fluß hinunter. Der Fluß war schlammig braun, nicht sehr breit und aufgewühlt vom stürmischen Regen. Das gegenüberliegende Ufer sah nicht anders aus als das, an dem er stand. Auch dort war dichter Dschungel, der sich unter dem Monsun duckte. Aber dort, auf der anderen Seite, war ein anderes Land – Thailand.
Kapitel 2
Jerry Brenner ging hinaus in die Nacht. Verdammt, war es schon dunkel gewesen, als er die Bar betreten hatte? Er wußte es nicht mehr. Jerry setzte sich in Bewegung. Es war kalt – vielleicht war deshalb niemand auf der Straße. Er roch Wasser, faulen Fisch, Abwässer. Sein Magen rumorte – Bier auf Cognac, keine gute Idee.
Er blieb stehen und sah sich um. Nur eine Straßenlaterne brannte ein paar Blocks entfernt – ein verschwommener gelber Fleck. Jerry ging darauf zu und wehrte sich dabei gegen den nagenden Verdacht, daß das Hotel in der anderen Richtung lag. Vielleicht parkt unter der Laterne ein Taxi, dachte er. Er war müde – schließlich hatte er die ganze Nacht gefeiert. Am Nachmittag hatte er der Bank von Thailand Datenbanksoftware im Wert von zwei Millionen Dollar verkauft, und der Vertrag lag unterschrieben im Hotelsafe. Das war Grund genug, einmal über die Stränge zu schlagen.
Jerry ging weiter, die Entfernung war größer als er gedacht hatte. Einmal glaubte Jerry, hinter sich Schritte zu hören, aber als er sich umdrehte, war da niemand.
Unter der Laterne stand ein Taxi. Die Straße war nur wenige Meter hinter dem Licht zu Ende. Eine niedrige Mauer versperrte den Weg. Dahinter lag ein Kanal; er hörte, wie das Wasser gegen den Beton schwappte. Plötzlich überwältigte ihn der Geruch von Abwässern und faulem Fisch. Die Übelkeit wurde unerträglich. Jerry stolperte in den Schatten eines Hauses und übergab sich.
Er erbrach sich über seine Golfschuhe und seinen Tropenanzug von Brooks Brothers. Und danach ging es ihm bedeutend besser. »Verdammt, Jer«, sagte er zu sich, »du bist auch nicht mehr der Jüngste.« Er richtete sich auf, rückte seine Krawatte gerade und drehte sich um.
Im Schatten stand ein Mann und musterte ihn. Jerry fuhr zusammen. »Himmel, Kumpel«, sagte er, »du hast mich erschreckt.«
Der Mann schwieg und wandte den Blick nicht von Jerry ab. Er hatte merkwürdige Augen – blau, so blau wie glasiertes Porzellan.
Der Mann hob eine Faust, die etwas festhielt – etwas, das einen Moment lang im Licht der Straßenlaterne aufblitzte: eine Pistole. Jerry war schlagartig nüchtern. »He«, sagte er, »mach keinen Unsinn, ich geb’ dir alles, was du willst.« Er faßte nach seiner Brieftasche.
Es gab einen Knall, nicht besonders laut, dann lag Jerry auf dem Rücken. Der Mann durchsuchte seine Taschen. »Ich bin verletzt«, wollte Jerry sagen, aber er brachte keinen Ton heraus. Der Mann fand Jerrys Paß, schlug ihn auf und betrachtete ihn. Dann zog er Jerry aus – die Golfschuhe, die Socken, den gelbbraunen Anzug, die mit Segelbooten bedruckte Krawatte, das Hemd aus hundert Prozent Baumwolle, die Boxershorts.
Jerry fror.
Der Mann zerrte ihn über rauhen Asphalt. Er summte ein Lied. Jerry erkannte es: »When die Music’s Over.« Die Melodie stieg hoch, höher, wurde unhörbar.
»Lieber Gott, hilf mir«, versuchte Jerry zu sagen, aber kein Wort kam über seine Lippen. Er fiel durch die Luft und klatschte ins Wasser. Oben war es kalt, doch weiter unten wurde es wärmer.
Kapitel 3
Von dem Moment an, in dem Bao Dai Heimaterde betreten hatte, hatte er Schwierigkeiten mit dem gleißenden Licht. Alles was er ansah, blendete ihn. Er richtete seinen Blick zum Himmel, um herauszufinden, warum es in seiner Heimat so hell war. Nicht einmal die Sonne schien – es war ein bewölkter Tag. Er rieb sich die Augen so heftig, als wolle er die verzerrenden Linsen herausnehmen, die ihm ohne sein Wissen, vielleicht im Schlaf oder im Fieber, eingesetzt worden waren, aber als er aufhörte zu reiben, war das Gleißen immer noch da. Alle Gegenstände bekamen dadurch verzerrte Kanten: die Autos, die Häuser, die hohlwangigen Schaufensterpuppen der Boutique, vor der er nun stand.
Bao Dai ging hinein.
Eine große schwarze Frau, hohlwangig wie die Schaufensterpuppen, kam durch das grelle Licht auf ihn zu und fragte: »Kann ich Ihnen behilflich sein, Sir?« Sie sprach nicht wie eine Schwarze, nicht wie irgendeiner der Schwarzen oder Weißen, die er da drüben kennengelernt hatte; sie sprach sehr vornehm. Sie musterte ihn rasch vom Scheitel bis zur Sohle, nahm den Anzug, das Button-down-Hemd, ! die Krawatte, die Lederschuhe mit all den kleinen runden Löchern in der Kappe wahr.
»Jeans«, sagte Bao Dai.
»Bitte?«
Er war sich nicht sicher, ob er es richtig ausgesprochen hatte. Hatte er so etwas wie »Jinns« gesagt? Er wiederholte das Wort und gab sich Mühe, es in die Länge zu ziehen.
»Sie wünschen ein Paar Jeans, mein Herr? Am besten sehen Sie sich einmal in unserer Country Weekend Boutique um.« Sie führte ihn zum hinteren Teil des Ladens. »Bevorzugen Sie eine spezielle Marke oder einen Designer? Calvin Klein? Jordache? Ralph Lauren?«
»Bell-Bottoms«, sagte Bao Dai.
»Wie bitte?«
Er wiederholte es und gab sich wieder mit der Aussprache besondere Mühe.
Die Frau blinzelte, sehr schnell, fünf- oder sechsmal hintereinander. In dem hellen Licht wirkten ihre flatternden langen Wimpern wie Blinklichter. »Sie meinen Bell-Bottom-Jeans?« fragte die Frau.
Bao Dai brummte.
Die Frau musterte ihn noch einmal von oben bis unten und betrachtete diesmal auch sein Gesicht. »In der Nähe von Coolidge Corner gibt es einen 60er-Jahre-Laden. Dort könnten Sie es versuchen.«
Später saß er in einem Bus, der den Highway entlangrollte. Auf einem Schild über dem Kopf des Fahrers stand: TOILETTE HINTEN. Er ging nach hinten, zog den Reißverschluß seiner Anzughose auf und pinkelte in die Metallschüssel. Er dachte an die schwarze Frau in dem Geschäft. Dann sah er auf und vergaß sie sofort. Er erkannte ein Gesicht im Spiegel. Es war sein Gesicht, natürlich, das wußte er. Aber er hatte keine Ahnung gehabt, daß es so viel älter aussah als das der Schwarzen. Er hatte vermutet, sie seien ungefähr im selben Alter. Aber es stimmte nicht. Er ging zurück zu seinem Platz und betrachtete die anderen Fahrgäste, während er den Gang entlangging. Er versuchte das Alter der Passagiere zu schätzen. Er ging mehrere Male im Gang auf und ab, bis er merkte, daß er beobachtet wurde und der Blick des Fahrers auf den Rückspiegel gerichtet war. Er ging in die Toilette zurück, verschloß die Tür, zog alle seine Kleidungsstücke aus und starrte auf die Gestalt im Spiegel, bis er merkte, daß der Bus stehengeblieben war.
Bao Dai wanderte über eine Landstraße.
Wie hieß dieses Lied noch? fragte er sich beim Gehen. »Changes?« »Sit by my side, come as close as ... – Setz dich zu mir, komm so nah wie ...« So nah wie was? Er konnte sich nicht mehr erinnern.
An die Akkordfolge allerdings konnte er sich noch erinnern: C-Dur, D-Dur, G-Dur, e-Moll. Seine linke Hand bewegte sich in Barrégriffen durch die Luft.
Diese Landstraße kannte er gut, trotz des grellen Lichts. Es regnete jetzt, und er hielt seinen Kopf gesenkt, nicht weil er die Nässe und die Kälte spürte, sondern weil ihm das diesige Flimmern, das jeden einzelnen Regentropfen umgab, nicht ertragen konnte. Er brauchte nicht auf den Weg zu achten, er kannte die Straße wie seine Westentasche.
Bao Dai kam zu einem der Briefkasten, die in dieser ländlichen Gegend oft zu sehen waren – dieser war bemalt. Er konnte sich noch an den Geruch der frischen Farbe erinnern und daran, wie schwer es gewesen war, die blauen Blumen richtig zu bemalen. Er wußte auch noch, daß er das schwarze Symbol – einen Kreis mit einem stilisierten Flugzeug darin – von irgendjemandes Button abgemalt hatte. Es schien ihm, als wäre es erst gestern gewesen. Aber das stimmte nicht. Die Farbe war schon verblichen und fast völlig verschwunden. Er mußte sehr genau hinsehen, um die Umrisse von ein oder zwei Blumen auszumachen.
Bao Dai bog in einen schlammigen Feldweg ein. Er sah die Farm. Er hörte Stimmen, Gelächter, Gitarren. Sein Herz raste. Er begann zu laufen, seine Bewegungen wirkten schwerfällig auf dem morastigen Untergrund und in den zwei Nummern zu großen Golf schuhen. Er rannte, aber es war niemand da – niemand sprach, niemand lachte, niemand spielte Gitarre.
Da war nur eine Frau mittleren Alters, die auf dem Hof Vogelfutter ausstreute. Sie sah auf. Das Gleisen war sehr stark. Er brauchte lange, bis er wußte, wer sie war – sehr lange.
Sie erkannte ihn überhaupt nicht.
Er mußte ihr sagen, wer er war.
Und was hätte dann geschehen sollen? Was hatte er denn erwartet? Was hatte er sich erhofft? Er wußte es nicht. Seine Arme hoben sich, ganz von allein. Aber sie kam ihm keinen Schritt entgegen; sie starrte ihm nur ins Gesicht. Ihm gefiel die Art, wie sie ihn anstarrte, nicht, und er mochte die Falten in ihrem Gesicht nicht.
Er senkte die Arme und trat einen Schritt zurück.
In diesem Moment breitete sie scheu die Arme aus. Er trat noch einen Schritt zurück. Sie senkte die Arme und biß sich auf die Unterlippe.
Ihre Bewegungen verliefen asynchron.
Sie gingen hinein. Sie bereitete eine Mahlzeit für ihn zu: gebratenes Hähnchen, gelbe Wachsbohnen und Bananenbrot. Es war grauenvoll.
Es wurde dunkel, aber das Gleißen war noch immer da. Sie machte Feuer im Kamin, rollte eine Zigarette, zündete sie an, inhalierte den Rauch und hielt sie ihm hin.
»Nein«, sagte er.
»Nicht?« Sie war überrascht. »Kolumbianer.«
»Nein.« Der Rauch machte ihm Angst.
Sie schaltete das Radio an. Musik ertönte, Rockmusik, nahm er an, aber er verabscheute Rockmusik und fand sie langweilig. Sie klopfte den Takt mit dem Fuß. Er bemerkte, daß seine Hände zu Fäusten geballt waren, und lockerte sie.
Ein Mann kam im Rollstuhl hereingerollt. »Besuch?« fragte er. Der Mann im Rollstuhl war blind.
»Geschäftlich«, sagte die Frau. »Kennst du nicht.«
Der Mann rollte wieder davon. Irgendetwas an ihm erschien Bao Dai vertraut, und er wollte sie gerade danach fragen, als ihm eine andere Frage einfiel, eine wesentlich wichtigere Frage.
Sie antwortete nicht. Zuerst. Er mußte sie noch ein paarmal fragen, aufstehen und durch den Raum gehen und sich vor ihr aufbauen. In diesem Moment berührten sie sich endlich – als er ihre Hand nahm, sie auf die Füße zerrte und ihr den Arm auf den Rücken drehte.
Da sagte sie es ihm.
Bao Dai ging am nächsten Morgen fort. Er trug den Tropenanzug, das Hemd mit dem geknöpften Kragen, die Golfschuhe, aber die Krawatte hatte er in die Jackentasche gesteckt, zusammen mit dem Reisegeld, das sie ihm überlassen hatte – sie hatte nicht protestiert, als er es aus ihrer Tasche genommen hatte.
Als er im Flugzeug saß, fiel Bao Dai zum ersten Mal auf, daß er alles, was er besaß, an sich trug: ein Tropenanzug, eine Krawatte mit Segelbooten darauf, ein Hemd, Boxershorts, Strümpfe, die dringend gewaschen werden mußten, und Schuhe – mit kleinen Löchern in der Kappe und zwei Nummern zu groß. Er bekam Blasen von diesen Schuhen. Er hatte die Blasen gesehen, als er am Abend zuvor ins Bett gegangen war, aber er spürte sie nicht.
»Einen Cocktail, Sir, vor dem Essen?«
Bao Dai sah auf und blickte in die Schlitzaugen einer gelben Frau. »Cocktail?« fragte sie noch einmal.
Er schrumpfte in seinem Sitz zusammen.
»Oder vielleicht lieber etwas Alkoholfreies?«
Bao Dai brummte. Sie ging weg. Den Rest der Reise behielt er sie im Auge.
Er verließ das Flugzeug in einer Stadt, in der die Luft so schlecht war, daß ihm die Augen tränten. Er fand das Haus, das er suchte, in der Nähe des Strandes. Es war ein spanisches weißes Haus mit rotem Ziegeldach, und es erinnerte ihn an Zorro. Ihm fiel ein, wie Zorro die Seven-up-Flasche mit seinem Schwert gedreht hatte. Zipp-zipp-zipp – Zorros Zeichen. Jeden Samstagnachmittag. Um halb fünf.
Bao Dai ging drei- oder viermal vor dem Haus auf und ab, bevor er anklopfte. Niemand erschien. Er lief zur Garage und versuchte die Tür zu öffnen. Sie ging widerstandslos auf. Er schlich hinein, zog die Tür zu und stellte sich an das Fenster, von dem aus er die Straße überblicken konnte.
Ein Wagen bog in die Auffahrt ein und hielt. Ein schönes blaues Auto. Die Fenster waren heruntergedreht, und Bao Dai hörte, daß im Wagen Musik spielte. Gleich darauf wurde der Motor abgestellt. Die Musik war laut und klar, als hätte die Band ihre gesamte Anlage gleich auf dem Rücksitz.
Ein jugendlich aussehender blonder Mann stieg aus, schloß die Haustür auf und ging ins Haus.
Er sah so verdammt jung aus.
Bao Dais Hände ballten sich wieder zu Fäusten. Er lockerte seine Finger und faßte nach der Klinke der Garagentür. In dem Moment fuhr noch ein Wagen vor. Eine Frau stieg aus.
Eine schöne Frau.
Sie hatte eine gesunde, strahlende Haut und einen kräftigen Körper – das konnte er daran erkennen, wie sie sich bewegte. Ihm gefielen ihre Bewegungen. Der Anblick rief Gefühle in ihm wach, an die er sich kaum noch erinnern konnte, fast als hätte er sie zum ersten Mal. Drei Frauengesichter huschten durch seinen Kopf – das schwarze aus dem Bekleidungsgeschäft, das gelbe aus dem Flugzeug und nun das weiße, das nur wenige Meter von ihm entfernt war. Und plötzlich hatte er Lust auf Sex, nicht hur auf Sex – auf brutalen Sex. Er hatte schon lange nicht mehr daran gedacht und seit Jahren keine Erektion mehr gehabt. Er wußte nicht, ob er überhaupt eine bekommen konnte. •
Bao Dai steckte seine Hand in die Anzughose und berührte sich. Nichts passierte. Er ließ die Hand dort, während er beobachtete, wie die Frau auf das Haus zuging. Sie hatte ein kleines Mädchen bei sich. Sie hatten das gleiche Haar. Er überlegte, wie sich solches Haar an seinem Penis anfühlen würde, und spürte eine leichte Regung. Er sah an sich hinunter. Das Gefühl verging. Vielleicht hatte er es sich nur eingebildet. Plötzlich hörte er ein tiefes, wütendes Knurren. Erst nach einigen Augenbücken wurde ihm klar, daß es aus seiner eigenen Kehle kam. Als er wieder aufsah, waren die Frau und das Mädchen im Haus verschwunden.
Bao Dai blieb in der Garage. Nach einer Weile kam die Frau allein wieder heraus. Jetzt stand eine tiefe Falte zwischen ihren dunklen Augen. Sie fuhr mit ihrem Wagen weg.
Der Himmel wurde dunkler, aber es blieb immer noch grell. Als der Himmel ganz dunkel war, nicht schwarz, sondern rosa-orange und sternenlos, öffnete Bao Dai leise die Garagentür und schlich sich zum Haus.
Kapitel 4
Jessie Shapiro hatte schlechte Laune. Das hätte jeder auf den ersten Bück an der Art, wie sie mit verschränkten Armen vor der Haustür stand, erkannt. Aber es sah niemand. Die Straße war menschenleer.
Jessie Shapiros Armbanduhr zeigte 15.30. Der Doppelpunkt, der die Stunden von den Minuten trennte, blinkte jede Sekunde einmal auf, um daran zu erinnern, daß die Zeit unaufhaltsam verging. Blink, blink, blink. Sie brauchte nicht daran erinnert zu werden.
Jessie schaute auf den Idaho, in der Erwartung, einen mit überhöhter Geschwindigkeit fahrenden blauen BMW zu entdecken, mit einem blonden Mann am Steuer und einem kleinen Mädchen auf dem Beifahrersitz.
Es war aber nichts zu sehen – überhaupt kein Auto. Es war zu kalt für den Strand und zu früh für die Abendvergnügungen. Die konzentrierte Langeweile von fünfzehn Millionen Menschen war fast körperlich spürbar. In wenigen Stunden würden sie wieder zur Arbeit fahren müssen, aber jetzt war das Summen des Verkehrs noch nicht lauter als Bienenstöcke in weiter Entfernung. Der Himmel hatte die Farbe von Messing, und die Sonne stand in einem merkwürdig flachen Winkel zur Erde, klein wie ein Tennisball und blaßgelb. Mitte November in L. A., Sonntag nachmittag.
Das hieß, daß Patt 33 Minuten Verspätung hatte. Kate sollte um 16.00 Uhr auf der Geburtstagsparty sein. Pat wußte das – Jessie hatte es ihm gesagt, als sie Kate am Freitag nachmittag bei ihm abgesetzt hatte. Zweimal. Einmal, als sie gekommen, und einmal, als sie gegangen war. Beim zweiten Mal hatten seine Augen diesen gewissen Ausdruck angenommen, diesen entnervten Teenagerblick, und er hatte gesagt: »Wie oft willst du mir das denn noch sagen?«
»Bis ich eine Bestätigung bekomme«, hatte sie sagen wollen. Aber es hatte keinen Sinn, jetzt noch mit ihm zu diskutieren. Streit war etwas für Verheiratete, und eine Scheidung bedeutete Frieden.
Eine Mutter mit einem Kinderwagen ging vorbei: Die Mutter blies eine Kaugummiblase, und ihr Walkman war so laut aufgedreht, daß Jessie das Lied erkennen konnte: »Sometimes when we touch.« Dem Baby lief die Nase. Die beiden waren die einzigen lebenden Wesen weit und breit.
»Verdammt«, fluchte Jessie, ging ins Haus und knallte die Tür heftiger zu als nötig. Das Haus zitterte. Sie war stark. Das Haus war schwach: klein, hübsch und zerbrechlich wie eine alternde Schönheit mit Knochenschwund. Jessie hatte vor, es von Grund auf zu erneuern, und sie wartete nur noch auf Zeit und Geld.
Sie trat unter den einzigen Wertgegenstand, den sie besaß, ein Calder-Mobile, das sie statt einer Bezahlung von einem Kunden angenommen hatte. Schließlich ging sie an der Tennisausrüstung vorbei, ihrer und Kates, in die Küche. Es hatte keinen Sinn, Pat anzurufen: er hatte ihr gesagt, daß sie segeln wollten und er Kate direkt vom Yachthafen aus herbringen würde. Jessie nahm trotzdem den Hörer und wählte seine Nummer. »Hallo«, sagte eine Frauenstimme, die sie nicht kannte und auch nicht mochte. »Im Moment ist niemand zu Hause, aber wenn Sie eine Nachricht hinterlassen, rufen wir zurück. Versprochen.«
»Himmel«, stöhnte Jessie und legte auf – auch etwas heftiger als nötig. In ihrem Kopf tauchten Zweifel auf, ob es richtig war, Kate jedes zweite Wochenende bei ihrem Vater verbringen zu lassen – aber Kate war gerne mit Pat zusammen, ein Kind braucht einen Vater – was konnte es schaden? Außerdem hatte sie sich bei der Scheidung schriftlich mit den Besuchszeiten einverstanden erklärt, und dieses Dokument war fast so schwer wie die Verfassung abzuändern.
Sie ging wieder zur Haustür und spähte auf die Straße. »Verdammt!« Die Geburtstagsparty war in Beverly Hills. Sie würden mindestens eine halbe Stunde dorthin brauchen. Jessie hatte gehofft, während Kates Abwesenheit arbeiten zu können. Stattdessen stand sie hier schlechtgelaunt im Eingang.
Das Telefon klingelte. Jessie rannte hinein.
»Hallo, Jessie. Hier ist Philip.«
»Hallo.«
»Du klingst ja wirklich begeistert.«
»Entschuldige, Philip. Ich dachte, es wäre jemand anderes.«
»Aha?«
»Pat meine ich«, sagte sie mit einer Ungeduld, die nicht Philip galt. »Er bringt Kate zu spät zurück.« Jetzt beschwerte sie sich schon bei Philip – hör auf damit, schalt sie sich. »Was gibt’s?«
»Es ist fertig.«
»Was ist fertig?«
»›Valley Nocturne‹.«
Jessie hörte vor dem Haus einen Wagen einparken. »Das ist gut. Hör mal, Philip, ich –«
»Wann kommst du vorbei und siehst es dir an? Wir machen eine gute Flasche auf und –«
»Also, ich bin nicht –«
»Wie wär’s mit heute abend? Ich würde wirklich gern –«
»Nicht heute abend. Hör mal, ich ruf’ dich zurück, okay? Ich glaube, da ist jemand an der Tür.«
»Aber –«
Jessie legte auf und ging zur Tür, aber niemand war da. Der Wagen gehörte der Frau, die gegenüber wohnte. Jessie warf einen flüchtigen Blick auf sie, als sie mit ihrem Sohn, der einen Stoffpanda auf dem Arm trug, ins Haus ging. Jede Woche kam der Junge mit einer neuen Trophäe von seinem Vater zurück. Jessie dachte an all die Kinder aus ganz Südkalifornien, die am Sonntag abend zu ihren Müttern zurückgebracht wurden: gesteigerter Benzinabsatz, gesteigerter Umsatz bei den Spielzeugfirmen. Vermutlich gab es Studien, die belegten, daß Scheidungen die Wirtschaft ankurbelten.
»Scheiße!« Sie überlegte, ob sie im Yachthafen anrufen sollte, aber sie hatte keine Ahnung, mit wessen Boot sie hinausgefahren waren. Pat kannte eine Menge Leute, die Segelboote besaßen. Sie wählte noch einmal seine Nummer. Sie brauchte sie nicht nachzuschlagen – das Telefon war früher auf ihren Namen angemeldet gewesen; das Haus in Venice hatte ihnen beiden gehört. »Hallo«, sagte die Stimme der Frau, die sie nicht kannte und nicht mochte. »Im Moment ist niemand zu Hause, aber wenn Sie eine Nachricht hinterlassen, rufen wir zurück. Versprochen.« Ein Wort kam ihr in den Sinn: Flittchen. Sie schüttelte den Kopf.
War es möglich, daß Pat zu Hause war und einfach nicht ans Telefon ging? Jessie versuchte, sich einen Grund dafür vorzustellen, aber ihr fiel nichts ein. Sie ging trotzdem wieder hinaus. Als sie am Dielentisch vorüberkam, fiel ihr Blick auf das Geburtstagsgeschenk, einen Zwölffarbenstift, den Kate ausgesucht und in Geschenkpapier gepackt hatte. Jessie nahm ihn an sich.
Sie stieg in ihren Wagen, ein fünf Jahre altes amerikanisches Modell, das schon dreimal in die Werkstatt zurückgerufen worden war, und fuhr nach Venice.
Das Haus war L-förmig, im spanischen Stil gebaut – weiß, mit rotem Ziegeldach; die Straße – eine Sackgasse – lag einen halben Block vom Strand entfernt. Jedes Mal wenn Jessie zu Besuch kam, dachte sie, daß die Gegend noch etwas weiter heruntergekommen war. Heute fuhren zwei jointrauchende Männer auf Rollerskates auf die Strandpromenade zu. Sie starrten sie an, ohne langsamer zu werden, und rollten um die Ecke. Ein Mann mit einer Flasche in einer Papiertüte kam ihr entgegen.
Jessie hielt vor dem Haus. Der BMW stand nicht in der Einfahrt. Sie stieg aus und spähte in die Garage. Leer. Jessie hatte einen Hausschlüssel, machte sich aber nicht die Mühe, hineinzugehen: auf der Veranda lagen zwei zusammengerollte Zeitungen.
Jessie ging zu ihrem Wagen zurück. Sie umklammerte das Lenkrad so sehr, daß ihre Fingerknöchel weiß wurden, dann faltete sie die Hände im Schoß. Vielleicht, dachte sie, hatte Pat gemerkt, daß er sich verspätet hatte, und versucht, Zeit gutzumachen, indem er Kate direkt zu der Party fuhr. Das sah Pat zwar nicht ähnlich, aber Jessie wendete dennoch und fuhr nach Osten. Das war ihre letzte Hoffnung, wenn sie nicht an einen Unfall denken wollte.
In der Gegend, in der das Geburtstagskind wohnte, gab es keine jointrauchende Rollerskater, Kates Freundin lebte auf einem großen Besitz hinter einer drei Meter hohen Mauer. Der einzige Mensch, den Jessie sah, war der Wächter am Tor. Er trug eine maßgeschneiderte schwarze Uniform und sah aus wie ein SS-Offizier aus einem Film, nur hatte er keine Abzeichen.
Jessie kurbelte ihr Fenster hinunter. »Ich suche meine Tochter – sie ist auf Cameos Party eingeladen, aber irgendetwas hat nicht geklappt. Vielleicht hat ihr Vater sie ja hergebracht.«
Der Wächter zog ein Clipboard zu Rate. »Wie heißt Ihre Tochter?«
Jessie nannte den Namen.
»Sie steht auf der Liste, stimmt, aber sie ist noch nicht hier. Die Party hat schon lange angefangen.«
»Vielleicht hat Kates Vater hier angerufen. Ich würde gern hineingehen und Cameos Eltern fragen.«
»Das wird nicht möglich sein. Sie befinden sich auf einer Kreuzfahrt.«
Er ließ seinen Blick mißbilligend über Jessies Auto schweifen.
»Dann –«
»Sie können mit Miss Simms sprechen. Sie beaufsichtigt die Party.« Er öffnete das Tor.
Jessie fuhr einen gewundenen Weg entlang, der zu beiden Seiten mit rosa Hibiskus gesäumt war. Auf einer Anhöhe glitzerte eine High-Tech-Vergnügungskuppel. Die Geburtstagsparty fand am Fuß des Hügels statt, wo ein kleines Volksfest für die Kinder aufgebaut war. Es gab eine Wahrsagerin, Clowns, Jongleure und ein kleines Riesenrad.
Zwei Mädchen saßen in der untersten Gondel des Riesenrades. Beide hatten glattes blondes Haar und hohe Wangenknochen. Jessie ging zu ihnen.
»Cannes ist ätzend«, sagte eine.
»Paris ist noch viel schlimmer«, antwortete die andere. \
»Entschuldigung«, sagte Jessie. »Ich suche meine Tochter.«
Sie sahen auf. Jessie spürte, wie sozioökonomische Sensoren ihre Oberfläche abtasteten. »Wie heißt sie denn?« fragte eine.
»Kate Shapiro.«
Die Mädchen schüttelten die Köpfe.
»Oder vielleicht kennt Ihr sie als Kate Rodney. Oder Rodney-Shapiro«, fügte Jessie grinsend hinzu.
Die Ironie an dieser Bemerkung entging ihnen. »Ist das die mit den krausen Haaren? Wie Ihre?«
»Genau. Genau wie meine.«
Etwas in ihrer Stimme veranlaßte die Mädchen, ihre Augen kurz niederzuschlagen. »Die haben wir nicht gesehen.«
Die meisten Kinder waren in einiger Entfernung um einen Swimmingpool versammelt. Als Jessie dort ankam, stellten zwei mexikanische Kellner gerade eine rosa Torte auf eine lange Tafel; obenauf brannten elf silberne Kerzen. Einer der Clowns spielte »Happy Birthday« auf einem Akkordeon, doch es sang niemand außer den Kellnern und einer großen schlanken Frau mit englischem Akzent.
»Los jetzt, Cameo«, sagte die Engländerin. »Wünsch dir etwas und puste die Kerzen aus.«
Das Geburtstagskind lümmelte auf einer Liege, eine Fruchtbowle neben dem Ellbogen. Sie trug eine Sonnenbrille von Vuarnet und eine Kappe, auf der ›Bora Bora Golf and Country Club‹ stand. »Ich bin müde, Miss Simms«, sagte sie. »Tun Sie es.«
Die Engländerin stieg auf einen Stuhl, wünschte sich etwas und blies die Kerzen mit einem Atemstoß aus. Die Clowns klatschten vor Entzücken in die Hände und stampften mit ihren großen Schuhen auf den Boden. Ihre Augen wirkten sehr müde. Jessie meinte, einen von ihnen aus einem Fernsehwerbespot zu kennen.
Die Engländerin schnitt die Torte an. Ein Junge ließ Pappteller in den Swimmingpool segeln. »Ich hab’ das ›Mister-Mister‹-Video gekriegt, das nächsten Monat rauskommt«, verkündete Cameo. »Will jemand es anschauen?«
Die Kinder standen auf und trotteten den Hügel hinauf zum Haus. Die Engländerin hörte auf, die Torte anzuschneiden. »Hector«, sagte sie, »stellen Sie die Torte in den Kühlraum.«
Die Kellner hoben die Torte hoch und trugen sie wieder weg.
»Miss Simms?« sagte Jessie.
»Ja?« Die Engländerin stand immer noch auf dem Stuhl und sah auf Jessie herunter. Ihre Gedanken waren weit weg.
»Mein Name ist Jessie Shapiro. Ich suche meine Tochter Kate. Ist sie hier gewesen?«
»Kate?« fragte Miss Simms. Ihre Miene hellte sich auf. Sie stieg vom Stuhl. »So ein nettes Kind. So –« Sie wollte etwas sagen, besann sich aber anders. »Nein«, sagte sie. »Kate ist nicht hier gewesen.« Miss Simms runzelte die Stirn.
»Hat ihr Vater vielleicht angerufen? Ich glaube, wir haben uns verpaßt.«
»Meines Wissens nicht.« Miss Simms setzte sich an die Tafel, schob mit dem Ellbogen einen Stapel Geschenke beiseite – alle waren hübsch verpackt mit Geschenkpapier der namhaften Geschäfte auf dem Rodeo Drive – und tippte eine Nummer auf ein Funktelefon. »Mrs. Sanchez«, sagte sie. »Könnten Sie mir bitte das Telefonprotokoll vorlesen?«
Während Miss Simms Mrs. Sanchez lauschte, schlug sie eine lederne Schreibmappe auf, entnahm ihr ein dickes Blatt Papier mit Büttenrand und begann zu schreiben. Jessie las die auf dem Kopf stehenden Wörter.
»Liebe Missy, danke für Dein wunderschönes Geschenk. Ich hoffe, meine Party hat Dir Spaß gemacht. Ich freue mich, daß Du kommen konntest. Deine Freundin –«,
Am unteren Rand der Karte war ein freier Platz für Cameos Unterschrift.
Miss Simms legte das Telefon auf den lisch. »Tut mir leid«, sagte sie. »Kein Anruf.«
Jessie bemerkte, daß sie sich auf die Lippe biß. Miss Simms beobachtete sie, und Jessie seufzte: »Himmel.«
»Ja«, sagte Miss Simms und nahm ein weiteres Blatt aus der Mappe. »Liebe Hilary«, schrieb sie.
Jessie stieg in ihren Wagen und fuhr zum Tor. Der Wächter öffnete es und strich ihren Namen auf seiner Liste aus. Jessie bog auf die Straße und bemerkte erst jetzt, daß das Geschenk für Cameo noch im Wagen lag.
Sie fuhr nach Hause. Der Verkehr hatte inzwischen zugenommen, als übten alle Leute für den morgigen Stoßverkehr. Jessie schaltete das Radio ein – eine Levi’s-Reklame. Sie klang wie viele andere Werbejingles, mit Ausnahme des melodiösen Gitarrensolos. Sie erkannte den Stil sofort: Pat. Er spielte sehr gut, nur aus freien Stücken blieb er Studiomusiker. Sie schaltete das Radio wieder aus.
Als Jessie nach Hause kam, war es Abend geworden. Sie fuhr ziemlich schnell über die Einfahrt, sah dann, daß im Haus kein Licht brannte und fuhr langsamer. Aber als sie das Haus betrat, rief sie trotzdem: »Kate? Kate?« Sie bekam keine Antwort.
Sie wählte Pats Nummer. »Hallo. Im Moment ist niemand –«, danach rief sie im Yachthafen an. Kein überfälliges oder vermißtes Boot war gemeldet worden. Jessie ging nach unten in ihr Arbeitszimmer und schaltete das starke Oberlicht ein. Auf einer Seite des Raumes standen Fahrräder, Skier und die Campingausrüstung. Auf der anderen Seite befand sich ein großer Tisch, auf dem Orpheus und Eurydike lagen, craquelure-krank. Jessie musterte sie kurz; Mrs. Stieffler würde nicht erfreut sein.
Sie setzte sich neben das Telefon und fing an, Pats Freunde aus ihrem Adreßbuch herauszusuchen. Sie hatte nach der Scheidung ziemlich viele von ihnen ausgestrichen. Jetzt, nach fünf Jahren, war nur noch s Norman Wine übrig. Er war früher einmal Pats Manager gewesen. Jessie vermutete, daß sie seinen Namen nicht durchgestrichen hatte, weil er der einzige von Pats Freunden gewesen war, den sie wirklich gemocht hatte. Sie wählte seine Nummer.
»Norman Wine Productions«, sagte eine Frau. Im Hintergrund übte ein Trompeter Tonleitern.
»Norman Wine bitte.«
»Mr. Wine ist im Moment nicht im Haus.«
»Ach.«
Die Frau schwieg einen Moment. Dann sagte sie: »Wenn es wichtig ist, kann ich Sie über die Seevermittlung durchstellen.«
»Die Seevermittlung?«
»Ja.«
»Es ist wichtig.«
»Wie lautet Ihr Name?«
Jessie sagte ihn und wartete; etwas klickte, und der Trompeter war verschwunden. Jessie hörte ein weiteres Klicken und statische Geräusche, und dann sagte Norman: »He, das ist aber eine nette Überraschung.« Er hätte im Zimmer nebenan sitzen können. »Over«, fügte er hinzu. »Du mußt immer ›over‹ sagen. Over.«
»Sind Pat und Kate bei dir?«
»Du hast es nicht gesagt.«
»Sind sie bei dir?«
Es entstand eine Pause. »Nein«, antwortete Norman weniger ausgelassen. »Stimmt was nicht?«
»Keine Ahnung«, sagte Jessie. »Pat hat Kate dieses Wochenende zum Segeln mitgenommen, und sie sind noch nicht zurück. Ich versuche herauszufinden, mit wem sie segeln waren.«
»Sie sollten bei mir mitfahren«, erklärte Norman. »Aber sie sind nicht gekommen.«
»Wie meinst du das?«
»Eigentlich wollten wir am Samstag um neun ablegen, Pat ist nicht erschienen. Wir haben bis zehn gewartet und sind deshalb zu spät in Catalina eingelaufen.«
Jessie dachte nach. Sie hörte auf Normans Boot Leute lachen und überlegte, ob Pat dabei war und Norman sie anlog. »Ich wußte gar nicht, daß du segeln kannst, Norman«, sagte sie.
»Kann ich auch nicht, ich muß ständig kotzen. Dieser Törn ist eine Steuergaunerei.« Eine Frau lachte. »Over«, fügte Norman hinzu. Die Frau lachte lauter.
»Sind sie auf dem Boot, Norman?«
»Wer?«
»Kate und Pat.«
»He! Die Frage habe ich dir doch schon beantwortet.«
Es entstand ein langes Schweigen. Dann sagte Jessie: »Hast du eine Ahnung, wo er stecken könnte?«
»Durchsuch mich.« Vielleicht hielt er die Verärgerung, die in seiner Stimme mitschwang, für übertrieben und fügte deshalb hinzu: »Was treibst du denn so? Möchtest du mal auf einen Törn mitkommen? Mein Boot heißt Schlepper.« Im Hintergrund schrie die Frau: »Es hat zweihunderttausend Dollar gekostet.«
»Hast du versucht, bei ihm anzurufen?« fragte Jessie.
»Bei Pat? Er war nicht zu Hause. Aber hör mal.
Mach dir keine Sorgen. Er ist doch kein Kind mehr.«
Genau das bezweifelte sie, aber Jessie sagte nur: »Aber Kate.«
Pause. Dieses Gespräch war nicht sehr amüsant. »Ich werde oben gebraucht«, behauptete Norman. »Ein Problem mit einem steckengebliebenen Korken.«
Die Frau brach in lautes Gelächter aus. »Auf Wiederhören, Norman«, sagte Jessie.
»Das war ernstgemeint mit dem Törn.«
Jessie legte auf und ging nach oben. Sie öffnete die Haustür und blieb im Eingang stehen. Straßenlaternen warfen grünliche Lichtlachen in die Nacht. Die Kaugummi kauende Mutter mit Kinderwagen kam wieder vorbei. Diesmal traten Jessie bei dem Anblick Tränen in die Augen. »Scheiße«, zischte sie und war wütend auf sich selber. Die Kaugummi kauende Mutter fuhr erschreckt herum. Jessie ging ins Haus und knallte die Tür zu.
Sie wählte wieder Pats Nummer. »Hallo –«
Aus dem Hängeschrank über dem Kühlschrank nahm Jessie eine Flasche Brandy und goß sich ein Glas ein. Sie nippte daran. Er beruhigte sie nicht. Sie trank noch einen Schluck.
Ihr Blick fiel auf eine Schulheftseite, die an der Kühlschranktür befestigt war:
Meine Mama
Meine Mama ist wie Schildpatt,
so stark und wunderschön.
Ihre Augen sind wie Meere,
die Gut und Böse sehn.
»Gute Bildsprache«, hatte Miss Fotheringham mit Rotstift daruntergeschrieben, »jedoch nicht ausgereift genug. 2–.« Jessie fragte sich, wie Cameos Gedicht wohl lautete.
Sie stellte ihren Drink ab. Sie war schon ein wenig benommen. Vielleicht sollte sie etwas essen. Sie machte sich ein Omelette, deckte den Tisch für eine Person, setzte sich, aß aber nichts. Stattdessen dachte sie an ihre Ehe und daran, was daraus geworden war. »Ganz einfach«, hatte Barbara Appleman, ihre Freundin und Rechtsanwältin, gesagt. »Sein Bewußtsein sitzt in seinem Schwengel. Er weigert sich, erwachsen zu werden.«
Aber das war nicht fair. Wer war Barbara Appleman, daß sie feststellen konnte, wann jemand erwachsen wurde? Beiläufiger Sex gehörte nun einmal zu den Berufsrisiken von Pats Karriere. Doch letztlich hatte Jessie das nicht akzeptieren können. Er hatte seinen erotischen Wert selbst gemindert. Seine Berührungen hatten sie kalt gelassen, und sie hatten aufgehört, miteinander zu schlafen.
Jetzt hatte sie Kate, und sie hatte ihre Arbeit, aber es war nicht genug.
Viel, sehr viel später merkte Jessie, daß sie auf das Omelette gestarrt hatte, bis es aussah wie eine Plastikspeise im Schaufenster eines japanischen Restaurants. 03:00 morgens. Der Doppelpunkt blinkte immer noch.
Ihr Zeigefinger tippte die Ziffern von Pats Nummer. Am anderen Ende der Leitung wartete süße Verbindlichkeit. »Hallo. Im Moment ist niemand zu Hause, aber wenn Sie eine Nachricht hinterlassen, rufen wir zurück. Versprochen.«
»Meine Nachricht ist«, sagte Jessie, und ihre Stimme war so schrill, daß jede Betonung fehlte, »du solltest gestern nachmittag um drei Uhr hier sein. Wo ist Kate? Wo, zum Teufel, steckst –«. Sie beherrschte sich, schluckte den Rest dessen, was sie sagen wollte, runter. Es war eine körperliche Anstrengung. »Ruf mich an«, sagte sie ganz leise und legte auf.
Sie ging nach oben, zog sich aus und legte sich ins Bett. Sie hörte all die Geräusche, die die Nacht belebten, aber das Telefon blieb stumm.
Kapitel 5
Jessie schlief, einen kurzen, angstvollen Schlaf. Sie träumte, daß sich ihre Gebärmutter in einen Eisklotz verwandelte.
Jessie fuhr zitternd auf und riß die Augen weit auf. 8.27. Sie stieg aus dem Bett und ging den Flur entlang zu Kates Zimmer; Wie jeden Morgen drang ein Sonnenstrahl durch das Fenster auf das Bett mit der bestickten Tagesdecke; doch heute vergoldete er kein verschlafenes Gesicht. Das Bett war leer.
Jessie hob den Hörer von Kates Miss-Piggy-Telefon und wählte Pats Nummer. Immer noch die gleiche Frauenstimme auf dem Anrufbeantworter. Jetzt war ihr Bewußtsein vollends wach. All ihre Ängste waren Wirklichkeit.
Sie erschrak. Aber plötzlich beherrschte sie die Hoffnung, daß Pat in diesem Augenblick Kate zur Schule fahren könnte. Sie lief ins Badezimmer, fuhr hastig mit der Bürste durch ihr Haar, spritzte sich kaltes Wasser ins Gesicht und rubbelte es mit einem Handtuch kräftig ab. Dann zog sie sich an und ging aus dem Haus.
Vor der Santa Monica Children’s School parkten europäische Wagen im Wert von einer Million Dollar. Jessie quetschte ihr Auto dazwischen und steigerte so den Gesamtbetrag um 3240 Dollar, den derzeitigen Listenpreis für ihr Auto. Sie hatte nichts gegen staatliche Schulen, aber Pat hatte darauf bestanden, daß Kate eine Privatschule besuchte, und er war bereit gewesen, für die Schulkosten aufzukommen.
Jessie sah weder Pat noch Kate, noch den blauen BMW. Kinder gingen im Gänsemarsch durch die Eingangstür. Autos brausten wieder weg. Um 9.02 kam ein Schwarzer in der Uniform einer Wachgesellschaft, um die Tür zu schließen. Jessie stieg aus ihrem Wagen und ging in das Gebäude.
An der Tür des Klassenzimmers 24 hing ein Bild der Chinesischen Mauer. Jessie öffnete die Tür und ging hinein. Die Kinder setzten sich gerade auf ihre Plätze. Kates Platz war in der hintersten Reihe. Er war leer.
Am lisch daneben saß Cameo Brown, die sie interessiert beobachtete. Jessie versuchte zu lächeln, aber ihre Gesichtsmuskeln gehorchten ihr nicht. Sie drehte sich um, um wieder zu gehen, als eine kleine dürre Frau das Klassenzimmer betrat. Miss Fotheringham. »Bonjour, classe«, sagte sie, dann bemerkte sie Jessie. »Miss Shapiro? Kann ich Ihnen behilflich sein?«
»Ich suche Kate. Ich dachte, daß ihr Vater sie hierhergebracht hat, aber irgendetwas muß wohl passiert sein.«
Miss Fotheringham warf einen raschen Blick auf den leeren Platz und schürzte die Lippen, dann sagte sie: »Haben Sie es schon im Sekretariat versucht?« Jessie spürte, daß ihr Name auf Miss Fotheringhams Liste schlechter Mütter nach oben rutschte.
Im Sekretariat blätterte die Sekretärin durch die Telefonnotizen. Jessie studierte das Mitteilungsbrett. Es war mit Arbeiten von den Kindern bedeckt. Ein Gedicht stach ihr ins Auge.
Meine Mama,
von Cameo Brown
Ist so hübsch
ist so schön
läßt dich immer büßen
Lippen blau
Augen grün
Ich seh’ sie nur
an Halloween
meine Malibu-Mom.
»Sehr gut«, hatte Miss Fotheringham daruntergeschrieben. So erhielt Jessie den ersten Einblick in Kates und Cameos Freundschaft.
»Tut mir leid.« Die Sekretärin sah auf. »Kein Anruf.«
Jessie fuhr nach Hause. Sie ging in der Küche auf und ab. Dann rief sie Barbara Appleman an.
»Ja?« antwortete ein verschlafener Mann. Einen Augenblick lang dachte Jessie, daß sie sich verwählt hatte.
»Barbara Appleman, bitte.«
»Sie ist auf dem Weg in die Kanzlei und müßte schätzungsweise in einer halben Stunde dort sein.« Die Stimme klang sehr jung. Jessie bedankte sich und hängte ein.
Sie rief bei Gem Sound an, dann im Hollywood Recording Studio, bei Pioneer Air und bei Electric Wing Recording sowie bei Bright Things A&R. Pat war in keinem der Studios. Nirgends wurde er erwartet, und niemand wußte, wo er steckte. Jetzt gab es niemanden mehr, bei dem sie anrufen konnte. Sie kannte keinen seiner Freunde, und er hatte keine Verwandten mehr. Seine Eltern waren bei einem Autounfall im Osten ums Leben gekommen.
Jessie legte den Hörer auf und spielte mit den Tasten. Vielleicht hatten andere eine Nachricht auf seinen Anrufbeantworter gesprochen, eine Nachricht, die Aufschluß darüber gab, wo er hingefahren sein könnte. Der Anrufbeantworter konnte auch von auswärts abgehört werden. – Jessie hatte den Apparat selbst gekauft, gleich nachdem sie mit dem Getty-Museum gebrochen und sich selbständig gemacht hatte. Doch der Code fiel ihr nicht mehr ein. Sie versuchte trotzdem Pats Nummer, in der Hoffnung, ihre Finger würden sich von selbst erinnern. Sie horchte auf die Frauenstimme, tippte dann 92356. Nichts geschah. Sie versuchte es noch einmal und tippte 92-365. Das Band surrte.
Ein Mann sagte: »Niemand da? Scheiße. Ich ruf’ später noch mal an.« Piep. Surr. Eine Frau, dieselbe Frau, die die Ansage gesprochen hatte, sagte: »Pat? Hallo, hör mal, Liebling, mir ist was dazwischengekommen, und ich schaff’s nicht. Wir sehen uns, wenn du wieder da bist. Werd nicht naß.« Sie schmatzte einen Kuß. Piep. Surr. Ein Mann sagte: »Pat? Donnie. Hast du die Noten? Die Probe ist von zwei auf halb drei verlegt. Im Barn.« Piep. Surr. Norman Wine sagte: »Patrick. Komm, laß uns ablegen. Wir warten alle.« Piep. Surr. Eine lange Pause. Jessie meinte, jemanden einatmen zu hören. Dann sprach eine andere Frau; ihre Stimme klang gepreßt, aber schwach, als spräche sie mit sich selbst. »Mist. Kannst du nicht drangehen?« Noch eine Pause. Dann sagte sie lauter: »Hör zu: Du mußt abhauen. Ich hab’ A–« Piep. Die Sprechzeit der Frau war abgelaufen. Surr. Dann gab es nur noch eine Stimme auf dem Band: »Meine Nachricht ist, du solltest gestern nachmittag um drei Uhr hier sein. Wo ist Kate? Wo, zum Teufel, steckst du – Ruf mich an.«
Jessie stand auf. Plötzlich waren ihre Beine weich, ihr Mund trocken. Sie holte den Schlüssel zu Pats Haus und ging hinunter.
Es klingelte an der Tür. Jessies Herz flatterte. Sie rannte die Treppe hinunter und riß die Haustür auf. Ihre Arme breiteten sich schon aus, um Kate zu umschlingen.
Aber es war nicht Kate. Ein pummeliger junger Mann und eine Frau mittleren Alters standen auf der Schwelle. Jessie kannte den Mann nicht, und sie brauchte einen Augenblick, um die Frau zu erkennen. Sie hatte ein allzu straffes Gesicht und trug eine kurze Hermelinjacke gegen die morgendliche Kühle: Mrs. Stieffler.
»Ach je«, sagte Jessie und schaute auf die Uhr. 10.15. »Ich hatte ganz ver –« Sie suchte vergebens nach einer Erklärung. »Kommen Sie doch herein«, sagte sie. »Bitte.«
Mrs. Stieffler schwebte ins Haus, und der Mann zottelte hinter ihr her. Sie begutachteten das Wohnzimmer. Es war nicht aufgeräumt, nicht einmal geputzt.
»Das ist Dr. de Vraag aus Berkeley«, erklärte Mrs. Stieffler. »Dr. phil. Er weiß alles, was man über Rubens wissen kann.«
»Nun ja, ich –«, setzte Dr. de Vraag an.
»Alles«, unterbrach ihn Mrs. Stieffler. »Schauen wir uns das Baby also mal an.«
Jessie rührte sich nicht.
»Kommen wir auch bestimmt nicht ungelegen?« fragte Dr. de Vraag. »Vielleicht –«
»Mrs. Rodney hat den Termin selbst festgelegt«, sagte Mrs. Stieffler. »Ich wollte früher kommen, aber sie mußte ihren Sohn zur Schule bringen.«
»Meine Tochter«, korrigierte Jessie und wandte sich von der Tür ab.
Sie führte ihre Besucher durch die Diele, unter dem Calder-Mobile hindurch, das Dr. de Vraag intensiv betrachtete und Mrs. Stieffler ignorierte, und hinunter in den Arbeitsraum.
Orpheus und Eurydike lagen auf dem Arbeitstisch unter der 500-Watt-Birne. Mrs. Stieffler und Dr. de Vraag beugten sich vor, um die Leinwand zu begutachten. Im hellen Licht konnte Jessie die winzige Narbe unter Mrs. Stiefflers Haaransatz sehen, die der plastische Chirurg beim Liften verursacht hatte.
Mrs. Stieffler sah auf. Ein Lachen breitete sich über ihr Gesicht, das Grinsen eines Schleckermauls, dem gerade die Dessertkarte präsentiert worden war. »Es gefällt mir sehr gut, was Sie bisher gemacht haben«, sagte Mrs. Stieffler. »Außerordentlich gut.« »Danke.«
»Diese Farben! Sehen Sie sich nur diese Töne an! Dieses Rosa!« Sie deutete auf Eurydikes runden Arm. »Erinnert Sie das nicht an die Helena Fourment, die wir letzte Woche in Antwerpen gesehen haben, Dirk? Ich habe es gewußt. Ich habe es einfach die ganze Zeit gewußt. Instinktiv.« Sie tippte sich an die Nase.
Dr. de Vraag wirkte verlegen. »Nun, wir können uns natürlich kein Urteil bilden aufgrund einer einzigen Farbschattierung. Nach allem, was im Moment zu sehen ist, kann man nur sagen, daß das Gemälde aus der Rubens-Schule stammt.«
»Ach, seien Sie doch nicht so stur.« Mrs. Stieffler wandte sich an Jessie, und unter dem Hermelin hoben sich ihre Brüste. »Im ersten Augenblick, als ich dieses Gemälde gesehen habe, habe ich es instinktiv gespürt: Es ist echt.«
»Wollen Sie etwa sagen, Sie halten es für einen Rubens?« fragte Jessie.
»Natürlich. Es müßte nur gereinigt werden. Und voilà!« Mrs. Stieffier lachte entzückt. Ihre spitze rote Zunge schnellte auf und nieder. »Wissen Sie, wieviel ich dafür bezahlt habe?«
»Siebzehntausend sagten Sie, glaube ich.«
»Sechzehneinhalb. Und wissen Sie, wieviel es wert sein wird, wenn wir nachweisen, daß es sich um einen echten Rubens handelt?«
»Eine Menge mehr.«
»Eine Million mehr. Mindestens. Stimmt’s, Dirk?«
»Nun ja, die Preise steigen, und natürlich sind wir noch lange nicht ...« Er hielt inne, nachdem er etwas in der unteren Ecke des Gemäldes entdeckt hatte, wo Orpheus’ muskulöse Wade inmitten eines Schrittes erstarrt war. »Was ist das?«
»Die Craquelure? Ich kann sie nicht vollständig entfernen.«
»Ich verstehe. Es ... es ist ein merkwürdiges Braun.« Er beobachtete Jessie aufmerksam.
»Ja«, sagte sie. Jetzt ließ es sich nicht mehr verzögern. »Es ist bituminös.«
Sie wechselten Blicke. »Sind Sie sicher?«
Jessie schob den schweren vergoldeten Rahmen beiseite, den sie von der Leinwand gelöst hatte, und nahm eine Mappe in die Hand, die darunter gelegen hatte. Sie reichte sie Dr. de Vraag. Darin befanden sich ein Laborbericht und ein Objektträger mit Präparat, einer winzigen braunen Flocke. »Ich habe es analysieren lassen.«
Dr. de Vraag warf einen kurzen Blick aus dem Augenwinkel auf Mrs. Stieffier. »Was ist darunter?«
»Nichts. Das ist die unterste Schicht. Vielleicht könnten wir das später besprechen. Ich muß –«
»He, was sind denn das für lange Gesichter?« fragte Mrs. Stieffler. »Die Sprünge kümmern mich einen Scheißdreck.« Sie wedelte mit der Hand. »Dadurch sieht es nur älter aus, und das spricht für uns.«
Es entstand eine lange Pause, in der Jessie und Dr. de Vraag abwarteten, wer von ihnen als erster sprechen würde. Schließlich sagte Dr. de Vraag: »Mrs. Rodney hat eine Schicht bituminöser Ölfarbe unter dem Firnis gefunden. Die verursacht die Craquelure.«
»Hören Sie doch auf mit Ihrer Craquelure! Das ist der Fang des Jahrhunderts, Freunde.«
Dr. de Vraag räusperte sich. »Bitumen in Ölfarben wurde erst um 1790 verwendet – frühestens.«
»Na und?« fragte Mrs. Stieffler. Der Ausdruck ihrer Augen veränderte sich langsam. Ihr Nacken wurde breiter und ihr Kinn schob sich vor. Dr. de Vraag konnte ihrem Bück nicht standhalten. Seine Lippe zuckte, aber er sagte nichts.
»Und?« wiederholte sie. »Und, Herr 500-Dollar- pro-Tag-Gutachter?«
Jessie sah auf die Uhr. Sie hatte jetzt wirklich keine Zeit mehr, mit Mrs. Stieffler zu streiten. »Rubens ist 1640 gestorben«, erklärte sie. »Das bedeutet, daß er das Bild nicht gemalt haben kann. Und ...«
»Und was?«
»Es kann auch nicht aus seiner Schule stammen.«
»Also«, sagte Dr. de Vraag. »Ich weiß nicht, ob wir das ausschließen –«
»Halten Sie den Mund«, zischte Mrs. Stieffler. Dr. de Vraags Kiefer klappten aufeinander, und Mrs.
Stieffler fuhr Jessie an: »Wollen Sie mir weismachen, daß es eine Fälschung ist?«
»Sie haben für Rubens-Schule bezahlt, und das ist es nicht. Aber es ist trotzdem ein schönes Bild.«
Mrs. Stiefflers Gesicht lief erst rosa an, dann rot. Ihr Blick bohrte sich in Jessies Augen. »Ich bezahle Sie nicht für Laborberichte«, sagte sie schließlich. »Und ich zahle auch nicht für Ihr Mundwerk. Ich habe Ihnen nur den Auftrag gegeben, das Bild zu reinigen.«
»Es ist kein Rubens, Mrs. Stieffler.« Jessie merkte selbst, daß ihre Stimme schneidender wurde. Mrs. Stieffler vermittelte den Eindruck, daß man ein altes Gemälde mit Wischlappen und Scheuerpulver bewerkstelligen könnte. »Und auch keine Rubens- Schule.«
»Quatsch.«
»Sie können nichts daran ändern.«, Die Bemerkung war Jessie herausgerutscht, bevor sie es verhindern konnte.
»Nein? Zunächst einmal könnte ich mein Gemälde jemandem geben, der weiß, was er tut.« Sie packte den Rahmen und drückte ihn Dr. de Vraag in die Arme. Dann legte sie ihre Hände auf das Bild.
»Warten Sie«, sagte Jessie und versuchte, ihren Ton zu mäßigen.
»Angst um Ihr Honorar?« schnappte Mrs. Stieffler und warf ihr Scheckbuch auf den Tisch. Sie füllte einen Scheck aus und schleuderte ihn in Jessies Richtung. Er flatterte zu Boden. »Hier ist Ihr Geld. Aber Sie werden nie wieder für mich arbeiten. Und für keinen meiner Bekannten. Aus Bel Air bekommen Sie keine Aufträge mehr.« Sie ergriff das Gemälde und marschierte nach oben. Dr. de Vraag folgte ihr mit dem Rahmen.
Jessie stand am Arbeitstisch und zitterte. Sie hatte noch nie die Geduld mit einem Kunden verloren und ihr Geschäft noch nie so schlecht betrieben. Plötzlich war ihr kalt. Die Kälte erinnerte sie wieder an ihren Traum. Sie verließ das Haus und fuhr nach Venice.
Alles sah aus wie gestern: kein BMW in der Einfahrt, alle Vorhänge zugezogen, die zusammengerollten Zeitungen – jetzt waren es drei – auf der Veranda. Jessie schubste sie beiseite und ging ins Haus.
Es war dunkel. Aus Gewohnheit schnellte ihre Hand zum Lichtschalter in der Diele. Sie fühlte sich hier immer noch wie zu Hause, viel mehr als in ihrem kleinen Heim am Idaho. Aber sie hatte kein Geld gehabt, um Pat seinen Anteil abkaufen zu können; stattdessen hatte er sie ausbezahlt und war selbst hiergeblieben.
Auf dem lisch in der Diele lag ungeöffnete Post. Das war nichts Außergewöhnliches. Die Pflanzen mußten gegossen werden, und die Goldfische brauchten Futter. Alles wirkte ganz normal. Jessie ging ins Eßzimmer und blieb vor einer gerahmten Fotografie stehen, die sie noch nicht gesehen hatte.
Pat stand am Steuer einer Yacht, sein blondes Haar wehte im Wind. Er trug es lang, aber nicht unordentlich – wie die Beatles auf dem Cover von Sergeant Pepper. So hatte er sein Haar getragen, als Jessie ihm zum ersten Mal begegnet war, und er hatte seine Frisur nicht geändert, als hätte er schon vor langer Zeit seine Linie gefunden.
Pat hatte einen Arm um eine junge, lachende Frau gelegt: ihre ebenmäßigen Zähne strahlten im Sonnenschein, und ihr Tanga bewies, daß sie nie so schlemmte, wie es Jessie zu tun pflegte. Ein Mann im Hintergrund hob eine Flasche Champagner. Jessie erkannte an Pats Blick, daß er bereits ein Glas zu viel getrunken hatte, er lächelte, aber in Gedanken war er weit weg.
Pappschachteln vom Restaurant ›King of Siam‹ lagen auf dem Eßzimmertisch. Ihr Inhalt war zu etwas Klebrigem erstarrt und mit dem ersten Anflug von Schimmel überzogen. In den vergammelten Garnelen mit Erdnußsoße steckten ein Paar Eßstäbchen – die Stäbchen aus Elfenbein, die Kate letzten Sommer aus San Francisco mitgebracht hatte. Jessie brachte sie in die Küche, spülte sie ab und räumte sie fort.