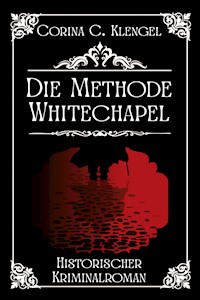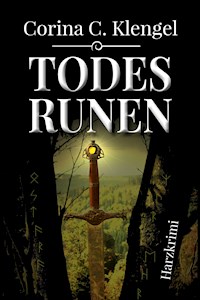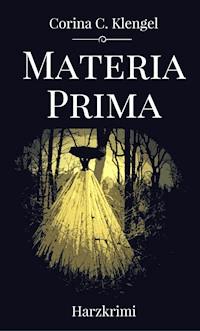4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Elektronik-Praktiker
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der zweite Fall für Tilla Leinwig: Eine junge Frau wird tot in einem Steinkreis oberhalb von Bad Harzburg gefunden. Tilla Leinwig, bei der die Tote wohnte, ist überzeugt, dass die junge Archäologin ermordet wurde. Doch die Goslarer Ermittler gehen von einem Unfall aus und legen den Fall zu den Akten. Tilla beginnt auf eigene Faust zu ermitteln und erfährt, dass die Tote in die Erforschung der Himmelsscheibe von Nebra eingebunden war. Tilla stößt auf bisher völlig unbekannte Materialanalysen des berühmten Artefaktes. Ein Professor für Archäologie von der Universität Aberystwyth bezweifelt öffentlich, ob die Scheibe überhaupt in Sachsen Anhalt hergestellt wurde. Dann taucht eine zweite, fast identische Himmelsscheibe in England auf. War Tillas Freundin womöglich einem folgenreichen Betrug auf der Spur?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Corina C. Klengel
Harzhimmel
Harzkrimi
Impressum
Harzhimmel
Überarbeitete Neuausgabe 2024
ISBN 978-3-96901-080-8
ePub Edition
V1.0 (02/2024)
© 2024 by Corina C. Klengel
Abbildungsnachweise:
Covermotiv © SergeyNivens | #208979128 | depositphotos.com
Himmelsscheibe © Rainer Zenz | Wikipedia (gemeinfrei)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nebra-1.jpg
Porträt der Autorin © Ania Schulz
Lektorat:
Sascha Exner
Verlag:
EPV Elektronik-Praktiker-Verlagsgesellschaft mbH
Obertorstr. 33 · 37115 Duderstadt · Deutschland
Fon: +49 (0)5527/8405-0 · Fax: +49 (0)5527/8405-21
Web: harzkrimis.de · E-Mail: [email protected]
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Titelseite
Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Ein Wort zum Schluss
Eine kleine Bitte
Über die Autorin
Mehr von Corina C. Klengel
Kapitel 1
Zwei Tage nach Mittsommer
Die Sonne von Süden, des Mondes Gesellin
Hielt mit der rechten Hand die Himmelsrosse
Sonne wusste nicht, wo sie Sitz hätte
Mond wusste nicht, was er Macht hätte
Die Sterne wussten nicht, wo sie Stätte hatten
Edda, Voluspa 5
Die Fichtenzweige waren schwer und tropften vor Nässe. Die morgendliche Sonne, zwei Tage nach der kürzesten Nacht des Jahres, spiegelte sich in einem Heer von Wasserperlen. Brennnesseln, wogender Fingerhut und Farnwedel milderten hier und da den Sturz der Tropfen, doch wo sie auf das verfestigte Erdreich des Waldweges klatschten, verbanden sie sich zu einem gleichmäßigen, leisen Schmatzen.
An diesem Morgen erfuhr das friedliche Leben des Waldes eine rüde Störung. Der frühen Stunde zum Trotz fanden sich rund zwanzig Polizisten auf dem Sachsenberg ein, der tausend Jahre zuvor den die Harzburg belagernden Sachsen als Sammelplatz diente. Die Polizisten kümmerte weder die Bedeutung des Platzes noch die Schönheit der Natur. Geschäftig liefen sie hin und her, bis der Steinkreis inmitten der Lichtung vollständig mit rot-weißem Kunststoffband umzäunt war.
Kriminalhauptkommissar Gerd Wegener war einer der Ersten gewesen, der sich den Sachsenberg hinauf gekämpft hatte. Nun lehnte er mit der linken Hand an einer Fichte, mit der rechten hielt er sich die eigene Seite, von der schmerzhafte Impulse ausgingen, während er darauf wartete, dass sich sein Atem beruhigte. Von der Anstrengung des Aufstiegs flimmerte es ihm vor den Augen, dennoch bemerkte er den sorgenvollen Blick, den sein junger Kollege Kriminaloberkommissar Andreas Kamenz Tilla Leinwig zuwarf. Die sonst so quirlige junge Frau mit den flammend roten Locken saß unbeweglich auf einer grob gezimmerten Bank für Wanderer und stierte leer in den Fichtenwald, vermutlich um den Steinkreis mit der Toten in der Mitte nicht sehen zu müssen.
Kamenz riss sich von ihrem Anblick los und kam auf ihn zu. Da es Wegener noch immer an Luft mangelte, begrüßte er ihn nur mit einer vagen Handbewegung und überließ ihm das Reden.
»Als Tilla ... Frau Leinwig ihre tote Freundin erkannte, ist sie auf den Steinkreis zugelaufen. Ich hab sie erst kurz vorher abfangen können. Der aufgewühlte Boden dort … ich hab sie umgerissen.«
Wegener brachte es nicht bis zu dem eigentlich angebrachten Tadel, sondern beschränkte sich auf ein gekeuchtes: »Sag’s gleich … den Tatorttechnikern … noch mal.«
Allmählich ließ das Flimmern vor seinen Augen nach. Ruhiger atmend ließ der Kommissar die Einzelheiten des Tatortes auf sich wirken. Sechs graue Klötze bildeten einen Steinkreis um eine weibliche Leiche herum. Die Quader neigten sich von der Toten weg, als erschräken sie vor deren Anblick. Nachdenklich betrachtete Wegener die durchnässte Kleidung der Toten. Das üppige lange Haar verbarg eine Hälfte des blassen Gesichtes. Es schien geradezu ungehörig, dass sich die Tote in so grotesker Weise um den jungen Baum im Zentrum des Steinkreises wand. Es wirkte, als wolle sie sich durch einen Griff um den dürren Stamm am Leben festhalten.
Endlich trafen die Kollegen von der Spurensicherung ein. In diversen Alukoffern führten sie ihre Ausrüstung mit sich. Wie schon Gerd Wegener zuvor verharrten sie mit hochroten Gesichtern, nach Luft ringend, in den bizarrsten Stellungen. Einige suchten an Bäumen Halt, andere standen, die Hände auf die Oberschenkel gestützt, oder hockten. Endlich beruhigte sich das konzertierte Keuchen. Die Routine konnte beginnen und doch zögerten alle gleichermaßen, den Steinkreis zu betreten. Hier ein Hüsteln, da ein Nesteln ‒ niemand wollte der Erste sein. So umringten die Polizisten in eigentümlicher Starre den Kreis aus Grauwackeklötzen.
Der Harz zähmte so manchen starken Geist und er brachte auch so manchen Jünger des logischen Denkens dazu, einer plötzlichen Empfänglichkeit für archaische Ängste nachzugeben, von denen man geglaubt hatte, sie mit der Kindheit abgelegt zu haben. Es spielte keine Rolle, ob dieser Steinkreis seit vielen Generationen besteht oder erst drei Tage zuvor von irgendjemandem zusammengeschoben worden war. Ein solcher Kreis hatte immer etwas Magisches, geradezu als erfordere es eine besondere Berechtigung, ihn zu betreten und damit zu entweihen.
An der Rechtsmedizinerin Dr. Hannah Giresch prallte der Zauber ab. Unbeeindruckt durchschritt die schlanke, blonde Frau den Ring, den die Polizisten bildeten, um sodann, ohne zu zögern, den Steinkreis zu betreten, um sich der Toten zu widmen. Als wäre dadurch ein Bann gebrochen, begannen die Polizisten noch geschäftiger als sonst umherzueilen. Vermutlich war ihnen der merkwürdige Moment des kollektiven Verharrens gleichermaßen peinlich.
Gerd Wegener hatte seine Kollegen ebenso interessiert wie amüsiert beobachtet, bevor er sich fragte, was es zu bedeuten haben könnte, dass eine Tote ausgerechnet in einem Steinkreis lag.
»Ich würde schätzen, sie liegt seit etwa zwei Tagen hier.« Die Rechtsmedizinerin wechselte kurz die Stellung. »Genauer kann ich es erst bei der Obduktion bestimmen.«
»Seit zwei Tagen schon?« Wegener sah sich um. »Ist das hier nicht eigentlich ein ziemlich frequentiertes Wandergebiet?«
Andreas Kamenz warf ein: »So wie es in den letzten Tagen geregnet hat, da geht doch keiner spazieren! Außerdem sind keine Ferien. Es sind noch keine Touristen da.«
Wegener grunzte zustimmend und registrierte, dass Andreas an seiner Lederjacke herum wischte. Ein kurzer Blick zur Bank zeigte ihm, dass Tilla Leinwig ebenso mit Resten des Waldbodens beschmutzt war wie Kamenz. Mit der sich aufdrängenden Vorstellung von seinem jungen Kollegen und Tilla Leinwig, die sich verschlungen am Boden wälzten, stieg Ärger in dem sonst so ausgeglichenen Kommissar auf. Kamenz war gut, richtig gut. Wenn er sich doch nur diese Leinwig aus dem Kopf schlagen würde, die nur Ärger brachte. Seine Aufmerksamkeit kehrte zu der Rechtsmedizinerin zurück, die das Gesicht der Toten mit einer kleinen Taschenlampe beleuchtete.
»Was gefunden?«, wollte Wegener wissen.
»Nein ... und genau das stört mich«, grummelte Dr. Giresch missmutig. Zentimeter um Zentimeter wanderte der Lichtfinger der Taschenlampe über weiße Haut, bleiche Lippen bis hin zu den milchigen Augen, wo er für einen Moment verharrte. »Ha!«, entfuhr es ihr triumphierend. »Punktförmige Einblutungen in der Bindehaut! Sie sind zwar dezent, aber ich denke, das werde ich mir genauer ansehen müssen. Was bedeutet, dass die Hübsche zu mir ins Institut gebracht wird«, verkündete die Rechtsmedizinerin hörbar zufrieden. »Solche Petechien können ein Zeichen für hypokapnisches Ersticken sein.«
»Dann ist sie erwürgt worden?«, fragte Andreas Kamenz.
»Das nicht«, sagte Dr. Giresch und beleuchtete kurz den Hals der Toten. »Würgemale sehe ich nicht. Aber Hypokapnie ist auch nur eine mögliche Ursache für Petechien. Die könnten theoretisch auch von starkem Husten oder von Erbrechen herrühren.«
»Und sonst? Keine Wunden?«, wollte Wegener wissen.
Dr. Giresch schüttelte den Kopf.
»Hat sie irgendetwas bei sich?«, fragte Andreas Kamenz.
Die Medizinerin befühlte die Kleidung der Toten. »Nein, nichts.« Sie blickte sich um. »Eine Handtasche sehe ich auch nicht.«
Gerd Wegener bat den Kollegen, der die Tatorttechniker koordinierte, nach einer Damenhandtasche suchen zu lassen, während Andreas sein Handy hervorholte, um den Abtransport der Leiche anzumelden. Beide standen noch immer außerhalb des Steinkreises, da die Rechtsmedizinerin ihre Arbeit noch nicht beendet hatte. Wegener registrierte eine kleine goldene Uhr am Handgelenk der Toten sowie den Umstand, dass die junge Frau keine Jacke trug. Zwei Tage zuvor war es sehr warm gewesen.
»Sie ist sehr einfach gekleidet. Ich glaube nicht, dass sie irgendetwas dabei hatte, was jemanden veranlasst, so ein Mädchen auszurauben«, sinnierte der Kommissar.
»Raubmord halte ich auch für unwahrscheinlich«, bemerkte Andreas.
»Seid nicht zu voreilig, Leute. Ich bin mir noch immer nicht sicher, ob sie überhaupt ermordet wurde«, warf Hannah Giresch ein.
»Na ja, aber eine junge Frau fällt doch nicht einfach beim Wandern tot um«, wandte Andreas ein, während Wegener diese Möglichkeit für einen Moment ernsthaft in Erwägung zog, da er selbst vor knapp zehn Minuten gekeucht hatte wie eine menschgewordene Dampfmaschine kurz vor dem Ableben.
Unschlüssig betrachtete Gerd Wegener die Kriminaltechniker in ihren weißen Overalls, die das Gebiet sorgfältig absuchten. Mehrere rote Markierungshütchen zierten den schmalen Pfad, der von dem eigentlichen Rundweg abwich und einen Schlenker zu diesem Steinkreis machte. Der Leiter der Kriminaltechnik trat hinzu und deutete auf eine Reihe von roten, auf dem Waldboden stehenden Hütchen.
»Also, für ein friedliches Ableben hätte sie aber ganz schön merkwürdige Fußspuren hinterlassen. Mal kleine Schritte, mal große Schritte, ziemlich schwankend … Hier vor dem Steinkreis sind mehrere sich überlagernde Fußabdrücke. Da ist sie wohl im Zickzack gelaufen. Schade, dass der Herr Kollege hier so nachhaltig auf alle Spuren gefallen ist«, schloss Henning Meyer und sah Andreas säuerlich an.
Andreas fragte muffig: »Was denn nun? Ist sie gelaufen oder geflohen?«
Wegener bremste die Streithähne aus. »Leute, wir müssen erst einmal den genauen Todeszeitpunkt wissen. Sollte sie nachts hier herumgeirrt sein, müssen die Fußspuren anders interpretiert werden als tagsüber. Nachts könnte sie in Panik geraten sein.«
»Ob Tag oder Nacht, ich bin für Flucht!«, verkündete Meyer mit der Endgültigkeit eines Evangeliums.
»Eigentlich müsste sie doch von der Burg gekommen sein«, nahm Wegener den Gedanken auf. »Aber wer flüchtet denn bergauf?«
»Das wäre irgendwie widersinnig«, stimmte Kamenz ihm zu.
Wegener besah sich den schmalen Waldweg und wandte sich wieder an den Tatorttechniker. »Gibt es denn noch weitere Fußspuren?«
Henning Meyer verzog das Gesicht. »Na ja, hier und da sieht es aus, als gäbe es eine zweite Spur, aber ich kann nicht mit Sicherheit sagen, wie alt die ist. Wegen der Nässe ist nicht mehr viel davon zu sehen. Ihre Spur …«, er wies mit dem Kinn auf die Tote, »… kann ich noch ganz gut erkennen, weil sie Trekkingschuhe mit starkem Profil trug.«
Wegener schaute durch eine Fichtenschneise abwärts. »Wenn sie von dort unten kam, ist sie nicht den Schildern gefolgt. Dann ist sie den Besinnungsweg quasi rückwärts gelaufen ...«
»Gerd …« Hannah Giresch hatte die Blusenärmel der Toten hochgeschoben: Auf dem Arm der jungen Frau waren zwei verschmierte Kreise zu sehen. In den Kreisen befand sich jeweils ein Muster und darunter ein Schriftzug. Doch das alles war zu stark verwischt, um etwas erkennen zu können.
»Verfluchte Nässe. Was soll das darstellen?«, fragte Wegener.
»Soll ich Tilla danach fragen?«, bot Andreas an.
Doch Wegener schüttelte den Kopf. »Nein. Noch nicht.«
Dr. Hannah Giresch erhob sich und überließ die Leiche Henning Meyer, der sich anschickte, wasserfeste Tüten über die Hände der Toten zu stülpen, um Spuren zu sichern.
»Warum hat sie eigentlich die Fäuste geballt? Hat sie vor ihrem Tod gekämpft?«, fragte Andreas mit Blick auf die Hände der Toten.
Hanna Giresch zog sich die Latexhandschuhe mit einem klatschenden Geräusch von den Händen und stopfte sie in eine weitere Beweismitteltüte. »So etwas kann auch Folge eines Krampfes sein. Entweder von irgendeinem Toxin oder es gab eine Verletzung in einer bestimmten Hirnregion. Das kann ich im Moment noch nicht sagen. Ist aber nicht ungewöhnlich.« Die Rechtsmedizinerin griff nach ihrem Koffer und warf einen letzten Blick auf die Tote. »Jungs, ich sehe sie mir wegen der Petechien zwar noch mal an, aber wenn ihr mich fragt, ich glaube, das ist gar kein Fall für die Mordkommission«, schloss sie und stapfte zielstrebig davon.
Tilla, die sich mittlerweile von der Bank erhoben und den Ermittlern genähert hatte, starrte ihr mit großen Augen nach.
»Ist die verrückt geworden? Natürlich ist Dorothee ermordet worden!«
* * *
Zwei Monate zuvor
Seine Daten, sie waren weg. All seine Dateien ... einfach weg. Verstört starrte er auf den Bildschirm seines Computers. Sein Herz begann in seiner Brust zu hämmern. Mühsam zwang er sich zur Ruhe und gab den Such-Befehl. Nach einigen Minuten erfolgloser Recherche hielt er inne. Seine Tabellen, Untersuchungsergebnisse, seine Auswertung – alles weg.
Mit einem Funken von Resthoffnung öffnete er den Papierkorb und stellte fest, dass auch dieser vollständig geleert worden war. Jemand hatte seinen Computer sabotiert. Dafür kam nur eine Person in Frage.
Vibrierend vor Zorn sprang er auf, stieß einen Wutschrei aus und begann auf und ab zu gehen. Seine Kiefer mahlten. Vor dem gotischen Fenster hielt er inne. Es tat weh, sich eingestehen zu müssen, von jemand betrogen worden zu sein, den er selbst betrogen hatte. Er hatte sie unterschätzt, gewaltig unterschätzt. Dann hielt er inne. Wie viel wusste sie? Ahnte sie, was er vorhatte?
Vermutlich hatte sie seine Dateien abgezogen, bevor sie alles gelöscht hatte. Das, was auf diesem Gerät gespeichert war, stellte nur den ersten Schritt seines Planes dar. Einige der Fakten hatte er sogar schon in Fachartikeln erwähnt. Einige der Ansätze stimmten und einige … Er grinste. Ein paar leidlich passende Vergleichswerte, ein paar hochwissenschaftliche Worte aus berufenem Munde und die Welt glaubte es.
Sein Grinsen erstarrte. Sie hatte er nicht so leicht manipulieren können, wie er gedacht hatte. Die verschwundenen Dateien waren eine Warnung. Sie glaubte ihm nicht. Nicht mehr. Das war nicht ungefährlich. Er traute ihr nicht unbedingt zu, offen gegen ihn vorzugehen, denn in der gesamten Geschichtswissenschaft fügte man sich brav den akademischen Hierarchien, innerhalb derer er als Professor den hohen Rang eines Vordenkers einnahm. Man würde seinen Theorien lemminggleich folgen. Doch selbst wenn sie ruhig blieb, was war mit ihrer Freundin? Eine Freundin, die archäologische Texte übersetzte. Verstand die genug von der Materie, um ihm gefährlich zu werden?
Er fluchte und schwor, sich zurückzuholen, was ihm gehörte. Er würde seinen Plan umsetzen. Ganz gleich, wer ihm im Wege stand.
* * *
Direkt über dem Sachsenberg, dessen Baumbewuchs sich aus der Ferne wie ein zarter grüner Flaum ausnahm, türmte sich eine gewaltige Kumuluswolke auf. Die Konturen rund um das wattige Weiß zeichneten sich wie mit dem Skalpell geschnitten vor dem immer dunkler werdenden Himmel ab. Die Sonne erhellte das Wolkengebilde noch einmal, bevor sie aufgab und ein unwirklich wirkender Gelbton den Wolkenberg einhüllte.
Das Handy auf dem Beifahrersitz dudelte. Tilla ignorierte es und schob trotzig das Kinn vor. Mitten im Refrain zu Lord of the Dance erstarb der Ton. Es war Gerred, der angerufen hatte. Sofort erschien das verfluchte Foto wieder vor ihrem inneren Auge. Er mit seiner hübschen jungen Kollegin, deren langes Haar wie eine Flagge vor azurblauem Himmel wehte, während sie ihre Visionen mit den Händen in die Luft malte. Am meisten hatte Gerreds Blick geschmerzt, mit dem er sie betrachtete. Das aussagekräftige Bild hatte Tilla am Morgen von Arnold Köster, Gerreds Chef, bekommen. Offiziell sollte sie das Portrait der neuen Kollegin in die Homepage des Architekturbüros Köster einarbeiten. Inoffiziell, da war sich Tilla sicher, hatte ihr Arnold einen Wink geben wollen. Sicher ahnte er, dass Gerred ihr bisher nichts von dieser Claudia Hohenstein erzählt hatte.
Tilla beobachtete den Rückspiegel. Der blaue Wagen, von dem sie sich einige Kilometer zuvor noch eingebildet hatte, dass er ihr folgen würde, war nicht mehr zu sehen. Erleichtert griff sie nach dem Spiegel, um ihn besser einzustellen. Für einen Moment tauchten ihre eigenen Augen darin auf. Eines war tannengrün, das andere braun mit hellen Sprenkeln darin. Tilla mochte ihre verschiedenfarbigen Augen nicht, offenbarten sie doch ihre Zerrissenheit zwischen unterschiedlichen Erbteilen. Das grüne Waldauge entstammte den Genen ihrer Mutter, das Erdauge hatte sie von ihrem Vater.
Tilla querte das Okertal. Die Luft war seltsam klar, wie so oft vor einem Gewitter. Man konnte jeden einzelnen Baum auf den Harzbergen sehen, die sich parallel zur Straße erstreckten. Kurz blitzte der Brocken in einer Lücke zwischen den runden Kuppen auf. Ein letzter Sonnenfinger liebkoste die runde Kuppe des Hexenreiches und wurde dann von stahlgrauem Zwielicht verschluckt.
»Heute Nacht werden die alten Götter im Harz einen ziemlichen Krawall veranstalten«, murmelte Tilla.
Das Wetter passte zu ihrer Stimmung. Es war genau auf den Tag ein Jahr her, dass ein Strudel von Katastrophen ihr Leben gründlich durcheinandergewirbelt hatte. Das wussten auch ihre Freunde, doch Tilla hatte alle Angebote abgelehnt, heute etwas mit ihnen zu unternehmen. Sie alle waren längst wieder im Alltag angekommen. Natürlich, warum auch nicht?
Obwohl ihre Mutter sie dafür gescholten hätte, verbot sich Tilla hartnäckig, an die Ereignisse im letzten Jahr zu denken. Im Geiste hörte sie Hedera mahnen: Solche Dinge müssen verarbeitet werden ...
Das Verdrängen funktionierte tatsächlich nur mäßig. Immer wieder schoben sich die Bilder von damals in ihr Bewusstsein – so auch jetzt. Tilla kämpfte verbissen dagegen an. Sie wollte keinen Besuch und auch nicht darüber reden. Mit einer Fluchtirade konzentrierte sich wieder auf die Straße. Vor ihr lauerte eine Radarfalle, in die sie in den letzten Monaten bereits zweimal mit überhöhter Geschwindigkeit hineingerauscht war. In gesittetem Tempo passierte sie das gestrenge Auge der Obrigkeit in Form eines Blitzers, gab dann wieder Gas und sauste in die Ausfahrt.
Sie würde sich mit einem Glas Wein vor den Fernseher setzen und alle Sinnlosigkeiten gewissenhaft ansehen, die das Gerät von sich gab. Jawohl. Sie war ja schließlich erwachsen.
Ja, irgendwann im letzten Jahr war sie tatsächlich erwachsen geworden. Wann und wie war das bloß passiert? Sie, die unstete Hexe, die bis zu jenen Katastrophen ohne nennenswerte Erfolge durchs Leben geschlingert war, hatte es mittlerweile als Übersetzerin zu einem ansehnlichen Kundenstamm gebracht. Sie arbeitete regelmäßig, fuhr einen neuen Wagen und ihre Rechnungen waren bezahlt. Sie, die immer Sklavin ihrer sprunghaften Gefühle gewesen war, führte sogar seit einem Jahr eine artige und ordentliche Beziehung mit Gerred Assmut. Obwohl ihr als Altgläubige die Gepflogenheiten des keltischen Zusammenlebens näher waren als die konventionelle, monogame Lebensweise der Gegenwart, hatte Tilla ihn tatsächlich noch nicht betrogen.
Seit heute Morgen wütete ein Gefühl in ihren Eingeweiden, dass sie bis dato überhaupt nicht gekannt hatte. Der Stachel der Eifersucht hatte sie völlig überraschend und schmerzhaft erwischt. Tilla ärgerte sich über das Gefühlswirrwarr aus Selbstzweifel, Angst vor Einsamkeit sowie einem drängenden Bedürfnis, sich zu rächen. Dazu gesellte sich die ebenso merkwürdige wie ernüchternde Erkenntnis, dass die zerstörerischen Gefühle stärker waren als ihre Liebe zu Gerred. Wieso bloß? Sie verstanden sich doch. Natürlich gab es Streitpunkte in ihrer Beziehung. Eigentlich gab es viele Streitpunkte, doch die versuchte Tilla ebenso zu ignorieren wie die Erinnerung an damals.
Die Kumuluswolke über den Harzkuppen hatte sich verbreitert. Tilla lächelte, denn sie glaubte einen Drachen in der Gewitterwolke zu sehen, der nun die Brockenkuppe zu berühren schien. Ein Beltanedrache? Der erste Mai stand kurz bevor. Tilla hatte dieses ihrer acht Jahresfeste immer am meisten geliebt. Es war für die Altgläubigen der Beginn des Sommers, der untrennbar mit dem Erwachen der Gefühle verbunden war, denen man sich ohne Scham hingab.
»Na, was willst du mir damit sagen?«, fragte sie den Wolkendrachen flüsternd. »Soll ich heute Nacht meine Flugsalbe zubereiten und zu dir auf den Brocken fliegen?« Tilla kicherte bei dem Gedanken, was Gerred für ein Gesicht machen würde, hätte er sie gerade gehört. Der kurze Heiterkeitsausbruch kehrte sich urplötzlich um und wurde zu lähmender Schwermut. Zwar gab es in ihrem Glauben weder Flugsalben noch einen Besenritt, aber sie war und blieb eine Altgläubige, eine Hexe. Würde Gerred das je akzeptieren können? In ihrem Glauben schloss man an Beltane eine Jahresehe, die man im Folgejahr an Beltane erneuern konnte. Oder auch nicht. Würde sie diese Ehe erneuern?
»Du dusselige Hexe, hör auf, über Keltenbräuche nachzudenken«, schalt sich Tilla. Seit jenen Vorfällen vor einem Jahr gab sie sich wirklich alle Mühe, normal zu sein. Es fühlte sich nicht direkt falsch an, aber es war auch nicht richtig ‒ nicht richtig für sie. Ihre Normalität war nichts weiter als eine Hülle, die etwas umschloss, das immer unruhiger wurde. Mit dem Tod ihrer Mutter war auch der schützende Kokon um ihre Lebensart weggefallen, die sich zum Teil recht deutlich vom christlichen Weltbild unterschied. Ihre hart erarbeitete Normalität hatte längst Risse.
Sie bog auf die Ilsenburger Straße ab, bis die letzten Häuser Bad Harzburgs an ihr vorbeirauschten. Kurz vor dem Abzweig in ihre Straße beschloss sie, nicht vor ihrem Haus zu parken. Stattdessen stellte sie ihren neuen Golf im vorderen Teil der Straße zwischen anderen Autos ab. Noch immer konnte sie das Gefühl nicht unterdrücken, dass es irgendwie nicht richtig war, sich Annehmlichkeiten wie ein neues Auto zu leisten. Vor allem konnte sich nicht mit dem Gedanken abfinden, dass sie für dieses Gefährt das Geld hatte angreifen müssen, das sie von ihrem Vater geerbt hatte. Doch nachdem ihr alter Wagen begonnen hatte, die Straßen mit Öl und Kleinteilen zu pflastern, hatte sie einsehen müssen, dass das schon fast historische Stück dem Autotod geweiht war.
»Du bist nichts weiter als eine Unterhaltszahlung!«, erklärte Tilla dem neuen Wagen. Sie nahm ihr Keltenkostüm, in dem sie ihre Führungen für Englisch sprechende Besucher im Rammelsberg machte, von der Rückbank und legte den Weg zu ihrem Häuschen zu Fuß zurück. Wenn ihr Auto nicht vor ihrer Haustür stand, kam hoffentlich auch niemand auf die Idee, sie zu besuchen.
Tilla hörte das leise Grollen über den nunmehr fast schwarzen Harzkuppen und beeilte sich. Mit scheelem Blick passierte sie das Haus von Gerred und seiner Schwester Dana. Gerreds Wagen war noch nicht da und Dana saß sicher in ihrem Ideenzimmer auf der Gartenseite und tüftelte an neuen Historienkostümen. Ein Lächeln stahl sich über Tillas Züge. Auch das Kostüm auf ihrem Arm stammte aus Danas Ideenschmiede. Endlich erreichte sie ihr Häuschen. Lange Efeufinger hielten das einfache kleine Siedlungshaus umschlungen und gaben ihm etwas Verwunschenes. Tilla schlüpfte fix durch die Haustür, gerade als der Himmel seine Schleusen öffnete. Vor der Tür zu ihrer Wohnung im Erdgeschoss zog sie ihre Stiefeletten aus und ging die Treppe hinauf, um ihr Kostüm ins Büro bringen, das sich seit wenigen Monaten in der Wohnung im Obergeschoss befand. Eines der zwei großen Zimmer hatte sie vermietet.
Obwohl Tilla kein Licht im Obergeschoss sah, rief sie vorsichtshalber: »Dorothee? Bist du da? Ich bin’s.« Ohne eine Antwort abzuwarten, öffnete sie die Tür und schritt durch den Flur in ihr Büro. Im Vorbeigehen registrierte Tilla, dass die Tür zu Dorothees Zimmer weit offen stand, was sie ein wenig verwunderte, da ihre Mieterin ein wenig zwanghaft war und ihre Tür normalerweise schloss.
Sie hängte ihr Kostüm über eine alte Nähpuppe, die ihr als Garderobenständer diente. Dicke Regentropfen schlugen zornig an die Fensterscheiben und verschluckten jedes andere Geräusch. Die dunklen Unwetterwolken schienen auch das Licht des frühen Abends nahezu vollständig aufgesogen zu haben, da das Arbeitszimmer in schummriges Zwielicht getaucht war. So wirkte das blinkende Auge des Anrufbeantworters überhell und um Aufmerksamkeit heischend. Tilla ging auf den Schreibtisch zu, um die Nachricht abzuhören, als ihr Blick sich in eine von einem kurzen roten Aufleuchten beschienene Gestalt in der Ecke neben dem Fenster verhakte. Die Erkenntnis, dass sie nicht allein war, traf sie wie ein Fausthieb.
Wie ein Schemen schnellte die Person aus der dunklen Ecke hervor. Tilla stieß einen spitzen Schrei aus und wirbelte fluchtartig herum. Sie fühlte einen derben Stoß gegen die Schulter, geriet ins Straucheln und schlug mit dem Kopf gegen die Kante des Schrankes. Ein feuerwerksartiger Lichtregen ergoss sich vor ihrem inneren Auge. Dann war Stille.
Tilla blinzelte und erspähte einen wollenen Kissenzipfel. Der Mond tauchte ihr Büro in fahles Licht. Der Regen hatte aufgehört. Es war still. Sie erkannte die Kontur ihres Schreibtisches. Das Blinken des Anrufbeantworters tauchte die Schrankwände impulsartig in Rot und bewirkte, dass Tillas Erinnerungsvermögen ansprang. Ein stechender Schmerz, der von ihrem Kopf ausging, holte die Erinnerungen endgültig zurück. Sie fuhr hoch und sah sich panisch um.
Nichts. Langsam erhob sie sich und tappte zum Schreibtisch, wo sie unbeholfen nach dem Schalter ihrer Schreibtischlampe tastete. Ein gelber Kegel breitete sich über der Tischplatte aus. Beklommen sah sich umher. Die Ecken ihres Arbeitszimmers waren noch immer in bedrohliche Dunkelheit gehüllt. Auf wackeligen Beinen tappte Tilla zur Tür und legte den Schalter der Deckenbeleuchtung um. Erleichtert stellte sie fest, dass sie allein war. An den Schrank gelehnt befühlte sie ihren Kopf. Unter ihren widerspenstigen dicken Locken spürte sie eine Beule.
Ein Geräusch ließ sie zusammenfahren. Die Haustür. Nun hörte sie Schritte. Mit klopfendem Herzen öffnete Tilla den schmalen Schrank neben ihr. Er enthielt ein Schwert, das einst ihrem Vater gehört hatte. Tilla zog es aus der Halterung und betrat vorsichtig den dunklen Flur. Sie hörte, wie jemand die Treppe hochstieg. Tilla legte beide Hände um den Griff und brachte die Klinge in Schulterhöhe in Anschlag. Die Flurtür schwang auf, gleichzeitig breitete sich gleißende Helligkeit aus.
Dorothee Messner wich einen spitzen Schrei ausstoßend zurück. Tilla sackte ein Stück in sich zusammen. Das Schwert sank herunter.
»Heilige Göttin ... bin ich froh, dass du es bist!«
Dorothee hatte sichtlich Mühe zu verarbeiten, was sie sah. Wie immer baumelte ihre alte lederne Schultasche an ihrer Seite, an deren breiten ledernen Riemen sie sich festhielt. Die viel zu große, weil ausgeleierte Strickjacke gab ihr etwas Kindliches.
»Was machst du denn da … mit einem Schwert?«, fragte sie mit zittriger Stimme.
Tilla zerrte das Langschwert, das ihr plötzlich viel zu schwer vorkam, in die Höhe. »Das gehört meinem Vater … äh, es gehörte ihm. Ich, äh … da war jemand … vorhin … jemand war hier oben … jemand Fremdes«, haspelte sie und griff sich mit der freien Hand an den Kopf.
»Was? Hier?« Dorothee sah sich alarmiert um. »Oh Gott, soll ich die Polizei rufen?«
»Ich … ich weiß nicht … Wie spät ist es eigentlich?«
»Fast Mitternacht.«
»Scheiße!«
»Was ist denn eigentlich passiert?«
Zögernd begann Tilla ihre Erzählung, beginnend mit der Rückkehr von ihrer Führung. Sie schloss mit den Worten: »Und dann bin ich auf meinem Sofa im Büro aufgewacht … Heilige Göttin, ich weiß gar nicht, was ich denken soll. Hab ich mir das Ganze nur eingebildet?«
Dorothee Messner ging zu ihrem Zimmer, machte Licht und linste zaghaft hinein. Danach öffnete sie die Türen zur Küche und zum Badezimmer, schaltete überall die Lampen ein und schaute nach. Erleichtert stellte sie fest: »Es ist niemand hier. Ist denn irgendwas weg … oder kaputt?«
Tilla war völlig durcheinander. »Nein, ich glaube nicht.«
»Eben an der Haustür habe ich nichts bemerkt«, sagte Dorothee unsicher, »also ich meine, keine Einbruchsspuren oder so.«
»Nein, ich glaube, die Tür war auch in Ordnung, als ich kam.« Tillas Kopf schmerzte mittlerweile unsäglich. »Ich bin gegen den Schrank gekracht. Jetzt komme ich mir so unendlich dumm vor. Vielleicht hab ich mir den Schädel gestoßen und dann schlecht geträumt.«
»Soll ich deinen Freund Gerred anrufen?«
»Nein!«, entfuhr es Tilla viel zu laut. »Ich meine, es ist ja schon spät … und ich muss das selbst erst mal verarbeiten. Ich ... äh ... ich schäme mich zu sehr.«
Dorothee rang sich ein Lächeln ab.
Plötzlich überkam Tilla das dringende Bedürfnis, Dorothee zu erzählen, was damals, genau vor einem Jahr passiert war. Und sei es nur, um ihr zu erklären, warum sie Schwert-schwingend im Flur gestanden hatte. »Hast du vielleicht Lust auf einen Tee?«
* * *
Schattenbuch
Manche Formen von Gewalt bringen Gestirne in Unordnung und verdunkeln die Sonne, manche werfen nur kurz Schatten auf eine Seele, mit der Folge, dass einem saftigen gesunden Apfel fortan an einer Stelle das Rot fehlt. Doch die schlimmste Wirkung von Gewalt ist, dass man sich so schnell an sie gewöhnt.
Gewalt ‒ Waltan hieß es im Altdeutschen, erklärte mir Tilla ‒ eng verwandt mit der Macht, der Potentia. Machiavelli verband sie untrennbar mit der Herrschaft. Für mich fängt Gewalt bereits bei der Lüge an.
Ich liebe ihn. Diese drei Worte aufzuschreiben ist mir unendlich schwergefallen, denn in ihm verbindet sich Waltan und Potentia. Ich schäme mich für diese Liebe, vor allem weil ich eine Zeit lang glaubte, sie beruhe auf Gegenseitigkeit. Aber er hat mich nur benutzt. Benutzt für eine Lüge von unglaublichem Ausmaß.
Und ich vermag nichts dagegen zu tun. Niemand würde mir glauben. Man würde mich auslachen. Und ich würde das Wichtigste verlieren, was ich habe: meinen Beruf. Niemand würde mich je wieder einstellen. Leider weiß er das. Die Lüge, die er plant, bringt mich fast um den Verstand, weil ich tatenlos zusehen muss.
Meine Mutter war es sicher nicht, die mich Ehrlichkeit und Moral lehrte, meinen Vater habe ich nicht gekannt. Nein, es war Harry, der mich lehrte, was richtig ist, und dabei war Harry ein Dieb.
Ich würde so gern mit Tilla darüber sprechen, aber wenn meine Vermutung stimmt, brächte ich sie damit in Gefahr. Tilla hat Gewalt in ihrer schlimmsten Form erlebt. Trotzdem ist sie stark, viel stärker als ich. Aber an ihm würde auch sie scheitern.
So erzählte ich Tilla von den Trieben meiner Angst, nicht aber von ihrer Wurzel. Sie riet mir, mich zu reinigen und zu erden, um meine selbstzerstörerischen Gedanken und meine ewigen Zweifel zu bekämpfen. Sie sagte, ich müsse mich neu kennenlernen, dann würde ich all das Gute sehen, was sie in mir sähe. Ich wandte ein, in meinem Kopf gäbe es keinen Reset-Schalter. Tilla lachte und erzählte mir von ihrem Glauben. Ich konnte es zuerst gar nicht fassen, dass es ihn noch gibt, den alten Glauben. Sie ist eine Hexe. Sie scheint in mich hineinsehen zu können mit ihren so interessanten Augen. Dann erklärte sie, dass sie ein Schutzritual mit mir durchführen wolle.
Zunächst habe ich nur aus Höflichkeit zugestimmt, doch dann fühlte ich mich tatsächlich seltsam berührt und gestärkt. Sie hatte in meinem Zimmer eine weiße Decke mit einem Pentagramm darauf ausgebreitet und auf jede der fünf Sternspitzen eine Kerze gestellt. Ich musste mich in den Kreis setzen. Innen vor jeder Kerze lag ein kleiner Rosenquarzstein, die ich später einstecken sollte, damit der Schutzzauber nicht nur in meinem Zimmer, sondern auch unterwegs seine Wirkung habe. Es roch scharf und würzig zugleich nach den Kräutern, die Tilla in einer Schale verbrannte. Ich sollte mich darauf konzentrieren, die Energien um mich herum zu einem Kreis zu schließen. Dann begann plötzlich eine der Kerzen zu flackern. Nur eine. Natürlich könnte dies an einem zu langen Docht gelegen haben, doch irgendwie irritierte es mich. Tilla wies mich an, nun den Spiegel aufzunehmen, auf dessen Rückseite sie ein Foto von mir geklebt hatte. Sie sagte mir Sprüche vor, mit denen sie die Elemente um Schutz bat. Ich wiederholte den Spruch, den sie mir sagte, vor jeder Kerze. Dabei sollte ich den Spiegel in diese Richtung halten. Vier der Kerzen waren genau auf eine Himmelsrichtung ausgerichtet, jede Himmelsrichtung stand für ein Element. Mit der flackernden Ostkerze sollte ich beginnen, da die negativen Energien von dort kämen, so Tilla. Also bat ich zuerst das Element Erde um Schutz. Vor der fünften Kerze sollte ich den Spiegel mit der Spiegelfläche nach oben niederlegen, hineinschauen und beschreiben, was ich sehe. Der Spiegel vergrößerte so stark, dass ich nur einzelne Partien meines Gesichtes sehen konnte. Plötzlich fand ich mein einzelnes Auge oder meinen Mund gar nicht mehr so hässlich, wie ich eigentlich war. Tilla trug mir auf, ich solle nun beginnen, Schatten und Licht meines Lebens aufzuschreiben, vor allem die Lebensschatten, um sie zu bannen. Diesem Rat verdanken diese Zeilen ihre Existenz. Mit diesem Schattenbuch werde ich versuchen, meinen größten Feind zu besiegen, nämlich mich selbst. Tilla sagte, so würde ich lernen, meinen Feind, nämlich mich, zu verstehen.
Und es hilft. Die Zeilen fließen nur so aus mir heraus und ich fühle mich tatsächlich leichter, obwohl die Angst vor einem ungebetenen Leser mein Schreiben stets begleiten und ich entgegen Tillas Rat, ehrlich zu mir selbst zu sein, sehr vorsichtig bin mit dem, was ich aufschreibe. Über ihn kann ich nicht schreiben. Vielleicht später. Dennoch, die Schatten sind nicht mehr ganz so dunkel.
Tilla ist eine weiße Hexe, jemand, der das überlieferte uralte Wissen der Kelten nutzt. Somit ist sie für mich, aber auch für meine Arbeit ein Quell von unendlich wertvollem Wissen. Ein Wissen, wie man es in keinem Buch findet. Manchmal denke ich, Tilla weiß gar nicht, über welche Schätze sie verfügt. Für sie sind die Gestirne nicht nur mineralische Klumpen, die irgendwo im All umherschwirren – für sie sind die Gestirne Personen, Götter gar. Das steht natürlich auch in Büchern, vor allem in denen über die Bronzezeit, doch ich habe immer darüber hinweggelesen. Erst jetzt verstehe ich, was es mit den alten Tierkreiszeichen und den Persönlichkeitsmerkmalen der Gestirne auf sich hat. Der Mond, sie nennt ihn ›Mondin‹, ist der Planet der Weiblichkeit, des Gefühls und der Magie. Rituale werden auf den Mond und seine Phasen abgestimmt. Der Mars gilt als Planet des Kampfes, Merkur steht für Kreativität, Jupiter für Macht und Wohlstand, Venus für die Liebe, Saturn für die Kraft, Hindernisse zu überwinden, und die Sonne, die Heilung und Wohlbefinden verspricht, steht bei den Altgläubigen für das Männliche. Wahrscheinlich kann nur ein Mensch mit diesem besonderen Wissen die Geheimnisse der Scheibe lösen.
* * *
Mit einem zartgrünen Kimono bekleidet tappte Tilla über ihre Terrasse, nippte an ihrem Tee und sog genießerisch die nach Regen duftende frische Morgenluft ein. Der hämmernde Schmerz in ihrem Kopf hatte etwas nachgelassen.
Sie hörte das metallische Klirren eines Fahrrades, dann Schritte. Gerreds hochgewachsene Figur tauchte hinter der efeubewachsenen Hausecke auf. Er trat auf sie zu. »Hey … geht es dir gut?«
Sie fuhr ihm leicht über die Narbe auf seiner rechten Wange. Früher hatte sich Tilla ein wenig an ihr gestört, heute bemerkte sie sie kaum noch. »Na, hast schon deine Tour durch den Wald gemacht?«
»Ja, nach dem Gewitter ist es herrlich heut Morgen. Wolltest du denn nicht laufen?«
»Heute nicht, ich habe Kopfschmerzen.«
»Du siehst wirklich ziemlich übernächtigt aus«, stellte Gerred mit besorgtem Blick fest.
Tilla zog den Kimono enger zusammen. »Hm, ja, ist gestern spät geworden.«
»Warum wolltest du ausgerechnet gestern allein sein?«
Plötzlich störte sich Tilla an dem nörgeligen Unterton in Gerreds Stimme. »Ich war nicht allein. Dorothee kam gestern aus Halle zurück. Wir haben noch zusammen gesessen und geschwatzt.«
»Du weißt, was ich meine. Du musst es verarbeiten, darüber sprechen ...«
»Ich hab es ihr erzählt«, entgegnete Tilla bockig. Gerred sah sie schweigend an. Sie hatte ihn vor den Kopf gestoßen. Immer kam es zu Missverständnissen, dabei wollte sie das doch gar nicht. »Manchmal ist es halt besser, wenn man mit einem Fremden über so was spricht«, sagte sie versöhnlich.
»Da bin ich ganz deiner Meinung«, stimmte Gerred ihr überraschend zu.
Erleichtert blickte sie in seine braunen Augen. Seine Gefühle für sie waren deutlich erkennbar und die Angst vor einer Nebenbuhlerin, die Tilla noch am Vortag so beschäftigt hatte, geriet so weit weg wie der Mars. Tilla hatte das Gefühl, ihm etwas vorzuenthalten, irgendwie unehrlich zu sein, und entschied sich, ihm doch lieber zu erzählen, was sie am Abend zuvor erlebt hatte. »Offen gesagt, es geht mir beschissen. Gestern ist nämlich etwas sehr Seltsames passiert …« Als sie seinen fragenden Blick auf sich gerichtet sah, wusste sie nicht mehr, wie sie weitermachen sollte. »Ich … äh … ich hab mir gestern den Kopf am Schrank gestoßen, im Arbeitszimmer, oben«, haspelte sie, hin und her gerissen zwischen dem dringenden Bedürfnis, sich ihm mitzuteilen, und der warnenden inneren Stimme, die ihr riet, es zu lassen.
»Bist du gestolpert?«, hakte Gerred nach. Er war offenkundig verwirrt.
»Ja … nein … äh ... als ich von meiner Führung zurückkam, da war ein Mann. Ich wollte grade mein Kostüm im Büro aufhängen, da stürzte jemand aus der Ecke neben dem Fenster, rennt mich über den Haufen und ich krache gegen den Schrank … und dann wache ich Stunden später auf dem Sofa im Arbeitszimmer auf.«
Gerred bedachte sie mit einem traurigen Blick. »Du hattest also wieder eine Panikattacke?«
Tilla sah ihn verwirrt an. »Was?«
»Du hattest Angst, es wäre dein Vater, stimmt’s? Du dachtest, er wäre zurückgekommen.«
»Nein! Natürlich nicht! – Und wieso wieder eine Panikattacke? Du tust ja grade so, als würde ich ständig panisch durch das Haus rennen.«
»Nun ja, du hast dir im letzten Jahr mehrfach eingebildet, dass jemand im Haus gewesen sei.«
Tilla fühlte, wie ihr die Hitze in die Wangen stieg. »Ja, schon …«
Er nahm sie in den Arm. »Nach dem, was dir letztes Jahr passiert ist, ist das doch auch kein Wunder. Schließlich sollte deshalb ja auch diese Studentin bei dir einziehen, oder?«
Tilla sonderte ein zustimmendes Geräusch ab. Trotz der Umarmung fühlte sie sich nicht geborgen.
»Tilla, was du erlebt hast, steckt man nicht einfach so weg. Die Seele muss das erst verarbeiten und sie tut das oft, indem sie das Erlebte im Geiste wiederholt. Manchmal vermischen sich solche Eindrücke mit der Wirklichkeit, man glaubt felsenfest, dass es wirklich passiert. Posttraumatisches Stresssyndrom nennt man das. Das war der Grund, warum ich dich gestern nicht allein lassen wollte.«
Tilla machte sich vorsichtig frei. Immer wenn er sie so umsorgte, hatte sie das Gefühl, nicht mehr richtig denken zu können. »Ja, ich weiß. Ich gebe auch zu, seit damals spinne ich ein bisschen ... Aber das gestern war so verdammt real.«
»Du hast aber nicht die Polizei gerufen.« Gerred sah sie ruhig an.
»Nein. Ich war mir später ja auch nicht mehr so sicher.« Tilla brachte mühsam ein schiefes Lächeln zustande. »Ein Einbrecher macht sich in der Regel wohl nicht die Mühe, sein Opfer hinterher aufs Sofa zu betten, oder?«
Gerred grinste. »Das wäre aber zumindest mal ein ziemlich netter Einbrecher gewesen!«
Tilla kam sich unendlich kindisch vor. Sie ließ den Kopf gegen seine Brust sinken und maulte: »Aber meine Beule … die ist real und tut verdammt weh!«
Von drinnen hörte sie das Telefon klingeln. Tilla ging hinein. Nach einem Blick auf das Display meldete sie sich aufgeräumt.
»Hallo, Hanjo!« Der Lebensgefährte von Astrid Volkers, die nach dem Tod ihrer Mutter ein wenig deren Rolle eingenommen hatte, war ehemaliger BKA-Beamter, der hin und wieder in beratender Funktion tätig wurde. Sie hörte ihm einen Augenblick zu und warf dann einen unsicheren Blick auf Gerred, der in der Tür auf sie wartete. Einerseits kam ihr Hanjo Berkings Bitte, nach Braunschweig zu kommen, um bei einem Verhör zu übersetzen, gerade recht. Sie brauchte dringend Beschäftigung außer Haus. Andererseits wusste sie, dass Gerred nicht eben erfreut reagieren würde.
»Jetzt?«, fragte er gereizt, nachdem sie ihn ins Bild gesetzt hatte.
»Ja. Sie haben den Kerl gerade festgenommen und er behauptet, kein Wort Deutsch zu können.«
»Wieso rufen sie dich an?«
Tilla blickte ihn säuerlich an. »Gerred, du weißt doch, ich habe im letzten Jahr öfter als Übersetzerin für die Justizbehörden gearbeitet! Außerdem war es Hanjo, der angerufen hat.«
»Das ist noch beunruhigender! Wenn ein BKA-Ermittler aus dem Ruhestand zurückgeholt wird, handelt es sich garantiert nicht um den Klau von Kaugummis.«
Tilla konnte ihren Ärger kaum noch im Zaum halten. »Heilige Göttin, Gerred … Hanjo hilft seinem Sohn und Jan ist der ermittelnde Staatsanwalt. Es ist nichts Außergewöhnliches, nur ein Verhör.«
»Du bist absolut nicht in der Verfassung, bei einem Verhör zu übersetzen!«, beharrte Gerred.
»Ich glaube, das entscheide ich lieber selbst.« Sein steinerner Blick ließ sie aggressiver als notwendig fragen: »Was stört dich eigentlich so an der Sache? Dass ich jetzt fahre? Dass ich einem polizeilichen Verhör beiwohne? Oder generell, dass ich berufstätig bin?«
Gerred drehte sich um und ging.
* * *
Schattenbuch
Ich sollte aufschreiben, was mich zu dem gemacht hat, was ich bin, hat Tilla gesagt. Genauso wie der Spiegel in dem Ritual sollen mir einzelne Begebenheiten ein objektiveres Bild meiner selbst offenbaren. Also machte ich mir Gedanken über meine Jugend und meine Mutter. Völlig erstaunt stellte ich fest, dass ich offenbar erst dann etwas von der Welt wahrgenommen habe, als Harry in unserem Leben aufgetaucht war. Er war es, der mich zu dem gemacht hat, was ich bin.
Harry und ich, wir waren beide Schattenmenschen ‒ Menschen, die niemand bemerkt. Und wenn sie doch mal bemerkt werden, dann mag man sie nicht. Niemand mochte Harry. Mich mag auch niemand so richtig. Männer müssen klug oder zumindest irgendwie clever sein, Frauen müssen schön oder wenigstens irgendwie ansehnlich sein. Harry war nicht klug und ich nicht schön. Wir passten wunderbar zusammen.
Hätte ich zu meinem Vater gepasst? Kurz bevor ich in die Schule kam, war ein Päckchen von ihm angekommen. Die hübsch verpackte Pappschachtel warf mir meine Mutter Jana zu, ohne sie eines Blickes zu würdigen. Sie interessierte sich nur für den Umschlag, denn der enthielt Geld. In dem Päckchen war ein Füllfederhalter, ein Heiko-Füller. Es musste ein Sondermodell gewesen sein, denn keiner meiner späteren Mitschüler hatte so einen schwarz-goldenen Füllfederhalter. Ich weiß noch, wie ehrfürchtig ich damals das Schreibgerät aus der edlen Schatulle herausnahm und bestaunte. Doch am meisten freute ich mich darüber, von ihm nicht vergessen worden zu sein.
Warum ich noch nie nach meinem Vater gefragt hätte, wollte Jana damals wissen. Wie sollte ich ihr darauf antworten? Dass ich doch Harry hatte? Ich hätte das Gefühl gehabt, Harry zu verraten, wenn ich mich für meinen mir fremden Erzeuger interessiert hätte. Doch Jana verfolgte diese Idee plötzlich mit Feuereifer und befand, ich sollte meinen Erzeuger für mich interessieren. Ich war von ihrem Plan nicht gerade angetan, wusste ich doch schon damals: Geld war die Triebfeder aller Aktivitäten meiner Mutter.
Irgendwann später fand ich beim Saubermachen im Papierkorb einen Brief von einer fremden Frau, offenbar die Antwort auf Briefe meiner Mutter, denen immer irgendwelche krakeligen Bilder von mir beigelegen hatten. Meine Bilder waren zurückgeschickt worden, auch sie lagen im Papierkorb. Die Zeilen der Frau zeugten von Bosheit, aber auch davon, dass die Schreiberin verletzt war. Sie schrieb, dass meine Mutter und ›ihr Balg‹ von nun an keinen Pfennig mehr sehen würden, denn ihr Ehemann, mein Vater, sei gestorben. Ob meine Mutter traurig war? Sicher nicht. Eher ärgerlich, weil er als Geldquelle ausfiel.
Meine Mutter und ich, wir passten so gar nicht zueinander. Ich kam am besten mit ihr zurecht, wenn ich mich unsichtbar machte. Wenn sie mich mal bemerkte, gab es ziepende Haare, weil sie ständig daran herumfrisierte, brennende Augen, weil sie mal wieder Haarspray hineingesprüht hatte, schmerzende Füße, weil sie immer so unpraktische Damenschühchen für mich kaufte, und Tränen, wenn sie mir meine Bücher wegnahm. Sie sagte, ich solle unter Menschen gehen und mich nicht mit Büchern vergraben. Heute weiß ich sogar, was sie meinte.
Aber Harry gab mir meine Bücher immer zurück. Er hatte nur vor einer Sache Angst, nämlich vor dem Tag, an dem Mama endgültig gehen würde. Auch ich hatte Angst davor. Harry und mich verband so vieles.
Irgendwann war es so weit. Wir zogen bei Harry aus und bei Tante Hannelore ein. Tante Hanni ist eine Gute. Ich fand schon damals, sie hatte etwas Besseres verdient, als dass ihre Schwester Jana ihr die sowieso schon dürftige Rente schmälerte. Für Tante Hanni war einfach Harry schuld an dem Desaster. Er hätte die verwöhnte, oberflächliche Jana gefälligst so befriedigen sollen, dass sie bei ihm blieb.
Doch Harry blieb mir erhalten. Immer nach der Schule schlüpfte ich kurz bei ihm zur Tür rein, erzählte ihm in lustigen, manchmal bösartigen Worten von Janas Eskapaden. Ich wollte, dass er lacht, über sie lacht. Lachen schafft Distanz, sagt Aristoteles. Nie sollte Harry wieder auf meine Mama reinfallen, denn auch er hatte etwas Besseres verdient. Wenn ich über Mama lästerte, lachte er tatsächlich ein wenig, aber nur eine Weile, dann kamen ihm die Tränen. Nichts konnte seine Liebe zu Jana zerstören, nicht mal Jana selbst. Dann ging ich. Leise. Manchmal war ich so eifersüchtig auf Jana, dass es fast wehtat. Wieso liebte er sie so? Zugegeben, sie war eine schöne Frau, aber innen war sie hässlich, völlig ohne Moral und Gefühl. Wieso wird so ein Mensch so geliebt?
Heute kenne ich die Antwort. Auch mich hat dieser Blitzschlag getroffen und urplötzlich ist nichts mehr, wie es war. Liebe gibt einem so viel Kraft und Energie, man bewältigt Dinge, die man sich zuvor niemals zugetraut hatte. So ging es auch mir, als ich noch an unsere Liebe glaubte. Sein Name wurde für mich zur Bestimmung, denn die Liebe zu ihm gab mir so viel Selbstvertrauen; durch ihn fand ich die Furt durch einen Fluss, in dessen Nähe ich mich früher nicht einmal gewagt hätte.
Als ich ihn das erste Mal sah, hörte ich zwei Stimmen in meinem Kopf. Meine Mutter schrie: Greif zu! Und Harry raunte: Lauf weg!
Hätte ich nur auf Harry gehört.
* * *
»Wie kann man nur Mädchen verkaufen«, lamentierte Tilla aufgebracht vor sich hin und hackte den Spaten mit zornigen Stößen in die Erde, die sich so vehement gegen ihren Versuch wehrte, den jungen Kalopanax umzusetzen. Sie ließ das Verhör, bei dem sie am Vormittag übersetzt hatte, Revue passieren. Zwischendurch hatte sie kurz erwogen, Hanjo von dem Erlebnis mit ihrem ungebetenen Besucher zu erzählen, doch angesichts des Mädchenschieberfalles, den er und sein Sohn gerade bearbeiteten, war ihr dieses Problem plötzlich lächerlich erschienen. Zumal sie noch immer nicht sicher war, ob sie wirklich einen Einbrecher überrascht hatte, oder ob ihr lediglich überreizte Nerven einen Streich gespielt hatten.
Tilla fuhr fort, den steinigen Boden zwischen den Wurzeln des Kalopanax mit ihrem Spaten zu traktieren. Womöglich versuchte der Garten ihr zu sagen, dass es bereits viel zu spät im Jahr war, um noch eine Pflanze umzusetzen, doch Tilla mochte von ihrem Vorhaben nicht ablassen, zumal sie bereits seit Wochen um das Bäumchen herum grub.
Beim Versuch, nach den Ereignissen im letzten Jahr zu so etwas wie einem Alltag zurückzufinden, hatte sie festgestellt, dass dieses Unterfangen scheiterte, wenn sie ausschließlich am Schreibtisch arbeitete. Also hatte sie sich an der Gartenarbeit versucht, von der sie jedoch weniger als nichts verstand. Das betraf jedenfalls die zum Teil sehr empfindlichen Heilpflanzen, mit denen ihre Mutter den großen Garten bestückt hatte. Nun wollte Tilla den kompliziert angelegten Heilpflanzengarten in eine leicht zu pflegende Rasenfläche umwandeln und arbeitete sich seit dem letzten Herbst emsig von außen nach innen vor. Zusammen mit Astrid hatte sie unzählige Heilpflanzen ausgegraben. Mit dieser Aktion hatte Astrid neben den Patienten von Tillas Mutter nun auch deren Pflanzen übernommen, die jetzt in der Erde in Osterode weiterlebten.
Zurzeit sah Tillas Grundstück allerdings aus, als wären Bomben darauf gefallen. Lediglich an der Grenze zum Nachbarn erstreckte sich hübsches, leicht erhöhtes Beet mit einer Natursteinmauer. Der Kalopanax, dessen Rinde ihre Mutter als Fungizid genutzt hatte, sollte von der Mitte des Gartens an die Wand des Schuppens wandern, wo das exotische Buschbäumchen geschützter stand und zudem die hässliche Wand mit seinen hübschen siebenfingrigen Blättern tarnte. Mittlerweile grub Tilla so tief, dass sie immer wieder auf Steine traf ‒ so auch jetzt. Wütend hieb sie das Spatenblatt unter einen besonders widerborstigen Stein und lehnte sich wippend auf den Stiel. Der Stein begann sich zu bewegen und Tilla wippte stärker. Im nächsten Moment krachte es und sie landete unsanft im Dreck. Wüste Verwünschungen ausstoßend kämpfte sie sich auf die Beine und warf den abgebrochenen Spatenstil von sich. Hier konnte sie wohl heute nichts mehr ausrichten.
Vor der Terrassentür stieg Tilla aus ihren Gummistiefeln und ging nach oben ins Arbeitszimmer, wo sie sich muffig auf ihren Schreibtischstuhl fallen ließ. Doch ihr stand so gar nicht der Sinn nach konzentrierter Schreibtischarbeit. Sowohl das Verhör am Morgen als auch der Einbrecher gingen ihr einfach nicht aus dem Kopf. Konnte man sich so etwas wirklich einbilden? Beklommen sah sie sich um.
Die Schrankwand stammte aus dem Büro ihres Vaters. Er war ein ranghoher Nazi gewesen, der sein Hauptquartier in Ilsenburg hatte, bevor eine Großrazzia der Vereinigung ein Ende gemacht hatte. Zuvor jedoch hatte man ihren Vater ermordet. Hatte hier vielleicht jemand etwas gesucht, der ihn gekannt hatte? Hatte sie mit den wenigen Sachen, die sie von ihm behalten hatte, womöglich seine Feinde angelockt? Ihr Blick blieb an dem schmalen Schrank hängen. Hatte es jemand vielleicht auf das Schwert abgesehen? Sie wusste, es war recht wertvoll. Ungnädig gab sie ihrem Schreibtischdrehstuhl Schwung, um den Schrank nicht mehr sehen zu müssen. Wie ein Kind freute sie sich an der schnellen Drehbewegung. Als sie verebbte, blickte Tilla geradewegs in die Ecke, aus der sie den Schatten hatte herausspringen sehen. Sie bemerkte etwas Dunkles auf dem Parkettfußboden und erstarrte. Dort hatten große Schuhe dreckige Abdrücke hinterlassen.
* * *
Schattenbuch
Was ich bin, verdanke ich Harry, deswegen ist es seine Geschichte, die ich aufschreiben muss. Harry wurde zum Dieb und doch war er ein guter Mensch. Was damals passierte, gab ihm für eine kurze Zeit sein Leben zurück. Und sein Leben war Jana. Mit dem Geldsegen kam sie wieder zu ihm. Ich war sechzehn, als ich die Sternenscheibe zum ersten Mal sah. Von da an wusste ich, dass ich Archäologin werden wollte.
Es war sommerlich heiß, als Harry wieder einmal mit seiner Sonde loszog. Was für andere das Ausfüllen eines Lottoscheines war, war für Harry die Schatzsuche. Leider wurde er an diesem Tag von seinem alten Freund Manfred begleitet, das nichtsnutzigste Subjekt, was man sich vorstellen kann. Harry und Manfred hatten sich entschlossen, ihr Glück auf einem Bergkamm bei Ziegelroda zu versuchen. Dort hatte Harry einmal ein altes Militärabzeichen gefunden. Er konnte mit seiner Sonde gut umgehen und wusste die Sinfonie von Tönen, die auf unterschiedliche Metalle hinwies, gut einzuschätzen. Ich hadere bis heute damit, dass es Manfred war, der Harry an diesem Tag begleitete, und nicht ich. Vieles wäre anders gelaufen. Wahrscheinlich würde er noch leben.
An diesem Tag, so erzählte mir Harry später, habe er dieses Zeichen an einem der Bäume gesehen. Jemand hatte in die Rinde einer Buche ein Herz mit einem J und einem H darin geschnitzt, genau so ein Herz, wie er einst für sich und Jana in die Buche beim Festplatz geschabt hatte. Dieses Herz sei für ihn das Signal gewesen, unbedingt weiterzumachen. Ich sagte ihm, dass ihm Jana aber noch nie Glück gebracht habe, doch er erklärte mir mit diesem typisch verschmitzten Lächeln, das ich so an ihm liebte, das H und das J in Ziegelroda habe auch nicht für Harry und Jana gestanden, sondern für Harry Jones, den Indiana Jones aus Halle. Und genau das wurde aus ihm.
* * *
»Hey Dorothee, was ist denn los? Kann ich dir helfen?«, fragte Tilla ihre Mieterin, die gerade die Treppe hinaufhuschen wollte.
Dorothee blieb unschlüssig stehen. Die ungeschminkten Augen hinter der dicken Brille zeigten verräterische Spuren von Röte.
»Na komm, ich mache uns einen Tee.«
Tilla lächelte Dorothee aufmunternd an und ging in die Küche, wo sie sich gleich an ihrem Wasserkocher zu schaffen machte.
»Ja, einen Tee kann ich gut gebrauchen.« Dorothee folgte ihr und ließ sich auf der Küchenbank nieder.
Tilla registrierte, dass sie ihre Ledertasche vorsichtig neben sich auf den Boden gleiten ließ, während sie eine bauchige, tiefblaue Kanne aus Steingut mit Teeblättern und siedendem Wasser füllte. Sodann schnappte sie sich zwei dazu passende Becher und platzierte alles auf dem Tisch. Von der Tür her meldete sich Tillas Katze Paris mit einem Maunzen. Dorothee fuhr zusammen und stieß prompt ihre Tasche um. Ein Sammelsurium kleiner Utensilien ergoss sich über den Fußboden. Ein Laptop rutsche ebenfalls heraus, aber so langsam, dass Dorothee danach greifen konnte, bevor das Gerät Schaden nehmen konnte.
»Gott, was bin ich ungeschickt!«
Tilla stellte den Zuckertopf ab und ließ sich ebenfalls nieder, um die restlichen Kleinteile aufzulesen. Ein schwarzgoldener Füllfederhalter, der über den Küchenboden gerollt war, wurde begeistert von Paris gefangen.
»Lässt du denn wohl los!«, mahnte Tilla liebevoll und nahm der Katze das Beutestück vorsichtig aus der gekrümmten Minitatze. »Ein schöner Stift … sieht alt aus.«
Paris bedachte Tilla mit einem strafenden Blick und strebte zu ihrem Katzennapf in der Ecke der Küche, vor dem sie sich gravitätisch niederließ, um sich an der Futterration gütlich zu tun. Tilla las noch weitere Kleinteile sowie einen kleinen Inhalator mit Asthmaspray auf und legte alles auf den Küchentisch.
Dorothee nahm den Füllfederhalter und drehte ihn nachdenklich zwischen Zeigefinger und Daumen. Ihr angespanntes Gesicht zeigte ein schiefes Lächeln. »Ja, das ist das Einzige, was ich von meinem Vater habe, ein guter alter DDR-Heiko-Füller.« Ihr Blick verdunkelte sich. »Mir erging es ähnlich wie dir, ich hab meinen Vater auch nicht gekannt.«
Tillas Magen zog sich zusammen. »Oh Dorothee, das tut mir leid für dich!«
»Muss es nicht. Ich hatte einen wunderbaren Stiefvater.« Dorothees Hand wanderte zu der Kette mit dem altmodischen Medaillon, das Tilla schon häufiger an ihr gesehen hatte. Ihr Finger strich an der Kontur der Rose entlang, die den Anhänger zierte, bevor ihr Blick zu Paris zurückkehrte. »Wir hatten auch mal eine Katze. Grau getigert mit einem breiten Kopf, nicht so schön wie sie.«
Paris ließ ein Maunzen hören, was Tilla auflachen ließ. »Sie hat dein Kompliment gehört und sagt, dass du sie dir jederzeit zum Streicheln ausleihen kannst!«
»Das würde ich gern, aber leider bin ich gegen Katzenhaare allergisch. Deswegen mussten wir Hannibal, unseren Kater, damals auch abgeben.« Dorothee hielt mit schiefem Lächeln den Inhalator hoch, bevor sie ihn in die Ledertasche fallen ließ.
»Oh, das wusste ich gar nicht. Soll ich Paris rausschicken?«, fragte Tilla besorgt.
»Nein, nein … jetzt ist es nicht mehr so schlimm.« Dorothee verstaute die restlichen Utensilien in einem Innenfach der Tasche. Ihr Mitteilungsbedürfnis erstarb wieder.
Tilla begann, die zurückkehrende Spannung ignorierend, über die angebotene Teesorte zu plaudern. Dorothee schob ihre unkleidsame Hornbrille höher, so dass der obere Rand mit ihren über der Nase zusammenwachsenden Brauen abschloss, und starrte ins Leere. Offenbar war sie in Gedanken ganz woanders. Tilla schob ihr den Teebecher zu, was ihren Gast ins Diesseits zurückbrachte.
»Ah, Lapacho … ja, ich habe schon von Lapacho-Tee gehört«, antwortete Dorothee, bemüht, an Tillas Worte anzuknüpfen, von denen sie vermutlich nur einen Bruchteil mitbekommen hatte. Etwas holprig schob sie nach: »Ich glaube mich zu erinnern, dass Lapacho schon von den Mayas genutzt wurde … als Mittel gegen Entzündungen und Fieber.«
Tilla hob anerkennend die geschwungenen, sorgfältig in Form gezupften Brauen. »Das stimmt. Aber ich trinke ihn so gern, weil ich den Geschmack mag.« Vorsichtig kehrte sie zu dem vermuteten Grund von Dorothees Kummer zurück. »Ich hörte dich gestern Abend ziemlich laut telefonieren. Magst du mir erzählen, um was es ging?«
Dorothee starrte in ihren Tee. »Es war … mein Freund.«
»Du hast dich mit deinem Freund gestritten?« Tilla durchforstete ihre Erinnerung danach, ob Dorothee je von einem Freund gesprochen hatte. Hatte sie nicht.
In erstaunlich festem Ton antwortete Dorothee nun: »Wir haben uns getrennt.«
»Oh«, machte Tilla mitfühlend.
Dorothees Augen wurden feucht, als sie leise sagte: »Der Mistkerl hat mich belogen und betrogen, er hat mich nur benutzt.« Sie fingerte wieder an ihrer Kette herum und kniff die Augen zusammen, um die Tränen zurückzuhalten. »Verdammt, wieso habe ich erst jetzt begriffen, was für ein verlogener Mistkerl er ist!«
»Erzählst du mir von ihm?«, fragte Tilla vorsichtig.
»Ich hätte mir eigentlich gleich denken können, dass so ein Mann nicht an mir interessiert sein kann. Er sieht so verdammt gut aus, viel zu gut für jemanden wie mich.«
Ihre Worte rührten Tilla sehr. Um die junge Frau vor ihr zu beschreiben, hätten höfliche Menschen vielleicht das Wort apart hervorgezwungen, doch sicher hätte sich niemand dazu verstiegen, sie hübsch zu nennen. Tilla ärgerte sich schon lange darüber, dass Frauen, die nicht dem gängigen Schönheitsideal der Medien entsprachen, stets abfällig behandelt wurden.
»Nun hör aber auf! Niemand ist zu gutaussehend für dich, Dorothee! Übrigens betrügen Schufte schöne Frauen genauso. Schuft bleibt Schuft. Dorothee, du bist so klug! Ich habe damals mein Studium abgebrochen, und ich beneide dich sehr um das, was du geschafft hast. Du bist eine vielversprechende Archäologin und ich bin sicher, du wirst die Fachwelt irgendwann vor Ehrfurcht erstarren lassen, wenn du Atlantis oder etwas ähnlich Tolles gefunden und ausgebuddelt hast!«
Dorothee lachte auf, gleichzeitig kullerte ihr eine Träne über die Wange. »Nett von dir, das zu sagen, aber auch was meine Fachkompetenz angeht, zweifele ich an mir. Er warf mir vor, mir fehle die wissenschaftliche Distanz, deshalb würde ich mich weigern, unumstößliche Fakten anzuerkennen. Wahrscheinlich hat er recht.«
»Weißt du, es gibt Männer, die machen Frauen gern klein. Solche Kerle brauchen das, vor allem, um mit jemandem wie dir umzugehen, denn mit deiner Klugheit bist du den meisten Männern überlegen. Vielleicht auch ihm …«
Dorothee sah Tilla nachdenklich an. »Ich gebe zu, von Männern verstehe ich gar nichts. Aber dieser Mann hat wirklich keinen Grund, sich vor mir zu fürchten. Er sieht gut aus, ist reich, berühmt, und an Talent mangelt es dem weiß Gott auch nicht. Ich kann ihm nicht mal das Wasser reichen … im Gegensatz zu anderen.«
Tilla ahnte langsam, wo das Hauptproblem lag. »Anderen? Eine Andere? Ist er verheiratet?«
Dorothee seufzte. »Er ist verlobt.«
»Na toll. Dann ist er wirklich ein Schuft, denn die andere hat er ja dann auch betrogen. Gut, dass du ihn in die Wüste geschickt hat. Vielleicht sollte ich mich doch mal an einem Schadenszauber versuchen«, schlug Tilla humorig vor. »Wenn ich nur nicht befürchten müsste, dass meine Mutter als Geist zurückkehren und mir den Hintern versohlte.«
Dorothee lachte leise, verstummte und blickte dann leer auf ihre Hände. »Ich fürchte, für Schaden hab ich schon selbst gesorgt. Ich habe seine Arbeit sabotiert und seine Daten gelöscht. Es war die ganze Arbeit der letzten Wochen.«
»Gut!« Tilla grinste wie ein Kobold. »Du sagtest, er hätte dich nur benutzt … was meinst du damit? Geht es um deine Arbeit? Ist er ein Arbeitskollege von dir? Kenne ich ihn womöglich?«
»Nein … nein, du kennst ihn nicht.«
Tilla sah, wie Dorothees Gedanken auf Wanderschaft gingen. Sie gab ihr die Zeit und nippte an ihrem Tee.
»Er wird seine Daten neu erstellen«, flüsterte Dorothee und kniff die Augen zusammen. »Wenn ich doch nur mehr Zeit hätte …«
»Zeit wofür?«
»Um seine Interpretation zu widerlegen. Es ist etwas kompliziert, denn ich darf noch nicht über die Untersuchungen sprechen …« Wieder versank Dorothee in Nachdenklichkeit. »Es kann einfach nicht stimmen«, murmelte sie. Plötzlich verkrampfte sich ihre Hand so um ihre Halskette, dass Tilla schon befürchtete, sie würde reißen. Völlig entgeistert starrte Dorothee das Medaillon an. »Oh Gott!«
»Was ist denn?«, fragte Tilla beklommen.
»Das ist es! Ich bin so naiv … Das ist es, was er wollte. Er wird sie uns wegnehmen und das ist meine Schuld«, gab Dorothee fast tonlos von sich. Dann riss sie so erschreckt die Augen auf, dass Tilla Angst um ihre Freundin bekam. »Und dich habe ich auch noch mit hineingezogen.«
»Hineingezogen? In was denn?«, fragte Tilla alarmiert.
»Das erkläre ich dir später. Jetzt ist es besser, wenn ich schnellstens verschwinde, bevor noch Schlimmeres passiert.« Abrupt erhob sie sich und raffte ihre Ledertasche an sich. »Sag allen, ich wäre ausgezogen und du weißt nicht wohin.«
»W... was?« Tilla sprang ebenfalls auf.
Dorothee sauste schon zur Tür, hielt inne und sagte dann: »Sag im Museum Bescheid, bitte. Ich bereite noch ein Kündigungsschreiben vor. Es wäre schön, wenn du es für mich abgibst. Erzähl denen was von einem familiären Notfall.«
»A… aber … deine Ausstellung«, haspelte Tilla.
»Da wird es keine Probleme geben, ich habe schon so weit alles vorbereitet. Ich packe jetzt meine Sachen zusammen, würde sie aber gern noch oben stehen lassen. Trotzdem: Wenn jemand nach mir fragt, sag unbedingt, ich sei weg und du weißt nicht, wohin.«
»Ja aber …«
»Glaub mir, ist besser so. Ich muss etwas nachprüfen. Vielleicht kann ich bei meiner … bei einer Bekannten ein paar Tage bleiben. Meine Sachen hole ich später ab und kehre nach Halle zurück.« Dann drehte sie sich einmal um und nahm Tilla ungeschickt in den Arm. »Du hast mir mehr geholfen, als du denkst.«
* * *
Claudia Hohenstein dachte über Gerred Assmut nach, während sie die Haustür des unscheinbaren Reihenhauses im Südteil von Wernigerode aufschloss. Ihre ersten Versuche, ihn auf sich aufmerksam zu machen, waren erfolgversprechend verlaufen. Es würde nicht lange dauern, bis er tat, was sie wollte. Und was sie wollte, war ein neuer Name. Durch Heirat. Unverfänglich und unkompliziert.
Ihr eigener Name hatte in der Architektenszene leider einen unangenehmen Beigeschmack. Bevor ihr dieses ärgerliche Faktum von Berlin hierher folgen konnte, musste sie Assmut für sich gewonnen haben. Es wurde Zeit, dass sie wieder richtige Entwürfe veröffentlichte, nicht diesen Kleinkram für Köster. Der Name Assmut war außerdem bereits mit dem Beruf des Architekten verbandelt, Gerred war wirklich die perfekte Wahl. Claudia sah in den Flurspiegel und fuhr kurz mit dem Finger unter ihrem Lidstrich entlang, der eigentlich keinerlei Korrektur bedurfte.
»Ich muss ihm nur noch klar machen, wie überflüssig diese Tilla für ihn ist«, murmelte sie ihrem Spiegelbild zufrieden zu.
Sie ging ins Wohnzimmer und rümpfte die Nase. Ihre Mutter hatte die Güte gehabt, ihr dieses Haus zu hinterlassen, es zuvor aber dreißig Jahre lang mit zwei Zigarettenschachteln pro Tag eingeräuchert. Der Geruch war auch durch die Sanierung nicht vollständig gewichen. Nun erinnerte er sie tagtäglich an die völlig emotionslose Person, die stundenlang rauchend aus dem Fenster geschaut und keinerlei Interesse für ihren Mann oder ihre Tochter aufgebracht hatte. Unwillig öffnete Claudia das Fenster.