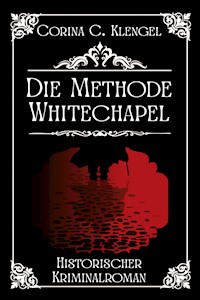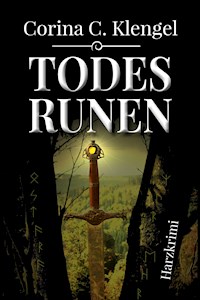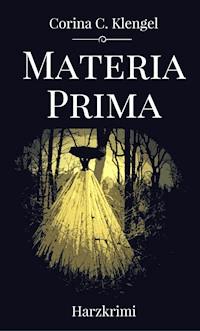Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Elektronik-Praktiker
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Als Kriminalhauptkommissar Andreas Kamenz den Auftragskiller des berüchtigten Venedigerordens verhören will, findet er diesen erschossen in seinem Krankenhausbett. Eine Bibelseite liegt auf dem Gesicht des Toten. Zur gleichen Zeit wird Kamenz' Freundin Tilla von einer Frau bedroht, die kurze Zeit später ermordet aufgefunden wird. Tillas Vermutung, dass ein Exorzist dafür verantwortlich ist, glaubt man zunächst nicht. Während der Suche nach der Identität der Toten stößt Tilla auf ihre eigene Vergangenheit. Sie erfährt, dass sie noch lebende Verwandte in Braunlage hat. Dann geschieht ein weiterer Mord in Torfhaus. Am Tatort liegt ein Messer, das zu Tilla führt. Weitere belastende Beweismittel werden auf dem Grundstück von Tilla und Andreas gefunden, die dadurch unter Mordverdacht geraten. Bald verschwinden zwei Mädchen, eine davon ist Tillas Cousine. Holt der Venedigerorden erneut zum Schlag aus? Oder ist tatsächlich ein verblendeter Exorzist im Harz unterwegs?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1011
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Corina C. Klengel
Impressum
ISBN 978-3-947167-38-8
ePub-Version (Kindle)
V1.0 | 05.2019
© 2019 by Corina C. Klengel
Abbildungsnachweise:
Umschlagmotiv © Waldkunst | pixabay.com
Autorenporträt © Ania Schulz | as-fotografie.com
Die Abbildungen im Prolog sowie den einzelnen Kapiteln
sind gemeinfrei (Public Domain) und entstammen entweder
dem Archiv der Autorin oder wurden mit (freiwilliger) Nennung
der Lizenz von Wikimedia Commons entnommen.
Lektorat:
Sascha Exner
Verlag:
EPV Elektronik-Praktiker-Verlagsgesellschaft mbH
Postfach 1163 · 37104 Duderstadt · Deutschland
Fon: +49 (0)5527/8405-0 · Fax: +49 (0)5527/8405-21
E-Mail: [email protected]
Alle in diesem Roman vorkommenden Schauplätze und Orte sind real. Die Handlung und Charaktere hingegen entspringen der Fantasie der Autorin. Ähnlichkeiten mit verstorbenen oder lebenden Personen wären rein zufällig und sind nicht beabsichtigt.
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
Impressum
Epilog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Über die Autorin
Mehr von Corina C. Klengel
Todesrunen
Harzhimmel
Venedigerzeichen
Die Hexenquelle
Materia Prima
Epilog
Im Harce ist sehr wohl bekannt,
ein Berg, der Brockelberg genannt.
Der Berg ist wahrlich arg beschreit.
Dieweil des Nachts zu Walpurgis Zeit,
in großer Zahl, wie ich bericht’,
die Zauberinn’ mit ihr’m Gezücht
insgeheim den Sabbat halten.
Über hohe Berg und tiefe Tal,
bis dass sie kommen allzumal,
eine jede Hex an ihren Ort,
auch oftmals stiften an zum Mord …
Johannes Praetorius
Sage vom Hexensabbat auf dem Blocksberg (Brocken), 1668
Blockes-Berges Verrichtung
Johannes Praetorius, 1668
(Archiv der Autorin)
Kapitel 1
Chaos
Διάβολος - Diábolos der Durcheinanderwerfer,
derjenige, der Chaos stiftet und der die Menschen ins Chaos,
den Urzustand, zurückwirft.
- Antikes Griechenland -
Der kahlköpfige, mit einem Arztkittel bekleidete Mann ging durch den leeren Krankenhausflur, als ob er dort hingehörte. Doch er war kein Arzt. Vor der Tür eines Krankenzimmers blieb er stehen, nahm die dicke Hornbrille ab und steckte sie in die Brusttasche. Er brauchte sie nicht. Die Brille und auch die Opferung seines vollen, dunklen Haares waren lediglich Bausteine einer brachialen Veränderung. Leise betrat er den Raum.
Ohne den schlafenden Mann in dem Bett aus den Augen zu lassen, griff er unter den Arztkittel und förderte eine halbautomatische Pistole nebst einem Schalldämpfer zutage. Mit einer exakten Bewegung schraubte er beides zusammen. Er mochte die 92er Beretta. Sie war schwer und lag gut in der Hand. Vor allem hatte sie Tradition. Es war der einstige Büchsenmacher Maestro Bartolomeo Beretta aus Venedig, der im 16. Jahrhundert den Grundstein für diese Waffenschmiede legte. Eigentlich sollte ihn das nicht mehr kümmern. Er gehörte nicht mehr zum Orden der Venediger. Er war ein Verfemter, hatte alles verloren. Unbändiger Zorn durchfuhr ihn wie eine glühende Lanze. Das hatte er zwei Personen zu verdanken. Dem Mann, der vor ihm in diesem Krankenbett lag, und seinem verfluchten Bruder.
Noch immer war es ihm ein Rätsel, wie es Andreas geschafft hatte, ihm auf die Spur zu kommen - ihm und damit dem Venedigerorden. Seinen kleinen Bruder so zu unterschätzen, war der größte Fehler seines Lebens gewesen. Gregor, der einst den Ordensnamen Abundius trug, drängte die verstörende Erinnerung beiseite und weckte seinen Schwager Johannes grob aus dem von Betäubungsmitteln geförderten Schlaf. Der einstige Liquidator des Venedigerordens, vor dem alle zitterten, war nur noch ein Schatten seiner selbst. Entsprechend abfällig geriet der Blick des nächtlichen Besuchers. Johannes Kamenz schlug die Augen auf, die, als er ihn erkannte, deutlich größer wurden.
Fast liebevoll setzte Gregor den durch den Schalldämpfer verlängerten Lauf auf die Stirn seines Opfers und flüsterte ihm zu: »Du hast mich ruiniert. Aber was noch schlimmer ist, du wolltest meine Schwester umbringen! Deshalb werde ich es mir nicht nehmen lassen, das hier selbst zu machen. Und mit deinem Tod werde ich das erreichen, an dem du gescheitert bist, nämlich meinen Bruder zu vernichten. Addio, du Versager.«
Johannes rührte keine Faser seines Körpers. Das Fehlen jeglicher Gegenwehr erleichterte und ärgerte Gregor gleichzeitig. Auf Johannes warteten endlose Verhöre und Jahre im Gefängnis. Das war für jemanden, der ohne Laroche Chablis und seine van Laack Seidenhemden nicht auskam, wohl kaum eine annehmbare Lebensgestaltung. Sie sahen sich in die Augen, als es pitsch machte. Die durch den Schalldämpfer umgeleiteten Geschossgase verursachten ein Geräusch, dass dem einer kleinen Peitsche ähnelte. Johannes’ Kopf drückte sich ruckartig ins Kissen. Sein Blick brach.
Gregor hatte immer wissen wollen, wie es ist, zu töten. Nun stellte er fest, es war ein erhebendes, geradezu elektrisierendes Gefühl. So großartig, dass er Johannes’ Sterben noch einen Augenblick genussvoll hinterherfühlte. Noch einmal … pitsch. Widerstrebend löste er sich von dem Anblick der starren Augen und horchte, ob sich draußen auf dem Flur etwas tat. Die Schüsse waren so gedämpft und verfremdet, dass sicher niemand in diesem Geräusch einen Pistolenschuss erkannt hatte. Spezialmunition und Schalldämpfer hatten dem Geschossknall alles bis auf neunzig Dezibel genommen. Gregor hob mit der behandschuhten Hand die Bettdecke an und schoss einmal in den gesunden Fuß, ins Bein, dann hinterließ ein weiteres pitsch eine durchschossene Hand. Befriedigt erkannte er, dass der Herztod dem Hirntod so langsam folgte, dass die Wunden noch bluteten. Genau in seinem Sinne. Daran würden die Rechtsmediziner im Team seines verfluchten Bruders zu kauen haben, bevor sie zu dem von ihm gewünschten Ergebnis kamen.
Mit einem Lächeln entnahm er der Tasche seines Arztkittels ein kleinformatiges schwarzes Buch mit der Prägung eines Kreuzes darauf. Die Initialen AK prangten quer auf den goldgefärbten Seitenrändern. Er schlug die Bibel auf. Andreas Kamenz stand dort in einer noch unreifen, eckigen Schrift. Er blätterte und fand die gewünschte Stelle im ersten Buch Mose. Der sechste Vers …
Eine kurze Erinnerung keimte in ihm hoch. Sein Vater hatte Andreas geschlagen. Wieder einmal. Stets wurde seinem aufsässigen Bruder dann diese Textstelle vorgehalten. Er drehte die aufgeschlagene Bibel um und klatschte sie dem Toten auf das blutige Gesicht. Andreas würde verstehen. Und er würde nichts tun können.
»So Kleiner, das wird dich davon abhalten, mich zu jagen. Deine Kollegen werden mir dabei helfen, sie werden dich nämlich in den Knast schicken.«
Irgendwo draußen fiel eine Tür zu. Schritte knatschten über den PVC-Boden. Fix schraubte er die Waffe auseinander und steckte sie ein. Er huschte zur Tür und öffnete sie einen Spalt breit. Eine grünliche Notbeleuchtung tauchte den Flur in ein Licht, als befände man sich unter Wasser. Irgendjemand war im Anmeldebereich der Station, der links von ihm lag. Er verließ das Krankenzimmer und bewegte sich nahezu geräuschlos in die entgegengesetzte Richtung, wo er wenige Augenblicke später durch die Tür eines Treppenhauses verschwand.
Wahrlich, zuerst war das Chaos und später die Erde.
- Hesiod, 700 v. Chr. -
Fahles Mondlicht fiel auf eine Gestalt in einem mittelalterlichen, dunklen Mönchsgewand. Sie stand im hinteren Teil des Gartens. Obwohl Andreas das von einer Kapuze verdeckte Gesicht nicht sehen konnte, spürte er deutlich den Blick des Mönches auf sich gerichtet. Langsam hob sich die Hand und die Kapuze glitt nach hinten. Es war, als würde Andreas in sein eigenes, um zehn Jahre gealtertes Gesicht sehen. Es war sein Bruder Gregor, der ihm eine Faust entgegen streckte. Das Mondlicht verfing sich in dem Diamanten des dreieckigen, goldenen Ringes, der Gregors Zugehörigkeit zum Venedigerorden dokumentierte. Plötzlich warf sich die Gestalt herum und verschwand zwischen den Bäumen. Andreas lief ihm nach. Tillas gellende Rufe hinter sich ignorierte er. Sein ganzes Denken war auf Gregor fokussiert. Er musste ihn sprechen, ihn davon abhalten zu fliehen. Warum war er so langsam? Seine Füße wurden immer schwerer. Er kam einfach nicht vorwärts. Es war, als hielte ihn die Erde fest. Plötzlich stand Gregor vor ihm auf einer Lichtung. Das Morgenlicht hüllte ihn in eine rot-gelbe Corona, als wäre er eine heidnische Gottheit. Andreas verstand nicht. Gregor hob den Arm erneut. Erst jetzt erkannte Andreas, dass sein Bruder eine Waffe auf ihn richtete. Noch während er mit dem Verstehen kämpfte, hörte er den Schuss und fühlte, wie er nach hinten fiel. Doch da war kein Boden. Er fiel und fiel, während er weit entfernt Tillas Rufe hörte ...
Keuchend fuhr er hoch und sah in Tillas verschiedenfarbige Augen. Ihre Hände lagen auf seinen Schultern, an denen sie kurz zuvor gerüttelt hatte, um ihn aus seinem Traum herauszuholen. Sie umfasste seine erhitzten Wangen und blickte ihn besorgt an.
»Wach?«
Andreas nickte kraftlos. Schweiß trat ihm aus allen Poren und kühlte unangenehm schnell ab, sodass er alsbald fror. Sobald er die Augen schloss, kehrte Gregors Gesicht zurück.
»Nein, nein, nein … nicht wieder einschlafen!«, mahnte Tilla. »Es gibt Träume, die wird man nur los, wenn man aufsteht. Also raus aus dem Bett!« Sie drückte ihm einen Kuss auf die Stirn. »Du gehst den Traum wegduschen und ich mache uns einen Tee.« Sie krabbelte über die Bettkante und suchte nach ihren Hausschuhen, die sich selten in unmittelbarer Nähe zueinander befanden.
Während Andreas stöhnend seine Beine über den Rand des Bettes schwang, sah er ihren nach oben gestreckten, von einem knappen Höschen verdeckten Hintern, der sich während ihrer Suche nach den Schuhen hinter der Bettkante hin und her bewegte.
»Wie spät ist es?«, grunzte er matt.
Der Hintern verschwand. Stattdessen tauchte ein Schwall wilder, roter Locken auf.
»Gleich halb sechs.«
Sie hatte einen plüschigen grünen Schlappen in der Hand, dem ein Frosch aus der Spitze wuchs, und sah sich unwillig um. Dann klarte sich ihre Miene auf, offenbar hatte sie den zweiten Frosch entdeckt. Tatsächlich zerrte sie etwas Plüschgrünes aus dem Bein ihrer verknüllten Jeans, stülpte es sich über den Fuß und schnellte hoch. Während sie zu summen anfing, fischte sie die Bluse vom Vortag von einem überfüllten Stuhl, zog sie über und verließ leichtfüßig das Schlafzimmer. Die offene Bluse bauschte sich und erinnerte an eine davonfliegende Fee. Andreas rieb sich durch das Gesicht, als habe ihn allein das Betrachten von Tillas Aktivitäten erschöpft.
Tilla hantierte bereits in der Küche, als Andreas sich endlich überwand, das Bett zu verlassen. Er kam sich vor, als hätte er einen Stunden währenden Boxkampf hinter sich. Tilla hatte recht, sobald sein Blick ins Leere abglitt, drängte sich Gregors Gesicht und der auf ihn gerichtete Mündungslauf in sein Bewusstsein. Als Altgläubige maß Tilla Träumen eine hohe Bedeutung bei. Er hörte sich normalerweise gern an, was Tilla alles über Traumsymbole und ihre Interpretation zu berichten wusste. Nicht selten erstaunte es ihn, wie gut all das passte. Doch jetzt war er hin und hergerissen zwischen dem Bedürfnis, den verstörenden Traum loszuwerden und ihn zu verstehen. Dass er von Gregor träumte, den seine Ermittlungen zur Flucht getrieben hatten, war nachvollziehbar. Aber dass sein Bruder auf ihn schoss …
Immerhin merkte er, dass sein Versuch, die surrealen Bilder zu interpretieren, gut tat. Tilla schaffte es doch immer wieder, Ordnung in seinen Kopf zu bringen. Während er sich frische Sachen aus dem Schrank nahm, sah er sich im Schlafzimmer um. Der Wäschekorb quoll über und auf dem Sessel daneben türmten sich Kleidungsstücke. Auf Tillas Bettseite brach der Nachttisch vor Büchern und Illustrierten fast zusammen. Wasserflaschen und weitere Buchtürme befanden sich neben dem Nachtschrank. In der Ecke hinter dem Sessel stapelten sich Kunststoffbehälter, in denen Tilla Schuhe aufbewahrte, die nicht mehr in den Schrank passten. Weitere Plastikboxen türmten sich neben ihrer Schrankseite, die Wintergarderobe enthielten. Da in der letzten Saison weitere Pullover der neusten Mode hinzugekommen waren, gingen die Behälter nicht mehr zu. Auf dem schiefen Deckel einer der Kisten thronte ein Korb, aus dem ein Berg bunter Schals lugte. Wie konnte jemand, der anderer Leute Kopf aufräumte, derart chaotisch sein? Mit bleischweren Beinen machte er sich auf den Weg ins Bad.
Das Chaos ist der Anfang,
ein sich öffnender Abgrund, ein leerer Raum.
- Aristoteles -
Mit kundigem Blick kontrollierte Azra Yilmaz das Krankenblatt der betagten Patientin, aus deren eingefallenem Mund ein röchelndes Schnarchen kam. Sie verglich die Angaben mit denen der diversen Monitoranzeigen neben dem Bett und trug die aktuellen Daten ein. Dann wandte sie sich dem Metallständer neben dem Bett zu, nahm den Plastikbeutel ab und ersetzte ihn durch einen neuen. Nachdem sie sich vergewissert hatte, dass alles richtig angeschlossen war, sah sie auf ihre Uhr. Sie musste sich beeilen, denn sie hatte eine ganze Reihe von Patienten zu betreuen. Zu viele. Sie strich der alten Frau noch einmal zart über die Wange und murmelte ihr auf Türkisch etwas zu, bevor sie sich auf den Weg zu dem Mann machte, der angeschossen worden war.
Leise wie ein Geist huschte Spiros 55639 an dem Anmeldebereich der Station vorbei. Dahinter lag der Aufenthaltsraum für das Personal. Die Gestalt, die sich hier einen Arztkittel aus der Wäschetonne nahm, war so wenig ein Arzt, wie der Besucher vor ihm. Doch von dem Anderen wusste Spiros nichts. Er rupfte ein paar Latexhandschuhe aus der Wandbox, zwängte seine Hände hinein und machte sich auf, seinen Ordensbruder umzubringen. Auf dem Weg zu dessen Zimmer träumte Spiros bereits von dem Ring. Er würde das goldene Kleinod früher erhalten als jeder andere. Das Schicksal meinte es gut mit ihm, weil er zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Für einen Moment verärgerte ihn der Gedanke daran, dass er ohne seinen Bruder gar nicht wüsste, wo sich der einstige Liquidator befand, doch das schob er schnell beiseite. Sich in einen Krankenhauscomputer hacken konnten viele, aber nur wenige waren in der Lage zu töten. Er schon.
Seine Schuhe quietschten unangenehm auf dem Kunststoffboden. Er wusste, Johannes war verletzt und vermutlich sediert. Eine Herausforderung war sein Vorhaben nicht. Seine Hand streifte das Messer, das in einer Lederscheide hinten am Gürtel steckte. Er hatte es nur mitgenommen, falls sich Johannes doch zu sehr wehrte. Ein Kissen auf seinem Gesicht sollte reichen. Der Orden hatte befohlen, nicht mehr als notwendig aufzufallen. Leise öffnete Spiros die Tür. Zwar brannte nur eine Notleuchte in dem Krankenzimmer, dennoch konnte er genug sehen, um zu erstarren. Konsterniert blickte er auf das Chaos. Nur langsam kehrte seine Denkfähigkeit zurück, was dazu führte, dass er die Tür hektisch hinter sich schloss. Die Hochstimmung, die ihn noch wenige Augenblicke zuvor so beflügelt hatte, war verflogen. Er verstand nicht. Er war es doch, der vom Orden den Auftrag erhalten hatte, Johannes zu töten. Er konnte sich doch nicht verhört haben. Hatten sie doch jemand anderes geschickt?
Seine Verwirrung niederkämpfend sah er sich um. Johannes war nicht gerade unauffällig verstorben. Das Bett war an mehreren Stellen mit Blut besudelt, vor allem das Kopfkissen. Irgendein Buch bedeckte das Gesicht. Angewidert hob Spiros die Bettdecke an und registrierte mehrere Einschüsse. Die Patronenhülsen waren gegen die Bettdecke geprallt und lagen neben dem zerschossenen Bein. Auswurf oben, eine Beretta, ging es ihm durch den Kopf. Zu theatralisch für den Orden. Die Weisung, unauffällig zu agieren, war unmissverständlich gewesen. Was jetzt? Einfach verschwinden und behaupten, er habe den Job erledigt? Den Orden belügen? Das könnte einen weiteren Liquidator auf den Plan rufen, der dann ihn umbrachte. Spiros klaubte die Geschosshülsen auf und betrachtete sie prüfend. 9 mm Subsonic-Munition. Kein Wunder, dass man nichts gehört hatte. Zwei weitere Hülsen entdeckte er auf dem Boden. Er sammelte auch diese auf.
Als er sich wieder aufrichtete, blieb sein Blick an dem Buch hängen. Eine Bibel? Er hob es an. Mit leisem Ratschen riss die blutgetränkte Seite ab. Gerade wollte er nach dem Blatt greifen, als ihn das Geräusch einer zufallenden Tür zusammenfahren ließ. Irgendwas klapperte draußen auf dem Flur. Schnell ließ er Bibel und Geschosshülsen in die Taschen des Arztkittels gleiten und sah sich nach einem Versteck um. In diesem Krankenzimmer gab es keine Toilette, in der er sich hätte verbergen können, also hastete er zur Tür, doch bevor er die Klinke zu fassen bekam, senkte sich diese. An die Wand hinter der Tür gedrückt, zog er das Messer. Azra Yilmaz hatte keine Chance. Der Stahl fuhr ihr so schnell durch die Kehle, dass sie nicht einmal schreien konnte.
Zwei Wochen zuvor
Die Frau ist eine Lockspeise des Satans.
- Petrus Damiani, Kardinalbischof von Ostia, 11. Jahrhundert -
Wie ein weggeworfener Putzlumpen lag sie auf den groben Holzdielen. Die Augen hielt sie krampfhaft geschlossen und versuchte die Männer auszublenden, die einen Kreis um sie bildeten. Auch wenn sie nichts sah, so wusste sie doch, einige der Gesichter zeigten religiöse Verzückung, andere blickten mit unverhohlener Gier auf ihren nackten Körper. So war es jedes Mal.
Der Schmerz pulsierte. Sie spürte, wie sie sich Stück für Stück von ihrem geschundenen Körper löste. Ihr körperloses Ich war so leicht, dass sie meinte, es könne zum Fenster hinaus schweben, durch die Dämmerung bis hinauf auf die Tannenspitzen und von dort bis zum Brocken. So wie die Hexen …
Als habe er ihre gottlosen Gedanken gelesen, erklang nun seine Stimme. Perfekt traf er jeden Ton des Chorgebetes. Heute wusste sie, wie kalt Perfektion war, wie kalt er war. Dabei hatte es mal eine Zeit gegeben, da war diese Stimme die schönste der Welt gewesen. Alsbald fielen die anderen Männer in die mittelalterliche Hymnologie ein. Ihr Ich floss zurück in den Körper. Sie öffnete die Augen und sah sehnend durch das Fenster zu den Tannen. Plötzlich wurde ihr Kopf an den Haaren hochgerissen. Unkoordiniert ruderten ihre Hände herum. Man griff nach ihr. Irgendjemand hielt ihre Arme fest. Ihr Kinn wurde angehoben. Ein Plastikrohr bohrte sich in ihren Mund. Sie biss die Zähne zusammen, wohl wissend, dass sie das Unabänderliche damit nur aufschob. Wimmernd schüttelte sie den Kopf, obwohl ihre Kopfhaut dadurch noch mehr schmerzte. Sie fühlte sich wie in einer Schraubzwinge, als ihr Kopf, zwischen Handflächen gepresst, zur Bewegungslosigkeit gezwungen wurde. Das Plastikrohr schabte schmerzhaft über ihr Zahnfleisch, weil es an den Vorderzähnen abrutschte. Sie schrie auf, schmeckte ihr Blut, schmeckte Salz. Das Rohr zwängte sich in ihren Mund, schabte über Zunge und Hals. Sie wehrte sich mit aller Kraft. Der Singsang wurde lauter, drängender.
Sie schütteten das Salzwasser in den Trichter. Sie fühlte, wie es ihren Schlund hinunter lief und krümmte sich, als ließe es sich dadurch aufhalten. Schließlich lief der Trichter über und ein Schwall ergoss sich über ihr Gesicht und in die Nase. Sie atmete es ein. Gurgelnd und spuckend rang sie nach Luft. Noch einmal zwang man sie in eine aufrechte Haltung und füllte den Trichter erneut. Alles in ihr schien sich mit Wasser zu füllen. Ihr Schlund, ihr Magen, ihr Mund und ihre Lungen. Sie erbrach sich. Endlich verlor sie das Bewusstsein.
Als sie langsam dämmernd erwachte, war der Schmerz in ihrem Mund und im Hals das erste, was sie wahrnahm. Dieses Mal hatte man sie mehr verletzt als sonst. Ihre Wange lag in etwas Klebrigem, vermutlich Blut. Unaufhörlich füllte sich ihr Mund damit und rann durch einen Mundwinkel heraus. Ihre zitternden Hände wanderten zaghaft zu ihrer nackten Brust, tasteten an ihrem Körper herunter, von dem er stets sagte, er sei zu schön, um gottgefällig zu sein. Der Schmerz durchfuhr sie wie ein Stromstoß, als ihre tastende Hand die Brandwunde an ihrem Gesäß erreichte, die Stelle des Teufelskusses.
Sie war wund zwischen den Beinen. Schamgebeutelt presste sie ihre Hände gegen ihren Schoß. Die Dunkelheit und das Alleinsein waren tröstlich. Obwohl der Boden eiskalt war, rührte sie sich nicht. Schließlich dämmerte sie erneut weg.
Irgendwann drangen Stimmen in ihr Bewusstsein. Jemand redete aufgebracht, hysterisch geradezu. Ihr Name fiel. Sie rührte sich noch immer nicht, aber sie versuchte zu verstehen. Das Wort unmenschlich fiel. Eine zweite, ebenso aufgeregte Stimme mischte sich ein. Nun hörte sie ihn. Er warf den beiden vor, sich angesteckt zu haben, bei ihr, dem Bösen. Etwas rumpelte. Ein umstürzender Stuhl? Ein Körper, der auf die Dielen schlug?
Eine flüsternde Stimme begann in ihr nachzuhallen. Drängend. Es geht los … geht los … geht los … mach dich bereit … bereit … bereit …
Stöhnend stemmte sie sich hoch. Hinter der Tür schrie jetzt alles durcheinander. Ihre Mutter hatte recht, das Chaos da draußen war ihre Chance. Ihr Körper schien wie aus Gummi, als sie sich mühsam auf die Beine kämpfte. Die Hände tastend nach vorne gestreckt, taumelte sie zum Fenster, das man mit Brettern vernagelt hatte. Selbst die Ritzen waren dunkel, also war es Nacht. Sie befand sich in einem Durchgangszimmer hinter dem Altarraum. Im Dunklen tastete sie sich zur Tür, die zur Waschküche führte. Sie fühlte sich so unsagbar schwach und müde, der Boden zog geradezu an ihr.
Das Gesicht ihrer Mutter erschien vor ihrem inneren Auge. Weiter … weiter … weiter …, schallte es in ihrem Kopf.
Einen Moment lang war es wie früher, wenn sie mit ihrer Mutter zu dieser Frau nach Bad Harzburg gefahren war. Intensiv beschwor sie das Bild von Hedera Leinwig herauf, ihre ruhige Freundlichkeit, ihre Unerschütterlichkeit, ihr Wissen, was zu tun war. Fast war es, als erhasche sie einen flüchtigen Dufthauch von Maiglöckchen, der sie stets umgab. Vielleicht halfen ihr ja Hederas Götter. Wenn sie überleben wollte, musste sie hier weg, also kämpfte sie sich hoch.
Sie konnte sich kaum entsinnen, wann sie zuletzt etwas gegessen hatte. Aß sie nichts, war ihr Kopf klarer, aber ihr Körper wurde schwächer. Immer schon hatte sie das Gefühl gehabt, dass ihr Selbst nicht richtig in sie hineinpasste. Was ihr Körper brauchte, war für ihre Seele schlecht und umgekehrt. Lebte wirklich ein Dämon in ihr? Ihr Großvater jedenfalls, war davon überzeugt.
Dumpf hörte sie weitere Möbelstücke umfallen. Ein Schrei, dann Keuchen, wieder rumpelte es. Sie hatte schon länger gespürt, wie der Einfluss ihres Großvaters auf die Anderen schwand. Er konnte seine Jünger nur unter Kontrolle behalten, wenn er ihnen zeigte, wie er Dämonen zu bändigen wusste, ihre Dämonen. Er musste ihnen immer etwas mehr bieten als bisher. Die Angst vor dem, was ihr bevorstand, schnürte ihr die Kehle zu. Obwohl ihr Leben so schäbig war, wollte sie es behalten. Ihr Großvater kannte kein Mitleid und fühlte nichts für sie. Sie war nicht mehr als ein Möbelstück für ihn. Ein kaputtes, unbrauchbar gewordenes Möbelstück.
Entschlossen zog sie sich an der alten Tür hoch. Ihre Hände glitten daran entlang, bis sie die schweren schmiedeeisernen Scharniere fühlte. Seit Monaten hatte sie mit dem Stiel eines Löffels in dem alten Holz des Türrahmens herumgestochert und die Aufhängungen der Tür gelockert. Hoffentlich reichte es. Ihre Finger schoben sich hinter die Riegel. Möglichst leise fing sie an, den Spieß aus dem Türrahmen zu ruckeln. Oben ein Stück, dann unten einen Zentimeter, wieder oben und wieder unten. Endlich fühlte sie, wie ihr die Tür entgegen kippte. Schnell zwängte sie sich durch die Öffnung. Als sie hindurch war, fummelte sie die Scharnierspieße wieder zurück in die Löcher im Türrahmen. So ruckelte sie so lange herum, bis ihre Finger nicht mehr durch den Spalt passten. Die Tür hielt. Auf den ersten Blick würde er nicht bemerken, dass diese Tür ihr Fluchtweg gewesen war. Was, so fragte sie sich, erzählte er dann wohl den Anderen? Dass sie sich endgültig in eine Windsbraut verwandelt habe und davongeflogen sei? Das stille Lachen in ihrem Inneren gab ihr die Kraft, den Raum zu durchqueren. Sie steuerte die Tür an, die in den Garten, in die Freiheit führte. Sie senkte die Hand auf die Klinke und erstarrte. Die Tür war abgesperrt. Hektisch befingerte sie das Schlüsselloch. Der Schlüssel war nicht dort. Mit einem verhaltenen Laut drückte sie die Klinke mehrfach nieder, aber ihr Fluchtweg blieb verschlossen. Verzweifelt sank sie zu Boden.
Im vorderen Teil des Hauses gab es Geschrei. Türen knallten. Sie hörte die Haustür. Dann ein Tumult. Rannten sie hinaus? Erneut rappelte sie sich hoch und näherte sich der Tür zum Flur, öffnete sie und spähte durch den Spalt. Ein eisiger Luftzug kam ihr entgegen. Die Haustür stand offen. Draußen war ein heftiger Disput zu hören.
Lauf! Kind, lauf! Jetzt … jetzt … jetzt, dröhnte es in ihrem Kopf, doch die Angst lähmte sie. Sollte sie das wirklich wagen? Sie waren alle da draußen, auch ihr Großvater. Was, wenn sie sie sahen? Andererseits … wenn sie blieb, würden sie dort weitermachten, wo sie aufgehört hatten. Das Ergebnis war wohl das Gleiche.
He … de … ra … sie wird helfen … lauf … lauf … lauf … Die Stimme ihrer Mutter pulste mit drängender Intensität durch ihr Hirn. Schließlich huschte sie durch den Flur bis zur Haustür. Dort verharrend sah sie ein Handgemenge links von ihr auf der Straße. Offenbar versuchten diejenigen, die sich ihrem Großvater widersetzt hatten, ihre Wagen zu erreichen. Der Rest der Gruppe hielt sie auf. Ihr Großvater stand mit dem Rücken zu ihr und beobachtete das Ganze. Im Dämmer einer entfernt stehenden Straßenlaterne wirkte seine Silhouette irgendwie verzerrt. Was hatte er da am Kopf? Hörner? Sie kniff die Augen zusammen, öffnete sie wieder. Die Teufelshörner waren verschwunden. Mit klopfendem Herzen schlüpfte sie durch die Haustür und huschte sofort nach rechts um die Ecke des dunklen, holzverkleideten Hauses. Sie rannte über die krautige Fläche des Gartens, den ihre Mutter einst so hingebungsvoll gepflegt hatte. Geduckt schlich sie an den Forsythien entlang, die unter der Last wilder Brombeerranken zu ersticken drohten. Kurz vor dem Zaun bohrten sich Steine und Tannenzapfen in ihre bloßen Fußsohlen, doch sie fühlte es kaum. Adrenalin flutete ihren Körper und blendete alles aus, was sie an ihrer Flucht hinderte. Auch die Äste, die über ihre Haut schrammten, spürte sie nur als Hauch. Unbeholfen kletterte sie über die maroden Staketen und setzte ihre Flucht durch den nächtlichen Tannenwald fort. Die Hände nach vorn gestreckt, bewegte sie sich vorsichtig, aber stetig vorwärts, während sie sich zu orientieren versuchte. Ein lautes Stimmengewirr im Haus sagte ihr, dass man ihre Flucht entdeckt hatte. Sicher schwärmten sie gleich zur Straße aus, da sie annehmen mussten, dass sie dort Hilfe suchen würde. Sie wählte den Waldweg.
Ihr Plan schien aufzugehen. Sie erreichte die kleine Brücke, unter der sie viele Wochen zuvor Kleidung deponiert hatte. Hoffentlich war sie noch dort. Neben der Brücke rutschte sie auf dem ersten frühen Bewuchs des Frühlings hinab und tastete nach der Plastiktüte. Sie war noch da. Ihr Herz machte einen Sprung. Nach einem Augenblick des Durchatmens hielt sie ihre zerschundenen Füße in das eiskalte Wasser des Bachs. Sie wusch sich das Blut von Gesicht und Körper und benetzte auch die Brandwunde an ihrem Gesäß mit dem wohltuend kalten Nass, bevor sie trank. Dann endlich griff sie nach der Tüte und holte ihre Kleidungsstücke heraus. Zum ersten Mal seit Monaten würde sie wieder Kleidung tragen. Fix streifte sie Slip und Jeans über, zog sich das T-Shirt und den Pullover an. Dann ließ sie sich auf einem Stein nieder und schlüpfte in die Strümpfe, bevor sie die Schuhe in die Hand nahm. Sie hob die Sohle eines Schuhs an und zog eine Kette darunter hervor. Es war ein kleiner silberner fünfzackiger Stern in einem Kreis. Sie erinnerte sich, wie Hedera ihr das Pentagramm gab und ihr erklärte, dass dies ein Drudenfuß sei, der sie beschützen würde. Druiden sollten dieses Symbol als Zeichen ihrer Weisheit in die Sohle ihrer Schuhe geritzt und so in den Boden gestempelt haben.
Sie band sich den Anhänger, durch den sie einen Schnürsenkel gezogen hatte, um den Hals. Zuletzt griff sie nach einer alten Steppjacke, die ihre Mutter immer bei der Gartenarbeit getragen hatte. Die Sachen waren ihr zu weit geworden, dennoch war es ein wundervolles Gefühl, bekleidet zu sein. Es gab ihr Kraft.
Du hast es geschafft … geschafft … geschafft, wisperte es in ihrem Kopf wie von hundert Flüsterern. Ein Ruf ließ sie herumfahren. Sie hörte ihren Namen. Sofort sprang sie auf und rannte los. Ihre Augen hatten sich mittlerweile an die Dunkelheit angepasst, dennoch übersah sie eine Wurzel und wäre fast gefallen. Unbeholfen hastete sie weiter. Plötzlich gab der Wald sie frei und das Torfmoor lag, in milchiges Mondlicht getaucht, vor ihr. Sie konnte die Holzstege erkennen, die sich darüber zogen. Obwohl ihre Lungen wie Feuer brannten, rannte sie weiter. Noch etwa fünfzig Meter, dann würde sie die Moorebene hinter sich gebracht haben. Sie konnte bereits die ersten Krüppelbäume sehen, die sich wie tanzende Gestalten ausnahmen. Wieder hörte sie ihn rufen. Es drängte sie, sich im Gestrüpp zu verstecken, doch noch durfte sie die Holzstege nicht verlassen. Ging sie ins Moor, lief sie Gefahr, irgendwo in den trügerischen Morast zu geraten. So schnell es ihre Kraft zuließ, folgte sie dem hölzernen Weg. Die sie umgebenden Bäume wurden höher. Der Wald. Endlich.
Sie wusste, wenn sie nach Bad Harzburg wollte, musste sie sich links halten. Aber wo war der Weg ins Tal? Nach ihrem Gefühl lief sie noch immer in Richtung Brocken. Hätte der Abzweig nicht längst kommen müssen? Als sie endlich eine Wegekreuzung erreichte, schrieb sie es ihrer Erschöpfung zu, dass ihr diese zu weit erschien. Sie bog links ab. Immerhin hörte sie keine Rufe mehr, nur die spärlichen Geräusche des ruhenden Waldes. Die lange Fastenzeit machte sich bemerkbar, doch noch glich das Adrenalin ihre Schwäche aus. Doch sie wusste, später würde sie dafür bezahlen müssen, was sie ihrem Körper antat.
»… Im Harce weithin ist bekannt, ein Berg, der Brockelberg genannt …« Sie passte ihren Schritt dem Wortrhythmus des alten Gedichtes von Johannes Praetorius an. »… Über das ist er beschreit, dieweil des Nachts zu Walpurgis Zeit, in großer Zahl, wie ich bericht, die Zauberinn’ mit ihr’m Gezücht, insgeheim den Sabbat halten …« Unwohl sah sie sich um. Eigentlich dachte sie, die Gegend gut zu kennen. Doch nachts narrten einen die Augen. »… Über hohe Berg und tiefe Tal, bis dass sie kommen allzumal, eine jede Hex an ihren Ort, wie man solches wohl hat gehört …« Immer wieder hatte er ihr aus Preatorius’ Lehrwerk des Bösen vorgelesen. Vor ihrem inneren Auge waren die schrecklichsten Dämonen erschienen. Die Gefahr, von ihnen besetzt zu werden, so mahnte er stets, war allgegenwärtig. Trotzig fuhr sie fort: »…Treibens ohne alle Scheu, ihr Hexenwerk und Zauberei, wider Gott und Sein Heil’ges Wort … auch anstiften sie zum Mord …«
Obwohl ihr die Worte, die sie endlos wiederholte, die Kraft zum Weitergehen gaben, wurden ihre Schritte so schwer wie in ihren Träumen. Das fahle Licht kündigte das Ende der Nacht an. Sie wusste nicht einmal annähernd, wo sie war. Den Weg, der unterhalb des Torfhaus vorbei ins Tal nach Bad Harzburg führte, hatte sie auf jeden Fall verpasst. Am Morgenlicht merkte sie, dass sie sich in östlicher Richtung über eine Hochebene bewegte. Der Brocken lag hinter ihr und überall um sie herum quoll Wasser aus dem Boden, das sich zu einem Flüsschen verband. Wo war sie? Fahrig wischte sie sich durchs Gesicht und rieb sich das Genick. Der Knoten des Schnürsenkels öffnete sich und der silberne Drudenfuß fiel unbemerkt ins Gras.
Eine Weile kreuzte der schmale Pfad mehrfach den in wilden Strudeln zu Tal strebenden Bach und begleitete ihn mal auf der einen, mal auf der anderen Seite. Wie in Trance tappte sie durch den Hochwald. Es fing an zu nieseln. Eigentlich hätte sie frieren müssen, doch sie fühlte nichts. Schon lange nicht mehr. Auch ihr Magen, der so lanhaltend geschmerzt hatte, war nicht mehr zu spüren. Es war, als habe sich die wenige Energie ihres Ichs zu einer Art Notversorgung zurückgezogen. Sie wusste, mit dem Schwinden ihrer eigenen Kräfte, schwand auch die Kraft der Anderen in ihr. Das war gut. Denn wenn die Anderen in ihr schwach waren, drohte ihr weniger Gefahr von ihrem Großvater, der Dämonen und ihre Wirte aufspüren konnte. Überdies vermochte sie freier zu denken, wenn die Dämonen schliefen.
Als ein Gebäude in ihrem Blickfeld auftauchte, blieb sie abrupt stehen. Verunsichert sah sie sich um. Das war eindeutig nicht die Radau und nicht Bad Harzburg. Sie ging ein Stück zurück, nahm den Hang in Angriff und kletterte aus dem Flusstal heraus. Oben angekommen gönnte sie sich eine Verschnaufpause. Durch die Bäume schimmerte ein Heer von Dächern. Welcher Ort war das? Vor ihr erhoben sich so altertümliche, trutzige Mauern um einen Innenhof herum, dass sie glaubte, in eine andere Zeit geraten zu sein, wären da nicht diese runden Kunststofftische mit Stühlen davor gewesen. Rechts von ihr erhob sich ein sehr alt wirkender, vermooster Steinbrunnen mit einem romanischen Bogenaufsatz. Ein Löwenkopf diente als Wasserspeier. Ein springender Hirsch zierte den Bogen. Der Hirsch war das Tier des Gehörnten, hörte sie die Stimme ihres Großvaters in ihrem Kopf dröhnen. Sie schloss die Augen und öffnete sie wieder. Ein Brummen kündigte einen Wagen an. Schnell verbarg sie sich hinter dem Brunnen. Ein Lieferwagen hielt auf dem Hof. Ein Mann trat aus einer Tür. Zusammen mit dem Fahrer trugen sie große Tabletts ins Haus. Ein köstlicher Geruch nach frischem Gebäck stieg ihr in die Nase, der sie daran erinnerte, wie hungrig sie war. Plötzlich konnte sie an nichts anderes mehr denken. Sie ließ alle Vorsicht fahren und huschte über den Platz zu dem Wagen, in dem sich weitere Tabletts mit köstlich duftendem Backwerk befanden. Hektisch grabschte sie nach zwei Hefeteilchen, warf sich herum und rannte so schnell sie konnte zurück in den Wald.
Sie lief noch, als hohe Buchen sie längst beschatteten. Die zuckrigen Teilchen hielt sie wie einen Schatz in der Hand. An einem Bachlauf hockte sie sich nieder und stopfte sich gierig eines der beiden Gebäckstücke in den Mund. Dann trank sie aus dem Bach. Das Wasser schmeckte herrlich frisch und sauber, mit einer leicht metallischen Note. Trotz der Mahlzeit fühlte sie, dass sie am Ende ihrer Kraft war. Sie musste einen Platz zum Ausruhen finden. Mit schweren Beinen setzte sie ihren Marsch fort. Endlich zweigte ein schmaler Pfad von dem breiten Schotterweg ab, der nicht aussah, als würde er oft genutzt. Sie folgte ihm vorbei an einem modrigen Tümpel, dessen Schwärze sie an ein Höllentor denken ließ. Wenn doch nur dieser Nieselregen nicht wäre. Schützend hielt sie eine Hand über ihren verbliebenen zuckrigen Schatz. Kraftlos tappte sie über eine Kuppe, um sodann auf ein Gebilde zu starren, dass ihr nur die alten Waldgötter geschickt haben konnten. Silbrige dünne, im Kreis stehende Stämme verjüngten sich oben zu einer Spitze, die etwa drei Meter über dem Boden lag. Ein klappriger Vorbau umrahmte eine Türöffnung. Ungläubig taumelte sie auf die Köhlerhütte zu, trat ein und ließ sich mit einem Seufzer auf dem trockenen Boden nieder. Mit geschlossenen Augen biss sie in das fluffige, mit dickem Zuckerguss überzogene Gebäckstück und war in diesem Moment überzeugt, im Himmel angekommen zu sein.
Ich sah die Erde an und siehe,
sie war ein תֹהוּ וָבֹהוּ - tohu wa bohu.
- Jeremia 4,23 Schöpfung -
Seit Stunden lag er bäuchlings mit ausgebreiteten Armen auf dem hölzernen Boden und betete. Die Kerzen neben dem mannshohen Kreuz waren fast vollständig heruntergebrannt. Hinter ihm füllten leere Stuhlreihen den kargen Gebetsraum. Einige der Stühle waren umgestürzt. Seit zwei Wochen lagen sie dort. Seine Getreuen fielen dem Bösen anheimgefallen und sind gegangen. Die Dämonen waren stark geworden.
Die Wände knarzten. Stürmische Böen fegten um das Holzhaus und drangen eisig durch die Ritzen, ließen die Kerzen flackern. Er wusste besser als jeder andere, wie sehr der Harz von dunklen Mächten durchsetzt war. Es war seine Aufgabe, sich ihnen zu stellen. Doch er spürte, etwas hatte sich verändert. Eine Macht braute sich zusammen. Etwas Böses, das nicht nur Rahel, sondern auch seine Gefolgschaft vergiftet hatte. Wie war es Rahel gelungen, einfach zu verschwinden? Wo war sie? Hatte sie Hilfe? Von wem? Sie kannte doch niemanden. In diesem Moment erkannte er seinen Denkfehler. Der Name der Hexe durchfuhr ihn wie ein Stromstoß. Er richtete sich auf.
»Hedera Leinwig …«, murmelte er hasserfüllt.
Schon einmal hatte sie ihre gierigen Finger nach seiner Familie ausgestreckt. Ihr hatte er zu verdanken, dass er Judith und Rebecca verlor. Und nun auch Rahel. Sein Blick wanderte zum Fenster, hinter dem es heute einfach nicht hell werden wollte. Schickte sie ihm diese Wetterverirrung, die direkt aus der Hölle zu kommen schien? Er murmelte ein kurzes Gebet des Dankes für diese Eingebung und machte sich auf den Weg.
Abkömmlinge des Chaos sind Gaia (Göttin der Erde),
Nyx (Göttin der Nacht), Erebos (Gott der Unterwelt),
Tartaros (Unterwelt, Ort und Person zugleich) und
Eros (Gott der Liebe). Ichohu.
- Hesediot, 700 v. Chr. -
Der April war in diesem Jahr besonders launisch. Der Sturm der letzten Nacht hatte dem Efeuhäuschen und auch dem angrenzenden Wald arg zugesetzt. Das Morgenlicht lieferte sich einen noch ungleichen Kampf mit den schweren Nebelschwaden, die sich beharrlich in den Senken zwischen den Harzbergen festhielten. In dem Häuschen am östlichen Rand von Bad Harzburg mit seinem immergrünen Bewuchs herrschte der frühen Stunde zum Trotz emsige Betriebsamkeit. Nicht nur seine Bewohner waren früher als sonst unterwegs, auch diverse Fremde beobachteten es. Doch was sich wie ein chaotischer Zufall ausnahm, hatte System.
Tilla stapfte vor sich hingrummelnd über das taunasse Gras, hob hier und da einige vom Sturm hingeworfene Äste auf und kämpfte abwechselnd mit Sorge und mit Zorn. Andreas hatte sich wie ein bockiges Kind aufgeführt. Ihren Protest hatte er ebenso ignoriert wie das unmissverständliche Verbot seines Chefs, Gerd Wegener. Am frühen Morgen war er ins Krankenhaus gefahren, um seinen Schwager Johannes zu verhören, der in dem Verdacht stand, mehrere Morde begangen zu haben. Unwillig kickte sie einen Tannenzapfen Richtung Grundstücksgrenze und warf die aufgelesenen Äste hinter dem Kompost in den Wald. Vor ihrem inneren Auge tauchte Andreas’ Gesicht auf, nachdem er den verstörenden Traum verlassen hatte. Sein Blick war regelrecht fiebrig gewesen. Natürlich konnte sie nachvollziehen, dass er von Johannes erfahren wollte, was mit seinen Bruder Gregor passiert war, nachdem die Machenschaften des Ordens aufgeflogen waren. Gregor war ein hochrangiges Mitglied des Venedigerordens und Andreas hatte ihn ans Messer geliefert. Gregor war seither gleichermaßen auf der Flucht vor der Polizei, als auch vor den Jägern des Ordens. Tilla wusste, Andreas machte sich deswegen Vorwürfe. Warum sah er bloß nicht ein, dass Gregor es nicht wert war? Dieses verbotene Verhör von Johannes konnte Andreas seinen Job kosten. Wenn Staatsanwalt Berking davon erfuhr, war er erledigt. Berking hasste Andreas. Als Tilla diesen Punkt erwähnte, hatte Andreas ihr wieder einmal vorgehalten, dass sie es war, die Schuld daran trug. Nach einem kernigen Wortwechsel war sie ins Bad geflohen und er weggefahren. Leider hatte Andreas recht. Nach ihrer kurzen Affäre mit Jan Berking im Vorjahr war es vermutlich Eifersucht, die den Staatsanwalt dazu trieb, jede Verfehlung von Andreas genüsslich auswalzen. Und der brachte sich nun erst recht in dessen Schusslinie.
»Bei der Weisheit des Gottes Lugh! Warum sind Männer nur so uneinsichtig?«, schimpfte Tilla vor sich hin. »Und das alles wegen Gregor, diesem verfluchten Teufel! Als würde Andreas ausgerechnet dem etwas schulden.«
Gregor hatte Andreas nicht nur zum Narren gehalten, er hatte höchstwahrscheinlich sogar etwas mit dem Anschlag auf Andreas zu tun, der ihn einige Wochen zuvor fast das Leben gekostet hatte. Aber davon wollte Andreas heute nichts mehr wissen. Es brach Tilla fast das Herz, wenn sie sah, wie er sich quälte, weil er nicht wusste, ob Gregor noch lebte oder nicht. Gregors Bild tauchte vor Tillas innerem Auge auf. Äußerlich ähnelten sie sich sehr, doch innerlich waren sie Welten voneinander entfernt. Gregor war durch und durch verschlagen.
Plötzlich hatte sie das Gefühl, beobachtet zu werden, und wandte sich abrupt um. Eine hagere Gestalt sah von der Straße aus zu ihr herüber, schritt dann auf den Wald zu und verschwand zwischen den Bäumen. Seit das Hotel unten an der Hauptstraße geschlossen worden war, sah man hier kaum noch Spaziergänger. Tilla fuhr damit fort, ihren Garten aufzuräumen. Das hieß, ihn auch von den Spuren des Polizeieinsatzes zu befreien, bei dem man Johannes festgenommen hatte. Da Tilla ihm eine Kugel durch den Fuß geschossen hatte, war die Festnahme nur als verbaler Akt auf dem Weg ins Krankenhaus erfolgt.
Missmutig betrachtete Tilla ihren fast zerstörten jungen Rasen. Auf der Suche nach innerer Ruhe beschirmte Tilla mit der Hand ihre Augen und suchte vergeblich nach dem ersten flaumigen Grün des Frühlings. Obwohl Ostarûn, also die Tag-und-Nacht-Gleiche des Frühjahres schon Wochen her war, zierte sich der Frühling. Es wagten sich lediglich Birken und Kastanien vorsichtig aus den Knospen. Seufzend öffnete Tilla die Tür zum Schuppen, um ihren Spaten zu holen. Da sie beim letzten Mal zu faul gewesen war, das Gerät ordentlich aufzuhängen, war er gegen das grobe Regal gekippt und hatte sich prompt in einem Wust von Bändern verheddert, mit denen Tilla gar zu üppig wachsende Stauden zusammenband. Auf der Suche nach ihrem Gartenmesser griff ihre tastende Hand überraschend ins Leere. Verdutzt stellte sie sich auf die Zehenspitzen und lugte in den Regalboden. Außer Staub befand sich dort nur Leere. Also begann Tilla, alle Pechzauber dieser Welt hinwegschimpfend, die Bänder mit den Händen zu entwirren. Es dauerte eine Weile, bis sie mit dem befreiten Spaten in der Hand über den Rasen stapfte, wobei ihre Gummistiefel bei jedem Schritt ein hohles Geräusch von sich gaben. Abermals glaubte sie eine Bewegung auf dem Weg zu sehen, dieses Mal auf der anderen Seite des Hauses. Sie schaute genauer hin, konnte aber niemanden entdecken.
Der Festnahme von Johannes war die unvermeidliche Tatortsicherung gefolgt, bei der gefühlte Hundertschaften von Polizisten durch ihren Garten getrampelt waren. Wenigstens hatte der Sturm die hässlichen Plastikbänder der Polizei von den Befestigungen gerupft und unauffindbar verschleppt. Das schwarze Pulver zum Sichtbarmachen von Fingerabdrücken an ihrer Terrassentür und der Hauswand hatte der boshafte Harzwind leider hängen lassen. Aber Luftgeister waren ja eh für ihre Launenhaftigkeit bekannt. Den schwarzen Pulverschlieren würde sie später mit Seifenlauge zu Leibe rücken müssen. Nun sah sie grimmig in das Erdloch unterhalb ihrer Terrasse. Vormals spross hier hübscher junger Rasen. Seufzend rammte Tilla den Spaten in einen Haufen lockeren Erdreichs. Um den Hergang des Kampfes zu dokumentieren, hatte die Spurensicherung die Patrone ausgegraben, die Johannes‘ Fuß durchlöchert hatte und dafür einen völlig überdimensionierten Krater geschaffen. Grummelnd fing Tilla an, die Erde zurück in das Loch zu schaufeln. Nach einigen Minuten trat sie die Erde fest und beschloss gerade, sich eine Handvoll Grassamen zu holen, als sie jemanden hinter sich säuerlich ihren Namen rufen hörte. Sie fuhr herum und sah geradewegs in die verkniffenen Mienen ihrer Nachbarn Gerred Assmut und Claudia Hohenstein.
Marduk, der Herr, besiegte den Chaosdrachen Tiamat
und erschuf die Welt. Er zerriss den Drachen und machte
aus den Teilen des Körpers Himmel und Erde.
- Babylonische Sage -
Es ging es ihr immer schlechter. Ergriff das Böse endgültig Besitz von ihr? Behielt ihr Großvater recht? War sie besessen? Sie konnte kaum noch einen klaren Gedanken fassen. Ihr Körper funktionierte wie per Autopilot gesteuert. Ihr Geist entfernte sich von der Wirklichkeit, wurde ständig in eine wattige Anderswelt gesogen. Sie hoffte auf die Macht der anderen Götter, den alten Göttern, denn ihr Gott hatte sie aufgegeben. Es gab nur eine, die ihr den Weg zu den alten Göttern weisen konnte, Hedera Leinwig.
Sie hatte einen langen Marsch hinter sich. Völlig entkräftet ließ sie sich am Stamm einer Buche auf den Waldboden niedersinken, den Blick voller Hoffnung auf das efeuumrankte Häuschen gerichtet. Es sah aus wie früher. Aber Hederas Garten war anders, lichter. Plötzlich öffnete sich die Tür. Jemand kam heraus. Ihr Herz stolperte vor Aufregung. Mühsam richtete sie sich auf. Das rote Haar wippte bei jedem Schritt. Ob es noch immer nach Maiglöckchen duftete? Ihr wurde schwarz vor Augen. Eisern hielt sie sich an dem Stamm fest. Hinter dem Hexenhaus stand ein Mann, gaffend. Rahel kniff die Augen zusammen. War da ein schwarzer Rüssel, wo sein Gesicht hätte sein sollen?
»Dämonen … überall Dämonen …« Wimmernd kniff sie die Augen zusammen. Als sie sie wieder öffnete, war der Mann mit dem Rüssel verschwunden. Das Haar der Hexe glühte geradezu. Das Kupferrot hatte sich in ein Rot verwandelt, wie es der Himmel zuweilen am Morgen zeigte. Zeit ihres Lebens hatte man sie vor Geschöpfen wie dieser Frau gewarnt. Er hatte sie gewarnt. Hexen konnten ihre Gestalt nach Belieben wandeln, hieß es. Sie hatten ein besonderes Verhältnis zur Natur, sie beherrschten die Elemente. Gerade war die Frühlingssonne durch die Wolken gebrochen. Vielleicht lag es an der Sonne, dass ihr Haar nicht die richtige Farbe hatte. Die Frau ging durch den Garten. Obwohl sie in einer wenig kleidsamen, weiten Latzhose steckte, hatten ihre Bewegungen etwas Anmutiges. Die Frau war jung, zu jung. War sie es überhaupt?
Rahel trat aus dem Wald heraus und stieß gegen einen Stuhl. Schwankend hielt sie inne. Da war ein Tisch. Etwas lag darauf. Sie kannte das Messer. Schlanke Hände schoben sich in ihre Erinnerung. Hände die mit flinken Bewegungen duftende Kräuter zerkleinerten. Liebevoll strich sie über den Griff, der mit dem Namen Hedera verziert war.
»Hexen beherrschen Raum und Zeit … Raum und Zeit … Raum und Zeit …«, murmelte sie gebetsartig. Doch ihr innerer Aufruhr wollte sich nicht legen. War es ihr Gott, der sich zurückmeldete und sie warnte? Nein, der hatte sie schon vor langer Zeit verlassen. Es waren die Anderen in ihr, sie hatten Angst vor der Hexe und ihrer Kraft. Ja, so musste es sein. So wie sich ihre Lebensenergie zurückzog und auf das Notwendigste beschränkte, so eingeschränkt war auch ihre Sicht. Sie wusste, das Auge war trügerisch. Es sah nicht alles, was da war. Und es sah Dinge, die nicht da waren.
Sie versuchte nach Kräften, die Dämonen zurückzudrängen und sich auf das Wahre zu konzentrieren. Und das war Hedera, ihre letzte Chance. Rahel sah nur noch die Frau mit den Haaren von der Farbe leuchtenden Morgenrots.
Über die Tria Principa entwickelten die Alchemisten
aus dem Chaos (Sulfur) über die Bewegung (Mercurius)
die Form (Sal/Salz und Erde).
- Chaosbegriff bei Philippus Theophrastus von Hohenheim, genannt Paracelsus -
Gerred Assmut und seine Freundin Claudia standen wie ein doppelter, gestaltgewordener Vorwurf am Gartenzaun. Im Gegensatz zu Tilla sahen die beiden aus wie aus dem Ei gepellt. Vermutlich waren sie auf dem Weg ins Büro. Tilla vergrub ihre verdreckten Hände in den Taschen ihrer Latzhose und verwünschte es innig, sich um diese Zeit in den Garten begeben zu haben.
»Tilla! Wir müssen reden!«
Gerreds Ton erinnerte sie an ihren früheren Schuldirektor, der sie so manches Mal in sein Büro zitiert hatte. Sie fügte sich in das Unvermeidliche und näherte sich dem Zaun. Ihr Ex-Freund hatte seinen Arm schützend um Claudias Schultern gelegt. Die trug ein weit schwingendes, geblümtes Kleid und eine farblich passende Strickjacke. Ihre Hände legten sich schützend über ihren Bauch, eine niedliche kleine Kugel, die eigentlich noch kein Umstandskleid erfordert hätte. Doch Tilla musste widerstrebend anerkennen, dass ihr Kleid und Kugelbauch gut standen. Was allerdings nicht verwunderlich war, denn Claudia Hohenstein könnte sich auch in Geschirrtücher wickeln und es würde glamourös aussehen. Neben ihr kam sich Tilla in ihrer Gartenkluft vor wie ein Höhlenmensch.
In aufgesetzt munterem Ton säuselte sie: »Guten Morgen, Gerred!« Claudia nickte sie lediglich dezent zu. Sie konnte diese Frau einfach nicht leiden. »Wie geht es euch?«
»Was denkst du denn, wie es uns geht?«, schnappte Claudia. Mit sorgfältig manikürter Hand strich sie eine Strähne ihres üppigen Blondhaars zurück.
Eisern zwang Tilla ihre Mundwinkel zu einem Lächeln auseinander. »Nun, in deinem Zustand kann es ja immer mal wieder vorkommen, dass es einem mal nicht so …«
»Hör auf! Du weißt genau, was wir meinen!«, fiel Gerred ihr grob ins Wort.
Tilla beschloss, keinen Deut nachzugeben, und setzte ein dümmlich fragendes Gesicht auf. Gerred sah sie böse an, Claudia anklagend. Tilla wartete mit festgefrorenem Lächeln und erwartungsvoll erhobenen Augenbrauen.
»Was. War. Hier. Los?«, blaffte Gerred, jedes Wort einzeln betonend.
Inbrünstig wünschte sich Tilla die ältlichen und wohltuend schwerhörigen Nachbarn zurück, von denen Gerred das Haus gekauft hatte.
»Nun …«, begann Tilla, die scheinbar schwer nachdenken musste, um zu ergründen, was ihre neuen Nachbarn so aufgeregt haben könnte. »… vielleicht meint ihr Andreas‘ Schwager? Also, der ist manchmal … etwas aufbrausend.« Sie sandte ein betont einfältiges Lächeln Richtung Zaun.
»Schwager?«, echote Claudia eine Oktave nach oben geratend. »Es geht nicht um einen aufbrausenden Schwager. Irgendjemand hat hier geschossen!«
»Mehrfach!«, bekräftigte Gerred und pikte mit einem entschlossenen Zeigefinger Löcher in die Luft.
»Ah, ja, genau! Das war Johannes. Äh, der Schwager … und ich. Also später ich … einmal«, haspelte Tilla mit jeder Silbe leiser werdend. Ihr Versuch zu lächeln mutierte zu einer Grimasse.
Gerred starrte Tilla an, als wären ihr soeben grüne Hörner aus dem Kopf gewachsen. »Du hast ge-schos-sen? Wieso?«
»Na ja, Andreas war damit beschäftigt, Johannes zu verhauen, da hatte er keine Hand frei … und weil die Waffe zufällig neben mir lag, hab ich geschossen.«
Es war aber auch ein Kreuz, dass sich Gerred mit seiner Barbie-Claudia ausgerechnet neben ihr ein Nest baute. Wenn es ihnen nicht passte, was Tilla in ihrem Garten trieb, sollten sie doch wegziehen. Nach Wernigerode vielleicht, in Claudias muffiges, gartenloses Mini-Design-Häuschen. Dort passten sie nach Tillas Dafürhalten viel besser hin. Claudias echauffierter Ton platzte in Tillas Wunschtraum von einem Umzugswagen, der Gerreds und Claudias Habe wegschaffte.
»Da ist eine Horde von Polizisten durch deinen Garten gestürmt. Es wurde geschrien, geprügelt und geschossen, bevor die den Kerl festgenommen haben! Und das war dein Schwager?« Ihre Stimme erreichte langsam das doppelt gestrichene C und damit eine Höhe, die in den Ohren wehtat.
»Ja, nein, also es war Andreas‘ Schwager«, korrigierte Tilla sie und verharrte überlegend. »Ich denke, sein zukünftiger Ex-Schwager … und ja, man hat ihn festgenommen.«
Während Claudia nach Luft schnappte, wurde Gerreds Ton eisig. »Hatte der etwa was mit dieser Mordserie zu tun, von der in der Zeitung berichtet wurde?«
Ihm hatte es schon in der Zeit, in der er und Tilla zusammen waren, nicht gefallen, dass sie immer wieder in polizeiliche Ermittlungen verstrickt wurde. Gerred hasste alles, was aus dem geordneten Alltag herausfiel.
»Hm-ja«, räumte Tilla nuschelnd ein und gab ihr aufgesetztes Lächeln endgültig auf.
Gerred schnaufte. Claudia schloss endlich ihren offen stehenden Mund, um ihn jedoch sofort wieder zu öffnen.
»Tilla, das geht einfach nicht! So etwas darf hier nicht passieren!«
Tilla fing an, mit den Händen herum zu wedeln, um sich die passende Erwiderung zurechtzulegen. »Ja gut, es war etwas hektisch hier und auch laut. Aber eure Umbauarbeiten machen doch auch einen Heidenlärm und …«
»Bist du irre? Es geht doch nicht um Lärm! Es geht um den Beruf deines Freundes! So was akzeptiere ich hier nicht«, polterte Gerred aufgebracht.
Tilla richtete sich ruckartig auf. »Du akzeptierst den Beruf meines Freundes hier nicht? Geht’s noch? Andreas ist nun einmal Polizist und er wohnt hier. Ob dir das passt oder nicht.«
Gerreds Stimme überschlug sich fast vor Empörung. »Er bringt Mörder hier her!«
Tilla brüllte nun ebenfalls ungehemmt über den Zaun. »Andreas hat Johannes doch nicht mitgebracht! Glaubst du allen Ernstes, wir hätten diesen Irren hierher eingeladen?«
»Du hast doch ständig mit so durchgeknallten Leuten zu tun!«, schrie Gerred zurück.
»Hör auf, mir zu unterstellen, dass ich was dafür könnte!« Tilla stampfte zornig mit dem Fuß auf, wobei ihr Gummistiefel ein vernehmliches Flopp von sich gab.
Gerred rang die Hände. »Na super. Dann hast du ja jetzt genau den richtigen Freund, um dich in Mord und Totschlag einzumischen! Das ist es doch, was du immer wolltest. Gratuliere!«
»Es gibt diese dreckige Welt nun einmal und irgendjemand muss sich um Mörder kümmern. Andreas hält diese Spezies von eurer rosaroten Welt fern!«
»Ja, wenn er das mal täte«, warf Claudia spitz ein. »Könnt ihr beiden eure Mörder nicht woanders fangen?«
Tilla stieß ein wildes Gelächter aus. »Sollen wir den Mördern ein Memo schicken?« Sie hob die Hände und spreizte Daumen und Zeigefinger, um eine imaginäre Textzeile darzustellen. »Liebe Mörder, bitte einen großen Bogen um unser Heim machen, unsere Nachbarn beschweren sich sonst!«
»Kann man mit dir nie ein sachliches Gespräch führen?«, herrschte Gerred sie an.
»So lange du so weltfremd bist, nein!«
Es floppte gleich zweimal, weil Tilla nun abwechselnd aufstampfte, um ihrem Zorn Herr zu werden.
»Tilla, ich werde das nicht hinnehmen!«, drohte Gerred aufgebracht. »Verstehst du denn nicht? Was ist, wenn unser Kind eines Tages im Garten spielt und von einer Kugel getroffen wird, weil ihr es zu einer Schießerei habt kommen lassen?«
Die Vision von einem derartigen Szenario ließ Tillas Wut zu Staub zerfallen. Natürlich durfte so etwas nicht passieren. Wesentlich leiser sagte Tilla nun: »Ach verdammt … natürlich verstehe ich das. Aber … das war doch nun wirklich ein Einzelfall. Die haben Johannes festgenommen. Der wandert für viele Jahre in den Bau und kommt nicht wieder. Und es war ja auch nicht wirklich eine Schießerei. Andreas hatte ihm die Waffe aus der Hand geschlagen und die beiden haben gekämpft. Erst bin ich von der Terrasse heruntergefallen und auf der Wiese gelandet und dann krachten Andreas und Johannes vom Beet runter auf den Rasen. Plötzlich war das Kampfgetümmel über mir und die Pistole neben mir. Ich hab das Ding gepackt und Johannes in den Fuß geschossen. Die Kugel ging in den Rasen, nicht zu euch …« Tilla sah auf, da sie sich wunderte, dass Gerred und Claudia sie nicht unterbrachen. »Es wird nicht wieder vorkommen«, fügte sie noch dünn hinzu, bis sie merkte, dass die beiden gar nicht sie ansahen. Deren sichtlich verstörte Blicke schienen sich in irgendwas verfangen zu haben, was sich hinter Tillas linker Schulter befand. Erst jetzt fühlte Tilla die Anwesenheit einer weiteren Person. Sie drehte sich um und erstarrte ebenfalls.
Vor ihr stand eine Frau mit langen, verfilzten Haaren, einer zerlumpten, blauen Steppjacke, fleckigen, zerrissenen Hosen und abgetragenen Sportschuhen. Doch das Schockierendste waren ihre Augen. Tilla hatte noch nie solche Augen gesehen. Innen waren sie hellgrau wie winterlicher Regenhimmel, doch umgab ein bronzefarbener Ring jede Pupille, gleichsam als würde dahinter ein Feuer lodern und so für eine glühende Corona sorgen. Das erste Adjektiv, das Tilla angesichts dieser Augen einfiel, war teuflisch.
Die Teufelsaugen irrten wild hin und her, als hätte die Frau erst jetzt bemerkt, dass zwei weitere Personen anwesend waren. Sie neigte das Kinn seltsam nach unten gegen den Hals und stierte Gerred und Claudia an. Mit einer eigenartig tiefen Stimme begann sie Sätze zu wiederholen, die Tilla wie Latein vorkamen, doch durch die verfremdete Stimme konnte sie die Worte nicht verstehen. Plötzlich brach die Stimme ab. Die Frau legte den Kopf schief und fixierte Tilla mit offenem Mund. Für den Bruchteil eines Momentes glaubte Tilla, sie schon einmal gesehen zu haben. Verwirrt wich Tilla einen halben Schritt zurück. Aus dem Mund der Frau kam ein Geräusch, das wie ein Husten begann und mit den Silben de-ra aufhörte, wobei die letzte Silbe einer Frage gleich, nach oben ging. Aus den Augenwinkeln registrierte Tilla, dass Gerred und Claudia in einer synchronen Bewegung vom Gartenzaun zurück spritzten. Da das Timing für eine weitere Katastrophe ausgesprochen suboptimal war, nahm sich Tilla ein Herz und sprach die unbekannte Frau an, wobei sie sich zur Sicherheit zwischen die Frau und ihre ungeliebten Nachbarn stellte.
»Hallo … äh … kann ich Ihnen irgendwie helfen?«
Der kurze Moment der Vertrautheit war verflogen. Die Teufelsaugen der Frau hefteten sich auf Tilla. Ihre ganze Körperhaltung signalisierte Anspannung. Um sie nicht aufzuregen, hob Tilla friedfertig beide Hände.
»Ganz ruhig … ich wollte Sie wirklich nicht erschrecken … aber Sie haben mich auch erschreckt, wissen Sie …«
Erst jetzt sah Tilla, dass die Frau wesentlich jünger war, als es auf den ersten Blick wirkte, womöglich jünger als sie selbst. Ihr Haar war auch nicht grau, sondern blond und unsagbar schmutzig. Dass ihr Gesicht mit den kräftigen Brauen schön war, konnte man trotz ihrer knochigen Magerkeit sehen. Sie trug eine viel zu weite, mit Rissen übersäte, dreckstarrende Jeans, die unten völlig ausgefranst war. Tilla erkannte jedoch in der Hose eine teure Marke, ebenso wie in den verschlissenen Schuhen, die mit graubraunem, angetrocknetem Lehm besudelt waren. An ihrer Steppjacke war eine der Taschen eingerissen und ein Dreieck von gut fünf Zentimetern klaffte an ihrem rechten Jackenärmel, aus dem die weiße Steppfüllung quoll. Die Jacke wies überall kleine Brandlöcher auf. An der Schnalle des Kragens hatte sich ein Stück Ast mit einem jungen Blatt daran verfangen, das Tilla als Kastanie erkannte. Darunter trug die Frau einen blauen, löchrigen Pullover. Die Miene der Frau wurde immer abweisender. In Tilla wuchs das beklemmende Gefühl, dass sie gleich explodierte.
»Vielleicht erzählen Sie mir, wer Sie sind, und wie ich Ihnen helfen kann.«
»H … dera …«
Wieder war die erste Silbe eine Art Husten. Ihr Gesichtsausdruck bekam etwas Flehendes, als sie Tilla fixierte. Die hatte allerdings mit ihrer Verblüffung zu kämpfen.
»Hedera? Sie wollen zu meiner Mutter?« Abermals stellte sich das Gefühl ein, die Frau schon einmal gesehen zu haben. »Es tut mir leid, aber meine Mutter starb vor drei Jahren.«
Unvermittelt stieß die Frau einen verzweifelten Laut aus, um dann abermals das Kinn zu senken. In verfremdeter, tiefer Stimme fing sie an zu psalmodieren. Tilla schien es, als wiederholte sie ständig drei Worte, doch sie verstand sie nicht, zumal sie immer schneller redete und Silben zu verschlucken begann. Schließlich flüsterte sie nur noch heiser vor sich hin.
»Circumsessioobsessiopossessio …«
Tilla warf einen scheelen Blick hinter sich. Gerred und Claudia standen noch immer schreckensstarr in ihrem Garten, ein paar Meter vom Zaun entfernt, und hielten sich aneinander fest. Abermals sprach Tilla die Frau in beruhigendem Ton an.
»Vielleicht sollten wir ins Haus gehen und uns in aller Ruhe unterhalten.«
Sie wies einladend auf die offenstehende Terrassentür und bewegte sich langsam darauf zu. Das Psalmodieren erstarb, die Teufelsaugen folgten Tillas Fingerzeig. Erstaunlicherweise strebte die Frau nun eilig an Tilla vorbei, der Terrassentür entgegen. Tilla warf ihren Nachbarn noch ein verunglücktes Lächeln zu und beeilte sich, der seltsamen Besucherin zu folgen. Die sauste derweil durch das Wohnzimmer in den Flur, wandte sich zielsicher nach links und riss zu Tillas Verblüffung die Tür zur Apotheke ihrer Mutter auf. In der Tür verharrend sah Tilla, dass die Frau hektisch in jede Nische blickte. Dabei murmelte sie fortwährend Hederas Namen. Tilla überlegte fieberhaft, was sie unternehmen sollte. Sie war sicher, es hier mit einer ausgeprägten psychischen Störung zu tun zu haben. Plötzlich stieß die Frau einen so verzweifelten Laut aus, der Tilla trotz ihrer Furcht anrührte. Das Wimmern wurde rhythmisch und glich bald wieder einem monotonen Singsang. Dabei hielt sie die Hände gegen ihren Kopf gepresst. Urplötzlich wurde es still. Sie ließ sie die Hände sinken und fixierte Tilla. Die glühenden Augen der Frau riefen bei Tilla den schwer zu bezähmenden Impuls hervor, wegzulaufen.
»Brauche … Ritual … rein …gdes Ritual …« Die Frau griff ungelenk in ihre Tasche. Im nächsten Moment starrte Tilla auf eine Messerklinge. »Ri … Ritual … Kr … Krt … Ritual«
Vorsichtshalber wich Tilla einen Schritt zurück, obwohl sie nicht das Gefühl hatte, dass die Frau sie mit dem Messer bedrohte. Wollte sie ein Kräuterritual?
»Ich würde Ihnen wirklich gerne helfen, aber ich bin keine Heilpraktikerin.«
Die Frau stieß einen Schrei aus, der etwas Tierisches an sich hatte. Sie ruderte wild mit den Armen, stampfte ein paarmal hin und her, bis ein Schatten vor dem Fenster der Apotheke vorbeihuschte und jemand Tillas Namen rief. Panik machte sich auf dem Gesicht der Frau breit. Mit einem erneuten Schrei stürzte die Frau aus der Apotheke und riss Tilla dabei von den Füßen. Während Tilla unsanft auf dem Boden des Flurs landete, sprang ihre Besucherin über sie hinweg und verschwand in der Tür zum Wohnzimmer.
»Dana, pass auf!«, rief Tilla ihrer Freundin zu, während sie sich hochrappelte. Draußen ertönte ein neuerliches Schreikonzert. Tilla rannte durch das Wohnzimmer. Auf der Terrasse sah sie, wie sich ihre Freundin Dana halb kniend an die noch zugedeckten Gartenmöbel klammerte, während die Frau bereits über den Rasen lief und in den nahen Wald flüchtete.
Tilla eilte zu ihrer Freundin. »Heilige Göttin! Dana, bist du in Ordnung? Hat sie dir was getan?«
»Nein, ich bin okay … glaube ich«, gab Dana mit dünner Stimme zurück.
Tilla sah kurz zum Zaun. Gerred und Claudia waren verschwunden.
Danas Blick blieb auf den Waldrand geheftet. »Mein Gott, was war das in ihrer Hand? Hatte die wirklich ein Messer?«
»Ich fürchte, ja.«
Danas Blick irrte zu Tilla zurück. »Himmel! Wer war denn das?«
»Wenn ich das wüsste.«
In diesem Moment bemerkte Tilla eine Bewegung hinter der Hausecke. Da sie bis zu den Haarspitzen mit Adrenalin vollgepumpt war, fuhr sie herum, als gelte es, sich einer neuen Gefahr zu stellen. Ein Mann in hellem Anorak, einer grauen, nach hinten gezogenen Mütze und Jeans stand auf der Straße und sah in ihre Richtung. Tilla erkannte mit kundigem Blick eine sehr teure Spiegelreflexkamera mit einem Teleobjektiv in seiner Hand. Ihre Blicke trafen sich für einen kurzen Moment, bevor er sich umdrehte und eilig Richtung Wald entschwand. Sicher hatte ihn nur das Tohuwabohu innehalten lassen. Mühsam versuchte Tilla, ihre Anspannung auszuatmen.
»Mein Gott, diese Augen …«, lamentierte Dana, »… als würden sie glühen. So was hab ich noch nie gesehen. Wie kann man solche Teufelsaugen haben?«
»Ja, ihre Augen waren wirklich gruselig. Man hätte glatt glauben können, dass sie Kontaktlinsen von einem Horrorfilm-Set trug.«
»Die war total irre.«
»Zweifellos.«
»Was wollte die denn hier?«
»Du wirst es nicht glauben, sie wollte zu meiner Mutter. Als ich ihr sagte, dass Hedera tot ist, drehte sie völlig durch. Dann hörte sie dich und geriet vollends in Panik.«
»Wieso hast du diese Verrückte überhaupt ins Haus gelassen?«
Zum zweiten Mal an diesem Morgen sah sich Tilla zu einer Rechtfertigung gedrängt.