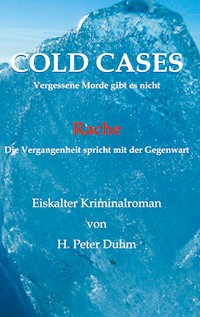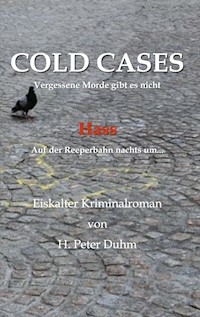
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Cold Cases
- Sprache: Deutsch
In diesem Roman geht es um die Frage: Wie verarbeiten Menschen dem plötzlichen Wechsel von Recht, Ordnung und Ethik? Das Buch soll zeigen, welche menschlichen Abgründe unter dem Deckmantel einer fehlgeleiteten Politik möglich waren. Die beschriebenen, unfassbaren Verbrechen sollen vor möglicher Idealisierung der Nazis warnen und verhindern, dass junge Menschen den heutigen Neo-Nazis vertrauen, ihnen sogar auf den Leim gehen. Als Autor bin ich der Meinung, dass die Darstellung von lokalen Verbrechen im begrenzten, daher weitgehend unbekannten Umfang, deutlicher dargestellt werden muss, zum Nachdenken anregt soll. Besser als globale, nicht personenbezogene Schuldzuweisungen. Bürger, die die Verlegung des "Geisterschiffes" in Bremerhaven aus Gründen der nächtlichen Ruhestörung durch Geschrei der Gefolterten, verlangten, weisen bereits 1938 den Verlust von Ethik und Menschlichkeit auf. Väter, die ihre taubstummen Töchter an Männer vermieten, haben jegliches menschliche Gefühl und Verantwortung verloren. Was muss im Kopf eines leicht geistig behinderten Jungen in der Pubertät vorgehen, der den Kampf seines Vaters gegen das Schlechte fortsetzen will. Die Beurteilung von Menschen nach Herkunft, Rasse und Glauben hat sich damals so stark eingeprägt, dass selbst heute noch Antisemitismus, Ausländerfeindlichkeit und Diskriminierung von anders Aussehenden an der Tagesordnung sind. Das kann und darf nicht sein. Verbrechen, ja Morde sind keine Lösung. Und dennoch geschehen sie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor
H. Peter Duhm schreibt über sein aufregendes Leben und über Verbrechen aus der Nachkriegszeit. In seiner neuen Heimat, Elten, Ortsteil von Emmerich am Rhein schreibt und recherchiert er. Neue, interessante Themen lassen sich überall finden. Man muss sehen und hören können. Auch am Niederrhein, der ihn seit Jahren begeistert.
Sport und Arbeit haben ihn lebenslang motiviert, sich nicht unterkriegen zu lassen.
1942 in Hamburg geboren, überlebte er die Vernichtungsangriffe der britischen und amerikanischen Bombenangriffe. Das Trauma dieser Bombennächte blieb. Vielleicht ist er deshalb jahrzehntelang in der Modebranche tätig gewesen, weil er dort seine Kreativität und Reiselust, seinen Drang nach Neuem, insbesondere während der zahlreichen und ausgedehnten Auslandsreisen, die häufig zu asiatischen Bekleidungsherstellern führten, ausleben konnte. Der Hamburger Modemacher und Professor für Fashion-Management gab nie auf Neues zu entdecken.
Sein Schreibstil ist kurz und direkt, sein Auftreten überzeugend. In seinen weiteren Büchern vereint er sorgfältige Recherche und Tatsachen mit einem prägnanten Schreibstil.
Das zeichnet alle seine Bücher aus.
Er selbst bezeichnet diesen neuesten Roman als ein Feature, als eine Reportage.
Elten am Niederrhein im Juli 2020
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Epilog
Vorwort
Dieses Buch soll eine Warnung an diejenigen sein, die die Taten, die Gedanken der Nazis verdrängen wollen. Deren unvorstellbaren Gräueltaten lassen sich nicht negieren. Dennoch gibt es heute Neo-Nazis, die glauben, an die NS-Zeit anknüpfen zu müssen. Zwölf Jahre NS-Macht haben Menschen so geprägt, dass sie vergaßen, Mensch zu sein. Gerade als das Nazi-Regime ab 1945 endete, konnten einige nicht verstehen, was über Nacht von Recht zu Unrecht geworden war. Die eigene Menschlichkeit war verloren gegangen. Nichts darf vergessen werden! Daran hat jeder Einzelne permanent zu arbeiten. Jeder muss Verantwortung für Vergangenes übernehmen.
Axel Springer hat nach dem Credo im Hinblick auf die Nazi-Zeit gelebt: „Eine Kollektivschuld gibt es nicht, aber schämen müssen wir uns kollektiv.“
Meinem Herausgeber Malte Temmen aus Elten am Niederrhein danke ich.
Frank van Nuenen aus Lent/NL fotografiert ausdrucksstarke Motive für die Titelbilder meiner Bücher.
Beiden besten Dank.
Alle Personen, Namen und Tathergänge sind Fiktion. Die Handlungsorte sind jedoch authentisch.
All den Museen, Gedenkstätten und Bibliotheken danke ich für ihre Unterstützung und den Zugang zu nicht öffentlichen Dokumenten.
Kapitel 1
Kriegsende in Hamburg, Mai 1945
Endlich war auch in Hamburg der fürchterliche Krieg seit drei Tagen vorbei. Wie viele Hamburger saß auch die Familie Sesilski, Vater Karl, Frau und Mutter Emma-Luise, deren unehelicher Sohn Rolf und die gemeinsame Tochter Eva, an diesem Nachmittag sehr angespannt vor dem kleinen schwarzen Kasten, ihrem Volksempfänger-Radio. Sie versuchten, die Anweisungen der britischen Besatzungstruppen über die Neuordnung des Lebens in Hamburg genau zu verstehen. Besonders Emma-Luise interessierte sich sehr für die Verlesung der Namen von Nazi-Verbrechern, die dringend gesucht wurden. Insgemein hoffte Sie, dass ihr Mann dabei sein würde. In diesen unsicheren Zeiten fürchtete sie wieder und wieder von ihm zusammenschlagen zu werden. Ihre Angst saß zu tief. Ihr Mann verhielt sich zu nervös. Die gesamte Bevölkerung wurde aufgerufen, die Aufenthaltsorte jeglicher Nazis, von Parteimitgliedern und Mitgliedern der Geheimen Staatspolizei (Gestapo), den britischen Besatzungstruppen umgehend zu melden. Unter dem Krieg, besonders unter den Bombenangriffen auf Hamburg, waren sie alle vollkommen verstört und lauschten angespannt am Nachmittag des 6. Mai 1945 in den Apparat hinein. Blitzschnell griff Vater Karl zum Radio, schaltete das Gerät unvermittelt aus. „Den Quatsch müssen wir uns nicht anhören. Wir alle haben unsere Befehle gehabt. Was wollen die Tommys denn.“ Seine eiskalten Augen richteten sich auf seine Frau: „Du weißt, ich habe meine Befehle ausgeführt“. Er trat einen Schritt auf sie zu: „Oder bist du etwa anderer Meinung?“ Wütend drehte sich Vater Karl um, ging zum Fenster, kratzte sich am Kopf.
Niemand aus der kleinen Familie wagte etwas, zu sagen. Wie eine viel zu schwere, grau verfilzte Wolldecke hatte sich die Angst vor den Bomben, vor den Gewalttaten des Vaters um sie gewickelt.
„Mama, was heißt das ‚Kriegsende‘? Die dreijährige Eva sah ihre Mutter fragend an. So wie immer beachtete sie ihren Vater nicht.
„Keine Bomben mehr, meine Kleine. Jetzt kannst du ruhiger schlafen!“, meinte die Mutter. Sie ließ sich dabei ihre Sorgen nicht anmerken.
„Was wohl jetzt wird? Ich werde einfach wie immer zum Dienst gehen. Oder was meinst du?“ Unterbrach sie Karl Sesilski. Sah sie herausfordernd an. „Klar, warum denn nicht? Du wirst schon sehen, wie es in deinem Gefängnis am Holsten Wall weitergeht. Du bist schließlich Beamter!“ Sie drehte sich um, ging über den kleinen Flur zur Haustür.
Bloß weg von diesem Mann, ich brauche unbedingt frische Luft, dachte sie. Ihre Gedanken an die vergangenen Monate jagten ihr einen eiskalten Schauer über den Rücken. Hoffentlich ändert sich doch etwas, schwirrte es durch Ihren Kopf. Etwas Freudiges setzte sich undeutlich, nebelhaft in ihr fest. „Vielleicht sind wir jetzt endlich frei. Ich kann nicht mehr, der Krieg und Karl, ich drehe bald durch,“ murmelte sie. Auf dem Gartenweg, zwischen den hohen Hecken. Sie atmete erst einmal tief durch.
Ihr Mann hatte sich in den letzten Monaten zum brutalsten Menschen entwickelt, von dem sie je gelesen oder gehört hatte. Sie wusste nicht, was mit ihm geschehen war. Ohne jedes Gefühl, ohne jeden Grund schlug er sie windelweich. Immer wieder auf die Beine, auf die Brust. Immer so, dass niemand etwas sah. Im Bett vergewaltigte er sie schlimmer als je zuvor. Zusätzlich drückte er ihr ein Kissen auf Mund und Kopf. Kurz vor dem Ersticken stieß er in sie hinein, dabei schliefen die Kinder fest, denn sie sollten von dieser Gräueltat nichts mitbekommen.
„Kinder kommt raus. Draußen ist was los. Vielleicht treffen wir Onkel Albert, Opas Bruder“, rief Emma-Luise ins Haus.
In Hamburg, am Eidelstedter Weg, unter den dicken Eichen vor dem alten Forsthaus, standen viele Nachbarn aus den Nachbarhäusern zusammen. Sie diskutierten verstohlen, sehr leise über das Kriegsende. Endlich, die Frauen sahen sich mit grauen Gesichtern, tiefen schwarzen Ringen unter den Augen, an. Sie nickten sich zur Begrüßung nur kurz zu. Die gespenstische Ruhe über diesem Teil der Stadt lag wie ein Leichentuch auch über den Menschen. Endlich schüttelte sich Frau Hansen, aus Haus Nummer 47. Sie ging direkt auf Emma-Luise zu: „Was meinst du, kommen unsere Männer von der Front zurück? Wie das wohl alles weitergeht. Du hast ja Glück, deiner war nicht an der Front. Immer am Holsten Wall. War bestimmt nicht leicht.“ „Nee, war es wirklich nicht,“ sie sah auf den Boden. Schweigen: „Nee, ich weiß auch nicht, wie‘s weitergeht. Seine Partei ist jetzt weg. Wo ist denn Nickel der Fettwanst. Als Ortsamtsleiter wusste der doch immer, wo es lang ging!“ „Der ist verschwunden. Der lässt sich bestimmt nicht blicken. Das fette Schwein. Und seine Alte, so aufgetakelt, wie die immer war.“ Frau Hansen konnte vor Schreck den Satz nicht beenden, denn unten vom Weiher, dem kleinen Park am Anfang der Straße, aus Richtung der Nivea-Fabrik Beiersdorf, brummten schwere Lastwagen den Eidelstedter Weg hinauf. Neugierig, vorsichtig, aber auch sehr verängstigt zogen sich die Bewohner dieser Straße unter die dickste Eiche am Straßenrand zurück. Als ein offener Jeep vor ihnen anhielt, verschlug es einigen von ihnen die Sprache. Zwei riesige Farbige in englischen Uniformen, mit schweren Waffen im Arm, stiegen langsam aus. Kamen auf sie zu. Die weißen Zähne blitzten in ihren dunklen Gesichtern. Sie lachten, winkten mit der freien Hand. Einer sprach etwas Deutsch: „Kein Angst, nix tun. Kommen aus England. Alles besser jetzt!“ Aus der Jackentasche zog er mehrere braune, flache Tafeln hervor. Cadbury’s Schokolade. „Komm her Junge,“ sprach er Uwe an. „Nimm, hier Schokolade.“ Uwe traute sich nicht gleich. Da rannte Rolf los, nahm dem Soldaten eine Tafel aus der Hand, rannte wieder zurück an die dicke Eiche, um sich dahinter halb zu verstecken. Er hielt die Tafel hoch und schrie: „Schokolade!“ Plötzlich lachten die meisten der versammelten Bewohner. Schokolade hatten sie lange nicht mehr gesehen. Auf dem Kopfsteinpflaster polterten und dröhnten schwere Panzer und Lastwagen an ihnen vorbei. Immer in Richtung Hagenbecks Tierpark und Volksparkstadion. Mit offenen Mündern sahen die Bewohner sich an.
„Das ist also das Ende deines Tausendjährigen Reiches“, fauchte Emma-Luise ihrem Mann Karl ins Ohr. Der hatte sich neben sie geschlichen. Unauffällig, unbemerkt von anderen Bewohnern: „Sieh dir die Trümmer an, alles kaputt. Und du Idiot hast daran geglaubt. Was jetzt? Willst du für die Tommys arbeiten? Immer hab‘ ich dir gesagt, lass mal Fünfe gerade sein, aber nein, du musstest den Tausendprozentigen machen. Immer drauf hauen auf die Schwachen.“ Sie spukte vor ihrem Mann aus. Humpelnd, sich vor Schmerzen immer wieder bückend, an ihr Schienbein fassend, ging sie langsam auf den farbigen Offizier zu. Mit einer Hand hielt sie ihre lange Turnhose fest. Der Gummibund war gerissen.
Ihr Mann hatte sie, in einem winzigen unbeobachteten Moment, ganz nah an sich heran gerissen. Seine wässerigen, eisig strahlenden hellen Augen starrten sie wütend an. Blitzschnell trat er mit voller Wucht gegen ihr linkes Schienbein. Sie knickte zusammen, biss sich auf die Lippen. Schmeckte Blut. Als seine Hand auf sie zuflog, beugte sie sich noch weiter nach unten. Der Schlag ihres Mannes ging daneben. Zum ersten Mal in ihrer Ehe. Nur vor ihrem Mann hatte sie Angst. Nie hatte sie gewagt, sich zu wehren, doch das sollte sich jetzt ändern. Immer wieder hatte er ihr gedroht, ihren Sohn Rolf den Behörden zu melden. Er würde ihn als Schwachsinnigen anzeigen. Sie wüsste ja, was dann passieren würde. Dabei fuhr er sich manchmal mit der flachen Hand über den Kehlkopf. „Rübe ab,“ meinte er höhnisch lachend. Diese Gedanken gingen ihr durch den Kopf, als sie in diesem Moment die Hand ausstreckte und den britischen Offizier mit schmerzverzerrtem Gesicht anlächelte. Ohne zu fragen, ohne auch nur etwas zu denken, nahm sie dem, vor ihr nahe den Jeeps stehenden, riesigen Soldaten, der seine Waffe auf sie richtete, einen zerknüllten, dreckigen Zettel aus der linken Hand. Sie hatte genau beobachtet, als er dieses Papier aus seiner Brusttasche zog. Als wenn sie es geahnt hätte, es standen tatsächlich Namen darauf. Mit weit ausgestrecktem Arm zeigte sie auf Karl Sesilski, ihren Ehemann. Der stand ganz oben auf der Liste. Blitzschnell machte der Soldat einen riesigen Satz auf Karl zu. Der alles beobachtet hatte. Er versuchte wegzurennen. Da versperrten ihm seine Nachbarn den Weg. Mit hängendem Kopf, nach unten gebeugtem Nacken, die Hände auf dem Rücken fest im Griff des Soldaten, stand Karl für ein paar Sekunden hilflos da. Der Soldat schubste ihn vorwärts in den Jeep. Emma-Luise erfror fast von dem Blick, den ihr Mann ihr zuwarf. Sie spukte aus. Die Nachbarn klatschten. Die Kolonne der englischen Soldaten fuhr langsam wieder an. Hielt plötzlich auf den Bürgersteig fahrend nochmals an. Der Offizier zeigte auf Max Kruse aus Hausnummer 47. Zeigte ihm die Liste, zeigte sie nochmals Emma-Luise, beide schüttelten den Kopf. Die anderen gesuchten Männer waren abgehauen. „Die Nazis sind nicht mehr hier, sind weggelaufen, nächste Straße, Hellkamp Nummer 15, Ortsamtsleiter, Nazipartei“, erwiderte Kruse und nutze dazu sein bisschen Englisch. Der Offizier grinste. „Danke, dein Name, komm mit uns.” Als Max Kruse nicht sofort antwortete, hob der Engländer die Waffe. Scharf fragte er erneut:
„Name.“ Kruse erklärte ihm, wer er sei. Der Soldat zog den Mann in den Jeep. Der jammernden Frau Kruse gab er Schokolade, versuchte sie, zu beruhigen: „Er ist jetzt unser Übersetzer. Er kommt bald zurück.” Die ersten schweren Lkws bogen bereits in den Hellkamp ein, als sich der Jeep mit den beiden Soldaten, dem Offizier, Kruse und Karl Sesilski, noch vor weiteren Panzern, in die Kolonne einreihte. Plötzlich löste sich die Anspannung der wartenden Anwohner. Alle rannten auf Emma-Luise zu. Herr Jungk aus Haus Nummer 45 stütze sie. Ihr Schienbein tat höllisch weh. „Wer stand auf der Liste? Was hast du gelesen? Mach zu, welche Namen?“ Emma-Luise sah hoch, sah in die vielen fragenden Gesichter, antwortete unsicher: „Viel konnte ich nicht lesen. Karl stand ganz oben, Fritz Wellmann und Heini Krasunke, der Scheißbonze, auch noch. Sonst weiß ich nichts. Ging alles viel zu schnell.“ „Diese verfluchten Nazis“, brummte Richard Wisch, der alte SPD-Mann. Er hatte wegen seiner politischen Überzeugung so viel gelitten, war aber um längere Aufenthalte im Gefängnis herumgekommen. Wieder und wieder holten sie ihn nachts ab, aber er kam zum Glück immer nach Hause zurück. Manchmal hatte er blutrote Striemen im Gesicht und auf den Händen. Dann blieb er für einige Tage in der Wohnung. Seine Frau sagte bei Beiersdorf Bescheid. Dort leitete er den technischen Wiederaufbau. Nach jedem Bombenangriff fingen er und seine Kollegen von vorne an. Sein Wissen um die Maschinen in diesem kriegswichtigen Betrieb rettete ihm wahrscheinlich das Leben. Langsam zerstreute sich die nachbarliche Ansammlung. Emma-Luise nahm ihre Kinder Rolf und Eva in die Arme. Sie humpelte in ihre Gartenlaube, neben dem Forsthaus am Eidelstedter Weg in Hamburg-Eimsbüttel, zurück. Die Kinder versuchten, sie zu stützen. Schweigend saßen sie noch lange im kleinen Wohnzimmer. Es war bereits spät abends, als die kleine Eva zum ersten Mal zu ihrem Bruder Rolf ins Bett krabbelte. Am nächsten Morgen kam seine Mutter nicht wie sonst in sein Zimmer gestürmt, um ihn zu schütteln. Er sollte aufwachen, bevor sein Vater ihn durch Schläge und Gebrülle wecken würde. Die letzten Jahre konnte er nicht vergessen. Das Zusammenleben mit seinem Vater war, je älter er geworden war, schwieriger, fast unmöglich geworden. Es gab nur noch Schläge für seine Mutter und ihn. Kam der Vater nach Hause, konnte der nicht anders. Zuerst war Rolf dran, egal was immer er machte, falsch oder richtig, sein Vater schlug zu. Rolf hatte sehr früh angefangen, seinen Vater zu hassen. Von dessen Arbeit wusste er fast nichts, nur, dass er im Gefängnis arbeitete. Nie hatte der etwas erzählt, nie konnte der lachen, nie kamen Freunde, Bekannte oder Nachbarn zu Besuch. Rolf, seine Mutter und seine kleine Schwester führten ein Leben ohne Vater. Dessen Familienleben bestand aus Terror gegen seine Frau und seinen Sohn. Eva, die kleine Tochter blieb verschont, sie wurde langsam zum Mittelpunkt des Familientrostes. Der Kontakt zu den Großeltern in Hamburg-Bergedorf war im Laufe der Jahre vollkommen abgerissen. Ihre Mutter nahm die Kinder zum Kuscheln in den Arm, wenn der Vater aus dem Haus war. Rolf, ihr großer, starker Bruder beschützte seine Schwester, wenn die Bomben fielen, wenn das Gartenhaus, ihr Zuhause, wackelte und zitterte. Nur er wusste, wie er seine Schwester beruhigen konnte. Wie oft hatte das kleine Mädchen mitbekommen, wie ihr Bruder bestraft wurde, wie oft die Mutter ihn vor dem Vater warnte. Ihr Bruder tat ihr oft leid, denn er konnte sich nicht wehren. Aber erinnern konnten sie sich alle gut, an die tägliche Angst, vom Morgen bis zum Abend, Terror vom Krieg mit den Bombennächten, mit den Trümmern ringsumher, mit den Zwangsarbeitern, die die Trümmer wegräumen mussten. Jeder ging an denen vorbei, blickte woanders hin, wollte damit nichts zu tun haben. Angst und Gewalt bestimmte tagaus und tagein das Leben draußen auf der Straße, in der Familie, im Bunker, einfach überall. Rolf hatte gelernt, dass nur Kraft, Mut und Brutalität sein Überleben sichern konnten. Nie wollte er die Schläge seines Vaters vergessen; er musste ihm eines Tages zeigen, wer der Herr im Hause war. Er musste stärker werden als der Verrückte, wie er seinen Vater heimlich nannte, als er mit dreizehn Jahren begriff, dass der Mann gefährlich für ihn wurde. Das war ihm bewusst geworden, als ihn sein Vater eines Tages zu einem Spaziergang durch die Kleingartenanlage ESV hinter dem Sportplatz mitnahm. Rolf hatte sich über dieses Zeichen der Ruhe gefreut, bloß raus aus dem Haus, wenn Vater da war. Zuerst schwiegen Vater und Sohn sich an. Dann, als sie vor dem Eisentor des Sportplatzes nach links abbogen, begann sein Vater von seiner Arbeit zu erzählen. „Weißt du, wie schwer es ist, unser Land zu schützen? Ich muss jeden Tag aufpassen, dass unsere Stadt nicht von Feinden zerstört wird. Verstehst du, was ich sage?“ „Nicht so richtig Papa“, antwortete Rolf ausweichend, machte einen großen Schritt nach rechts. Er tat so, als ob er über die dicke Hecke in den Kleingarten reingucken wollte. Er verschaffte sich dadurch einen Abstand zu seinem Vater. „Ach Junge, wir müssen die Feinde bestrafen, einsperren, manchmal sogar sterben lassen, weil sie sehr gefährlich sind.“ „Und, was hast du damit zu tun?“, fragte Rolf, neugierig geworden. „Ich muss auf alle aufpassen.“ „Tun dir manche nicht leid, so im Gefängnis?“ „Hör mal,“ fing sein Vater erneut an zu erzählen, dabei wurde seine Stimme gefährlich leise. Rolf blieb etwas zurück und lauschte angestrengt, immer auf der Hut, möglichen Schlägen ausweichen zu können. „Wenn bei uns Zuhause die verfluchten Kakerlaken unter der Tür durchkriechen, wenn im Herbst die dicken Spinnen die Wände hochkrabbeln und Fliegen, die eben noch auf der Hundescheiße vor dem Haus gesessen haben, mit ihren dreckigen Füßen auf deinem Marmeladenbrot tanzen, hast du dann Mitleid?“ Mit einem ernsten Blick, der keinen Widerspruch duldete, sah er zu seinem Sohn hinunter: „Hast du das verstanden?“ Fragte er nochmals nach.
„Ja, habe ich. Du passt auf, damit das Ungeziefer keinen Dreck macht. Aber das sind Menschen, Papa, vielleicht Hamburger, Deutsche, oder?“ Unbeholfen blickte der Junge auf den Boden. Er wollte viel mehr sagen und fragen, traute sich aber nicht, weil es ihm schwerfiel, die richtigen Worte zu finden. Drohend machte Karl Sesilski einen großen Schritt auf seinen Sohn zu. „Merk dir Eines Junge, Dreck muss weg, Menschen können Dreck sein. Alles, was anderen Menschen schadet, ist Dreck. Ist das klar?“ Schweigend gingen sie weiter. In Rolfs Kopf arbeiteten die Gedanken. Wie Mühlsteine, die alles in kleinste Teile zermahlen mussten, damit er richtig verstand, was sein Vater gesagt hatte. Waren er und seine Mutter auch Ungeziefer, das totgemacht werden sollte? Und seine kleine Schwester, war die was anderes? Warum prügelte der Vater nur ihn und seine Mutter. Täglich übte er in den Trümmern Liegestütze und auf dem Sportplatz lief er stundenlang seine Runden, obwohl die Aschenbahn löchrig und mit fleckigem Gras bewachsen war. Stark wollte er werden, er musste einfach erst seine Schwester und dann seine Mutter retten. Immer wieder kamen seine Erinnerungen an die Schläge seines Vaters hoch, spornten ihn an, stachelten ihn auf, nichts zu vergessen, weil er sich rächen wollte. Er wollte seinen Vater bestrafen, wollte dessen Grausamkeiten an der Familie wieder gutmachen. Besonders abends im Bett, wenn er nicht mit seiner Schwester kuscheln konnte, spiegelten sich seine Erinnerungen in der schmutzig grauen Glasscheibe. Fratzen, Monster, Ungeheuer pressten sich durch das Glas des Fensters und tanzten im flackernden Licht der vor dem Haus stehenden Gaslaterne. Wenn diese denn brannte, was selten genug war. Auch seine Mutter tauchte in seinen Erinnerungen immer wieder auf. Wie sie sich seit den Zeiten in Bergedorf bei den Großeltern mehr und mehr verändert hatte. Das alles schob er auf seinen Vater. Der hatte seine Mutter kaputtgemacht, hatte sie zur harten, unterwürfigen, gefühllosen Schaufensterpuppe geschlagen, hatte sie zu seiner Sklavin gemacht. Irgendwann würde sein Vater sie totschlagen, doch das musste er verhindern. Diese Erinnerungen verfolgten ihn, sein Hass, seine Wut gegen diesen gewalttätigen Mann, der nicht sein richtiger Vater war, fraß sich mehr und mehr in seinem Kopf fest. Warum hatte sie sich nie gewehrt? Warum mich nie beschützt? Mich nie richtig getröstet? Immer wieder murmelte er diese Gedanken vor sich hin. Er verstand seine Mutter nicht, nicht wirklich. Noch nicht. Je älter er wurde, je besser begriff er jedoch das Verhalten seiner Mutter. Sie hatte Angst um ihn, ihren Sohn gehabt. Seinen Stiefvater hatte er aus seinem Leben gestrichen, den wollte und konnte er niemals verstehen. Den wollte er nur bestrafen, so wie er selbst jahrelang für nichts bestraft wurde.
Jetzt, da etwas Ruhe in die Familie eingekehrt war, wanderten die Gedanken quälend, Furchen in seinem Geist hinterlassend, durch seinen Kopf. Gerade seine Mutter, manchmal weinte er leise vor sich hin, wenn die schwarzen Gedanken ihn in seinem Bett erdrückten. Wo sollte er hin mit seiner Wut, seinem Hass. Schon mit vierzehn Jahren entdeckte er an sich selbst ein Ventil, das Druck aus ihm herausnahm, dass ihn beruhigte und befriedigte. Zum ersten Mal in ihrem Leben schliefen sie am nächsten Morgen alle länger. Eva lag wieder in ihrem Bett. Ihr Bruder hatte sie im Halbschlaf zurückgebracht. Vati war weg. Irgendwie war die Luft jetzt sauberer in ihrem kleinen Gartenhaus. Man konnte endlich durchatmen. Rolf ging noch nicht zur Schule. Alles war zerstört, ungeordnet. Seine Mutter stützend, zogen sie zum Verschiebebahnhof Eidelstedt. Sie wollten ein paar Kohlen sammeln. Vom letzten Tritt des Vaters schmerzte Mutters Bein höllisch. Vati konnte nun nichts mehr für sie tun. Nicht schlagen, nicht schreien, aber auch nichts mehr mitbringen. Von seiner Arbeit hatte er immer genug Essen und Kohle mitgebracht. Gefroren und gehungert hatten sie nie. Auch gefragt hatten sie nie, woher er all die Sachen hatte. Rolf wunderte sich nur, dass die Nachbarn seinem Vater immer aus dem Weg gingen, aufhörten sich zu unterhalten, wenn er ihnen entgegenkam, ihn nie direkt ansahen. Selbst im Bunker, wenn alle jammerten und klagten, Angst hatten, manche Frauen weinten, herrschte Totenstille, wenn sein Vater mit ihnen dorthin geflüchtet war. Meistens blieb der aber in solchen Momenten zu Hause, oder er war auf seiner Arbeit im Gefängnis am Hamburger Holstenwall. Zärtlich strich Emma-Luise ihrem Sohn über das Haar. Erstaunt blickte Rolf zu ihr hoch. „Jetzt wird alles besser“, brummelte sie. Die Kinder verstanden nichts. Ihre Angst saß zu tief. Nur eine Sache hatte Rolf für sein Leben von seinem Vater gelernt. Auch Menschen können Dreck sein, der weggeräumt werden musste. Vielleicht war er selbst auch Dreck, denn lernen konnte er nur schwer. Sein Vater hatte sich in der Schule für ihn eingesetzt, war in seiner schwarzen SS-Uniform zum Direktor gegangen. Zuhause prahlte er damals am Esstisch, sah seine Frau dabei mit eisigen Augen grinsend an: „Dem Jungen passiert nichts, die Gestapo wirkt immer. Dass du das man weißt, benimm dich also mir gegenüber, so wie ich es will, dann ist alles gut.“ Dabei reckte sich Karl genüsslich, streckte die Arme zur niedrigen Decke. Zu Rolf gewandt meinte er nur: „Lass den Streit mit den anderen Kindern und Lehrern in der Schule. Ich will das nicht, klar?“
„Klar“ antwortete Rolf und starrte auf die geblümte Tischdecke.“ Er wusste ja bereits, dass menschlicher Dreck weg musst und sein Ventil funktionierte jede Nacht. „Lass das nachts sein Junge. Das ist nicht gut. Du machst du kaputt damit.“ „Lass mich in Ruhe. Ich bin jetzt der Mann im Hause.“
Kapitel 2
Das Mädchen Ella Kruse Hamburg–Eimsbüttel, August 1946 - Ende 1947
Es regnete in Strömen. „Ungewöhnlich“ dachte Elfriede Kruse. „Jetzt mitten im Jahr. Wir haben doch erst Anfang August.“ Bestürzt sah sie aus dem Küchenfenster auf die Straße. Blutrot verwässerte der Regen Wasserfälle vom gegenüberliegenden Trümmerberg. Die vielen roten Mauersteine aus den Ruinen gaben ihre Farbe ab. „Sie bluten aus,“ sagten die Nachbarn. „Ja, genau wie wir alle ausbluten. Sogar die Steine lösen sich auf, so wie alles sich langsam auflöst,“ ergänzte sie das Gerede der Nachbarn. Sie strich sich mit ihrer mageren Hand eine graue Haarsträhne aus dem Gesicht. „Was soll bloß werden.“ Sie konnte ihrer Tochter nicht einmal Brote zur Schule mitgeben, nichts zu trinken. „Heute gehe ich runter zum Einkaufen, mal sehen, was wir bekommen. Irgendwas haben die bestimmt. Wenigstens Brot und Schmalz, vielleicht hat Remmel Wurst.“ „Ella hörst Du?“ Rief sie und lachte zynisch auf: „Wenn ich bloß etwas bekommen würde.“ Immer wieder dachte sie daran. Die Verzweiflung stand ihr ins Gesicht geschrieben, denn heute hatte sie gar nichts Essbares mehr im Haus. Ein Jahr und gut zwei Monate nach Kriegsende, Anfang August 1946, hungerten sie alle, immer noch. Sie lief wieder in die Küche. Ella, ihre Tochter musste zur Schule. Das Mädchen sah sie mit großen Augen an. Ein Glas Fliederbeerensaft hatte sie schon getrunken. Ella Kruse besuchte die Helene-Lange-Mädchen-Oberschule in der Nähe zum Grindel. „Habt ihr heute Schwedenessen?“ Verschämt blickte ihre Mutter aus dem Küchenfenster, werkelte dabei am großen Herd herum. Wenigstens in der Küche hatte sich die Familie Kruse gemütlich eingerichtet. Der große Herd auf der einen Seite und direkt gegenüber der Tür zum Flur stand das rote Sofa, davor der Tisch mit dem Wachstuch, rechts der alte Küchenschrank, der schon so oft gestrichen worden war. Die Türen schlossen nicht richtig, zu viel Farbe dazwischen. In diesem Sommer leuchtete er in lindgrüner Ölfarbe. In der linken Eisblumenscheibe der oberen Tür fehlte ein Dreieck, aber Glas war nicht zu bekommen. Das Loch bleibt also so, weil es den ganzen Krieg so überstanden hatte. Ihr Familienleben spielte sich in eben dieser Küche ab. Genau. Seit Anfang August waren die meisten Schulen, die nicht zerbombt waren, wieder eröffnet worden. In Ellas Klasse waren sie bis jetzt nur vierzig Schüler, hatte sie der Mutter stolz berichtet. „Weißt du, bei Cousin Holger haben sie sechzig in der Klasse,“ erzählte ihr Uschi Gora, ihre beste Freundin. „Bei mir sind wir jetzt vierzig Kinder, weil noch Flüchtlinge dazu gekommen sind. Ist jetzt echt voll. Uschi berichtete oft aus der Volksschule an der Lutterothstraße. Beide Mädchen gingen früher gemeinsam auf dieser Schule. Sie waren stolz wieder lernen zu dürfen. Elfriede Kruses Mann, Max Kruse, hatte sich gestern in der Nacht mit Nachbarn wieder auf den Weg gemacht. In Eidelstedt klauten sie sich Kohlen für den kommenden Winter zusammen. Herr Hansen sprang auf den langsam fahrenden Zug, kletterte auf den Kohlenberg hinauf, warf Kohlenbrocken herunter. Die anderen Männer und Frauen warteten eng an den Bahndamm gepresst, bis die roten Lampen am Ende des Zuges verschwunden waren. Die dreißig Zentimeter von den Kanten der Waggons mussten reichen. Sonst wären sie selbst im trüben Licht der Straßenlaternen zu sehen gewesen. Ihre Gesichter und Hände hatten sie vorher mit Kohlenstaub aus ihren Beuteln und Taschen geschwärzt. So konnten sie sicher sein. Die englischen Soldaten würden sie nicht erkennen, nicht auf sie schießen, weil sie unentdeckt blieben. Oft schossen die in die Luft. Hansen sprang dann vom Waggon ab, rollte sich den Bahndamm runter und kam zu seinen wartenden Bekannten und Nachbarn zurück. Sie alle benötigten dringend diese Kohlen für den bevorstehenden Winter. Vor dem sie Angst hatten. Wenn Hansen zurückgeschlichen kam, dann passte immer jemand auf, ob nicht versteckte Soldaten auf sie warteten und schossen. Manchmal robbten sie auf die andere Seite der Gleise. Jedoch war es immer ein Spiel mit dem Tod. Werner Bleifink bekam das zu spüren. Sie sahen ihn nie wieder. Vor einem Monat brach plötzlich ihr Mitbewohner oben auf dem Kohlenwaggon zusammen. Ein Schuss musste ihn erwischt haben. Alle mochten den mutigen Mann sehr. Wie hatte er immer gesagt und dabei herzlich gelacht: „Die Nazis habe ich als Jude überlebt, jetzt werde ich das mit den Tommys auch noch hinkriegen. Und dann, irgendwann geht es uns wieder besser.“ Alle wussten, dass er viele Jahre in einer Gartenlaube in Eidelstedt versteckt gewesen war. Das hatte ihn vor dem KZ gerettet. Auch wenn er so manche Nacht in einem eiskalten, nassen Erdloch unter dem Regenfass verbringen musste, er hatte so die Kriegsjahre überlebt und nun starb er mit vierundzwanzig Jahren auf einem Kohlenwaggon. Genau in der Gegend Hamburgs, in der er sich so lange vor den Nazis versteckt hatte.
Ella blickte ihre Mutter an. Sie saß an der rechten Ecke des großen Küchenherdes; in dem einige Kohlen leicht glühten: „Ja Mama, jeden Tag haben wir Schwedenessen. Und Lebertran nehme ich auch. Ekelhaft.“
„Du musst los, vielleicht hast du Glück und deine Bahn fährt heute.“
„Ja Mama, die fährt. Sonst laufe ich. Immer die Bundesstraße runter. Ich weiß.“ Ella drehte ihre Augen nach oben. Die ewigen Ermahnungen ihrer Mutter nervten sie. „Iss dich satt, bitte gib nichts ab. Auch wenn die anderen Kinder noch so betteln.“ Um ihre Tochter kreisten ihre mütterlichen Gedanken tagein und tagaus. Sie hatten gemeinsam den Krieg überlebt, jetzt hieß es, an die Zukunft zu denken. Ihr Mann Max kam verschlafen in die Küche. „Ein bisschen zu warm hast du es hier, aber das tut richtig gut.“ Er griff zu der braunen Steingutkanne, die immer rechts auf dem Herd stand. Beherzt nahm er einen großen Schluck vom Ersatzkaffee direkt aus der Tülle. Erst als er den Kaffeesatz auf der Zunge spürte, setzte er die Kanne ab. „Nimm doch eine Tasse, wie oft habe ich dir das gesagt. Wenn Ella das macht, meckerst du rum.“ Seine Frau sah böse zu ihm rüber. Er setzte sich auf den Stuhl, von dem seine Tochter gerade aufgesprungen war. „Heute gebe ich dir keinen Kuss Papa, du bist nicht rasiert. Und Muckefuck hängt dir im Bart.“ Lachend lief sie aus der Küche, verschwand im Flur. Die beiden hörten die Wohnungstür ins Schloss fallen. Ella war Ella war weg. Jetzt konnten sie nur hoffen, dass sie gesund zurückkommen würde. Sie sahen sich an. „Gehst du heute wieder los?“ Fragte seine Frau besorgt. Sie schien beunruhigt zu sein.
„Um zwei werde ich abgeholt. Wie immer, ich soll bei Verhören wieder dabei sein und übersetzen. Es geht immer nur um die Nazi-Verbrechen. Woher die Tommys das alles wissen, ist mir ein Rätsel, aber die wissen wirklich über jeden Bescheid.“
„Auch über dich?“ Nervös stocherte Ellas Mutter in der roten Glut des Küchenherds.
„Auch über mich wissen die etwas. Was soll sein. Ich war nicht in der Partei, ich war kein Nazi.“ „Aber du hast immer als Lehrer gearbeitet.“
„Und?“ Hob Max Kruse aufgebracht seine Stimme: „Und, was habe ich falsch gemacht. Nichts, oder? Ich will wieder als Lehrer arbeiten. Heute frage ich den Major Hillery. Sie müssen mich doch freigeben. Mir werden die ewigen Verhöre zu viel. Heute frage ich wirklich.“ „Ich weiß nicht, du hast als Lehrer für die Nazis gearbeitet. Wenn sie dich dabehalten?“ „Was willst du, warum sollten sie mich beschuldigen.“ „Was weiß ich. Wir müssen los. Hoffentlich ist im Garten alles noch vorhanden und nichts gestohlen worden.“ Sie sah ihren Mann sorgenvoll an: „Bleib du hier. Ich gehe alleine einkaufen, hoffentlich kriege ich was. Um eins bin ich wieder zurück. Irgendetwas Essbares werde ich schon finden.“
„Und ich suche nach reifem Obst im Garten“, antwortet Max Kruse, sah seine Frau nachdenklich an. „Wenn sie nicht alle Birnen geklaut haben, kannst du heute Birnen machen.“ „Sei vorsichtig. Bitte. Nimmst du das Rad? Es regnet.“ „Ja, dann bin ich schneller wieder zurück. Ich lege die Jacke über. Danach muss ich zu den Vernehmungen.“ Ein paar Minuten später kam ihr Mann an der offenen Küchentür vorbei. Sein altes Fahrrad, das er den ganzen Krieg über gerettet hatte, trug er auf der Schulter. Leicht schwankend, sich mit einer Hand am Geländer festhaltend, schlich er sich die fünf Etagen herunter. So wie jeden Tag, dachte seine Frau. Hoffentlich bleibt er gesund, so dünn, wie der Mann jetzt ist.
Über das Treppengeländer gebeugt, blickte sie ihrem Mann durchs Treppenhaus hinterher. Erst als sie im Erdgeschoss die Haustür zuschlagen hörte, schlurfte Elfriede Hansen die drei Schritte zurück in ihre Wohnung, schloss leise die schwere Tür. „Wie klapperdürr er geworden ist. Mein Gott, hoffentlich wird er uns nicht krank,“ verzweifelnd murmelnd schlich sich Ellas Mutter in die Küche. Heute brauchte sie keine Kohlen nachzuwerfen. Sie wollte ja nur kochen, nicht heizen. Und Birnen, ja Birnen würden nicht viel kochendes Wasser brauchen. Und wenn ihr Mann Birnen mitbringen würde, Mehl für Klöße gab es in ihrem Haushalt nicht mehr. Sie setzte sich neben den Herd, stützte den Kopf in die Hand, schluchzte dabei leise. Starrte aus dem offenen Fenster zum Hof. Draußen war es warm, aber regnerisch. „Ich muss endlich einkaufen gehen. Mehl muss ich haben. Das wird es wohl irgendwo geben. Ohne Mehl komme ich nicht zurück,“ sprach sie sich selbst Zuversicht zu.
Elfriede Kruse stand auf, zog ihr Schürze fester zusammen, band sich ein geblümtes Kopftuch um, nahm ein Einkaufsnetz vom Haken, das neben der Kaffeemühle hing, warf einen kurzen Blick in den fleckigen Spiegel in der brauen, leicht abgestoßenen Flurgarderobe. Nachdenklich verließ sie die Wohnung.
Ella und ihre Freundin Uschi rannten durch den langen Flur ihrer Schule. Ihre Zöpfe flogen hin und her, genauso wie die Henkelmänner, wie sie scherzhaft die Blechtöpfe mit Henkel nannten. „Langsam Kinder, langsam. Jeder bekommt etwas. Langsam!“ Frau Pfeilschmidt, ihre Bio-, Mathe- und Deutschlehrerin ermahnte die beiden. Wie jeden Tag.
Aus der, von Bomben unbeschädigt gebliebenen Turnhalle duftete es nach Milchsuppe. Kinder drängten sich wuselnd und schubsend vor der breiten Eingangstür. Die Jungen in kurzen Hosen schoben die Mädchen einfach zur Seite. Frau Pfeilschmidt griff sich den größten Schreihals am rechten Ohr. Zerrte ihn ganz ans Ende der Schlange. Alle Mädchen lachten. Auf ihren, vom vielen Waschen schon leicht grau gewordenen, ehemals weißen Kleidern ließen sich die bunten Blumenmuster nur noch erahnen. Eigentlich hatten beide Mädchen kaum noch Kleider, die richtig passten. Alles wurde zu klein. Jetzt, da sie wieder zur Schule gingen, besonders an dieser Oberschule, mussten sie sauber aussehen. Das wurde kontrolliert. Ihre vom Regen durchweichten, ehemals weißen Socken lagen ausgewrungen unter ihren Schulpulten zum Trocknen. Beim täglichen Schwedenessen, wenn alle Schüler ihre Milchsuppe, den schrecklichen Löffel Lebertran bekamen, achteten die netten Frauen, mit den Rote-Kreuz-Zeichen an den weißen Blusen und Hauben, auf die gewaschenen Hände, saubere Beine und Knie. Manchmal griffen sie sich ein Kind und guckten in die Ohren, besonders bei Jungen. „Bei dir kann man Petersilie säen.“ Gab es oft als Kommentar. Und die Schüler wussten, wenn diese Bemerkung von einer der Frauen kam, musste das Kind seinen Namen in eine Liste schreiben. Am nächsten Tag wurden die Ohren wieder kontrolliert. Das war ja so peinlich. Zur Entlausung brauchten sie nicht mehr zu gehen, das war Gott sei Dank vorbei. Aber, wenn die Lehrer oder die Schwestern vom Roten Kreuz merkten, dass sich jemand immer wieder kratzte, wurden der oder die kontrolliert. Mit Läusen durfte niemand in die Schule kommen. Salmiakgeist als Haarwaschmittel gegen die Quälgeister in den Haaren roch zwar stark, half aber sehr gut. Alle Kinder wussten das. Es war immer noch besser, als nackt in der Entlausungskabine draußen auf dem Schulhof zu stehen. Dann stanken die Haare, Haut und Sachen immer so sehr nach Desinfektionsmittel.
Ellas Mutter meinte jeden Tag, bevor ihre Tochter die Wohnung verließ: „Deine Kleider und deine Schlüpfer müssen sauber sein. Das ist wichtig! Es kann ja immer mal was sein. Sonst kommst du nicht aus dem Haus.“ Fröhlich lachte Ella, wenn ihre Mutter sie ermahnte. „Mama ich bin sauber, das siehst du doch!“ Manchmal nahm sie ihre Mutter in den Arm, sagte ganz lieb zu ihr: „Du machst dir viel zu viele Gedanken. Es wird schon wieder besser mit unserem Leben.“ „Wie groß und vernünftig du geworden bist,“ erwiderte die Mutter, schloss nachdenklich an solchen Tagen hinter ihrer Tochter die große, schwarz gestrichene Wohnungstür. Ein langer Riss unterbrach mit seiner gezackten Linie das Eisblumenglas in der rechten Scheibe. Das ganze Haus hatte bei Bombenangriffen gewackelt. Jeden Tag erinnerte sie dieser Sprung im Glas an den letzten Bombenangriff. Von ihrer Familie verließ niemand die Wohnung, ohne ein fröhliches Auf Wiedersehen. Niemand ging so nach Draußen, nie. Die vergangenen zwölf Jahre mit den Nazis hatten Ängste hinterlassen, gerade an der Wohnungstür und bei Geräuschen im Treppenhaus. Sie hatten viel gehört. Jeder kräftige Schritt, jedes Klopfen an Wohnungstüren, jedes laute Gespräch schallte hinauf bis zu ihrer Wohnung im vierten Stock. So oft hatten ihr Mann und sie über das gesprochen, was in den letzten Kriegsjahren im Haus geschehen war, dabei vermieden sie es gewissenhaft, Einzelheiten preiszugeben. Dass nun alles vorbei sein sollte, konnten beide nicht so recht glauben. Und was war mit den Tommys in Hamburg. Manchmal hatte sie vor denen Angst.
„Das sind die Uniformen,“ murmelte dann ihr Mann. „Weißt du, die Uniformen kriegen wir nicht aus dem Kopf.“ Neben der Haustür klebte immer noch der Aufruf der britischen Besatzer mit den neuen Regeln und Gesetzen nach dem Ende der Nazizeit. Die Anweisungen an die Hamburger mussten strikt eingehalten werden. Ihr Mann hatte den Aufruf von seiner Dienststelle mitgebracht, damals, als endlich das Dritte Reich zu Ende war und die britischen Truppen Hamburg übernommen hatten. Mehrfach bat ihn seine Frau den Aufruf abzunehmen. „Mache ich, irgendwann mache ich das weg. Aber lass das mal, denn wenn die Tommys, für die ich arbeite, mal nach oben kommen, dann sehen die, dass wir uns an ihre Anweisungen halten.“ Seine Frau gab dann Ruhe. Sie wusste, dass ihr Mann recht hatte. Wenn er wieder als Lehrer arbeiten wollte, musste er sich mit den Besatzern gut stellen. Lehrer fehlten in Hamburg, das wusste er. Übersetzer aber auch. Er war in seine derzeitige Aufgabe einfach so reingerutscht. Jetzt saß er fest. Von seiner Arbeit, von seinen Übersetzungen, von anderen Einzelheiten, vom Wincklerbad in Bad Nenndorf erzählte er weder seiner Frau noch seinen Freunden aus der Sozialdemokratie Hamburgs. Major Hillery hatte ihn vor einiger Zeit gefragt: „Was wissen Sie von Bad Nenndorf, Mann?“ Überrascht hatte Max Kruse von seinen Papieren aufgesehen und geantwortet: „Nichts, Sir, nichts!“ Lange hatte ihn der Offizier angesehen, war dann plötzlich im Nachbarzimmer verschwunden. Bevor er jedoch die schwere Eichentür hinter sich zuschlug, drehte er sich um. „Gut so. Besser Sie wissen nichts. Lassen Sie es dabei.“ Irgendwie hatte er es geschafft, aus einigen seiner SPD-Parteifreunde etwas herauszubekommen. Sie wussten von Bad Nenndorf und dem Wincklerbad. Die paar Sätze, die sie preisgaben, reichten ihm. Er arbeitete schließlich bei den Tommys. Von Folterzellen und Todesfällen, von verhungerten Deutschen wollte er nichts mehr hören. Auch wenn das höhere Beamte und Parteimitgliedern bei den Nazis gewesen waren. Angst hatte er jedoch immer, besonders von diesem Tag an. Er konnte die Engländer nicht einschätzen. Jeden Tag kam die Angst in ihm hoch, Fehler zu machen. Er musste von denen fort, musste und wollte wieder Lehrer sein. Diese Angst beherrschte den Alltag, auch wenn die kleine Familie Hansen von seiner Arbeit Vorteile hatte. Oft genug kam er mit einem Paket zurück, das ihm britische Offiziere zugesteckt hatten. Immer enthielten sie Brot, Fett und auch Milchpulver für Ella. Manchmal, besonders zum Wochenende bekamen er Wurst oder Fleisch. Das war gut so, aber die Angst blieb trotzdem. Max Kruse wurde langsam von seiner Arbeit geprägt. Von den Verbrechen, von den Unmenschlichkeiten der NS-Zeit hatte er nichts gewusst. So manchen Tag konnte er nach seiner Arbeit nichts mehr essen. Die Abendstunden, die Hausaufgaben mit Ella, die belanglosen Gespräche mit seiner Tochter lenkten ihn ab. Seine Frau an seiner Seite zu wissen, ließ ihn nicht verzweifeln. Er war fest entschlossen, die Zukunft seiner Tochter mitgestalten zu wollen. „Sie soll nie das durchmachen, was wir überstanden haben. Nie!“ Fest entschlossen sah er bei
solchen Gesprächen seine Frau an. Den Satz wiederholte er oft. „Was können wir sonst auch machen“, fügte er meistens hinzu: „Die Kinder sind unsere Zukunft. Wir haben überlebt. Sonst nichts.“
„Zeig mal deine Zunge“, meinte die rundliche Rote-Kreuz-Schwester und blickte Ella fest an, „Raus damit, mach schon und den Kopf hoch.“
„Ähhh,“ automatisch streckte das Mädchen seine Zunge raus.
„Gut so, Mund auf,“ hörte sie noch die Aufforderung, schon wackelte der Löffel mit Lebertran ganz leicht vor ihrem Mund. „Runter damit und dann weitergehen!“ Gut, das war erledigt, dachte Ella, freute sich jetzt auf die heiße Milchsuppe. Heute gab es sie mit Mehlklößchen. Uschi, ihre Freundin kam hinter ihr her. „Man ist das ekelig“, hörte Ella sie fluchen. Die Mädchen sahen sich an, schüttelten sich und lachten sich kaputt. „Aber gesund, sagt mein Vater immer. Gut für unsere Knochen.“ Rief Ella scherzhaft. „Ja, ja, das sagen sie immer, wenn was ekelig ist,“ ergänzte Uschi. Beide Mädchen sahen in ihr Blechgeschirr, zogen den Eisenlöffel von Rand ab und wischten ihn schnell am Kleid ab. „Lecker heute, so mit den Klößen. Was machst du heute Nachmittag?“ Fragte Ella ihre Freundin. Uschi sah sie an: „Nichts und du?“ „Erst mal Schularbeiten. Dann weiß ich nicht?“ „Kommst du mit zum Weiher? Meine Mutter kommt vielleicht mit.“ „Klar, gut, wenn es nicht mehr regnet.“ Beide lachten und alberten weiter, verabredeten sich so um Drei im kleinen Park mit dem Weiher, in dem sie baden konnten. Unten, da wo Beiersdorf anfing, dort wo sich fünf Straßen verknäulten, da lag ihr Spielpark, mitten darin ihr Badeteich mit dem kleinen Strand. Nur vor den Blutsaugern im Schlamm mussten sie sich vorsehen. Wenn es irgendwo zwickte, schwammen alle Kinder schnell zurück an den Strand. Oft hing dann ein schwarzer Wurm an den Beinen oder am Körper. „Die sind zwar etwas ekelig, aber nicht gefährlich. Früher wurden die vom Arzt angesetzt, wenn jemand zu viel Blut hatte,“ beruhigte der Vater dann seine Tochter. Ellas Vater wusste einfach alles. Sie war stolz auf ihn. An diesem Tag rannten die beiden Mädels zur Haltestelle, denn die Straßenbahn stand wartend genau vor der Schule. Laut klingelnd machte der Fahrer die bummelnden Kinder auf die Abfahrt aufmerksam.
„Bis heute Nachmittag“, rief Ella ihrer Freundin nach, als die hinkend und hüpfend über die Lutterothstraße rannte. Uschi winkte zurück. „Ja, bis nachher.“ Ella Kruse, das nette vierzehnjährige Mädchen, bummelte zu ihrer Wohnung am Eidelstedterweg, verschwand in Nummer Siebenundvierzig. So wie fast jeden Tag. Immer wenn sie aus der Schule kam und nicht direkt zum Schrebergarten der Familie musste. Ihre Eltern warteten dort auf sie.
Der Rest des Sommers verging viel zu schnell. Jeden Tag arbeitete einer von ihnen im Schrebergarten. Äpfel, Birnen, Pflaumen und Gemüse für den langen Winter ernten, die Hühner und Kaninchen füttern. Sie wollten zeigen, dass sie immer anwesend waren. Diebe gab es genug.
Viele Familien ohne Graten hungerten. Äpfel gab es reichlich, Boskop, Cox, Celler Dickstiel, diese Sorten hielten sich bis zum nächsten Frühjahr. Kartoffeln und Wurzeln ließen sie in Kisten mit Laub und alten Jutesäcken, gegen Frost geschützt, im Kaninchenstall stehen. Eine große Zinkwanne mit Zuckerrüben schleppten sie im Herbst zu Fuß nach Hause. Fast eine Woche stank es in der ganzen Wohnung nach gekochten Rüben. Erst dann war der wunderbar süße Zuckersirup fertig. Über dem Herd hingen in langen Reihen Apfel- und Birnenscheiben. Auf dem Bord über der Küchentür stapelten sich Einmachgläser mit Bohnen, Erbsen, Birnen, Grünkohl, Kirschen und Pflaumen. Aus den Zwetschen hatte Mutter Kruse fast schwarzes Mus gekocht. Ihre Tochter Ella half ihr, wo sie nur konnte. Abends im Bett meinte ihre Mutter zu ihrem Mann: „Was würde ich bloß ohne das Kind machen. Sie ist eine so große Hilfe.“ „Pass aber auf; sie soll ihre Schule nicht vergessen. Ab nächste Woche bin ich wieder mehr zu Hause.“ Beide waren sehr froh, dass jetzt, kurz vor dem Winter, Max Kruse zurück in seinem alten Beruf als Lehrer arbeiten konnte. Ende September hatten ihn die Engländer, nicht zuletzt wegen seiner Tochter, entlassen. Ihm genehmigt, wieder als Lehrer zu arbeiten. Sie hatten ihn sogar an die Schule an der Lutterothstraße in Eimsbüttel geschickt. Der Direktor stellte ihn sofort ein, als seine Papiere geprüft waren. Die Herren kannten sich flüchtig aus der SPD. Seine Frau umarmte ihn. Tränen in den Augen, als er ihr so ganz nebenbei von diesem neuen Anfang berichtete. „Jetzt wird alles gut,“ hatte sie ihm ins Ohr geflüstert. „Und gleich bei uns um die Ecke, die Schule kennst du doch. Mensch haben wir Glück!“ Seine Tochter fiel ihm um den Hals, als ihre Eltern abends die neue Arbeit ihres Vaters erwähnten. Ihre Tasse mit Maggibrühe stieß sie fast um, als sie sich über den Tisch beugte. „Mensch Papa, jetzt kannst du mir noch mehr bei den Schularbeiten helfen. Endlich bist du nicht mehr bis nachts auf der Arbeit.“ „Und wenn ich Schichtunterricht habe?“ Max lachte seine Tochter an. „Dann bist du nur von mittags bis sechs Uhr abends weg. Prima, oder?“ „Ja, prima und jetzt Marsch ins Bett.“ Ihr Vater gab ihr einen liebevollen Klaps auf den Po. Elfriede Kruse schob langsam ihre Hand über das geblümte Wachstuch. Als sie die knochige Hand ihres Mannes zart berührte, sah er von seinem Buch auf, lächelte seine Frau an. Sorgfältig schob er ein Stückchen Zeitungspapier als Lesezeichen zwischen die Seiten.
Liebevoll meinte er: „Ja Friedel, jetzt ist wohl die Zeit gekommen, wieder zu glauben, dass es weitergeht.“ Seufzend drückte er die Hand seiner Frau. „Jetzt diesen Winter noch, dann geht’s bergauf. Die Kinder brauchen uns, wir müssen sie weiterbringen. Sie sind unbelastet. Das siehst du an Ella!“ „Ja, sie strahlt so was Freundliches aus. Nichts ist ihr zu viel, wenn das man so bleibt.“ „Wir müssen daran arbeiten“, antwortete er zuversichtlich. Beide sahen nachdenklich auf das geblümte Wachstuch auf ihrem Küchentisch. Müde stand Max Kruse auf, die Hand seiner Frau zog er über den Tisch, ließ sie nicht los.
Ella schlief ruhig im vorderen Zimmer. Vorsichtig zog ihre Mutter die Gardine zurück, nur um zu prüfen, ob die Fensterklappe geschlossen war. Jetzt im Oktober wurde es nachts oft sehr kalt. Vor dem kommenden Winter hatten sie und die Nachbarn Angst. Es gab einfach zu wenig zu kaufen. Zu wenig Lebensmittel, zu wenig Kohle, zu wenig warme Sachen zum Anziehen. Ihren Mann hörte sie in der Küche mit Wasser planschen. Sie wusste, er versuchte, sich den Tag vom Gesicht zu waschen. Mit leichter Hand zog und schob sie die Bettdecke ihrer Tochter etwas zurecht. „Schlaf gut,“ flüsterte sie und küsste ihrer Tochter aufs Haar. Als sie die Tür leise hinter sich schloss, schlüpfte ihr Mann bereits bibbernd vor Kälte ins Schlafzimmer. „Ich wärm schon mal das Bett an.“ Heute schloss er die Schlafzimmertür hinter sich, worüber sich Elfriede wunderte, denn das hatte er seit Jahren nicht mehr getan. Immer die Türen offenlassen, hatte ihr Mann gesagt, dann hören wir, wenn im Treppenhaus Stiefel auf der Treppe poltern. Sie kuschelte sich an ihren Mann ran. Ganz eng, ganz fest. Als er sich über sie beugte, sie zärtlich küsste, als er zwischen ihren Beinen lag und sie liebte, wusste sie, dass eine neue Zeit angebrochen sein musste. Seit fünf Jahren, seit der Krieg mit Russland 1941 begonnen hatte, gab es keine Zärtlichkeiten mehr. Die Angst war zu groß gewesen. Und Bombennächte zerstörten Sehnsüchte. Ruhig und zufrieden schliefen beide an diesem späten Abend ein.
Auch als Weihnachten immer näherkam, mussten sie abwechselnd zu ihrem Garten gehen. Die Kaninchen, die Hühner versorgte Ella, aber sie ging nie alleine. Ihren Eltern war das zu gefährlich. Es wurde schon früh dunkel, alle Menschen froren und viele hatten großen Hunger. Sie mussten aufpassen, dass nichts gestohlen wurde. Jeden zweiten Tag schlief Max Kruse in ihrem Gartenhäuschen.