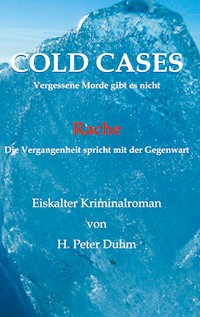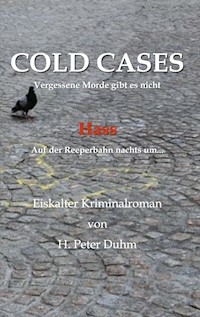8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Das Leben ist eine Einbahnstraße, immer vorwärts, niemals zurück
- Sprache: Deutsch
Ein verrücktes Leben. All inclusive Mein Privatleben und ich. War es eine Sucht geworden, war es eventuell Flucht? Ich wusste es nicht. Nur eines fühlte ich, Reisefieber. Nicht kurz vor einer Reise, nein schon dann, wenn ich gerade in Deutschland aus Asien gelandet war. So schnell wie möglich wieder aufbrechen. Dieses Verlangen trieb mich wie die Feder in einem Spielzeugauto an. Der Schlüssel verbarg sich unter meinen Traumata aus der Kindheit. Angst bestimmte mein Leben. Ängste allein, verlassen leben zu müssen. Niemand merkte es. Ich lachte fort was mich belastete. Wer würde mich schon verstehen. Irgendwie irre. Das war eben so, konnte ich nicht ändern. Ein lachender, kuscheliger, jedoch tiefgefrorener Eisbär. Das schrie mir eines Tages eine Freundin entgegen. Auch gut. An Eis perlt viel Dreck ab. Und wie begann diese Lust, dieser Drang zu reisen? Sicherlich hatte sich ein Satz meines Großvaters in mir festgesetzt. Junge, sagte er eines Tages: Man kann dir in deinem Leben alles nehmen, nur deine Erinnerungen nicht. Das hatte er als Sozialdemokrat in der NS-Zeit gelernt. Dieses Buch soll einen Einblick geben, wie man leben kann, wie man beruflichen Erfolg haben will, ohne Internet, ohne Computer, ohne Handy und Smartphone. Heute unvorstellbar und doch war es real. Und ich reiste Ende der 80er Jahren schon zwanzig Jahre um die Welt. Also schreibe ich vieles auf, alles ist nicht möglich, so viel wie ich denke, dass es lesenswert ist. Wie begann ich zu reisen? Ohne Geld, ohne Kontakte. Im Ausland erfolgreich tätig zu werden? Ganz einfach. Risiko, Fehler, Rock und Roll akzeptieren. Auch wenn ich wieder heim nach Norddeutschland wollte, die Abenteuerlust trieb mich weiter. Wie fremdgesteuert! Das Leben ist eine Einbahnstraße, immer vorwärts, niemals zurück. Mein Leben gestaltete sich so irre, als hätte ich Fliegen mit Essstäbchen fangen wollen. Und das in über sechzig Ländern dieser schönen Welt. Diese Bücher sollen als Feature, als Reportage über ein ganzes Leben verstanden werden. Teil 1
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 437
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Der Autor
H. Peter Duhm schreibt über sein aufregendes Leben und über Verbrechen aus der Nachkriegszeit. In seiner neuen Heimat, Elten, Ortsteil von Emmerich am Rhein schreibt und recherchiert er. Neue, interessante Themen lassen sich überall finden. Man muss sehen und hören können. Auch am Niederrhein, der ihn seit Jahren begeistert.
Sport und Arbeit haben ihn lebenslang motiviert, sich nicht unterkriegen zu lassen.
1942 in Hamburg geboren, überlebte er die Vernichtungsangriffe der britischen und amerikanischen Bombenangriffe. Das Trauma dieser Bombennächte blieb. Vielleicht ist er deshalb jahrzehntelang in der Modebranche tätig gewesen, weil er dort seine Kreativität und Reiselust, seinen Drang nach Neuem, insbesondere während der zahlreichen und ausgedehnten Auslandsreisen, die häufig zu asiatischen Bekleidungsherstellern führten, ausleben konnte. Der Hamburger Modemacher und Professor für Fashion-Management gab nie auf Neues zu entdecken.
Sein Schreibstil ist kurz und direkt, sein Auftreten überzeugend. In seinen weiteren Büchern vereint er sorgfältige Recherche und Tatsachen mit einem prägnanten Schreibstil.
Das zeichnet alle seine Bücher aus.
Er selbst bezeichnet diesen neuesten Roman als ein Feature, als eine Reportage.
Elten am Niederrhein im Juli 2020
Inhaltsverzeichnis
Prolog
In Los Angeles
Jugend in Hamburg ab 1946
Mord an Ella
Kapitel 5 : Freundin ULLA
Kapitel 6 : Erinnerungen aus der Kindheit
Kapitel 7 : Opa Emil trifft Opa Richard
Kapitel 8 : Dicke Eier
Kapitel 9 : Schule und mehr
Kapitel 10 : Die Zukunft beginnt…
Kapitel 11 : Klingeling der Eiermann
Kapitel 12 : Krebs
Kapitel 14 : Vanessa und ihr Bett
Kapitel 15 : Hamburg plus
In der chinesischen Metropole Hong Kong
Los Angeles
Indien
Meine erste mystische Nacht in Goa
Mein indischer Traum unter Drogen
EPILOG
Prolog
Verstehen musst du das Leben rückwärts, leben musst du es vorwärts.
Ach ja, Sie haben Recht. Ich muss mich vorstellen. Sorry. Mein Name
ist Peter Wiese, oder wie die Amerikaner sagen, einfach Peter Vice, nach dem Aktionskrimi < Miami Vice.> Immer noch Kult bei den Amis.
Von meinem Job als Dozent in Sachen Mode-Management kennen sie nur wenig. Fashion in Bekleidung endet für viele in Kalifornien am Hosenbund, wenn nur die Calvin Klein Unterhose hervorlugt und wenn Frauen mit dreißig Pfund Übergewicht in Dessous von Victoria Secrets engelsgleich ins Schlafzimmer schweben. Aber im Ernst, Meinungen über Mode in Europa und den USA trennen wirklich Kontinente. In Schlappershorts und Vintage – Hawaii-Hemd ist man hier immer up-to-date gekleidet. Ich genauso, bequem muss Bekleidung sein. Vor allem im Sommer. Und Sommer ist hier fast das ganze Jahr. Denken Sie daran, wenn Sie Ihren nächsten Urlaub im Süden der USA planen. Übrigens Fashion betrifft nicht nur Bekleidung. Unser ganzes Leben wird von Mode und Trends bestimmt. Denken Sie an ihr Handy. Eigentlich ist es ein Telefon. Ein unfassbarer Trend hat es zu einen Kommunikationsmittelpunkt gemacht. Stammt Ihre Küche noch aus den Siebzigern und ist ihr Bad in Bahamabeige oder Currygelb gehalten? Nee, Sie sind modern eingerichtet? In Schwarz und Weiß, meinen Sie wirklich? Dann prüfen Sie nur einmal Ihre Matratzen. Auch die unterliegen Trends und Mode zum Guten oder Bösen Ihres Rückens.
Und, Sie wollen mich begleiten?
Dann man los. Auf geht die Reise durch mein Leben, durch Schluchten, über hohe Berge, immer begleitet von Katastrophen und vielen lustigen Erlebnissen aus aller Welt. Ich komme gerade von meiner morgendlichen Radtour am Pazifik zurück. Sie können es nicht wissen, aber ich lebe in Marina del Rey bei Los Angeles. Im Panay-Way, einer künstlichen, mit Palmen bewachsenen Halbinsel, mitten im Yachthafen. An der Ecke befindet sich ein Restaurant der Cheesecake Factory. Witzigerweise ist deren Nachmittagsspezialität Schokoladenkuchen, innen so wunderbar glitschig. Mit den Tortenstücken könnte man in Wanne-Eikel eine ganze Jugendmannschaft beglücken, so mächtig sind die. Ganz vorne rechts am Beginn meiner Straße gibt es eine kleine Bar für die Segler und Bootseigner.
Kaffee und Muffin verkauft der gute Mann den ganzen Tag. Immer hat er Gäste, mich auch. Morgens einen riesigen Blaubeer-Muffin und einen schlappen amerikanischen Kaffee mit Karamellgeschmack und der Tag stimmt hier. Wunderbar. Die vielen Spatzen müssen von den Muffins wissen. Sogar auf dem Rand meines Bechers sitzend, kacken sie auf den Tisch. Jedes Mal gibt es dann ein großes Stück Muffin und weg ist der Vogel. Nach einer Woche hatte ich begriffen warum der nette Mann im Café so große Muffins backt. Die vielen Spatzen, eben deswegen. Und wissen Sie was, weil das Leben in vielen Teilen der Erde so gänzlich unbekannt abläuft, nicht schlechter oder besser, anders eben.
Deshalb habe ich mich selbst eingeladen meinen Lebensweg aufzuschreiben. Es wird ein Buch in dem Sie sich oft selbst erkennen werden, erstaunt ins Grübeln kommen. Nicht neidisch, nicht traurig werden, nur lesen und genießen. Verwundert, überrascht nachdenklich sollen Sie schon werden. Denken Sie daran, die meisten Menschen waren niemals in Paris.
In Los Angeles
In meinem Apartment in Marina del Rey, dem eleganten Yachthafen von Los Angeles, beginnt meine Reise zurück in die Zukunft.
Lustig klimperten die Stahlseile gegen die vielen Masten der Segelboote, die genau unter meinem Fenster im leichten Wind des Pazifiks dümpelten. Sie stimmte mich jeden Morgen fröhlich, diese Musik aus Ozean, Freiheit und Meeresbrise.
Nach einem Frühstück mit Muffins, kackenden Spatzen und Ami-Kaffee machte ich mich an diesem Vormittag daran in einer Holzkiste zu kramen. In meiner Kindheit war sie stets verschlossen und stand oben auf dem Kleiderschrank meiner Großeltern in Hamburg, auf der vierten Etage. Für mich und meinen Cousin unerreichbar, was uns mächtig nervte. Wir wollten wissen was sich darin verbarg. In diesem Kasten – wie es in meiner Familie offensichtlich üblich gewesen war, wurden die wichtigsten Papiere aufbewahrt und durch den Ersten und Zweiten Weltkrieg gerettet.
In einem großen Paket, innen verpackt in die neuesten Tageszeitungen aus Hamburg, brachte der US-Parcelservice diesen Holzkasten. Meine Tante Anneliese liebte solche Überraschungen. Selbst wenn ich tausende Kilometer entfernt wohnte. Sie schickte immer Pakete. Klar mit einem Laib Schwarzbrot, Leberwurst und einigen Franzbrötchen aus der Bäckerei „Nur Hier“.
In Hamburg Lokstedt, direkt hinter den Studios vom NDR hatte sie eine öffentliche Quelle neben ihrem Verkaufsraum eingebaut.
Immer habe ich dort meine Franzbrote gekauft und Wasser in Plastikflaschen abgefüllt. Es war gutes Wasser. Immer. Weil die Brötchen so vom vielen Zucker und Honig klebten. Das Quellwasser schmeckte gut dazu. Klebrige Frische eben, echt lecker. Schlecht für die Zähne, gut für die Laune. Ich kramte zwischen zerknüllten Zeitungen, selbstverständlich hatte die Tante die neueste Ausgabe vom Hamburger Abendblatt verwendet. War mit auch klar. Der muss in den USA Kontakt zur Heimat halten, dachte sie sich wohl dabei. In diesem mysteriöse, alten, nach osteuropäischer Kunstschnitzerei aussehenden Deckelkasten tauchten plötzlich völlig gruselige Bilder auf. Ich erschrak vor dem, was ich entdecken würde. Meinen Kopf schüttelnd, blickte ich lächelnd durch meine großen Fenster auf die vorbeifliegenden Pelikane, die mich mitzunehmen schienen, in eine längst vergangene Zeit. Mit den großen weiß-rosa Vögeln verschwand ich hinter dem Horizont in meiner eigenen Vergangenheit. Der Bescheid über die Höhe der Kriegsrente meines Stiefvaters, ließ an den brutalen Mann mit seiner Krallenhand denken. Meine Angst als Kind vor dieser Kriegserinnerungskralle fand ich jetzt lustig. Der Mann hatte einen Durchschuss seines Handgelenks aus Russland mitgebracht. Das geschah ihm Recht, diesem Sadisten. Ich drehte mich um, meine Balkonblumen lachten mich an und die Palmen standen dort Draußen wie jeden Tag. Diese verdammte, verkrüppelte Hand griff nicht nach mir. Nee, tat sie nicht mehr. Mehr und mehr versank ich in meiner Vergangenheit. Die Sterbeurkunde meines Urgroßvaters, den sorgfältig ausgeschnittenen Zeitungsartikel über die Gratulation des Kreisleiters, die meiner Urgroßmutter galt, als sie hundert Jahre alt geworden war, die Bescheinigung über das Sorgerecht für mich als Kriegswaise, das Abschlusszeugnis meines Stiefvaters vom Alten Gymnasium in Bremen und die Bestätigung, dass ich bei Leuten in Bremen von nun an zu leben hatte. Ich musste laut lachen. Wie man damals in der Nachkriegszeit über Menschenleben entschied, unglaublich. Lustig, weil es so lange her war. Zwischen diesen und vielen anderen Papieren, fand ich kleinformatige Totenzettel mit Namen und Todesdatum von angeblichen Verwandten, die ich nie kennengelernt hatte. Ich stand auf, diese vielen Gruftys, dachte ich dabei und lächelte. Die hätten bestimmt auch gern einen leckeren Kaffee mit Milchschaum gehabt, den ich mir jetzt machte. Ein vergilbtes, mehrfach gefaltetes Papier bescheinigte meinem Großvater, dass er entscheiden konnte, wo ich zu leben hatte. Welche Perspektiven im Leben räumte man damals herrenlosen Hunden, pardon Kindern ein. Ich lachte laut auf. Mensch war es hier in Marina del Rey am Pazifik schön, wunderbar. Plötzlich hatte ich den Geruch nach frischen Muffins in der Nase. Gestern, auf dem Wochenmarkt in Santa Monica ließ ich mir von einer netten deutschen Dame aus Hamburg, das passte zu mir, riesige Dahlien – Blüten einpacken. Sie freute sich, weil ich mich mit Dahlien auskannte. Ich freute mich an den herrlichen Farben und ungewöhnlichen Formen. Die Farben leuchten in der Sonne, die in mein Wohnzimmer fiel. Entweder sollte ich ins Waisenhaus, eines in Bordesholm, das liegt bei Kiel, oder ins Raue Haus in Hamburg. Ich war in beiden .. An Hamburg erinnere ich mich nicht. An Bordesholm sehr wohl. Verdreckt und durchgeprügelt stand ich eines Tages vor meiner Tante Anna, die mit dem Zug gekommen war. Ich weinte, sie weinte. Sie nahm mich an die Hand, ich trottete neben ihr her. Sie sprach nicht, ich ließ ihre Hand nicht los. Wir fuhren mit den Zug nach Hamburg. Opa und Oma warteten bereits. Das Sorgerecht sei ihm hiermit übertragen worden, stand von Hand geschrieben auf dem Zettel. Na wunderbar, so einfach war es eine Familie zu bekommen. Prima. Nur mitten in der Küche nackt in einer Zinkwanne zustehen, fand ich schrecklich. Weil mich alle von oben bis unten anguckten. Meine vielen blauen Flecke taten weh. Ich sah bunt aus, manche verfärbten sich grün oder gelb. Damals begann wohl mein Leben als bunter Vogel, der durch die Welt jettet. Dann, beim Blättern durch eine Art Brieftasche, die mit einem farbigen Band fest verschnürt war, fand ich die Scheidungsurkunde meines Stiefvaters. Der Typ hatte nie über seine erste Frau gesprochen. Typisch nur nichts an sich selbst kleben lassen. Immer auf die Kleinen einprügeln. Scheidung war ein Makel, den konnte der Mann nie von sich abwischen. Das meinte er, als Hanseat jedenfalls. Nach Außen fein, nach Innen verrottet. Ich blickte versonnen auf die Segelboote, die Palmen und die blauen, sich kräuselnden Wellen des weiten Ozeans. Nur sehr langsam kam mir zum Bewusstsein, dass ich dabei war viel über die eigene Kindheit, das Schicksal meiner Familie aus offiziellen Papieren, Dokumenten und Zeitungsausschnitten zu erfahren. Mein anfänglich neugieriges, wahlloses, nebensächliches Suchen, wich langsam purer Neugierde. Vielleicht hatte ich etwas geerbt oder hatte Geschwister, auf die ich mich freuen konnte. Es musste etwas Wichtiges in dieser Kiste verborgen sein, warum hätte mir meine einzige und Lieblingstante sonst den ganzen Kram geschickt. Das handschriftlich vermerkte <<Wichtig<< wurde ein Wort, das ich auf vielen Briefen, in Verbindung mit Unterschrift und Stempel fand. Und jetzt, ich bin frei, lebe tatsächlich mein Leben. Genieße meine Zeit in den USA, zwei Jahre in Phoenix und jetzt mit einem Vierjahresvertrag an der UCLA . Frei von den Zwängen und Konventionen, die mir das alte Europa immer abverlangt hatte. Immer Anzug und Krawatte, geputzte Schuhe und weißes Hemd. Das Thema hatte wir weiter oben bereits. Mir kam es vor als hole mich meine so lange verdrängte, lange im Dunkel gebliebene Geschichte doch noch ein. Jumaji, der Film mit Robin William schien plötzlich vor mir abzulaufen. Statt der wilden Tiere rannten plötzlich Erinnerungen durch den Raum. Lustige Clowns, gefährliche Männer mit weit aufgerissenen Mäulern, chinesische Frauen in knallroten Kimonos mit Drachenköpfen darauf, indische vielarmige Götter. Es nahm kein Ende mit dem Theater in meinem Kopf. Nicht schlecht dachte ich, das hast du alles erlebt. Ist doch prima. Wer erlebt schon so viel. Niemand. Feuer flammte auf meinem Sofa auf. Ich lächelte, weil ich ahnte, welcher Film sich jetzt vor mir abspielen würde. Shanghai so um 1974, mit meinem Chef war ich in der Volksrepublik China unterwegs. Im Peace Hotel in Shanghai tat sich vor mir auf. Ich öffnete die Tür zu einem großen unheimlichen, zuletzt vor vierzig, fünfzig Jahren von den Engländern renoviertem Doppelzimmer. Die Betten standen jeweils an entgegengesetzten Wänden. Ein riesiges Badezimmer weckte damals wie heute Beklemmungen, weil alles zwar sauber aber mindestens hundert Jahre alt war. Auch die Betten, in denen man in durch gelegenen Matratzen unter riesigen, mit Federn gefüllten Bettdecken versank, ließen mich fast ersticken. Ich ging zum Balkon, blickte auf den Pazifik. Das Hotelzimmer aus Shanghai drehte sich durch mein Wohnzimmer. Wurde ich langsam wahnsinnig? Lastwagen ratterten nachts unter dem Fensters vorbei, Sirenen heulten irgendwo in der großen Stadt. Ich blickte über meine Balkonbrüstung; da war nichts. In meiner Wohnung tobte und lärmte der Jumaji - Verschnitt aus China. Plötzlich brannte alles lichterloh. Ich rannte ins Zimmer zurück. Nichts. Nur damals, in meinem Albträumen stieg ich ins Bett meines Chefs. Kuschelte mich an und schlief weiter. Ich schmiss den blöden Holzkasten zu. Alles friedlich, keine Feuer. Nur Lachen, ich dachte an das Gesicht meines damaligen Chefs am nächsten Morgen, beim Frühstück. In Shanghai, mitten in China, 1973. Jetzt musste ich einen Kaffee haben. Der blöde Deckelkasten blieb geschlossen, die Gespenster verschwanden. Es konnte losgehen, meine Reise in die Vergangenheit. Zurück in die Zukunft, zurück in ein lustiges, gefährliches, abenteuerliches Leben immer auf der Überholspur.
Jugend in Hamburg ab 1946
Die Sonne schien an diesem Vormittag, noch vor der Schule, hell gegen die von den Erschütterungen der Bombenexplosionen undicht gewordenen Fenster.
„Ungewöhnlich warm“, murmelte meine Oma, „jetzt im Jahr. Wir haben erst Ende Juni“. Überrascht sah sie aus dem Küchenfenster in den Innenhof der Nachbarhäuser. Sie schlurfte dann wie jeden Morgen ins vordere Balkonzimmer, schob die Gardine zur Seite und schüttelte den Kopf. Blutrot glitzerten Glasscherben, Mauerreste und Papierfetzen in bereits um diese Zeit ungewöhnlich hellen Sonnenlicht vom gegenüberliegenden Müll- und Schuttberg auf den Eidelstedter Weg in Hamburg Eimsbüttel. Ratten huschten unerschrocken hin und her. Blieben aufrecht sitzen, putzten sich ohne Angst die Barthaare. Die vielen roten Mauersteine aus den Ruinen verblassten mehr und mehr.
„Sie bluten aus“, sagten die Nachbarn aus dem Haus Nr. 47.
„So wie wir alle ausbluten. Sogar die Steine lösen sich auf, so wie alles sich langsam auflöst“.
Ich verstand nichts. Die Trümmer waren doch prima Spielplätze. Die alte Frau, meine Oma, strich sich mit ihrer mageren Hand eine graue Haarsträhne aus dem Gesicht. „Was soll bloß werden“, murmelte sie vor sich hin. Sie konnte mir keine Schulbrote mitgeben, nichts zu trinken. „Heute gehe ich runter zum Einkaufen, mal sehen was wir bekommen. Irgendwas haben die bestimmt. Wenigstens Brot und Schmalz, vielleicht hat Schlachter Remmel Wurst. Nimm man einen Apfel mit, hörst du?“ „Nee, Oma, die sind so schrumpelig und schmecken faul. Die sind zu alt, ich muss nichts essen. Lass man.“ Ich hüpfte aus der Küche. Sie lachte tonlos auf und rief in den langen Flur hinein: „Dann lass man gut sein. Opa holt heute vielleicht Birnen.“ Am großen Herd, der noch nicht brannte, weil nichts zum Kochen und Essen im Hause war, hatte ich so wie jeden Morgen gesessen. Rechts an der immer noch, um diese Jahreszeit unangenehm warmen Herdplatte und hatte Haferschleim unwillig in mich hinein gelöffelt. Hoffentlich bekommt sie etwas essen, dachte ich völlig in mich zurückgezogen. Ganz einfach, dachte ich, heute haben sie nichts zu essen im Haus, das hatte ich gehört, aber nicht verstanden. Wir mussten doch leben. Unbewusst schüttelte ich den Kopf. Lachend stolperte ich den langen Flur weiter.. Drehte mich aber zur Küche um. Auf dem Bord über der Küchentür standen so vciele Gläser mit Bohnen, Erbsen, Birnen und Apfelmus standen. Wieso hatten wir nichts zu essen? Drei Jahre und gut zwei Monate nach Kriegsende, Im Juni 1948 hungerte meine Familie und alle die ich kannte nicht wirklich. Wir hatten unseren Garten. Da wuchs immer was. Sogar Kaninchen, die Hühner gaben Eier, manche voll gekackt. Aber sie redeten immer davon und vom Winter, das machte mir Angst. Ich wollte nicht hungern und frieren. Vom letzten Treppenabsatz rutschte ich auf dem Treppengeländer fast vor die Haustür. Auch das war verboten, und wenn schon. In der Küche hatte sich die Familie überall gemütlich eingerichtet. Der große Herd, direkt gegenüber der Tür zum Flur das rote Sofa, davor der Tisch mit dem Wachstuch, rechts der alte Küchenschrank, der schon so oft gestrichen worden war. Jetzt, in diesem Sommer leuchtete er in lindgrüner Ölfarbe. In der linken Eisblumenscheibe Oma schrie aus der vierten Etage hinter mir her: "Nicht auf dem Geländer rutschen. Du fällst noch runter." "Ja Oma," schrie ich zu ihr hoch. Die blöde Haustür mit der zersprungenen Scheibe ließ sich viel zu schwer öffnen. Meine Schule in der Lutherothstraße, lag nur wenige Minuten von unserer Wohnung entfernt. Die damals, ein Jahr nach Kriegsende, rechtzeitig zum Schulbeginn eröffnet wurde. Die großen Jungn Joachim aus der Wohnung ganz unten im Parterre und Hans Rohr aus der Wohnung neben uns, Annegret und Ilona hatten mir davon erzählt. Damals war ich noch zu klein, um das alles mit zu bekommen. Ich spielte in den Trümmern, aus denen viele Frauen die Steine abklopften. Sommerferien gab es damals in den beiden ersten Nachkriegsjahren auch nicht. Es gab zu wenige Schulen. Schichtunterricht hieß das damals. Gut, dass ich jetzt zur Schule ging, wenigstens hatte ich Ferien. Wir Kinder hatten viel zu lernen, vor allem wie man überlebt .„Habt ihr heute Schwedenessen?“ Ella aus dem Nachbarhaus hüpfte neben mir über die Schwenkestraße. "Weiß ich nicht," dabei warf ich einen Mauerstein in den zerbombten Tiefbunker vor uns. Ganz unten hörte wir Wasser aufspritzen. Ilona kam ganz dicht zu mir :"Meinst du, da unten sind Ratten?" "Klar was meinst du denn, ganz fette." Ich nahm ihre Hand. Fühlte sich gut an. Nach zwei Schulstunden stand ich wieder in unserer Küche. Es gab auch in der Schule nichts zu essen. Wir wurden einfach entlassen, schulfrei. Unser Leben spielte sich in eben dieser Küche ab. Seit Anfang Mai 1946 öffneten die meisten Schulen, die nicht zerbombten. Ein Jahr später war es für mich endlich so weit. Ich wollte zur Schule. In kurzer Hose, weißem Hemd und einer großen Schultüte stand ich auf der Treppe vor der Schule. Meine Tante Anneliese machte Fotos. Endlich, ich freute mich sehr endlich Schüler und nicht mehr Kind zu sein. Jedenfalls beim Spielen auf der Straße oder in den Trümmern der umliegenden Häuser. In meiner Klasse waren wir bis jetzt nur vierzig Schüler, hatte ich stolz meiner Großmutter nach dem ersten Schultag berichtet. „Weißt du, bei Uwe haben sie sechzig in der Klasse. Das weiß ich, weil wir auf die gleiche Schule gehen. „Oma hörst du zu“. Ich blickte zu ihr "Wo ist Opa? Arbeiten?" "nee Junge, der schläft. Gestern in der Nacht war er mit Nachbarn zum Kohlen holen." Beinahe jeden Abend unterhielten sich die Erwachsenen in der Küche über das was sie in den Nächten machten. In Eidelstedt, auf dem großen Rangierbahnhof, klauten sie Kohlen für den kommenden Winter zusammen. Unser Kleingarten lag nur wenige hundert Meter davon entfernt. Das war praktisch. Wenn es gefährlich wurde, wenn zu viele englische Soldaten die Kohlentransporte absicherten, zogen sich die Männer in unser Gartenhaus zurück. Ich wollte dabei sein. Schließlich war ich jetzt Schüler. Herr Hansen, unser Nachbar aus der Wohnung zwei Stockwerke tiefer, sprang auf den langsam fahrenden Zug, kletterte auf den Kohlenberg im Waggon hinauf, warf Kohlenbrocken herunter. Die anderen Männer und Frauen warteten eng an den Bahndamm gepresst, bis die roten Lampen am Ende des Zuges verschwunden waren. Die dreißig Zentimeter von den Kanten der langsam vorbei rollenden Waggons mussten reichen. Sonst wären sie selbst im trüben Licht der Laternen auf dem Eisenbahngelände zu sehen gewesen. Ihre Gesichter und Hände hatten sie mit Kohlenstaub aus ihren Beuteln und Taschen geschwärzt. So konnten sie sicher sein, dass die britischen Soldaten nicht auf sie schossen. Weil sie eben unentdeckt blieben. Oft schossen die nur so in die Luft. Hansen sprang dann vom Waggon ab, rollte sich den Bahndamm hinunter und kam zu seinen wartenden Bekannten und Nachbarn zurück. Da wollte ich mitmachen. Wie oft ich meinen Opa bedrängte,weiß ich nicht mehr, aber ich muss sehr genervt haben. "Warte ab, Junge, du kommst schon noch mit." Alle benötigten dringend Kohlen für den bevorstehenden Winter, vor dem sie Angst hatten. Ich verstand das nicht. Wir hatten es immer schon warm, wenigstens in der Küche. Jeden Abend unterhielten sich die Männer über nichts anderes. Vor dem Winter hatten sie echt Angst. Wenn Hansen zurückgeschlichen kam, dann passte immer jemand auf, ob nicht versteckte Soldaten auf sie warteten und schossen. Manchmal robbten sie auf die andere Seite der Gleise. Ende August meinte mein Opa beiläufig, ohne von seiner Zeitung aufzusehen: "Zieh dich an Junge, ab jetzt kommst du mit. " Es war so weit. Ich strahlte. Immer wieder nahmen die Erwachsenen uns Kinder mit zum Kohlen klauen. Die Soldaten schossen nicht auf Kinder. Und, am nächsten Tag gingen wir nicht zur Schule, die Nächte waren einfach zu lang und anstrengend, aber aufregend. Ich fand das jedenfalls. Nur später nackt in der Küche, in der blöden runden Zinkwanne zu stehen und mich abwaschen zu lassen, mochte ich nicht. Ich guckte immer in die Luft und hielt still. Einen Nachbarn, Werner Bleifink sahen wir eines Tages nicht wieder. Plötzlich, vor einem Monat, war unser Mitbewohner oben auf dem vorbei rollenden Kohle-Waggon zusammengebrochen. Ein Schuss musste ihn erwischt haben. Der Zug fuhr weiter. Niemandem gelang es auf den schnell rollenden Waggon aufzuspringen. Ich zerrte unsere Kohlentasche den Bahndamm herunter in einen Fliederbeerenbusch. Wir alle mochten den mutigen Mann sehr. Der war sehr freundlich zu uns Kindern. Und vorlesen konnte der, echt gut, so mit Betonung. Und manchmal lachte der so lustig:
„Die Nazis habe ich als Jude überlebt, jetzt werde ich das mit den Tommys auch noch hinkriegen. Und dann, irgendwann geht es uns wieder besser.“ Wir Kinder verstanden nichts. Und die Erwachsenen fragen, das ließ man lieber. Die hatten keine Lust auf Kinderfragen. Aber sie wussten, dass Blei, wie wir unseren Freund nannten, in einer Gartenlaube in Eidelstedt viele Jahre versteckt gewesen war. Das hatte ihn vor dem KZ gerettet, wie ich am nächsten Abend am Küchentisch hörte. Ein paar Tage später fragte ich meinen Opa, was ein Jude ist und wann man ins KZ kommt. Niemand, auch er nicht, antwortete. Kinderfragen eben. Sie schickten mich ins Bett. Mit vierundzwanzig Jahren starb der junge Mann auf einem Kohlen-Waggon. Genau in der Gegend Hamburgs, in der er sich so lange vor den Nazis versteckt hatte. Ich saß so manchen Abend unter dem Küchentisch, hörte den Erzählungen der Erwachsenen mit roten Ohren zu. Was die über die Juden erzählten, verstand ich nicht. Nur traurig wurde ich, weil damals auch Kinder aus dem Nachbarhaus plötzlich verschwunden waren. Wenn ich meine Oma fragte, wo die Judenkinder hingezogen seien, zuckte die nur mit den Schultern. "Frage mich nicht, Junge." Kinderfragen eben. Heute saß sie an der rechten Ecke des großen kalten Küchenherdes: Sie sah mich fragend an: „Ja Oma, wir hatten kein Schwedenessen. Und Lebertran auch nicht. Ekelhaft. Wir haben schulfrei.,“ ich blickte zu ihr hinüber, weil ich genau wusste, was sie sagen würde.
„Du kannst gerne unten spielen Junge. Sei vorsichtig in den Trümmern, bleib lieber auf der Straße.“ Ich verdrehte die Augen nach oben. Die ewigen Ermahnungen meiner Großmutter nervten. Um ihre Enkel kreisten ihre mütterlichen Gedanken tagein tagaus. Sie hatten als Familie mit zwei kleinen Kindern die Kriegsjahre und einen Abschnitt der Nachkriegszeit gemeistert, ja überlebt. Jetzt hieß für sie und meine Familie an die Zukunft zu denken. Großvater Max kam verschlafen, mit krummem Rücken in die Küche geschlurft: „Ein bisschen zu warm, hast du es hier. Das tut richtig gut. Du bist immer so früh hoch und fleißig. Meine Gute.“ Meine Oma drehte sich um. Ihr warmes Lächeln, ihr liebevoller Blick zauberten einen Hauch von Zufriedenheit in das Gesicht meines Großvaters. Sehr kurz nur, kaum merkbar. Die Nazizeit und der Krieg hatten zu tiefe Furchen auf seiner Seele, in seinem Gesicht hinterlassen. Er griff zu der braunen Steingutkanne, die immer rechts auf dem Herd stand. Beherzt nahm er einen großen Schluck vom Ersatzkaffee direkt aus der Tülle.Erst als er den Kaffeesatz auf der Zunge spürte, setzte er ab. „Nimm doch eine Tasse, wie oft habe ich dir das gesagt. Wenn die Jungen das machen, meckerst du rum.“ Oma Hinrichs sah böse zu ihm hinüber. Er setzte sich auf den Stuhl, von dem ich gerade aufgesprungen war: „Heute drücke ich dich nicht Opa, du bist nicht rasiert. Und Muckefuck hängt dir im Bart. Wir haben schulfrei.“ Lachend lief ich aus der Küche, verschwand im Flur. Die beiden Alten hörten die Wohnungstür ins Schloss fallen. Ich war weg, jetzt hofften sie , dass ich gesund zurückkommen würde. Das wußte ich, weil ich es zu oft gehört hatte. Nach einer halben Stunde, ich wartete auf Rolf und die Mädchen aus unserem Haus, packte mich mein Großvater am Arm, drehte mich zu sich herum: „Bleib du hier. Ich gehe alleine einkaufen, wenn ich was kriege. Um eins bin ich wieder zurück. Irgendetwas Essbares werde ich schon finden. Danach fahre ich zum Garten. Du bleibst hier. Oma kommt auch runter. Wenn reifes Obst da ist und nichts geklaut wurde, bringe ich Birnen mit. Sag Oma, sie soll heute Abend Birnen kochen. Sei vorsichtig in den Trümmern. Das ist gefährlich." Ich lachte. Es begann zu regnen "Vielleicht kommt ein Gewitter, dann gehe rein, hörst du." Mein Opa schrie über die Schulter zu mir zurück. So wie jeden Tag, fuhr er zu unserem Kleingarten. Erst den Eidelstedter Weg hinauf, dann verschwand er in Richtung Hagenbeck Allee. Mir fiel auf, wie dünn mein Opa war. Keine Hose passte richtig. Alle Hemden und Jacken schlotterten an ihm herunter. Jahre Später erfuhr ich warum der Mann so krank und fertig aussah. Die vielen Verhöre, die Folter in den Kellern der Gestapo und der wochenlange Aufenthalt im Konzentrationslager Hamburg-Neuengamme waren nicht spurlos an ihm vorbei gegangen. Immer noch schlief er oft sehr unruhig, manchmal schrie er laut auf oder murmelte im Schlaf vor sich hin. Ich schlief ja mit im Schlafzimmer der Großeltern. In dem Extrabett in der Ecke neben dem Kleiderschrank. Zu seiner Partei der SPD stand er felsenfest, immer noch. Irgendwie war meine Großmutter stolz auf ihn, auch wenn sie seinetwegen viel Angst ausgestanden hatte. Manchmal hörte ich sie murmeln: „Wie klapperdürr er geworden ist. Mein Gott, hoffentlich wird er uns nicht krank. Nach allem was der Mann durchgemacht hat.“ mit Tränen in den Augen schlich sich Oma dann in die Küche. Heute brauchte sie keine Kohlen nachzuwerfen. Sie wollte ja nur kochen, nicht heizen. Und Birnen, ja Birnen würden nicht viel kochendes Wasser benötigen, um gar zu werden.
“Und wenn er Birnen mitbringt, Mehl für Klöße gibt es in unserem Haushalt nicht mehr. Ich muss unbedingt welches besorgen,“ ihre Gedanken flogen von einem Einkaufsladen zum nächsten. Es musste ihr etwas einfallen, um Mehl zu bekommen. Sie setzte sich neben den Herd, stützte leise schluchzend den Kopf in die Hand und starrte aus dem offenen Fenster zum Hof. Erschrocken blickte sie nach unten auf die Fliesen vor dem großen, schwarzen Küchenherd. Ihr zweijähriger Enkel Lothar krabbelte zu ihr hin. Er zog sich an der geblümten Kittelschürze an ihr hoch. Draußen war es warm, aber es roch nach Regen, die Trümmer der Nachbarhäuser stanken in der warm feuchten Luft nach Verwesung. „Ich muss endlich einkaufen gehen, Mehl muss ich haben. Das wird es wohl irgendwo geben. Ohne Mehl komme ich nicht zurück.“ Oma zog ihre Kittelschürze fester zusammen, band sich ein geblümtes Kopftuch über die weißen Haare, nahm ein Einkaufsnetz vom Haken neben der Kaffeemühle am Küchenschrank, warf einen kurzen Blick in den fleckigen Spiegel in der brauen, leicht abgestoßenen Flurgarderobe und verließ die Wohnung, den kleinsten Enkel an der Hand hinter sich herziehend. Noch hatte sie ausreichend Nahrungsmittelkarten, die die Engländer in Hamburg Ende 1945 ausgegeben hatten. in der rechten Tasche ihrer Bluse, die sie unter der Kittelschürze trug, fühlte sie schnell nach den Marken. Angezogen hatte den kleinen Jungen seine Mutter Anneliese, die im vorderen Zimmer mit ihm wohnte und bereits vor sechs Uhr in der Frühe in die Fabrik zur Arbeit am Fließband aufgebrochen war. Immerhin trug sie mit einem erheblichen Teil ihres Monatslohnes zum Lebensunterhalt der Familie bei. Sie brachte im Monat ungefähr einhundertvierzig Reichsmark nach Hause. Das war damals viel Geld. Aber sie arbeitete ja auch mehr als fünfundvierzig Stunden in der Woche. Stand sie mehr als zwölf Stunden am Band um Tuben zu verpacken, verdiente sie etwas mehr. Ihren Rücken spürte sie dann kaum noch. Sie war froh, dass die Fabrik nur zehn Minuten von der Wohnung entfernt lag. Und gutes Essen gab es mittags kostenlos für alle Mitarbeiter. Auch ihr Vater, mein Großvater , aß mittags immer in der Fabrik. Mein Cousin und ich freuten uns abends auf Hasenbrote, die tagsüber nicht gegessenen, mit Margarine und selbst gekochter Marmelade bestrichenen Brotscheiben. Jeden Abend brachten entweder Anneliese oder der Opa in ihren Blechdosen welche zurück. Um diese Hasenbrote stritten mein Cousin und ich uns immer, weil die Rinde abgeschnitten war. Wir mussten nicht viel kauen. Sollten wir aber, immer viel kauen wegen der Zähne. Opa hatte große Probleme mit seinen klappernden Zahnprothesen. Sah echt lustig aus. Wenn wir darüber lachten, zog er uns schon mal an den Ohren, wenn er uns zu fassen bekam. In der zweiten Pause rannte ich mit meinem Freund Uwe Rohr durch die langen, dunklen Flure unserer Schule. Die „Henkelmänner“, unsere Blechtöpfe mit Henkel, flogen hin und her „Langsam Kinder, langsam. Jeder bekommt etwas. Langsam, Jungens!“ Frau Pfeilschmidt, unsere rundliche, immer im Gesicht rosige Bio-, Mathe- und Deutschlehrerin ermahnte uns, so wie jeden Tag. Aus der von Bomben unbeschädigt gebliebenen Turnhalle duftete es nach leckerer Milchsuppe, wie an den meisten Schultagen. Wie immer drängten wir uns wuselnd, schubsend zu der breiten Eingangstür durch. Wir Jungen in kurzen Hosen schoben die Mädchen einfach zur Seite, bis Frau Pfeilschmidt sich den größten Schreihals griff und ihn am rechten Ohr ganz ans Ende der Schlange zog. Jetzt lachten alle Mädchen. Auf deren, vom vielen Waschen schon leicht grau gewordenen, ehemals weißen Kleidern ließen sich die bunten Blumenmuster nur noch erahnen. Und sie warten viel zu kurz geworden. Wenn die Mädchen auf dem Schulhof hin und her rannten lachten wir sie oft aus, weil ihre Unterhosen unter den zu kurzen, hochfliegenden Kleidchen hervorlugten. Eigentlich hatten wir Jungs und die Mädchen kaum noch Kleider, die richtig passten. Alles wurde zu klein, zu kurz, zu verwaschen und zu geflickt. Jetzt, da wir wieder zur Schule gingen, besonders an dieser traditionellen Schule, mussten wir Kinder sauber aussehen. Das wurde kontrolliert. Unsere von so manchem Regen durchweichten, ehemals weißen Socken lagen dann ausgewrungen unter unseren Schulpulten zum trocknen. Beim täglichen Schwedenessen, wenn wir Schüler unsere Milchsuppe und den schrecklichen Löffel Lebertran bekamen, achteten die netten Frauen, mit den Rote-Kreuz-Zeichen an den weißen Blusen und Hauben, auf die gewaschenen Hände, auf saubere Beine und Knie. Manchmal griffen sie sich jemanden von den Kinder, immer einen von uns Jungens und guckten in unsere Ohren. „Bei dir kann man Petersilie säen...“, wenn diese Bemerkung von einer der Frauen kam, mussten wir unsere Namen in eine Liste schreiben. Am nächsten Tag wurden wir aufgerufen, die Ohren wieder kontrolliert. Das war ja so peinlich. Zur Entlausung brauchten wir nicht mehr. Das war Gott sei Dank vorbei. Aber, wenn die Lehrer oder die Schwestern vom Roten Kreuz merkten, dass sich jemand immer wieder kratzte, wurde kontrolliert. Mit Läusen durfte niemand in die Schule. Meine Oma wusch mir und meinem Cousin die Haare mit Salmiakgeist gegen die Quälgeister. Das roch schrecklich, half aber sehr gut. Alle Kinder wussten das. Das war immer noch besser als nackt in der Entlausungskabine draußen auf dem Schulhof zu stehen. Dann stanken unsere Haare, Haut und Anziehsachen immer so nach Desinfektionsmittel. Die Großmutter ermahnte jeden Tag ihre schon bald dreißigjährige Tochter, den Großvater und die Enkelkinder, bevor diese die Wohnung verließen. „Deine Kleider und deine Schlüpfer müssen sauber sein. Das ist wichtig! Es kann ja immer mal was sein. Sonst kommt niemand aus dem Haus.“ Fröhlich lachten wir dann: Wir sind sauber, das siehst du doch!“ Manchmal nahm ihre Tochter die Mutter in den Arm.
„Du machst dir zu viele Gedanken. Es wird schon wieder besser mit unserem Leben.“
„Wie groß und vernünftig sie geworden ist“, nachdenklich schloss Elfriede Kruse an solchen Tagen hinter ihrer Tochter die große, schwarz gestrichene Wohnungstür. Ein langer Riss unterbrach mit seiner gezackten Linie das Eisblumenglas in der rechten Scheibe. Jeden Tag erinnerte dieser Sprung im Glas an den letzten Bombenangriff. Von ihrer Familie verließ niemand die Wohnung, ohne anständig „Auf Wiedersehen“ gesagt zu haben. Niemand ging ohne die Bemerkung nach draußen, nie. Die vergangenen zwölf Jahre mit den Nazis hatten Ängste hinterlassen, gerade an der Wohnungstür und bei Geräuschen im Treppenhaus. Sie hatten viel gehört. Jeder kräftige Schritt, jedes Klopfen an Wohnungstüren, jedes laute Gespräch schallte hinauf bis vor unsere Wohnung im vierten Stock. So oft hatten die Großeltern nicht über die letzten Kriegsjahren gesprochen. In Haus hatten alle Bewohner schreckliches erlebt. Verhaftungen, Durchsuchungen und Bombenangriffe, die die Nachbarhäuser in Schutt und Asche legten. Über genaue Einzelheiten schwiegen sie immer noch. Ich verstand nichts. Dass nun alles vorbei sein sollte, konnten beide nicht so recht glauben. Und was war mit den Tommys in Hamburg. Manchmal hatten sie auch vor denen Angst. „Das sind die Uniformen“, meinte Opa Max beim gemeinsamen Abendessen zu seiner Frau und blickte dabei seine Tochter Anneliese und die beiden Enkel an .“Weißt du, die Uniformen kriegen wir nicht aus dem Kopf.“ Neben der Haustür klebte immer noch der Aufruf der britischen Besatzer über die neuen Regeln und Gesetze nach dem Ende der Nazizeit. Die Anweisungen an die Hamburger, mussten strickt eingehalten werden. Mein Großvater hatte die von seiner Arbeit mitgebracht, damals, als endlich das Dritte Reich zu Ende war und die britischen Truppen Hamburg übernommen hatten. Oma bat ihn oft den Aufruf abzunehmen. „Mache ich, irgendwann mache ich das weg. Aber lass man, wenn die Tommys, für die ich jetzt arbeite, mal nach oben kommen. Die sehen dann, dass wir uns an ihre Anweisungen halten. Die geben in er Fabrik den Ton an. Vorsicht ist besser.“ Seine Frau gab dann Ruhe. Sie wusste, dass ihr Mann Recht hatte. Wenn er weiter als Fachmann für Industriemaschinen bei Beiersdorf arbeiten wollte, musste er sich mit den Besatzern gut stellen. Fachleute fehlten in Hamburg, das wusste er. Er war in seine derzeitige Aufgabe hineingerutscht, weil er schon vor dem Krieg in diesem chemischen Betrieb als gelernter Schlosser und Ingenieur gearbeitet hatte. Von seiner Arbeit, von anderen Einzelheiten, die er auf seiner Arbeit erfuhr, erzählte er weder seiner Frau noch seinen Freunden aus der Sozialdemokratie etwas . Major Hillery, der Kontaktoffizier der Engländer in seinem Betrieb hatte ihn vor einiger Zeit gefragt: „Was wissen Sie von Bad Nenndorf, Mann.“ Überrascht hatte Großvater von seinen Papieren aufgesehen: „Nichts, Sir, nichts!“ Lange hatte ihn der Offizier angesehen. War dann plötzlich im anderen Zimmer verschwunden. Bevor er die schwere Eichentür hinter sich zuschlug, drehte er seinen Kopf zu Großvater um: „Gut so. Besser Sie wissen nichts.“ Der Großvater erzählte mir vieles aus dieser Zeit Jahre später.. Irgendwie hatte er es geschafft, aus einigen seiner SPD-Parteifreunde etwas über die englische Besatzungsmacht heraus zu bekommen. Sie wussten von Bad Nenndorf und dem Wincklerbad. Die paar Sätze, die sie preisgaben, reichten ihm. Er arbeitete schließlich unter Aufsicht der Tommys. Von Folterzellen und Todesfällen, von verhungerten Deutschen wollte er nichts mehr hören. Auch wenn das höhere Beamte und Parteimitgliedern bei den Nazis gewesen waren, die dort gefangen gehalten wurden. Angst hatte er jedoch immer. Er konnte die Engländer nicht einschätzen. Jeden Tag kam die Angst in ihm hoch, Fehler zu machen. Diese Angst beherrschte den Alltag der Großeltern. Und, deren Angst setzte sich in meinem Kopf als dunkle Wolke fest. Selbst heute, viele Jahrzehnte später, habe ich immer noch keine Klingel an meiner Haustür. Angstträume von Gefangenschaft in Konzentrationslagern, die hohlen Gesichter von Häftlingen erinnern mich immer wieder in meinen Träumen an meinen Großvater. Sein Aufenthalt im KZ Hamburg-Neuengamme hatte ihn gezeichnet. Unsere kleine Familie hatte von seiner Arbeit in der Nivea-Fabrik Vorteile. Oft genug kam er mit einem Paket zurück, das ihm britische Offiziere zusteckten. Immer enthielten die Brot, Fett und auch Milchpulver für die Enkelkinder. Manchmal, besonders zum Wochenende, auch Wurst oder Fleisch. Das war schon gut so, aber die Angst blieb. Großvater Max wurde langsam von seiner Angst geprägt. Von den Verbrechen, von den Unmenschlichkeiten der NS-Zeit hatte er gewußt, in der Öffentlichkeit jedoch geschwiegen. Und dennoch, ich erinnere mich an Kinderfeste der SPD in Hamburg Eimsbüttel. Bei Fraskati, einer Gaststätte traf man sich. Wir Kinder wurden zu bestimmten Festen mitgenommen. Das hat sich bei mir eingeprägt, weil es dort immer lustig zu ging. Kinder bekamen Schokolade oder Bonbons, Kakao und manchmal einen neuen Pullover oder die schrecklich kratzenden langen Strümpfe. Jahre später erfuhr ich, dass dieses Lokal in der NS-Zeit als Versammlungslokal der SPD diente. Als Kaninchenzuchtverein getarnt. So manchen Abend konnte mein Opa nichts mehr essen. Die Abendstunden, im Kreis seiner Familie, die Hausaufgaben mit mir, die belanglosen Gespräche mit seiner Tochter, aber auch seine Frau an seiner Seite zu wissen, ließen ihn nicht verzweifeln. Er war fest entschlossen, die Zukunft seiner Tochter Anneliese und der Enkelkindern mitgestalten zu wollen. „Sie soll nie das durchmachen, was wir überstanden haben. Nie!“ Fest entschlossen sah er dabei seine Frau an. Den Satz wiederholte er oft.
„Was können wir sonst auch machen“, hatte er hinzugefügt. „Die Kinder sind unsere Zukunft.“
„Zeig mal deine Zunge“, die rundliche Rote-Kreuz - Schwester blickte mich fest an: „Raus damit, mach' schon und den Kopf zurück.“ „Ähhh“, automatisch streckte ich meine Zunge raus und legte den Kopf in den Nacken. „Gut so, Mund auf“, der Löffel mit Lebertran wackelte ganz leicht vor meinem Mund. „Runter damit und dann weiter gehen!“ Das war erledigt. Ich freute mich jetzt auf die heiße Milchsuppe. Heute gab es sie mit Mehlklößchen. Uwe mein Freund trottete hinter mir her: „Man ist das ekelig,“ wir sahen uns an, schüttelten uns und lachten. „Aber gesund, sagt mein Vater immer.“ „Ja, das sagen sie immer, wenn was ekelig ist.“ Dann blickten wir in unser Blechgeschirr, zogen den Eisenlöffel von Rand ab, wischten ihn schnell an der Hose ab.
„Lecker heute, so mit den Klößen. Was machst du am Nachmittag?“ Uwe sah mich an. „Nichts und du?“ „Erstmal Schularbeiten, dann, ich weiß nicht?“ „Kommst du mit zum Weiher? Meine Oma kommt vielleicht mit.“ „Klar, gut, wenn es nicht regnet.“ Wir lachten und alberten weiter, verabredeten uns so um drei im kleinen Park an Badeteich, dem Weiher. Unten, da wo Beiersdorf anfing, da wo sich fünf Straßen verknäuelten, da lag unser Spielpark, mit Badeteich und dem kleinen Strand. Nur vor den schwarzen Blutegeln im Schlamm mussten wir uns vorsehen. Wenn es irgendwo zwickte, schwammen alle Kinder schnell zurück an den Strand. Oft hing dann ein schwarzer Wurm an den Beinen oder am Körper.
„Die sind zwar etwas ekelig, aber nicht gefährlich. Früher wurden die vom Arzt angesetzt, wenn jemand zu viel Blut hatte.“ Opa Max wusste einfach alles. Ich war sehr stolz auf ihn. An diesem Tag rannten wir so gegen drei Uhr hinkend und hüpfend über die Lutterothstrasse nach Hause. Uwe winkte zurück: „Ja, bis bald.“ Ich bummelte zum Eidelstedterweg und verschwand in Nummer siebenundvierzig. So wie fast jeden Tag. Immer wenn ich aus der Schule kam und nicht direkt zu unserem Schrebergarten gehen musste, weil seine Großeltern dort auf ihn warteten. Der Rest des Sommers verging viel zu schnell. Jeden Tag ging oder fuhr einer von ihnen zu unserem Garten zum Ernten. Äpfel gab es reichlich, Boskop, Cox, Celler Dickstiel, diese Sorten hielten sich bis zum nächsten Frühjahr. Kartoffeln und Wurzeln ließen wir in Kisten mit Laub und alten Jutesäcken gegen Frost geschützt im Kaninchenstall stehen. Eine große Zinkwanne mit Zuckerrüben schleppten wir im Herbst zu Fuß nach Hause. Fast eine Woche stank es in der ganzen Wohnung nach gekochten Rüben. Erst dann war der wunderbar süße Zuckersirup fertig. Über dem Herd hingen in langen Reihen Apfel- und Birnenscheiben und auf dem Bord über der Küchentür stapelten sich die Einmachgläser mit Bohnen, Erbsen, Birnen, Grünkohl, Kirschen und Pflaumen. Aus den Zwetschen hatte die Großmutter fast schwarzes Mus gekocht. Tante Anneliese half ihr, wo sie nur konnte. Manchmal murmelte sie vor sich hin: „Was würde ich bloß ohne das Kind machen. Sie ist eine so große Hilfe“. „Pass aber auf; sie soll ihre Arbeit nicht vergessen. Ab nächste Woche bin ich auch wieder mehr zu Hause.“ Beide waren sehr froh, dass jetzt, kurz vor dem Winter, Großvater Max wieder in seinem alten Beruf als Meister arbeiten konnte. Ende September hatten ihm die Engländer, nicht zuletzt wegen seiner Tochter und Enkelkinder genehmigt, als Meister mit Führungsaufgaben zu arbeiten. Der Direktor stellte ihn sofort ein, als seine Papiere geprüft waren. Sie kannten sich flüchtig aus der SPD. Großmutter umarmte ihn mit Tränen in den Augen, als er ihr so ganz nebenbei von diesem neuen Anfang erzählte. „Jetzt wird alles gut“, hatte sie ihm ins Ohr geflüstert. „Und gleich bei uns um die Ecke, Beiersdorf kennst du doch wie deine Westentasche. Mensch haben wir Glück.“ Seine Tochter Anneliese fiel ihm um den Hals, als ihre Eltern abends die neue Arbeit ihres Vaters erwähnten. Jetzt war wenigstens diese Arbeit gesichert. Er hatte nun ebenfalls die Möglichkeit seine Tochter langsam in bessere Arbeit zu bringen, weg vom Fließband. Ihre Tasse mit Maggibrühe stieß sie fast um, als sich meine Tante Anneliese über den Küchentisch beugte. „Mensch Papa, gratuliere, jetzt bist du endlich wieder der Maschinenmeister. Bitte erkläre mir alles. Ich will weiter kommen. Endlich bist du nicht mehr bis nachts auf der Arbeit.
„Und wenn ich Schichtdienst habe?“ Opa Max lachte seine Tochter an. „Dann bist du nur von mittags bis sechs Uhr abends weg. Prima, oder?" "Ja, prima, " er sah zu mir herunter: " Du hast genug zugehört.“ Großvater gab mir liebevollen Klaps auf den Po. Mein zwei Jahre jüngere Cousin schlief bereits im vorderen Zimmer. Ich sah noch wie meine Oma langsam ihre Hand über das geblümte Wachstuch schob. Als sie die knochige Hand ihres Mannes zart berührte, sah er von seinem Buch auf, lächelte seine Frau an. Sorgfältig schob er ein Stückchen Zeitung als Lesezeichen zwischen die Seiten und legte sein Buch auf das alte durchgesessene, mit roten Plüsch bezogene Küchensofa neben sich: „Ja Frau, jetzt ist wohl die Zeit gekommen wieder zu glauben, dass es weiter geht.“
Seufzend drückte er die Hand seiner Frau. „Jetzt, diesen Winter noch, dann geht’s bergauf. Die Kinder brauchen uns, wir müssen sie immer unterstützen. Sie sind unbelastet. Das siehst du an Anneliese!“ „Ja, sie strahlt so was Freundliches aus. Nichts ist ihr zu viel, wenn das man so bleibt.“ „Wir müssen daran arbeiten. Unsere Jüngste haben wir seit langem verloren. Die geht ihren Weg allein, gut oder schlecht. Das ist nicht mehr unsere Sache. Auf die Jungs müssen wir aufpassen, besonders der Große, der kriegt zu viel mit.“ Beide blickten starr, sehr nachdenklich auf das geblümte Wachstuch ihres Küchentisches. Müde stand Opa Max auf. Die Hand seiner Frau zog er über den Tisch, ließ sie nicht los. Mit meinen zehn Jahren schlief ich immer ruhig und geborgen auf dem flachen Sofa im Schlafzimmer meiner Großeltern. Zwischen dem braunen, mit einer Krone verziertem Kleiderschrank und der Wand am Fenster, direkt an der Wand zur Toilette. Jeden Abend stellte ich mich schlafend, wenn Großmutter vorsichtig die Gardine zurück zog, nur um zu prüfen, ob die Fensterklappe offen war. Jetzt, in dieser Jahreszeit kühlte es nachts kaum noch ab. Und doch, so manchen Abend unterhielten sich die Erwachsenen über nichts anderes als den kommenden Winter. Ich verstand nichts. Bei uns wurde immer gut geheizt, der Küchenherd glühte dann. Und zu essen hatten wir genug. Unser Garten gab es genug Obst und Gemüse, Kaninchen und Hühner, meinte ich jedenfalls. Aber, da schlich sie sich wieder ein, die Angst vor Kälte. War es nicht die Angst vor den Nazis, den Besatzungssoldaten, der Arbeitslosigkeit, so hatte alle wenigsten die Angst vor Kälte. Das verstand ich, deshalb begann ich mich vor Kälte zu fürchten. Bis heute, über sechzig Jahre später, begleitet mich diese Angst. Es gab einfach zu wenig zu kaufen. Zu wenig Lebensmittel, zu wenig Kohle, zu wenig warme Sachen zum Anziehen. Die Einkaufsmarken der Engländer halfen nichts, wenn es einfach keine Ware in den Läden gab. Mit leichter Hand zog und schob sie meine Bettdecke etwas zurecht. Als sie die Tür leise öffnete, um nochmals in die Küche zu gehen schlüpfte ihr Mann vor Kälte bibbernd ins Schlafzimmer. „Ich wärme schon mal das Bett an.“ Heute schloß er die Tür hinter sich. Die Großmutter blickte ihn verwundert an. Das hatte er seit Jahren nicht mehr getan. Immer alles offen lassen, hatte ihr Mann immer gesagt, dann hören wir wenn im Treppenhaus Stiefel auf der Treppe poltern. Sie kuschelte sich später an ihren Mann. Ganz eng, ganz fest. Als er sich über sie beugte, sie zärtlich küsste, als er zwischen ihren Beinen lag und sie liebte, wusste sie, dass eine neue Zeit angebrochen sein musste. Seit Jahren, seit der Krieg mit Russland 1941 begann, hatten sie sich nicht mehr geliebt.
Die Angst war zu groß gewesen. Und Bombennächte zerstörten Sehnsüchte. Ruhig und zufrieden schliefen beide an diesem späten Abend ein. Leise klapperte der silbrige Metallschlauch des alten Staubsaugers. Immer dann, wenn ich mich im Schlaf umdrehte und mit den Armen herumfuchtelte. An einem Haken über meinem Bett hing diese Schlange, in die ich so gern hinein blies. Das Geräusch erinnerte mich an das Trompeten der Elefanten bei Hagenbeck. Im Schlaf träumte ich dann von den fernen Ländern in Afrika, von denen Großvater Max so oft erzählte. Als Maschinist auf Schiffen der Hamburg-Süd-Reederei befuhr der vor dem Krieg die Westküste Afrikas. Viele bunte Postkarten von seinen Besuchen in Dörfern an der afrikanischen Küste und besonders der echte Stoßzahn eines Elefanten regten meine Fantasie sehr an. Besonders ein Handspiegel, der mit Leder von einem Haifisch oder einer Eidechse bezogen war, regte meine Fantasie an. Er lag als rätselhafter Zauberspiegel auf der großen Schlafzimmerkommode. Nie wurde geklärt von welchem Tier das Leder wohl stamme. Und wenn man hinein sah spiegelte sich eine Fratze darin. Mit seinen verzerrenden Facetten geschliffen blieb der Spiegel verzaubert. Ich denke damals begann meine Sehnsucht fremde Länder zu bereisen, fremde Menschen kennen zu lernen In anderen Kulturen zu leben und Sprachen zu lernen. Nur die Angst vor Kälte und Behörden blieb. Auch in den fünfundsechzig Ländern, die ich bereiste. Nie passierte etwas Außergewöhnliches, etwas Gefährliches. Und trotzdem, eine innere Unruhe trieb mich immer vorwärts ohne das Ziel jemals zu erkennen. Sehnsüchte blieben, Sehnsüchte nach Ruhe, angstfreier Geborgenheit und Zuversicht.
Dann eines Tages, ich hatte mich mit Händen und Füßen gewehrt. Trotzdem wurde ich mitten in der Nacht aus der mir vertrauten Wohnung, in der ich bisher mit den Großeltern gelebt hatte, abgeholt.. So einfach aus dem Schlaf gerissen. Ich wusste von nichts. Meine Oma weinte, das sah ich. Klar wollte ich nicht aus meinem warmen Bett, klar wollte ich nicht mit den Erwachsenen nachts irgendwohin fahren. Den Mann kannte ich nicht, nie gesehen. Was wollte der von mir. Und die Frau, die hatte ich einige Male gesehen. Als ich noch nicht zur Schule ging, musste ich diese Frau in Bremen besuchen. Immer war sie fein herausgeputzt. In ihr großes Bett konnte ich mich so richtig einkuscheln. Mein hartes, schmales Extrabett im Schlafzimmer der Großeltern kam mir dann so unbequem vor. Nur, hier in Bremen war ich jeden Abend allein. Bis nachts die Frau zurück kam. Meistens nicht allein. Ich wurde fast jeden Abend aus meinem warmen Bett gehoben und auf ein Sofa im Wohnzimmer umquartiert. Schrecklich und dann immer das Gejammer aus dem Nebenzimmer. Aber ich schlief schnell ein. Morgens spielte ich mit Autos auf meiner Bettdecke. Die brachten die Männer mit. Die kamen auch nachmittags. Ich spielte dann so lange Draußen bei der Brotfabrik, weil es dort nachmittags so lecker roch. Das sollte meine Mutter sein, warum war sie dann nicht bei mir in Hamburg. Fragte ich meine Großmutter danach, zuckte die nur mit den Schultern. Sehr nachdenklich lehnte ich mich in meinem Thonet Sessel weit zurück und blickte auf den Ozean. Dessen Wellen übertrugen sich auf mich. Plötzlich, immerhin Jahrzehnte später überfielen mich wieder einmal Ängste und Einsamkeit. Erinnerungen aus meiner Kindheit schossen wie Blitze durch meinen Kopf. An meine erste Freundin aus unserem Haus. Das war Ella, die mit den langen blonden Zöpfen. Ella war viel vernünftiger als wir Jungs damals. Ich hatte sie gern.
Mord an Ella
Hastig rannte ich die Treppe von der vierten Etage hinunter. Es roch nach Bohnerwachs. Polternd sprang ich, immer mehrere Stufen gleichzeitig ins Erdgeschoss. Vorsichtig von Stufe zu Stufe zu gehen, so wie meine Oma es mir jeden Tag einbläute ging einfach nicht. Die Treppen verleiteten immer zum Springen und Poltern. Alle Ermahnungen gingen sofort zum anderen Ohr wieder hinaus. Alle Kinder sprangen alle Treppen immer herunter. Oder sie rutschten auf dem vernarbten hölzernen Geländer bis vor die Haustür. Vom Glasdach über dem Lichtschacht waren Glassplitter in den Bombenächten ins Treppenahaus gerauscht. Vielen waren scharfkantig im Holzgeländer stecken geblieben. Wir Kinder sollten immer noch vorsichtig sein. Trotzdem tombten und rutschen alle die Treppen hginunter. Klar, ich auch, wenn ich keine Erwachsener im Treppenhaus hörte. Wie spät es war , so ganz genau wusste ich das nicht. Aber ich war mir sicher, dass Ella aus der Schule zurück sein würde und ihre Schularbeiten erledigt hatte. So wie fast jeden Tag. Außer wenn sie nachmittags zum Turnen musste. Sie hatte nie Lust dazu. Ihre Mutter Hildegard, jeder nannte sie Hilde, ihr Mann auch, bestand darauf.
Bei schönem Wetter, immer so um halb vier trafen wir uns vor dem Nebenhaus. Ella mochte ich gern. Sie war schon vierzehn Jahre alt. Bei ihr auf dem Pflaster zu sitzen und ihrem Geschichtenball zuzuhören lenkte von der Enge inder Wohnung, der Strenge der Großeltern und dem Dreck in den Trümmern ab. Wir kleineren Jungen, ich mit meinen zehn Jahren und Freunde aus dem Haus, saßen auf dem Pflaster neben der kleinen Bäckerei . Ella kam aus dem Nachbarhaus mit einem bunten Gummiball, stellte sich ohne viele Worte vor die Wand und begann den Ball dagegen zu werfen. Ihr kurzes Kleid wippte dabei auf und ab. Sie warf den Ball über die Schulter, durch die Beine , um ihren Rücken herum und, sie erzählte dabei eine Geschichte die sie sich ausgedacht hatte. Wir Jungen mochten das sehr. Die nette, sehr alte Bäckersfrau kam oft aus ihrem kleinen Laden geschlurft und gab jedem von uns eine Schreibe Rosinenbrot, ein Brötchen von Gestern oder Kanten vom Butterkuchen. Die mochte ich besonders gern. Heiute immer noch. Manchmal kamen andere Mädchen aus den umliegenden Häusern hinzu. Marlies Krause aus der Wohnung unter uns, Juliane aus der nächsten Straße. Abwechselnd nahmen sie den Ball und erzählten ihre Geschichten. Für mich war Ella die Beste. Immer interessant und so ein wenig aufregend. Die Mädchen in ihrem geblümten, kurzen Kleidchen hüpften bei diesem Spiel viel hin und her. Wenn sie müde wurden, setzten sie sich zu uns Jungen auf die Gehwegplatten. Ella immer neben mich. Hin und wieder blitzen die weißen Schlüpfer der Mädchen unter ihren bunten Kleidchen hervor. Die Jungen lachten sie dann aus und zeigten mit Fingern nach ihnen. Ich wollte nicht, dass jemand Ella auslachte. Einmal ging ich wütend auf die blöden Jungs los und trat nach ihnen oder ich lief weg. Dann schreien sie hinter mir her: „Der Kleine liebt