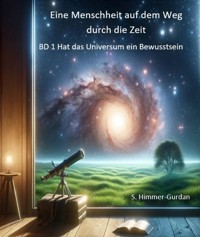
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Führt Naturwissenschaft zu Gott? Ein faszinierendes Buch über aktuelle Ergebnisse aus Physik, Philosophie und Bewusstseinsforschung, die erstaunliche Antworten liefern. Die Autorin stellt prägnant und leicht verständlich spannende Erkenntnisse vor und zeigt auf, was passiert, wenn die Wissensbausteine zu einem Bild zusammengesetzt werden. Eine Lesereise, die erst begonnen hat. Ein inspirierendes Werk auf den Spuren der Menschheit zum Weiterdenken und Philosophieren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 171
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Autorin: S. Himmer-Gurdan
Titelbild:
Silvia Himmer-Gurdan
Hat das Universum ein Bewusstsein?
Widmung
Für alle, die über den Tellerrand hinausschauen wollen.
Gewidmet meiner ganzen Familie (hier und dort) und allen, die (wissentlich oder unwissentlich) zu diesem Buch beigetragen haben.
Gewidmet all den kleinen und großen Sternen auf der Suche nach ihrem Platz.
Gewidmet all denjenigen, die Tag für Tag ihr Bestes geben und im Guten bleiben.
Gewidmet all denjenigen, die sich nach Liebe und Zuwendung sehnen.
Hinweis
In diesem Buch wird versucht, Zusammenhänge zwischen hoch komplexen Sachverhalten herzustellen. Damit diese einzelnen Bausteine gemeinsam betrachtet werden können, ist es not-wendig gewesen, sie sehr komprimiert, z.T. stark vereinfacht und damit lediglich in ihrem Kern zu beschreiben.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung: Eine Menschheit auf dem Weg durch die Zeit
1. Der Elefant und die Blinden
2. Faszination Gehirn
2.1 Bewusstsein und Unterbewusstsein
2.2 Intuition und Logik
3. Mehr wissen als es scheint: Der clevere Staubsaugervertreter
4. Das intelligente Universum
4.1 Strukturelle Parallele zwischen Gehirn und Weltall
4.2 Von Formation zu In-Formation
4.3 Rätselhafte Synchronisation
5. Exkurs: Evolution und Devolution
6. Exkurs: Doppelte Codierung
7. Biophotonentheorie: Information im Licht*
7.1 Das Leben leuchtet
7.2 Die Sprache der DNA
7.3 Der DNA-Phantom-Effekt
8. Information im Wasser
9. The Infinite Mind: Information, die in der Luft liegt
10. Zum Verhältnis von Geist und Materie**
10.1 Kollektives Bewusstsein
10.2 Der Maharishi-Effekt
10.3 Popper
10.4 Panpsychismus
11. Und Gott erwacht
11.1 Das Gottesteilchen
11.2 Max Planck: Keine Materie an sich
11.3 Gott würfelt nicht: Das Bayes-Theorem
11.4 Ein Raum im Wachstum
11.5 Wunder der Anomalie
11.6 Alles hat seine Zeit
12. Der Elefant: Gott lebt
12.1 Im Gehirn verankert
12.2 Naturwissenschaft und Religion vereint
12.3 H.P. Dürr: Es existiert immer nur das Ganze
12.4 Wo die Seele ist, ist Gott
12.5 Und wie schafft Gott das alles
12.6 Antwort auf das Theodizee-Problem
Einleitung: Eine Menschheit auf dem Weg durch die Zeit
Zu einem der aufregendsten und am besten dokumentierten Fälle der Medizin, die Fragen zum Thema Bewusstsein auf-werfen, zählt Pam Reynolds{1}.
Bei der jungen Frau wurde 1991, als sie 35 Jahre alt war, im Gehirn ein Aneurysma festgestellt, das mit den herkömmlichen Methoden nicht entfernt werden konnte. Um ihre Überlebens-chancen zu erhöhen, unterzog sie sich einer hoch riskanten Operation, zu derein hypothermischer Herzstillstand gehörte, was zur damaligen Zeit absolutes Neuland unter den Opera-tionsmethoden war.
Dabei wird die Körpertemperatur auf ca. 15 Grad abgesenkt. Das Herz hört zu schlagen auf und pumpt somit auch kein Blut mehr in das Gehirn. Das EEG, welches die Hirnströme misst, zeigt eine Null-Linie.
Bisher wird die Aktivität des Gehirns für unser Bewusstsein vorausgesetzt, da es dieses durch die Gedankenströme erzeu-gen soll.
Bei Pam Reynolds gab es keine messbare Aktivität und keine Reaktion des Gehirns mehr und trotzdem berichtete sie später von verschiedenen Eindrücken und „Sinneswahrnehmungen“, die von den Ärzten bestätigt werden konnten.
Sie empfand ein Heraustreten oder Herausgezogen-Werden aus ihrem Körper und konnte verschiedene Operationsgegen-stände sehen, von denen sie im Anschluss erzählte.
Sie beschrieb ihre Wahrnehmung als klarer und bewusster als sonst. Sie berichtete auch von der Musik, die abgespielt wurde, obwohl in ihren Ohren Kopfhörer waren, die pro Sekunde mehrfach Klickgeräusche abspielten. Im weiteren Verlauf bemerkte sie eine „Präsenz“ und ein Licht, das sie anzog und erkannte ihren Onkel sowie weitere vertraute und auch un-bekannte Personen. Ihr Onkel brachte sie schließlich „zurück“ zu ihrem Körper, der ihr kalt und leblos vorkam und in den sie nicht mehr zurückwollte.
Kann so etwas möglich sein?
Der Neuropsychiater Peter Fenwick (2012), sieht in dem Bericht keinen Einzelfall und folgert daraus, dass Bewusstsein und Gehirn nicht zwangsläufig dasselbe sein müssen. Er hat viele Erzählungen verschiedener Nahtoderfahrungen gesammelt und veröffentlicht.
Von der Medizin, über die Philosophie und Psychologie bis hin zur Physik macht man sich große Gedanken darüber, was das Bewusstsein sein und wie es entstehen könnte.
Das Bewusstsein kann als Summe der menschlichen Gedanken beschrieben werden. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Quantenphysik wird auch das Bewusstsein durch Elemen-tarteilchen verkörpert. Der Theorie der Quantenphysik nach können diese Elementarteilchen sich bis in die Unendlichkeit ausdehnen. Was gleichfalls hieße, dass das Bewusstsein nicht auf einen bestimmten Raum limitiert wäre.
Aber nicht nur Nahtoderlebnisse stellen uns hier vor große Herausforderungen. Wir stehen immer noch vor den grund-sätzlichsten Fragen, nämlich wer oder was überhaupt Bewusstsein haben kann. Haben z.B. sogar Pflanzen oder Zellen in uns ein Bewusstsein?
Wenn wir uns aber fragen, was Bewusstsein ist und ob es Bewusstsein auch im Kleinen geben kann oder sogar muss, dann landen wir unmittelbar auch bei der Frage, wie es eigentlich eine Ebene weiter, über uns, im großen Ganzen, aussieht.
Forscher zeigten auffallende Parallelen zwischen Gehirn und Universum. Aber kann das sein? Ist das Universum ein Gehirn oder hat es ein Gehirn? Gibt es dann doch etwas Großes, dessen Teil wir sind und das manche als Gott bezeichnen würden?
Es wurde mehrfach versucht, GOTT zu belegen oder zu wider-legen, aber bei der Beantwortung dieser gewaltigen Frage müssen wir tiefer gehen, als das Leid (das wir z.T. selbst verursachen) gegen oder Wunder für die Existenz ins Feld zu führen. Und wenn es ein übergeordnetes Bewusstsein geben sollte, was bedeutet das dann für uns?
Seit vielen Jahren stellen sich die Menschen viele große Fragen. Gibt es einen Gott? Und wenn ja, warum gibt es dann Leid? Hat der Mensch eine Seele? Und wenn ja, haben Tiere auch eine? Gibt es unveränderliche Werte?
Diese Fragen wurden je nach Zeit und Kultur immer wieder unterschiedlich beantwortet.
Vielleicht ist es nun möglich, nachdem doch einiges an Zeit der Menschen auf der Erde vergangen ist, diese Fragen zu beant-worten, indem wir die vielen Ideen, die entstanden sind, zusammenfassen. In Band 1 dieser Reihe wollen wir uns zunächst dem Bewusstsein widmen.
Wenn sich jede Generation einzeln betrachtet, wie ein Individuum, dann können verschiedene Kulturen und Gene-rationen auf verschiedene Gedankenmodelle und Anschauun-gen kommen. Aber wir sind auch insgesamt unterwegs. Als eine Menschheit durch die Geschichte der Zeit.
Abb.1 Eine Menschheit auf dem Weg durch die Zeit, Quelle Stahov
Was bedeutet es, wenn viele Menschen kulturübergreifend immer wieder ähnliche Erfahrungen machen oder Ideen im Laufe der Zeit immer wieder kommen?
Kann es nicht sein, dass es dafür dann einen Grund gibt und wir von mehr als einem Zufall ausgehen müssen?
Im letzten Jahrhundert ist ungeheuer viel Wissen entstanden, gesammelt und öffentlich zugänglich gemacht worden.
Da wir auf dieses zugreifen und neue, verblüffende Bausteine gemeinsam von außen betrachten und Schlussfolgerungen ziehen und somit unser eigener Publikumsjoker sein können, können wir auch hoffen, Antworten auf die großen Fragen zu bekommen, denn es wird sie geben.
Gehen wir ein Stückchen Weg gemeinsam und betrachten ursprünglichere und aktuellere Erkenntnisse zu den Geheim-nissen unseres Lebens.
1. Der Elefant und die Blinden
Bisher machen sich verschiedene Disziplinen, die unterschied-lichsten Religionen, die Physik/Mathematik, Philosophie, Psy-chologie usw. Gedanken zu den großen Fragen und manchmal geraten sie darüber in Streit.
Passend dazu gibt es eine spannende Anekdote{2}.
Es waren einmal fünf weise Gelehrte. Sie alle waren blind. Diese Gelehrten wurden von ihrem König auf eine Reise geschickt und sollten herausfinden, was ein Elefant ist. Und so machten sich die Blinden auf die Reise nach Indien. Dort wurden sie von Helfern zu einem Elefanten geführt. Die fünf Gelehrten standen nun um das Tier herum und versuchten, sich durch Ertasten ein Bild von dem Elefanten zu machen.
Als sie zurück zu ihrem König kamen, sollten sie ihm nun über den Elefanten berichten. Der erste Weise hatte am Kopf des Tieres gestanden und den Rüssel des Elefanten betastet. Er sprach: "Ein Elefant ist wie ein langer Arm."Der zweite Gelehrte hatte das Ohr des Elefanten ertastet und sprach: "Nein, ein Elefant ist vielmehr wie ein großer Fächer.
"Der dritte Gelehrte sprach: "Aber nein, ein Elefant ist wie eine dicke Säule." Er hatte ein Bein des Elefanten berührt.
Der vierte Weise sagte: "Also ich finde, ein Elefant ist wie eine kleine Strippe mit ein paar Haaren am Ende", denn er hatte nur den Schwanz des Elefanten ertastet.Und der fünfte Weise berichtete seinem König: " Also ich sage, ein Elefant ist wie eine riesige Masse, mit Rundungen und ein paar Borsten darauf.“ Dieser Gelehrte hatte den Rumpf des Tieres berührt.
Nach diesen widersprüchlichen Äußerungen fürchteten die Gelehrten den Zorn des Königs, konnten sie sich doch nicht darauf einigen, was ein Elefant wirklich ist. Doch der König lächelte weise: "Ich danke Euch, denn ich weiß nun, was ein Elefant ist: Ein Elefant ist ein Tier mit einem Rüssel, der wie ein langer Arm ist, mit Ohren, die wie Fächer sind, mit Beinen, die wie starke Säulen sind, mit einem Schwanz, der einer kleinen Strippe mit ein paar Haaren daran gleicht und mit einem Rumpf, der wie eine große Masse mit Rundungen und ein paar Borsten ist.
Die Gelehrten senkten beschämt ihre Köpfe, nachdem sie erkannten, dass jeder von ihnen nur einen Teil des Elefanten ertastet hatte und sie sich zu schnell damit zufriedengegeben hatten.
Verfasser unbekannt{3}
Die Geschichte hat etwas Faszinierendes - mit einem Wow- oder Aha-Effekt. Verschiedene kluge Männer streiten sich darüber, wer von ihnen wohl recht haben wird. Obwohl sie Gelehrte sind, gehen sie über den eigenen Horizont des eigenen Wissens nicht hinaus. Sie bleiben bei ihrer Erfahrungswelt, spezialisieren sich vielleicht, werden hier immer genauer und entfernen sich voneinander.
Abb.2 Der Elefant und die Gelehrten, Quelle Stahov
Lassen sich hier vielleicht Parallelen zu unseren Fachgebieten erkennen?
Viele Jahrtausende wurden große Fragen diskutiert und aus verschiedenen Perspektiven immer wieder neu beantwortet.
Dabei wurden manche mathematische und physikalische Theo-rien, medizinische wie psychologische Konstrukte, philosophi-sche oder spirituelle Konzepte, theologische Modelle und menschliche Erfahrungswelten so detailliert und genau ausge-arbeitet, dass sie nicht mehr gut zueinander zu passen schei-nen. Sie wirken weit voneinander entfernt und wenig ver-einbar.
Aber kann das überhaupt sein? Gibt es rein naturwissen-schaftlich gesehen wirklich so viele Welten, wie Menschen und Ansichten oder gibt es viele Meinungen, aber trotzdem EINE Welt?
Was passiert, wenn wir uns fragen, welches Bild unsere Ahnungen, Wissensbausteine, Eindrücke und Rätsel zusammen-gesetzt ergeben?
Und wie vertraut wäre uns dieses Bild? Vermutlich wäre es erst einmal fremd für uns, weil wir es noch nie (so) gesehen haben.
Wäre es vermutlich nicht genauso ungewöhnlich wie das zusammengesetzte Bild eines Elefanten? Wäre es nicht ebenso gewöhnungsbedürftig?
Stellen Sie sich vor, Sie hätten bisher nur geometrische Formen: einen Kreis, ein Oval, eine Linie usw. gesehen und würden dann zum ersten Mal einen Elefanten zu Gesicht bekommen, was würden Sie denken? Wäre es nicht ein absolut seltsamer, sehr ungewohnter Anblick?
Vielleicht sollten wir genau das einmal versuchen: alle Bausteine zusammensetzen und schauen, welches Bild sich dann ergibt. Aber wie kommen wir, wenn wir bisher nur die einzelnen Formen und Beschreibungen gesehen haben, zum Bild des ganzen Elefanten, also zu unserer Wirklichkeit?
Dazu braucht es zwei Dinge: viel Mut und Unerschrockenheit vor dem, was die Welt uns selbst offenbart.
Der Weg beginnt damit, dass wir versuchen, bisherige Ahnun-gen und große Bausteine zu vereinfachen, zu abstrahieren und dann zu einem Gesamten zusammenzusetzen, egal, welches Bild dann entsteht - nur so kommen wir, auf Basis der letzten Jahrhunderte, der Wahrheit vielleicht ein Stückchen näher.
Dabei sollten wir so objektiv wie möglich vorgehen, es wird also nicht darum gehen, eine Theorie als richtig und alle anderen als falsch zu belegen, sondern es geht nur um das Gesamtbild, das sich ergibt, wenn man jeder Theorie einen Funken Wahrheits-gehalt und Berechtigung zugesteht.
Je (gedanklich) freier und unvoreingenommener wir sind, desto eher wird man das sich ergebende Gesamtbild annehmen können, das von der Ästhetik, Schlichtheit und Schönheit der bisherigen Einzelbausteine deutlich abweichen kann. Es kann ungemütlich und ungewöhnlich sein, d.h. das Einzige, was bleibt ist, dass es (vielleicht) wahr ist und das könnte das wahre Schöne sein.
2. Faszination Gehirn
Wenn wir später über Bewusstsein sprechen wollen, sollten wir uns zunächst einmal mit dem beschäftigen, was damit in Verbindung gebracht wird: dem Gehirn - oder in diesem Fall unserem Gehirn und dessen Informationsverarbeitung.
Betrachten wir also zunächst einmal das Organ, mit dem Sie vor diesen Zeilen sitzen, die Worte lesen und sich Gedanken machen.
Abb.3 Gehirn, Quelle Stahov
Ihr Gehirn ist ein Hochleister an Datenaufnahme und Verar-beitung. Es verfügt über ca. 86 Milliarden Nervenzellen, die wiederum mehrere Verknüpfungen aufweisen. Ca. 69 Milliarden Neurone befinden sich dabei im Kleinhirn (zuständig für die Muskulatur, Bewegungen und Gleichgewicht), nur ca. 16 Milliarden im Großhirn (zuständig für höhere Verstandes-leistungen) und der Rest muss mit 1 Milliarde Neuronen auskommen.{4} Durch Synapsen können Informationen von einem Neuron auf andere Neurone oder Muskeln übertragen werden. Jede einzelne noch so simpel wirkende Leistung, z.B. das Betrachten eines Bildes, setzt eine Vielzahl an korrekt ablaufenden und aufeinander abgestimmten Prozessen voraus.
Sowohl die Umwelt als auch der eigene Körper sind in den menschlichen Gehirnen topographisch in verschiedenen Berei-chen repräsentiert (Luhmann, 2020).
Neuronale Informationen werden sowohl seriell (nacheinan-der), als auch parallel (gleichzeitig) über verschiedene Nerven-bahnen geleitet, so ist es u.a. möglich, Informationen auf verschiedenen Ebenen zu verarbeiten.
Sie können auch mehrfach verarbeitet werden, indem sie wieder am Anfang eingespeist und neu betrachtet werden. Sie werden ausgewertet, summiert, miteinander verrechnet und in Beziehung gesetzt.Unser Gehirn verarbeitet dabei diejenigen Informationen bevorzugt, die kongruent, also deckungsgleich zu unseren Einstellungen sind, d.h. sich mit unserer Meinung decken. Hierzu gibt es schon ein neuronales Netz, die Verarbeitung ist leichter. Und weil es sich leicht anfühlt, eingängig und klar, meinen wir auch, dass es richtig ist. Das macht es dann so schwer, eigene Meinungen zu überdenken oder unähnliche Information zuzulassen. Sie passen eben nicht dazu, hier müssen erstNeurone aufgebaut, verzweigt oder gestärkt werden. Sie wirken also erst einmal fremd und anstrengend, vielleicht deswegen sogar falsch.
Wenn wir davon ausgehen, dass jedem Denken ein neuronales Netz zugrunde liegt, dann kann man sagen, dass Informationen, die unserer Meinung entsprechen, für das Gehirn auch tatsächlich leichter zu verarbeiten sind, weil sie vertrauter sind. Das neuronale Netz ist schon da. Müssen wir Informationen verarbeiten, die nicht unserer Meinung entsprechen, ist das Gehirn schwergängig, da es dafür „neue Bahnen“ nutzen muss. Neurone verhalten sich ja wie Muskeln. Je öfter sie verwendet werden, desto stärker werden sie. Sie werden ausgebaut, erhalten mehr Verzweigungen, werden sozusagen von der Landstraße zur Autobahn. Die Informationsverarbeitung geht fix. Andere sind vielleicht noch nicht so gut ausgeprägt und die Verwendung noch nicht ganz so selbstverständlich. Sie sind wie ein selten genutzter Trampelpfad: zugewachsen, unbequem.
Dies wird übrigens v.a. dann zum Problem, wenn Personen über sich selbst oft schlecht denken. Neurone entscheiden nicht darüber, ob etwas gut für uns oder richtig ist, sondern es geht um Häufigkeiten. Wenn wir oft gut denken, fühlt sich der Gedanke leicht und somit richtig für uns an. Das gilt leider auch für das Gegenteil. Deswegen ist es so schwer, Menschen, die ein negatives Selbstbild aufgebaut haben, wieder zu einem positiven zu verhelfen. Es braucht ein (intensives) Training und das dauert, denn die selbstwertdienlichen Bahnen müssen mühsam trainiert werden und werden nur langsam vom schmalen Weg zur selbstverständlichen Autobahn. Umgekehrt muss die bereits bestehende Autobahn (die negativen Gedanken) möglichst oft ignoriert werden. Das kann sich v.a. ganz am Anfang des Trainings ungewöhnlich, fast unwahr anfühlen.
Zurück zum Thema:
Im Laufe der Evolution haben sich die Nervensysteme in ihrer Komplexität stets weiterentwickelt, um die Informationen aus der Umwelt und dem eigenen Körper wahrzunehmen, einzu-ordnen und bestmöglich darauf zu reagieren. Reaktionsweisen und -muster werden wiederum gespeichert und dienen künfti-gen Situationen als Ressource.
Eine der erstaunlichsten Fähigkeiten des menschlichen Gehirns ist dessen Fähigkeit, sich anzupassen. Es hat sich nicht nur im Laufe der Menschheitsgeschichte ständig weiterentwickelt, es ist auch in der Lage, Ausfälle und Schädigungen (in einem gewissen Rahmen) zu kompensieren. So können Hirnregionen, die eigentlich für andere Aufgaben zuständig sind, ausgefallene Aufgaben übernehmen.
Auch geschädigte neuronale Netzwerke können sich, bis zu einem gewissen Grad, wieder regenerieren.
Allerdings sind natürlich auch den Verarbeitungsmöglichkeiten des menschlichen Gehirns Grenzen gesetzt. So ist beispiels-weise die Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses verhältnismäßig begrenzt.
Ungenutzte Informationen werden gemäß dem Motto „use it or lose it“ wieder vergessen. Vergessen bedeutet in diesem Zusammenhang allerdings nicht, dass die Informationen gelöscht werden, sondern, dass wir nicht mehr darauf zugreifen können. Aus der Hypnoseforschung ist bereits seit Jahren bekannt, dass Bilder, Erlerntes oder Gedanken in unserem Unterbewusstsein abgespeichert werden und somit nicht verloren gehen.
Trotzdem gibt es noch keine Strategie, Unbewusstes direkt abzurufen, um es anschließend bewusst zu verarbeiten. Auf der anderen Seite gibt es auch noch keine Strategie zu verhindern, dass plötzlich auftretende Gedanken aus dem Unter-bewusstsein den bewussten Verarbeitungsprozess unter-brechen. Trotz voller Konzentration auf eine bestimmte Aufgabe schaffen es unbewusste Informationen, die Aufmerk-samkeit abzuziehen und diese auf etwas anderes zu lenken.
2.1 Bewusstsein und Unterbewusstsein
Das Gehirn kann immens viele Informationen aufnehmen, jedoch laufen aufgrund der Begrenztheit unserer Verarbei-tungskapazität Selektionsprozesse ab, sodass die Rate an bewusst verarbeiteten Informationen vergleichsweise gering ausfällt. Um bewusst zu (ver)arbeiten, benötigt es zudem ein bestimmtes Maß an Aufmerksamkeit und Konzentration.
Wir verarbeiten nur einen Teil der aufgenommenen Infor-mationen wirklich bewusst. Bewusstsein meint, dass wir mentale Zustände und Prozesse aktiv (bewusst) erleben, wenn Gedanken, Emotionen oder Erinnerungen bewusst wahr-genommen werden. Ein weiterer Aspekt für das bewusste Verarbeiten von implizitem oder unbewusstem Wissen stellt die sprachliche Rekonstruktion dieser Informationen dar. Erst wenn dieses Wissen sprachlich rekonstruiert wird, kann es in das Bewusstsein gelangen (Von Kopp, 2015).
Dem Bewusstsein steht das Unbewusste gegenüber, das sogenannte Unterbewusstsein. Ein großer Teil der Informa-tionen wird in unserem Unterbewusstsein gespeichert und dort in verschiedenen Bereichen aufbewahrt, bis sie im passenden (oder auch unpassenden) Moment ins Bewusstsein treten.
Gedanken, Impulse und Hinweise aus dem Unterbewusstsein wahrzunehmen, stellt eine große Ressource dar, welche wir in unserem hektischen Alltag und dem Suchen nach schnellen, adäquaten Lösungen häufig vernachlässigen. Jedoch kann es ein großer Vorteil sein, das Unterbewusstsein noch stärker als Ressource zu nutzen.
In der Forschung finden sich einige Befunde, welche die Überlegenheit des unbewussten Denkens gegenüber dem bewussten Denken bestätigen (Dijksterhuis, 2010).
In einem Sprachtest wurden den Teilnehmern unter der Wahrnehmungsschwelle Worte wie „vergesslich“, „langsam“, „einsam“, „Heim“ präsentiert - Worte, die wir normalerweise mit Senioren verbinden. Als die Teilnehmer die Räumlichkeiten verließen, bewegten sie sich langsamer, gingen vorsichtiger, wirkten müder - sie waren also buchstäblich gealtert - natürlich nur vorübergehend. In einem anderen Versuch zeigte man Personen, die Angst vor Spinnen hatten, Bilder von Spinnen - wieder unter der Wahrnehmungsschwelle. Sie beschrieben Gefühle der Nervosität und des Ekels, ohne dass sie erklären konnten, wo diese auf einmal herkamen. Manche Wissen-schaftler glauben, dass wir nur 1% oder weniger von dem mitbekommen, was unser Gehirn plant, leistet, verarbeitet - manche witzeln auch, wir wären die letzten, die erfahren würden, was unser Gehirn so treibt.
Natürlich kann man auch feststellen, dass die Wirkung vorbe-wusster Impulse in manchen Studien falsifiziert (also nicht bestätigt) wurde - es kommt wohl noch eine gehörige Portion individueller Variablen ins Spiel wie z.B. Aufmerksamkeit, Sensibilität, Empfänglichkeit, Offenheit usw.
Dennoch werden einigen Forschenden zur Folge bessere Entscheidungen getroffen, wenn man das Unbewusste an einer anstehenden Entscheidung „arbeiten lässt“ und sich an-schließend für die Alternative entscheidet, mit welcher man ein besseres Gefühl verbindet. Große Entdeckungen wurden erst über die Datenmengen des Unbewussten möglich.
So erklärte sogar Einstein: „Der Intellekt hat weniger mit Entdeckungen zu tun als die Intuition. Die Lösung kommt einfach zu dir und du weißt nicht woher oder wie“ (von Kopp, 2015).
Die Intuition bedient sich dieser großen Datenmengen und tritt als Geistesblitz oder spontane Eingebung ins Vorbewusstsein. Informationen sind in diesem Stadium noch nicht greifbar, sondern äußern sich eher als (Bauch-)Gefühl oder Ahnung.
Woran liegt das?
2.2 Intuition und Logik
Unser Gehirn nimmt in jeder Sekunde ca. elf Millionen Informationen auf. Gerade einmal vierzig davon erreichen das Bewusstsein, also das, was wir im Alltag unseren Verstand oder unsere Vernunft nennen. Ist das nicht unglaublich?
Der Rest ist vor- oder unbewusst. Darauf haben wir nur Zugriff über das Bauchgefühl oder die innere Stimme. Das bedeutet aber auch, dass wir dieser Intuition glauben können, denn das Bauchgefühl hat in Wirklichkeit mehr Daten zur Verfügung als der Verstand. Das macht die Intuition also nicht zu etwas Mystischem, sondern sie greift auf reale Information zu.
Wenn sie sich einschaltet und wir nicht wissen, warum sie uns etwas zuflüstert, können wir also darauf vertrauen, dass sie es auf Grundlage von viel mehr Informationen tut, als unserem Verstand zugänglich sind.





























