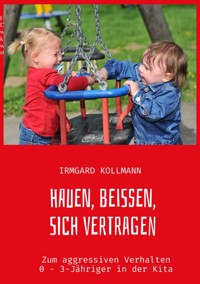
15,99 €
Mehr erfahren.
Es geht um die Entwicklung kleiner Kinder von 0 bis 3 Jahren, um die Frage welche Bedürfnisse Kinder in dem Alter haben und wie Eltern, Betreuer, Erzieherinnen und Erzieher sie angemessen erfüllen können. Während dieser Phase zeigen Kinder häufig aggressives Verhalten. Wie können Erziehende damit umgehen und was kann sich dahinter verbergen? Unterschiedliche Erklärungsansätze werden dargestellt und sollen helfen, das herausfordernde Verhalten zu verstehen und Wege für den Umgang mit den Kindern zu finden. Dabei helfen viele Praxisbeispiele und Tipps zur Prävention von Konflikten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 170
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Irmgard Kollmann, Diplom-Soziologin und Studiendirektorin i.R., arbeitet in der Aus- und Weiterbildung von Erzieherinnen undErziehern. Sie bildete Lehrerinnen und Lehrer für das Fach Sozialpädagogik aus und ist in einer Erziehungsberatungsstelle tätig.
Irmgard Kollmann
HAUEN, BEIßEN,SICH VERTRAGEN
Zum aggressiven Verhalten 0- bis 3- Jähriger in der Kita
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2023 Irmgard Kollmann
4. Version,
3.Auflage 2018
Lektorat: 1. – 3.Auflage Liliane Wopkes, Forchheim
Titelfoto: Adobe Stock
alle weiteren Fotos: © 2023 Irmgard Kollmann
ISBN Softcover: 978-3-347-97472-2
ISBN E-Book: 978-3-347-97473-9
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist die Autorin verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne ihre Zustimmung unzulässig.
Druck und Distribution im Auftrag der Autorin:
tredition GmbH, Halenreihe 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland
Inhalt
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
1. Einleitung
2.Erklärungsmodelle für Aggressionen
2.1 Sind Aggressionen angeboren?
2.2 Sind Aggressionen eine Folge von Frustrationen?
2.3 Werden Aggressionen gelernt?
2.4 Neurobiologische Erklärungen
3.Erklärungen für aggressives Verhalten speziell im Kindesalter
3.1 Kindliche Bedürfnisse – und Auswirkungen ihrer Nichterfüllung
3.2 Kindliche Entwicklungsschritte und deren Beachtung
3.3 Funktionelle Störungen
4.Vorschläge zur Prävention
4.1 Im Team aus Geschichten lernen
4.2 Für gute Rahmenbedingungen sorgen
4.3 Für Sicherheit und Orientierung sorgen
4.4 Mit Eltern zusammenarbeiten
5.Handlungsmöglichkeiten für Erzieherinnen und Erzieher in herausfordernden Situationen
5.1 Erfahrungen einer Kita-Leiterin - ein Interview
5.2 Auf Konflikte reagieren
5.3 Vom Nutzen der Theorie
5.4 Die Anwendung in der Praxis am Beispiel
Literaturverzeichnis
Hauen, beißen, sich vertragen
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
1. Einleitung
Literaturverzeichnis
Hauen, beißen, sich vertragen
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
1. Einleitung
Für die Überschrift dieses Buches habe ich bewusst auf zwei Begriffe verzichtet: auf „Krippe“ und auf „Aggression“. Weshalb ich den Begriff „Krippe“ vermeide, ist einfach zu erklären. Denn „Krippe“ ist ein veralteter Begriff für einen Futtertrog und als Unterbringung für Babys höchstens eine Notlösung - als was diese Einrichtung übrigens auch lange Zeit betrachtet wurde. Mit der Vorstellung von einer Einrichtung zur Bildung, Betreuung und Erziehung von kleinen Kindern ist dieser Begriff nicht zu vereinbaren. Also wird hier die Rede von „Kleinstkindergruppen“, „U3-Gruppen“ oder Kita-Gruppen“ sein.
Aufwendiger zu begründen ist meine Entscheidung gegen den Begriff „Aggression“ im Titel. Da ich mich vorrangig mit dem gezeigten und beobachtbaren Verhalten der Kinder auseinandersetze, spreche ich lieber überwiegend von „aggressivem Verhalten“.
Eine weiterführende fachliche Begründung wird im Folgenden näher auf die Definition von „Aggression“ eingehen. Jeder hat jedoch, auch ohne weitere Auseinandersetzung mit der Bedeutung des Begriffs, eine Vorstellung davon, was Aggressionen sind. Unter frühpädagogischen Fachkräften werden sie immer wieder zum Thema.
Folgende Situationen fallen Erzieher*innen unter anderem dazu ein:
Lea (9 Monate) liegt auf dem Boden neben Kevin (10 Monate), der gerade vor sich hindöst. Sie versucht mit beiden Händen seinen Arm festzuhalten und hineinzubeißen.
Die Kindergruppe kommt auf dem Weg zum Spielplatz an einem Blumenbeet vorbei. Den Kindern ist oft gesagt worden, dass sie auf dem Weg bleiben sollen. Leo (2;3) rennt zwischen die Blumen, tritt darauf, bleibt stehen und sieht die Erzieherin erwartungsvoll an.
Lina (4Monate) liegt in ihrem Bett und schreit lautstark. Der Erzieher vermutet, dass sie mit ihrem aggressiven Schreien deutlich machen möchte, dass sie hungrig ist, es ist schließlich ihre Zeit. Er bereitet das Fläschchen vor.
Der Erzieherin ist aufgefallen, dass Kevin (10 Monate) in der letzten Zeit ein paar Mal scheinbar grundlos anfing zu weinen. Immer war dann die zweijährige Katja in der Nähe, um ihn zu trösten. Durch gezielte Beobachtung findet sie heraus, dass Katja jedes Mal kurz vorher an Kevin vorbei geht und ihn kneift.
Leo (2;3) baut einen Turm aus Bauklötzen. Fatima (1;10) sieht das, kommt angelaufen, stößt den Turm um und freut sich über ihr Werk.
Erik (8 Monate) und Robert (11Monate) liegen auf dem Boden. Erik hält eine Plastikflasche in der Hand, bewegt sie hin und her und beobachtet die Lichtreflexe. Robert robbt zu ihm und versucht, die Flasche an sich zu reißen.
Handelt es sich in allen diesen Fällen wirklich um Aggressionen? Je nach individueller Sichtweise fallen die Antworten unter-schiedlich aus. Jedoch finden sich für jedes Beispiel Erwachsene, die das beschriebene Verhalten als „aggressiv“ bezeichnen. Wird von einem sehr weit gefassten Begriff ausgegangen, bedeutet aggressiv „etwas in Angriff zu nehmen“, Energie aufzubringen, um ein Ziel zu erreichen. Diese Bedeutung wird von dem lateinischen Wort „aggredere“ abgeleitet, welches bereits damals einen positiven und einen negativen Aspekt beinhaltete: den positiven von „sich nähern“ und das feindliche „Angreifen“. Bauer (2011a) weist darauf hin, dass aufgrund der humanistischen Bildung vieler Wissenschaftler diese Doppelseitigkeit automatisch übernommen wurde – ohne zu überprüfen, ob es sinnvoll ist.
Ist Linas Weinen schon aggressiv?
In diesem positiven Sinne wäre Lina aggressiv und es wäre wichtig, dass sie es ist: man würde sich sonst möglicherweise nicht ausreichend um ihre Bedürfnisse kümmern. Und später, als älterem Kind, würde ihr sonst vielleicht die Fähigkeit fehlen, sich für ihre Belange einzusetzen. Versteht Linas Erzieher also ihr Schreien als Aggression, die nötig ist, um auf ihre Bedürfnisse aufmerksam zu machen, wird er weitgehend aufmerksam und gelassen darauf eingehen. Trotzdem wird er in manchen Situationen angespannter auf „aggressives Schreien“ reagieren als eine Kollegin, die Linas Schreien als eine der wenigen ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Kommunikation versteht.
Die Ableitung vom lateinischen Begriff „aggredere“ hat dazu geführt, dass auch im deutschen Sprachgebrauch - wie in dem Beispiel von Lina - Aggression meist eine positive Seite zugeordnet wird, so zum Beispiel von Rogge. Für ihn bedeutet Aggression:
„auf etwas zugehen, etwas in Angriff nehmen. Aggressionen haben mithin etwas Konstruktives, Aufbauendes. Aggression ist eine schöpferische Kraft. Wer Aggressionen bei Kindern generell stilllegt, legt ihre Entwicklung, ihre Neugierde und Lernbereitschaft still. Kinder wollen Neues erproben und probieren.“ (Rogge,65)
Einige Autoren weichen in diesem Zusammenhang auf Beschreibungen wie „konstruktive Aggressivität“ aus und meinen damit das neugierige Erforschen der Umwelt. Aber selbst wenn die hergeleitete Wortbedeutung so stimmt, gibt es keinen Grund, die „positive Seite der Aggression“ auch Aggression zu nennen. Sie ist Neugierde, Lernwille, Motivation, alles Mögliche, aber keine Aggression. Man weiß mittlerweile auch, dass sich im Gehirn ganz unterschiedliche Prozesse abspielen, je nachdem, ob die positive oder die negative Seite ausgelebt wird. Aggression ist „-aus neurobiologischer Sicht […] etwas völlig anderes als Motivation.“ (Bauer 2011a,47)
Aus dieser Doppeldeutigkeit ergibt sich für Erziehende die Notwendigkeit zu begründen, warum sie sich nicht eindeutig gegen Aggressionen in ihrer Einrichtung verwahren können. Sie könnten dann ja eine „schöpferische Kraft“ unterdrücken. Wird Aggression dagegen grundsätzlich als destruktive Art der Auseinandersetzung angesehen, ist eindeutig, dass sie nicht akzeptiert werden kann und eine andere Form des Umgangs mit Konflikten gefunden werden muss.
Auch wer in diesem Buch blättert oder liest, macht es nicht, weil er mit einer angeblich positiven Art von Aggression Schwierigkeiten hat. Darum und aus den oben genannten Gründen wird hier folgende Definition von Bauer verwendet (2011, 46):
„Aggression ist jede physische oder verbale Handlung, die darauf angelegt ist, eine andere Person zu konfrontieren, anzugreifen, zu schädigen, zu verletzen oder zu töten. Dabei wird vorausgesetzt, dass es sich um eine Aktion handelt, die von der geschädigten Person abgelehnt wird.“ [Dazu gehören meist] Gefühle, die wir mit den Worten >Ärger<, >Zorn<, >Wut< und >Hass< bezeichnen.“
Auch für die tägliche Arbeit in der Kita sind es nicht die angeblich positiven Seiten der Aggression, die Sorgen bereiten, und auch nicht die versehentlichen Aktionen. Wenn Martin laufen lernt und sich dabei an Karim festhält, so dass beide hinfallen und sich weh tun, werden sie getröstet, ohne dass Martins Verhalten als bedenklich einzustufen wäre. Damit wird auch deutlich, warum ich diesem Abschnitt über Definitionen ein sehr großes Gewicht beimesse: Wir reagieren auf Verhalten, das wir als aggressiv ansehen, meist emotionaler als auf Verhalten, welches wir uns anders erklären - zum Beispiel als ein Versehen oder als Entwicklungsschritt. Lea in dem oben beschriebenen Beispiel ist in dem Alter, in dem sie versucht, alles in den Mund zu stecken und darauf zu beißen. Sie kann noch nicht erkennen, dass sie Kevin Schmerzen zufügen würde, wenn sie ihn beißt. Deshalb wird ihr Verhalten - obgleich es aggressiv aussieht - im Sinne der Definition auch nicht als aggressiv angesehen.
Wenn man von diesem Aggressionsbegriff ausgeht, stellt sich die Frage: Können Kleinstkinder überhaupt aggressiv sein? Gerade Zweijährige zeigen sehr häufig im Umgang miteinander aggressives Verhalten. Aber sind sie von ihrem Entwicklungsstand her in der Lage zu erkennen, ob und womit sie andere verletzten oder schädigen können? Die Grundannahme dieses Buches ist, dass Kinder in U3-Gruppen zwar häufiger aggressives Verhalten zeigen, aber selten „wirklich“ (im Sinne der Definition) aggressiv sind. Wenn hier also von „aggressivem Verhalten“ die Rede ist, ist damit auch ein Verhalten gemeint, das für Außenstehende wie Aggression aussieht, aber von dem Kind nicht als bewusste Schädigung eingesetzt wurde. Wenn in dem Ausgangsbeispiel Fatima Leos Turm umstößt, sieht das wie Aggression aus; Fatima macht das aber vermutlich für sich selbst, weil sie den Lärm der herunter fallenden Steine so schön findet.
In den folgenden Kapiteln werden mögliche Ursachen und Hintergründe von Verhaltensweisen aufgezeigt, die „wirklich aggressiv“ sind, und von anderen, die „aggressiv erscheinen“. Für die Bezeichnung beider Erscheinungsformen werde ich den Oberbegriff „aggressives Verhalten“ verwenden, um die Beschreibung zu vereinfachen. Es ist jedoch meine Intention. eine differenziertere Sichtweise auf diese beiden Möglichkeiten des Verhaltens zu erreichen - und damit verbunden Erzieher*innen einen differenzierteren Umgang damit zu ermöglichen.
An den angeführten Beispielen lässt sich erkennen, dass man sich dem Thema „Aggression“ nicht nähern kann, ohne gleichzeitig das Thema „Konflikte“ und den Umgang mit ihnen zu bedenken. Ist den Erzieher*innen dies deutlich, stellen sie sich viel eher Fragen wie „Wie wird bei uns mit Konflikten umgegangen?“ „Wie lernen Kinder diesen Umgang?“ „Was lösen Konflikte bei mir aus?“ statt „Wie gehe ich mit diesem aggressiven Kind um?“ Blicken wir noch einmal auf die Beispiele am Anfang des Abschnittes zurück, zeigt nur Katja Aggressionen, indem sie Kevin kneift. Allerdings ist auch ihr vorrangiges Ziel vermutlich nicht, Kevin wehzutun, sondern die Aufmerksamkeit und Zuwendung der Erzieherin für ihr fürsorgliches Umgehen mit dem weinenden Kind zu erhalten. Diese Art der Aggression wird als „instrumentelle Aggression“ bezeichnet, weil sie als Mittel eingesetzt wird, um etwas zu erreichen, ihr aber nicht Gefühle wie Wut und Ärger zugrunde liegen. Lea dagegen will Kevin nicht verletzen, sondern das Beißen ausprobieren. Auch Robert möchte Neues erfahren und sein Blick fällt dabei auf Eriks Flasche; die möchte er haben, nicht Erik schaden. Selbst Leos Ziel ist vermutlich nicht, die Erzieherin zu provozieren, sondern herauszufinden, ob die Regel von gestern auch heute noch gilt.
Die Einsicht, dass viele Verhaltensweisen aggressiv aussehen, es im Sinne der obigen Definition aber nicht sind, bedeutet natürlich nicht, dass sie weniger ernst genommen werden müssen. Jedoch ist die Reaktion auf sie eine andere. Generell werden die Erziehenden versuchen, das Erkundungsverhalten zu unterstützen und in Bahnen zu lenken, die andere Kinder nicht schädigen, während sie das aggressive Verhalten von Katja unterbinden werden. Sie werden versuchen, das dem Kneifen zugrunde liegende Bedürfnis, nach (zum Beispiel) Aufmerksamkeit, zu erfüllen, ohne dass Katja erst durch Kneifen darauf aufmerksam machen muss, dass ihr etwas fehlt.
Neben der mehr theoretischen Beschäftigung mit dem Thema „Aggressives Verhalten“ - unabhängig davon, ob es auf Aggression, Entwicklungsstand oder andere Faktoren zurückzuführen ist - wird in diesem Buch die Auseinandersetzung mit den Haltungen und Einstellungen der Erzieher*innen ebenfalls einen weiten Raum einnehmen. Wie wichtig die ständige Überprüfung der eigenen Einstellung ist, bemerkt der Praktikant Mark bei einem Gespräch mit seiner Anleiterin Sonja. Er berichtet:
Wir haben ja im Moment drei Mädchen in der Gruppe, die alle ungefähr ein Jahr alt sind. Die spielen gerne miteinander, also meist eher nebeneinander. Eben standen sie an der Fensterbank. Elisa sah zu, was die anderen machten. Frederike hatte Duplo-Steine auf die Fensterbank gelegt, die sie dann wieder durch die Gegend warf, das Werfen hatte sie ja gerade für sich entdeckt. Ab und an traf sie aus Versehen auch einmal Elisa oder Antje. Plötzlich zog Antje ganz aggressiv Elisa an den Haaren. Ich habe dann mit Antje geschimpft und Elisa getröstet. Ich verstehe Antjes Verhalten nicht.“
Mark ist sichtlich aufgebracht. Er wird nachdenklich, als Sonja ihn auf Gemeinsamkeiten im Verhalten von Antje und Frederike hinweist: Beide wollen etwas ausprobiere, Frederike das Werfen und Antje die Beschaffenheit von Haaren. Vielleicht möchte sie die Haare auch zu sich heranziehen, damit sie sie in den Mund stecken kann, wie die meisten Dinge, die sie untersucht. Beide müssen lernen, dass sie mit ihrer Neugier und ihren Übungen nicht anderen Schmerzen zufügen dürfen.
Bei diesem Prozess ist die Bewertung des einen Verhaltens als „Aggression“ und des anderen als „Übung“ wenig hilfreich, weder für die Kinder noch für die Erziehenden. Um „wirklich aggressives Verhalten“ von „aggressiv aussehendem Verhalten“ genauer abgrenzen zu können, werden in den folgenden beiden Kapiteln verschiedene Erklärungsansätze vorgestellt.
Schlussfolgerungen: In der Praxis macht es wenig Sinn, jedes „in Angriff nehmende Verhalten“ als Aggression zu bezeichnen, da sich bei diesem weit gefassten Begriff die Grenze zwischen tolerierbarem und nicht zu tolerierendem Verhalten nur schwer ziehen lässt. Denn dass Kinder auf ihre Umwelt zugehen, etwas in Angriff nehmen, soll gefördert werden. Die bewusste Schädigung anderer soll vermieden werden – diese Entscheidung ist eindeutig. Abgesehen davon verfügen Kinder unter drei Jahren meist noch nicht über den entsprechenden Grad an Bewusstheit.
2.Erklärungsmodelle für Aggressionen
Aggressives Verhalten untereinander und den Erziehenden gegenüber scheint in der U-3-Gruppe zum Alltag zu gehören, zum Beispiel bei einer Auseinandersetzung um ein Spielzeug.
Selma (2;7) und Anna (3;0) stehen vor dem Regal mit den Spielen und Puzzles; sie wissen noch nicht genau, womit sie sich jetzt beschäftigen wollen. Dann entdecken sie beide zur gleichen Zeit das Tierkinderpuzzle und greifen danach. Jede zerrt an dem Kasten: „Das ist meins!“ und „Nein ich!“ streiten sie erst leise, dann immer lauter und aufgeregter. Sie beginnen, gegenseitig zu treten und sich zu schubsen, bis der Kasten aufgeht und die Puzzleteile sich vor dem Regal verteilen. Jetzt weinen beide.
Es gibt viele Erklärungen für das Auftreten von aggressivem Verhalten, z.B. „Aggression ist angeboren“, „Bestimmte gesellschaftliche Strukturen fördern Aggressionen“, „Aggression ist gelernt“. Diese Sätze sind natürlich nur Schlagworte, die jeweils ein Erklärungsmodell kennzeichnen. Die meisten beziehen sich jedoch auf ältere Kinder, Jugendliche oder Erwachsene und sind nicht unbedingt auf kleine Kinder zu übertragen. Daher werde ich hier nur auf die Erklärungen eingehen, die für die Arbeit mit Kleinstkindern eine besondere Rolle spielen.
2.1 Sind Aggressionen angeboren?
Besonders bekannt ist die Annahme, dass Aggression auf einem angeborenen Trieb beruht, wobei dieser Trieb einen Impuls, eine Art Motivation darstellt. Diese Annahme wird von dem Psychologen Sigmund Freud und dem Verhaltensforschers Konrad Lorenz geteilt, Angesichts des Streites von Selma und Anna z.B. könnten Anhänger dieser Richtung der Meinung sein: „Natürlich streiten sich die beiden; sie haben einen angeborenen Impuls, sich aktiv und zur Not auch aggressiv für ihre Bedürfnisse einzusetzen.“
Nach Konrad Lorenz (1903 – 1989) spricht für diese These unter anderem die Tatsache, dass aggressives Verhalten universell anzutreffen ist. Seiner Meinung nach ist eine derartige spontane Bereitschaft zum Kampf für Lebewesen überlebenswichtig. Ansonsten wären sie nicht in der Lage ausreichend für ihr Dasein zu sorgen. Seine Schlussfolgerungen hat er allerdings auf Grund von Beobachtungen im Tierreich gezogen. (Lorenz 1963)
Bereits ungefähr fünfzig Jahre vor Lorenz spricht bereits Sigmund Freud (1856 – 1939) in seinen späteren Jahren von Aggression als einem nach außen geleiteten Todestrieb, dem Aggressionstrieb (Freud 1920/1975). Auch er geht von aggressiven Impulsen aus, die im Menschen entstehen und abgebaut werden müssen. Man vermutet, dass er versuchte, sich mit Hilfe dieses Konstrukts unter anderem die Geschehnisse des ersten Weltkrieges und den Tod zweier Söhne als Soldaten erklärbar zu machen. (Dückers, 24) Aber für seine und Lorenz Annahmen lassen sich kaum empirische Belege finden. Feststellen lässt sich allerdings, dass Menschen über „eine körperlich-affektive`Alarmreaktion` auf aversive, negativ erlebte Ereignisse“ verfügen (Nölting,54)
Dem sechs Monate alten Bill ist es auf dem Wickeltisch endlich gelungen, die offene Cremedose zu erwischen, die er schon so lange im Blick hatte. Schnell nimmt Sonja sie ihm wieder aus der Hand. Sein darauffolgendes Geschrei, die Mimik, die Fäuste: alles drückt Missfallen und Ärger aus. Sein Atem geht schneller, sein Cortisolspiegel steigt vermutlich an (ein Hormon, das Stress signalisiert). Wäre er älter, wäre er jetzt vermutlich. „kampfbereit“, würde versuchen, die Dose wieder an sich zu nehmen.
Mithilfe dieser Aktivierung sind wir imstande, Gefahren zu begegnen oder Hindernisse aus dem Weg zu räumen. So kann z.B. ein zweijähriges Kind, das morgens hinter seiner Mutter herlaufen will und von einer Erzieherin festgehalten wird, erstaunliche und ungeahnte Kräfte entwickeln, um von diesem „Hindernis“ loszukommen.
„Weiterhin angeboren sind einige elementare Fähigkeiten, die entweder schon bei der Geburt vorhanden sind oder sich aufgrund der genetisch gesteuerten Reifungsprozesse entwickeln, z. B. Schreien, Treten, Stoßen, Zerren usw.“ (Nölting, 54)
Dass die genannten Fähigkeiten elementar sind und sehr früh auftreten, wissen viele Menschen aus eigener Erfahrung. So können Schwangere bereits über die Fähigkeit der Ungeborenen berichten zu treten.
Allerdings lässt sich aus der Tatsache, dass wir alle die Fähigkeit zum aggressiven Verhalten haben, nicht notwendig schließen, dass diesem Verhalten ein angeborener Trieb zugrunde liegt. Wer würde wegen der angeborenen Fähigkeit zum Schwimmen automatisch von einem „Schwimmtrieb“ ausgehen? Aus diesen und anderen Gründen (z.B. nachzulesen bei Nölting, 49ff) könnten wir es bei dem Fazit von Nölting (49) belassen: “Dieser Ansatz hat heute nur noch historische Bedeutung.“ Warum werden diese Überlegungen dann hier trotzdem aufgegriffen? Weil sie bis heute wirken und nachwirken, zum Beispiel:
– Dückers bemerkt zum „eindringlichen Schreien“ eines Babys auf Grund von Hunger: „Dass es sich dabei um ein angeborenes Aggressionspotential handelt, bestreitet heute kaum ein Forscher ernsthaft.“ (Dückers,24) Solche Gedanken haben in der Praxis ihre Konsequenzen. Das folgende Beispiel soll verdeutlichen, welche Auswirkungen es haben kann, je nachdem, ob die Energie, mit der ein Kleinkind sich für die Sicherung seiner Grundbedürfnisse einsetzt, als „Aggression“ oder als „notwendige Selbsterhaltung“ angesehen wird.
Luna (4 Monate) schreit, weil sie Hunger hat. Ihre Mutter bereitet das Fläschchen vor und murmelt dabei: „Meine Güte, bist du heute wieder sauer! Dabei hattest du vor kurzem erst ein Fläschchen. So langsam musst du dich aber mal an die Essenszeiten gewöhnen. Ich kann mich ja nicht immer nach deinem Geschrei richten.“
Auch Elias ist vier Monate alt und schreit vor Hunger. Seine Mutter redet laut, damit Elias sie hören kann, während sie das Fläschchen fertig macht: „Meine Güte, hast du schon wieder Hunger? Und kannst nur schreien, damit ich das merke. Ich bin ja schon dabei, gleich kannst du trinken. Sieh mal, hier.“
–





























