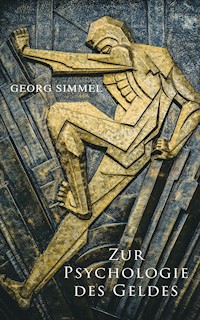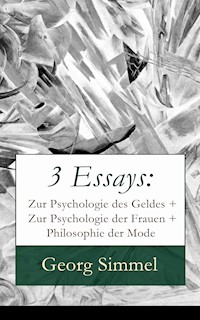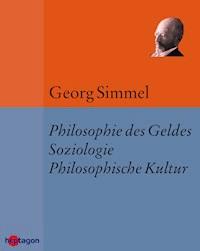Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Elementare Fragen und Probleme der Philosophie beleuchtet Simmel in folgenden Kapiteln: Einleitung 1. Kapitel: Vom Wesen der Philosophie 2. Kapitel: Sein und Werden 3. Kapitel: Vom Subjekt und Objekt
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hauptprobleme der Philosophie
Georg Simmel
Inhalt:
Georg Simmel – Biografie und Bibliografie
Hauptprobleme der Philosophie
Einleitung
1. Kapitel: Vom Wesen der Philosophie
2. Kapitel: Sein und Werden
3. Kapitel: Vom Subjekt und Objekt
4. Kapitel: Von den idealen Forderungen
Hauptprobleme der Philosophie, Georg Simmel
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849617035
www.jazzybee-verlag.de
Georg Simmel – Biografie und Bibliografie
Geb. 1. März 1858 in Berlin, gest. 26. September 1918 in Straßburg.
S. verbindet die psychologisch-genetische, evolutionistische mit einer logisch-idealistischen, an Kant und Hegel orientierten, vielfach »dialektischen« Betrachtungs- und Denkweise. Das Erkennen enthält apriorische Faktoren, die aber (als Kategorien) eine Entwicklung durchmachen, nicht unverändert bleiben. Alle Formen und Methoden des Erkennens haben sich im Verlaufe der menschlichen Geistesgeschichte entwickelt und entwickeln sich weiter, so aber, daß das Erkennen eine formende, gesetzgebende Aktivität des Geistes bleibt, welche aus dem Chaos der Erlebnisse erst einen sinnvollen, verständlichen, einheitlichen Zusammenhang gestaltet. Die Kategorien usw. stammen aus »der dem Geiste eigenen Fähigkeit, zu verbinden, zu vereinheitlichen«, können aber als historische Gebilde die Totalität der Weltinhalte nie völlig adäquat aufnehmen. Das Ich hat die Funktion der Einheitsetzung, das Streben zur Einheit. Die Wahrheit ist, rein logisch, etwas Zeitloses, Absolutes, vom subjektiven Denken Unabhängiges, sie gehört dem »dritten Reich«, dem »Reich der ideellen Inhalte« an; diese Inhalte sind wahr, gleichviel ob sie gedacht werden oder nicht. Das Geistige bildet inhaltlich einen geschlossenen Zusammenhang, den unser individuelles Denken unvollkommen nachzeichnet. Die ideellen Inhalte sind nicht, sie gelten, sie sind nicht mit den psychologischen Vorgängen zu verwechseln. Anderseits hat die Wahrheit auch eine biologisch-evolutionistische Seite. Wahr sind hier jene Vorstellungen, die, als reale Kräfte in uns wirksam, »uns zu nützlichem Verhalten veranlassen« (vgl. James). Durch Selektion haben sich bestimmte Vorstellungen als wahr erhalten, nämlich jene, »die sich als Motive des zweckmäßigen, lebenfördernden Handelns erwiesen haben« (vgl. Nietzsche). »Die Nützlichkeit des Erkennens erzeugt zugleich für uns die Gegenstände des Erkennens.« Es gibt so viele prinzipielle »Wahrheiten«, als es verschiedene Organisationen und Lebensanforderungen gibt. Das Objektive und Wahre bedeutet die »gattungsmäßige Vorstellung«.
Auch in der Ethik verbindet S. die genetisch-relativistische Betrachtungsweise betreffs der empirischen Einzeltatsachen mit einem gewissen Apriorismus und Idealismus. So ist das Sollen etwas Ursprüngliches und Objektives, als eine Forderung, die mit der Sache selbst gegeben ist, als ein »in dem Verhältnis von Seele und Welt präformiertes Sollen, das einer besonderen, aber nicht weniger übersubjektiven Logik unterliegt, wie das Sein«. Unser Bewußtsein empfindet Forderungen an sich, die es durch den Willen realisieren kann. Das Sollen schlechthin ist eine »Urtatsache«, eine »ursprüngliche Kategorie«, mag auch der Inhalt des Sollens noch so wechseln und sozial-historisch bedingt sein. Tatsächlich sind es immer »historische Zustände der Gattung, die in dem Einzelnen zu triebhaftem Sollen werden«. Der »Wille der Gattung« kommt in uns zum Ausdruck, kündigt sich imperativisch an. Ein ungeheurer Teil der an uns gestellten Ansprüche ist sozialen Inhalts, ohne daß dadurch die Unbedingtheit des idealen Sollens überhaupt, die »innere Logik ideeller Ansprüche« beeinträchtigt wird. Das sittlich Gute besteht nicht im Anstreben des Glücks u. dgl. (gegen den Eudämonismus), sondern es ist eine »unmittelbare Qualität und Lebensform des Willensprozesses«. Etwas ist gut, weil und wofern es Inhalt eines an sich guten Willens ist. Die moralischen Imperative sind »Ausmündungen, Ausformungen, Substantialisierungen des guten Willens«. Die Sittlichkeit liegt nicht im Material des Willens, sondern in diesem selbst, in dessen Funktion. Das Ideal des sittlichen Verhaltens liegt im Unendlichen. Das Sollen kann sich an den verschiedensten Inhalten verwirklichen; die Einheit des Zieles ist nicht notwendig, es genügt die Einheit der psychologisch-ethischen Funktion, die den Zweck trägt. Ursprünglich ist das sozial Erforderte die Norm des Verhaltens der Einzelnen. Den »kategorischen Imperativ« Kants kritisiert S. nach der Richtung der Versöhnung des Individualismus mit der Allgemeinheit des Handelns. Das Gewissen ist nach S. gleichsam ein »rückwärts gewandter Instinkt«; es ist die.Lust oder Unlust der Gattung über die Tat, die in uns zum Ausdruck kommt. Der Altruismus ist ebenso primär wie der Egoismus, er ist »Gruppenegoismus«, ein vererbter Instinkt. Sehr oft. »machen die Motivierungen unserer Handlungen... an Punkten Halt, die völlig und definitiv außerhalb unser selbst liegen«. Auch enthält das Ich noch eine Fülle von Motiven außer dem »Glück«. – Die Freiheit des Willens bedeutet, daß sich der Charakter des Ich ungehindert im Wollen ausprägen kann, das Vermögen, das für uns wertvolle Wollen realisieren zu können. Freiheit ist »Selbstbestimmung«, sie ist zugleich, weil das Ich nur so sein kann, wie es ist, Notwendigkeit. Die Verantwortlichkeit ist nicht aus der Willensfreiheit abzuleiten, sondern umgekehrt: »Derjenige ist frei, den man mit Erfolg verantwortlich machen kann.« Zurechnungsfähig ist jemand, wenn die strafende Reaktion auf seine Tat bei ihm den Zweck: der Strafe erreicht.
Die Grundfrage der Geschichtsphilosophie ist die: wie ist Geschichte möglich? Geschichte ist nur durch Kategorien, apriorische Verbindungsformen möglich, sie ist kategorial verbreitete Wirklichkeit und daher hat die Geschichtsphilosophie die »Aprioritäten festzustellen und zu erörtern, durch welche aus dem Erleben... Geschichte als Wissenschaft wird«. Die Kompliziertheit des historischen Geschehens gestattet nicht die Aufstellung eigener historischer Gesetze, wenn auch das Historische auf (biologisch-psychologischen) Gesetzmäßigkeiten beruht. Das ganze Spiel der Geschichte ist die Folge, Erscheinung oder Synthese dieser primären Gesetzmäßigkeiten, geht aber nicht aus einem besonderen Gesetz hervor.
Die Soziologie ist die »Wissenschaft vom Gesellschaftlichen als solchen, von den Formen der Vergesellschaftung, von den Beziehungsformen der Menschen zueinander«. Die Soziologie ist keine Universalwissenschaft vom Menschen u. dgl., sondern eine besondere Methode; sie abstrahiert vom Inhalt des Gesellschaftlichen, achtet nur auf dieses, wie der Mathematiker etwa nur auf die geometrische Form, nicht auf das Material der Körper achtet. Die Soziologie, hat die »Kräfte, Beziehungen und Formen zum Gegenstand, durch die die Menschen sich vergesellschaften«, sie ist die »Lehre von dem Gesellschaft-Sein der Menschheit«. »Gesellschaft im weitesten Sinne ist offenbar da vorhanden, wo mehrere Individuen in Wechselwirkung treten. Die besonderen Ursachen und Zwecke, ohne die natürlich nie eine Vergesellschaftung erfolgt, bilden gewissermaßen den Körper, das Material des sozialen Prozesses; daß der Erfolg dieser Ursachen, die Förderung dieser Zwecke gerade eine Wechselwirkung, eine Vergesellschaftung unter den Trägern hervorruft, das ist die Form, in die jene Inhalte sich kleiden.« Solche Formen sind Über- und Unterordnung, Konkurrenz, Arbeitsteilung usw.; wichtig sind besonders auch die kleinen, flüchtigen Wechselwirkungen von Person zu Person. Die sozialen Verbindungen erwachsen aus bestimmten Trieben oder Willenstendenzen (Zielen), sind etwas Psychisches, aber nichts Psychologisches, denn die Soziologie hat es nicht mit psychologischen Vorgängen, sondern mit Inhalten solcher zu tun, mit Kombinationen soziologischer Kategorien, mit etwas Sachlichem. Es gibt keinen Gesamtgeist, wohl aber eine seelische Beeinflussung der Individuen durch ihre Vergesellschaftung. In der Gesellschaft herrscht Arbeitsteilung und Differenzierung, verbunden mit Integrierung, indem jede Befreiung zu einer neuen Bindung führt. Die Religion wurzelt in den Gesamttendenzen der Persönlichkeit und ihrer Beziehung zum All.
SCHRIFTEN: Das Wesen der Materie nach Kants physischer Monadologie, 1881. – Über soziale Differenzierung, 1890; 3. A. 1906, – Einleit. in die Moralwissenschaft, 1892-93; 2. A. 1901. – Die Probleme der Geschichtsphilosophie, 1892; 2. A. 1905; 3. A. 1907. – Philosophie des Geldes, 1900; 2. A. 1907. – Vorlesungen über Kant, 1904; 2. A. 1905. – Die Religion, 1906. – Schopenhauer u. Nietzsche, 1906. – Soziologie, 1908. – Hauptprobleme der Philosophie, 1910. – Das Problem der Soziologie, Schmollers Jahrbücher, Bd. 18, 1894. – Skizze einer Willenstheorie, Zeitschr, f. Psychol. d. Sinnesorgane, Bd. 9, – Beitrag zur Erkenntnistheorie der Religion, Zeitschr. f. Philos., Bd. 118. – Über eine Beziehung der Selektionslehre zur Erkenntnis, Archiv f. systemat, Philos., 1895. – Über die Grundfrage des Pessimismus, Zeitschr. f. Philos., Bd. 90. – Zur Psychologie der Frau, Zeitschr. f. Völkerpsychol, 1890, u. a.
Hauptprobleme der Philosophie
Einleitung
Man hat das Verständnis der Kunst so gedeutet, dass der Beschauer den Schaffensprozess des Künstlers in einer bestimmten Art wiederhole.
Und wie tatsächlich das große Kunstwerk das ganze Strahlenbündel des Lebens, das zu ihm als zu seinem Gipfel führt, fühlbar macht und damit den ganzen Verdichtungs- und Erhöhungsprozess des künstlerischen Schaffens gleichsam in uns überträgt, so ist der große philosophische Gedanke das sublimierteste Resultat eines weitausgreifenden Lebens, das uns jener Gedanke nachzuerleben, bis es in ihn selbst mündet, veranlasst.
Wie aber mit jenem innerlich nachschaffenden Begreifen des Kunstwerks doch erst eine lange und hingebende Werbung um die Kunst belohnt wird, so öffnen die abstrakten und starren Begriffe der philosophischen Systeme ihre innere Bewegtheit und die Weite des Weltfühlens, das sich in sie hineingelebt hat, nur dem Blick, der sich lange um sie und die Erregungen ihrer Tiefen bemüht hat.
Dieses Verständnis der Philosophie von dem inneren Prozess her, dessen Lebendigkeit in ihr die Kristallform des Begriffes angenommen hat - dieses Verständnis zu erleichtern haben sich die Darstellungen der Geschichte der Philosophie, wenn ich mich nicht täusche, nicht allzuhäufig zum Problem gemacht; sie pflegen vielmehr das Letzte und Zugespitzteste der Resultate des Denkens darzubieten, deren logisch geschlossene Formung sich in dem weitesten Abstand von der lebendig-kontinuierlichen Strömung des Schaffensprozesses hält.
Indem das Recht solcher Darstellung, die die Resultate des Denkvorganges, gleichsam in deren eigner Ebene verbleibend, erfassen will, unangetastet bleibt, erscheint mir daneben doch der Versuch gerechtfertigt, zu jenem andern Verständnis anzuleiten, das mehr unmittelbar auf die geistige Bewegung, als auf das von ihr gestaltete Gebilde, mehr auf den geistigen Zeugungsvorgang, als auf das schließliche Erzeugnis geht und das bisher, im großen und ganzen, nur der Philosoph dem Philosophen gegenüber besessen hat, weil seine eigne Produktivität das Organ jenes inneren Nachschaffens voraussetzt und ausbildet.
Dieser Aufgabe, das innerliche, miterlebende, die Bedingungen der Produktion nachfühlende Verständnis außerhalb des Kreises der Profession zu fördern, will ich hier durch Darstellung und Erwägung einiger hauptsächlicher, historisch vorliegender Probleme und Lösungsversuche dienen, und zwar unter Zugrundelegung einer gewissen Fiktion.
Ich möchte die Bilder dieser großen Philosopheme so geben, wie sie sich etwa einem Philosophen darstellen, der eine eigne Lösung ihrer Probleme sucht und zu diesem Zwecke die bereits vorliegenden Lösungen sich vergegenwärtigt und erwägt.
Die Absicht eines solchen wäre keine historische, sondern eine sachliche, d.h. das Problem wäre ihm nicht wichtig, weil Plato und Hegel es behandelt haben, sondern Plato und Hegel sind ihm wichtig, weil sie das Problem behandelt haben.
Darum werden in dem Fluss seines Denkens ihre Lehren gewissermaßen nur als besonders geformte Wellen auftauchen, ohne, als Selbstzwecke, dessen Kontinuität zu unterbrechen.
Da sie jetzt nur Stationen seines eignen Gedankenweges sind, so legen sie die systematische Form ab, deren starre Geschlossenheit so oft das Eindringen in ihr inneres Leben hindert und die als dessen vergänglichste Hülle sowieso von der geistesgeschichtlichen Entwicklung desavouiert wird.
So wird am ehesten die eigne Geistesbewegung die Konturen des überlieferten Gedankens nachzeichnen und sich in ihn ergießen können, der ohne diese Transfusion und Einfühlung im letzten Grunde unzugängig bleibt.
1. Kapitel: Vom Wesen der Philosophie
Wenn man zu den Gedankenmassen, die unter dem Begriff der Philosophie gesammelt sind, einen Eingang sucht, eine Bestimmung dieses Begriffes von einem Orte der geistigen Welt her, der nicht selbst schon in den philosophischen Bezirk hineingehört, so kann sich dieses Bedürfnis an der gegebenen Struktur unseres Erkennens nicht befriedigen.
Denn was Philosophie ist, wird tatsächlich nur innerhalb der Philosophie, nur mit ihren Begriffen und Mitteln ausgemacht: sie selbst ist sozusagen das erste ihrer Probleme.
Vielleicht richtet keine andre Wissenschaft ihre Fragestellung in dieser Art auf ihr eignes Wesen zurück. Der Gegenstand der Physik ist doch nicht die physikalische Wissenschaft selbst, sondern etwa optische und elektrische Erscheinungen, die Philologie fragt nach den Plautushandschriften und der Kasusentwicklung im Angelsächsischen - aber nach der Philologie fragt sie nicht.
Die Philosophie, und vielleicht also sie allein, bewegt sich in diesem eigentümlichen Zirkel: innerhalb ihrer eignen Denkweise, ihrer eignen Absichten, die Voraussetzungen dieser Denkweise und Absichten zu bestimmen.
Es gibt von außen keinen Zugang zu ihrem Begriff, weil nur die Philosophie selbst ausmachen kann, was die Philosophie sei, ja, ob sie überhaupt sei oder etwa mit ihrem Namen nur ein geltungsloses Phantasma decke.
Dieses einzigartige Verhalten der Philosophie ist die Folge oder vielleicht nur der Ausdruck ihrer grundlegenden Bemühung: voraussetzungslos zu denken.
Wie es dem Menschen überhaupt nicht gegeben ist, ganz und gar "von vorn anzufangen", wie er in sich und außer sich immer eine Wirklichkeit oder eine Vergangenheit vorfindet, die seinem Verhalten einen Stoff, einen Ausgangspunkt oder wenigstens ein Feindseliges und zu Vernichtendes bietet - so ist auch unser Erkennen von irgendeinem "Vorgefundenen" bedingt, von Realitäten oder inneren Gesetzen; von ihnen, die der Denkprozess selbst nicht erzeugen kann, hängt, in mannigfaltigster Beschränkung seiner Souveränität, sein Inhalt und seine Richtung ab - und seien es auch nur die Regeln der Logik und der Methode oder das Faktum einer bestehenden Welt.
Wo nun das Denken dennoch versucht, sich jenseits von Voraussetzungen überhaupt zu stellen, beginnt es zu philosophieren. Im ganz radikalen Sinne freilich wird dieser Versuch selten auch nur unternommen.
Es wird vielmehr in der Regel ein Erkenntnisbild erstrebt, das von irgendwelchen einzelnen Voraussetzungen unabhängig ist: von dem unmittelbaren Eindruck der sinnlichen Welt oder von den hergebrachten moralischen Wertungen, von der selbstverständlichen Gültigkeit der Erfahrung oder der ebenso selbstverständlichen Realität göttlicher Mächte.
Aber selbst in solcher Begrenzung unterscheidet sich die philosophische Voraussetzungslosigkeit von der andrer Gebiete durch die mitschwebende Stimmung: dieses Sich-selbst-Gehören des Denkens, diese von nichts Äußerem gebundene Konsequenz seiner betreffe, über die momentane Einzelheit hinaus, das Ganze des Erkennens, ja, des Lebens.
Die vollkommene Voraussetzungslosigkeit ist freilich unerreichbar.
Wo auch das Erkennen einsetzt, irgend etwas ist schon vorausgesetzt, das uns entweder als ein Dunkles, nicht zu Bewältigendes ängstigt, oder umgekehrt uns ein Halt in der Relativität, dem Fließen, dem Nur-sich-selbst-Haben der Erkenntnis ist.
Darum ist die absolute Voraussetzungslosigkeit zwar ein richtunggebendes, aber nicht ein erreichbares Ziel des philosophischen Denkens, während sie dies in andern Wissensgebieten von vornherein nur in relativem Maße ist.
Wo sich die Philosophie zur Erkenntnistheorie entwickelt, hat dies den tieferen Sinn, dass sie nun die Voraussetzungen des Erkennens, auch des philosophischen selbst, aufsucht und anerkennt, oder eben dadurch dies außerhalb ihrer Gelegene in ihre Jurisdiktion, ihre Erkenntnisformen einbezieht.
Diese, im Begriff der Philosophie gelegne Voraussetzungslosigkeit, diese innere Autonomie ihres Denkprozesses hat begreiflicherweise jene Folge: dass sie ihr Problem mit ihren eignen Mitteln bestimmt, dass, wenn ihr Gegenstand, ihre Ziele und Wege untersucht werden, es nur innerhalb ihrer selbst geschehen kann.
Diese Folge hat aber ihrerseits eine wichtigere Konsequenz.
Das Recht und die Pflicht der Philosophie, sich mit größerer Unabhängigkeit von dem Gegebenen, als sie in andern Erkenntnisprovinzen besteht, ihr Objekt selbst zu fixieren, bringen es mit sich, dass die verschiedenen philosophischen Lehren auch von grundsätzlich verschiedenen Problemstellungen ausgehen.
In jeder andern Wissenschaft besteht ein allgemeiner, prinzipiell anerkannter Erkenntniszweck, der sich sozusagen erst in einer oberen Schicht in die Mannigfaltigkeit der Sonderaufgaben zerlegt. In der Philosophie allein bestimmt jeder der überhaupt originalen Denker nicht nur, was er antworten, sondern auch, was er fragen will - fragen nicht nur im Sinn jener Sonderaufgaben, sondern was er überhaupt zu fragen hat, um dem Begriff der Philosophie zu entsprechen.
Diesen Begriff bestimmt z.B. Epikur als die Bemühung, durch Gründe und Überlegungen zu einem glückseligen Leben zu gelangen, Schopenhauer als das Bestreben, durch Vorstellungen zu dem zu gelangen, was nicht Vorstellung ist, d.h. zu dem jenseits der empirischen Erscheinung, mit der die andern Wissenschaften sich beschäftigen; für das Mittelalter ist die Philosophie die Magd der Theologie, die Begründung der religiösen Wahrheiten, für den Kantianismus die kritische Besinnung der Vernunft auf sich selbst; während sie einerseits rein ethisch bestimmt wird als die Untersuchung dessen, was für die praktischen Lebensideale des Menschen bedeutsam ist, erscheint sie anderswo als eine logische Bearbeitung des Weltbildes, um dessen ursprünglich vorgefundene Widersprüche zu überwinden.
Aus dieser - beliebig vermehrbaren Mannigfaltigkeit der philosophischen Zielsetzungen ergibt sich unzweideutig: dass der einzelne Philosoph das scheinbar ganz allgemeine, gegenüber aller Antwort noch unparteiliche Problem dennoch von vornherein so stellt, wie es der Antwort, die er geben will, entspricht. Jene Personalität des philosophischen Denkens verhindert es, dass ein allgemeines Erkenntnisziel, über die Zentriertheit der Denkbewegung in sich selbst hinausreichend, gegeben werde.
Man könnte fast sagen, die philosophische Produktivität des originellen Denkens sei etwas in sich so Einheitliches, so sehr der intellektuelle Ausdruck eines in sich geschlossenen Seins, dass Frage und Antwort erst eine nachträgliche Spaltung des Denkbildes bedeuteten.
In viel geringerem Maße mindestens, als auf andern Gebieten, ist hier das Problem ein gemeinsames und die Lösung eine besondere; vielmehr, wenn diese die jeweilig bestimmte sein soll, so kann von vornherein das Problem nur in der bestimmten, auf jene zugespitzten Art gestellt werden.
Was aber bleibt, wenn jede Definition nur für die besondere Philosophie des besonderen Denkers gilt, noch übrig, um die Gemeinsamkeit des Namens für so auseinandergehende Bestrebungen zu rechtfertigen? Vielleicht wird man, um hier zu einer Antwort zu kommen, die Frage aus ihrer bisherigen Richtung herausdrehen müssen.
So lange Zweck und Inhalt der Philosophie ihre Definitionen bestimmen, scheint ihr Gesamtgebiet keinen Generalnenner zu besitzen; aber noch könnte dieser in dem Verhalten der Philosophen selbst liegen - nicht in den Resultaten ihres Denkens, sondern in einer Grundbedingung, unter der all jene, in ihren Verzweigungen nicht mehr zusammenzubringenden Resultate allein gewonnen werden können.
Es handelt sich um eine formale innere Beschaffenheit des Philosophen als solchen, die nicht als psychologische "Lebensstimmung" gemeint ist, sondern als die sachliche, wenn auch natürlich nur in seelischer Verwirklichung lebendige Bedingung alles Philosophierens überhaupt.
Man kann den Philosophen vielleicht als denjenigen bezeichnen, der das aufnehmende und reagierende Organ für die Ganzheit des Seins hat.
Der Mensch ist im allgemeinen - dafür sorgt schon die Praxis des Lebens - immer auf irgendwelche Einzelheiten gerichtet; mögen sie sehr klein oder sehr groß sein: der tägliche Broterwerb oder ein kirchliches Dogma, ein Liebesabenteuer oder die Entdeckung der Periodik der chemischen Elemente - es bleiben immer Einzelheiten, die das Sinnen, das Interesse, die Betätigung erwecken. Der Philosoph aber hat, natürlich in sehr verschiedenen Maßen und niemals in absolut vollkommenem, einen Sinn für die Gesamtheit der Dinge und des Lebens und - insoweit er produktiv ist - die Fähigkeit, diese innere Anschauung oder dieses Gefühl des Ganzen in Begriffe und ihre Verknüpfungen umzusetzen.
Er braucht natürlich nicht immer vom Ganzen zu sprechen, ja vielleicht kann er das im genauen Sinne gar nicht; aber welche Spezialfrage der Logik oder der Moral, der Ästhetik oder der Religion er auch behandle - als Philosoph tut er es nur, wenn jene Beziehung zu der Totalität des Seins irgendwie darin lebt.
Nun ist natürlich die Ganzheit des Daseins im wirklichen Sinne niemandem zugängig und kann auf niemanden wirken. Sie muss erst aus den allein gegebenen Fragmenten der Wirklichkeit zustande gebracht werden - wenn man will: als "Idee" oder auch nur als Sehnsucht -, um so erst die Reaktion des philosophischen Intellekts hervorzurufen.
So ist freilich damit ein Wechsel diskontiert, der nie mit seinem vollen Betrage eingelöst werden wird. Aber dies philosophische Produzieren eines objektiven Ganzen aus den Fragmenten der Objektivität und der Weiterbau auf dem so Produzierten ist nur die äußerste Steigerung eines allgemeinen Verfahrens.
So leuchtet z.B. dem Historiker aus den Bruchstücken der Überlieferung die Ganzheit eines Charakters entgegen, auf die er seine Darstellung aufbaut; ja, selbst die vollständigste Überlieferung kann hier jene innere Anschauung des Gesamtwesens nicht enthalten, sondern diese bleibt die spontane, wenn auch durch äußere Einzelheiten angeregte und gelenkte Tat einer merkwürdigen Energie, die man, um nur einen Namen dafür zu haben, das Totalisierungsvermögen der Seele nennen mag.
Und dieses wird, jenseits einer gewissen Größenschwelle, zur gemeinsamen Voraussetzung alles Philosophierens überhaupt, zu so individuellen - schon in jenen Definitionen der Philosophie ihre Individualität ausdrückenden - Gebilden dieses sich auch entwickle.
Es sind nun zwei prinzipielle Versuche geschehen, die Ganzheit des Seins dennoch in einer realeren Weise zu ergreifen und - sowenig sie von dahingehendem Bewusstsein und Absicht gelenkt waren - eine Verständlichkeit dafür zu schaffen, dass der Philosoph von dieser Ganzheit irgendwie berührt ist und intellektuell darauf antwortet.
Der eine ist der Weg der Mystik, der andre der Kants. - Ich lasse dahingestellt, ob die Mystik - als deren Typus ich hier die des Meister Eckhart wähle - ohne Vorbehalt der Philosophie zuzurechnen ist; vielleicht ist sie ein für sich stehendes geistiges Gebilde, jenseits von Wissenschaft wie von Religion; aber Eckharts Spekulation bewegt sich sozusagen in einer so allgemein menschlichen letzten Tiefe, dass die Philosophie seine Motive ohne weiteres in ihre Formen übertragen kann.
Das erste Glied der Reihe, in die seine Gedanken für unsern jetzigen Zweck zu ordnen sind, ist die absolute Eingeschlossenheit aller Dinge in Gott; insoweit sind sie alle ein Wesen, das einzelne ist nichts Individuelles für sich.
Erst durch das Geschehen, das Eckhart mit dem mystischen Symbole bezeichnet: dass Gott in Ewigkeit den Sohn gebäret - werden die Dinge in ihrer Mannigfaltigkeit.
Aber sie bleiben, ihrer Wurzel wie ihrer Substanz nach, des göttlichen Wesens.
Gott fließt in alle Kreaturen aus und darum ist alles Geschaffene Gott; kehrte sich Gott einen Augenblick ab, so würden sie zunichte.
Dieses Göttliche aber ist in sich schlechthin Einheit - Gott, der alles ist, ist "weder dies noch das", sondern "ein und einfältig in sich selber".
So ist also zunächst die Ganzheit der Welt in einen Punkt gesammelt. Dies aber gibt Eckhart die Möglichkeit, sie in die Seele überzuführen. Die Seele selbst hat zwar mannigfache Fähigkeiten, aber es ist ein Mittelpunkt in ihr, der von keiner kreatürlichen Mannigfaltigkeit berührt wird; Eckhart nennt ihn "das Fünkchen" - ein schlechthin "Eines und Einfältiges", der eigentliche Geist der Seele.
In diesem spricht Gott unmittelbar, ja, er ist überhaupt nicht mehr von Gott geschieden, er ist mit ihm "eins und (nicht nur) vereint": "hier ist Gottes Grund mein Grund und mein Grund Gottes Grund". An diesem Punkte erkennen wir alle Dinge in ihrem wahren Wesen, weil wir ihre Einheit in Gott haben, oder richtiger: sind; "mein Auge und Gottes Auge ist ein Auge und ein Gesicht".
Hier ist vielleicht das innerste Motiv der Verbindung, die von je zwischen Religion und Philosophie bestanden hat, am klarsten ausgesprochen.
An der Vorstellung Gottes hat der Gläubige das Ganze der Welt, auch wenn ihm all ihre unzähligen Einzelheiten fehlen.
Die Mystik sucht dies gewissermaßen anschaulich zu machen, indem sie das Wesen der Seele in einen letzten, einfachen Lebenspunkt sammelt, der von jener Einheit des göttlichen Wesens nicht mehr getrennt ist.
In den verschiedensten Formen geht dieses Motiv durch die religiöse Mystik und die philosophische Spekulation aller Zeiten hindurch: dass die tiefste, alle Mannigfaltigkeit überwindende Versenkung in uns selbst zugleich in die absolute Einheit der Dinge führt; es gäbe einen Punkt, an dem diese Einheit, in der Idee Gottes ausgesprochen, sich als das Wesen und die Einheit unser selbst offenbarte.
Die philosophische Attitüde, die ein Verhältnis des Geistes zum Ganzen der Welt bedeutet und angesichts der Maße des Individuums und der Welt als ein Widersinn, ja, ein Irrsinn erscheinen könnte, erhält damit eine metaphysische Rechtfertigung, sie erscheint als die intellektuelle Wendung jenes, wie es scheint, in allen Epochen des tieferen Menschheitslebens auftauchenden Gefühles: dass wir in den Grund der Welt gelangen, wenn wir uns in den Grund der eignen Seele versenken.
Von der entgegengesetzten Seite her gibt das Grundmotiv der Philosophie Kants eine Möglichkeit, jenes, im Weltgefühl des Philosophen vorweggenommene Wissen um die Ganzheit der Dinge zu begründen.
Kants Hauptwerk findet seinen Gegenstand nicht an dem Dasein, das als Ganzes gedacht wird oder das unmittelbar erlebt wird; sondern an ihm, insoweit es Wissenschaft geworden ist.
Dies ist die Form, in die jene Ganzheit der Dinge für ihn eingeht, um nach ihrem Wesen und nach ihren Bedingungen befragt zu werden.
Die Welt ist ihm Realität, insofern sie Inhalt der - schon gewonnenen oder möglichen - Wissenschaft ist; was den Bedingungen dieser nicht entspricht, ist nicht "wirklich". Und hierüber bedarf es einer weiter ausholenden Besinnung, ehe der Kantische Weg zu dem jetzt fraglichen Ziel verfolgt werden kann.
Es gibt vielleicht keine Notwendigkeit des Denkens, deren wir uns - obgleich sie weder logischen Zwang noch den der fühlbar gegebenen Tatsächlichkeit enthält - so wenig entschlagen können, als der Zerlegung der Dinge in Inhalt und Form.
In unzähligen, so und anders benannten Modifikationen durchzieht diese Scheidung unser Weltbild, als eine der Organisationen und Gelenkigkeiten, mit denen der Geist die in ihrer unmittelbaren Einheit ungefüge Masse des Daseienden sich gefügig macht. Schließlich erhebt sich über alle einzelnen Inhalte und variierenden Formen ein höchstes Gegensatzpaar: die Welt als Inhalt, als das in sich bestimmte, aber in seiner Unmittelbarkeit uns nicht ergreifbare Dasein - dadurch indess ergreifbar gemacht, dass es in einer Mannigfaltigkeit von Formen ausgestaltet ist, deren jede prinzipiell seine Ganzheit zu ihrem Inhalt gewinnt.
Die Wissenschaft und die Kunst, die Religion und die gefühlsmäßig-innerliche Verarbeitung der Welt, die sinnliche Auffassung und der Zusammenhang der Dinge nach einem Sinn und Wert - dies und vielleicht noch andre sind die großen Formen, durch welche jeder einzelne Teil des Weltinhaltes sozusagen hindurchpassieren kann oder soll.
Wie uns unsere Welt gegeben ist, zeigt sie an jedem Punkt ein inhaltliches Element, das in eine dieser Kategorien aufgenommen ist; denselben Inhalt meint unsre Reflexion bald unter dieser, bald unter jener Kategorie zu erblicken: eben denselben Menschen können wir als Gegenstand des Erkennens und der künstlerischen Formung haben, eben dasselbe Ereignis als Moment unseres inneren Schicksals und als Erweis eines göttlichen Eingreifens, eben denselben Gegenstand als rein sinnlichen Eindruck und als Moment einer metaphysischen Konstruktion des Daseins.
Es ist nun der Sinn jeder dieser großen Formen, jeden überhaupt vorhandenen Inhalt in sich aufnehmen zu können; die Kunst kann es ihrem Prinzip nach beanspruchen, den ganzen Umfang des Daseins zu gestalten, ebenso kann sich der Erkenntnis kein Stück der Welt entziehen, jedes Ding kann man nach seiner Stellung in irgendeiner Wertreihe fragen, auf ein jedes muss ein vollkommenes Gefühlsleben reagieren können usw.
Allein wenn, der Idee dieser Formen nach, eine jede die ganze Welt in ihre Sprache übersetzen kann, so lässt die Wirklichkeit sie dennoch nicht in diesem vollen Maß zu Worte kommen.
Und zwar deshalb nicht, weil jene Formen niemals in abstrakter Reinheit und absoluter Vollendung wirksam sind, sondern nur in den Grenzen und Besonderheiten, die die jeweilige Geisteslage ihnen lässt. Wir haben keine Kunst schlechthin, sondern die in der Zeltkultur gegebenen Künste, Kunstmittel und Stile.
Und da diese heute andere sind als gestern und als sie morgen sein werden, so reichen sie nur aus, bestimmte Inhalte künstlerisch auszugestalten, während andre in diesen jetzt verfügbaren artistischen Formungen kein Unterkommen finden - grundsätzlich aber allerdings zum Inhalt der Kunst werden könnten.
Eben sowenig haben wir die absolute Religion, die es gestatten würde, jedem Dinge, dem niedrigsten und zufälligsten wie dem höchsten einen religiösen Sinn, einen Zusammenhang mit allen in der Einheit des religiösen Grundmotivs zu geben; sondern wir haben nur historische Religionen, deren jede einen gewissen Teil der Inhalte von Welt, Seele, Schicksal religiös durchdringt, während ein andrer Teil draußen bleibt und sich der religiösen Formung entzieht.
Es ist immer dasselbe: das ideelle Recht jeder dieser großen Formen, aus der Gesamtheit der Inhalte je eine ganze Welt aufzubauen, realisiert sich nur in der unvermeidlichen Unvollkommenheit des historischen Gebildes, als welches sie allein lebendig ist, mit all den Zufälligkeiten, Anpassungen, Zurückgebliebenheiten oder Schiefheiten der Entwicklung, individuellen Einseitigkeiten, kurz all den Besonderheiten und den Ausfällen, die die historische, an die Umstände der Zeit gebundene Realität gegenüber der Idee und dem Prinzip aufweist.
Mit der wissenschaftlichen Erkenntnis kann es sich nicht anders verhalten. Die Begriffsbildung und die Art, Erfahrungen zu sammeln und zu ordnen, die Umbildung der sinnlichen Gegebenheit in ein naturgesetzliches oder geschichtliches Bild, die Kriterien von Wahrheit und Irrtum, kurz all die Formen und Methoden, in die aufgenommen die Weltinhalte zu Wissenschaftsinhalten werden, haben sich im Verlauf der menschlichen Geistesgeschichte entwickelt und entwickeln sich zweifellos weiter.
Zu dem Ideal der Wissenschaft, in die die Weltinhalte restlos aufgegangen seien, fehlt uns nicht nur die Fähigkeit, diesen Inhalt empirisch zu bewältigen, die Wissenschaftsform nun auch tatsächlich auf die ganze Unermesslichkeit der Dinge anzuwenden; sondern es fehlt uns auch die absolute, jeder Aufgabe überhaupt gewachsene Vollendung dieser Form selbst, da wir sie nur in den fortwährend modifizierten, nicht abgeschlossenen und für ein historisch-evolutionistisches Wesen, wie der Mensch es ist, auch niemals abzuschließenden Ausgestaltungen in der jeweiligen Erkenntnisepoche besitzen.
Allen Wahrscheinlichkeiten, allen Analogien, unzähligen tatsächlichen Hinweisen würde die Annahme widersprechen, dass die von unübersehbar mannigfaltigen historischen Umständen bedingten Formungen irgendeiner aktuellen Wissenschaft auch nur imstande wären, die Ganzheit des Daseins in sich aufzunehmen.
Wenn Fichte sagt, was für eine Philosophie jemand habe, hänge davon ab, was für ein Mensch er wäre - so gilt dies weit über die Philosophie und weit über den einzelnen Menschen hinaus.
Was für eine Wissenschaft die Menschheit in einem gegebenen Augenblick hat, hängt davon ab, was für eine Menschheit sie in diesem Augenblick ist; und wie sich die Unvollendetheit und geschichtliche Zufälligkeit ihres Seins zu der Idee ihrer Vollendung verhält, so ersichtlich die Formen und Kategorien, die für sie in jedem jetzt Wissenschaft bedeuten, zu jenen, die für die Gestaltung des gesamten Weltinhalts zur Wissenschaft zulänglich wären.