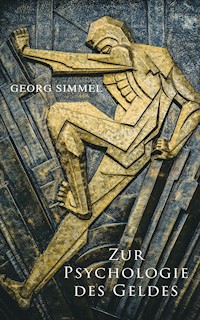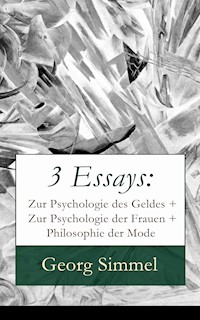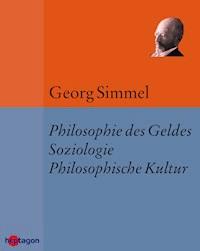Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieser Band beinhaltet die folgenden Werke Simmels: Die Überstimmung - Eine soziologische Studie Friedrich Nietzsche - Eine moralphilosophische Silhouette Henri Bergson Metaphysik des Todes Michelangelo als Dichter Nietzsche und Kant Persönliche und sachliche Kultur Philosophie der Landschaft Philosophie der Mode Philosophie des Abenteuers
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 248
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Essays und Schriften, Band 2
Georg Simmel
Inhalt:
Georg Simmel – Biografie und Bibliografie
Die Überstimmung - Eine soziologische Studie
Friedrich Nietzsche - Eine moralphilosophische Silhouette
Henri Bergson
Metaphysik des Todes
Michelangelo als Dichter
Nietzsche und Kant
Persönliche und sachliche Kultur
Philosophie der Landschaft
Philosophie der Mode
Philosophie des Abenteuers
Essays und Schriften, Band 2, Georg Simmel
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849616854
www.jazzybee-verlag.de
Georg Simmel – Biografie und Bibliografie
Geb. 1. März 1858 in Berlin, gest. 26. September 1918 in Straßburg.
S. verbindet die psychologisch-genetische, evolutionistische mit einer logisch-idealistischen, an Kant und Hegel orientierten, vielfach »dialektischen« Betrachtungs- und Denkweise. Das Erkennen enthält apriorische Faktoren, die aber (als Kategorien) eine Entwicklung durchmachen, nicht unverändert bleiben. Alle Formen und Methoden des Erkennens haben sich im Verlaufe der menschlichen Geistesgeschichte entwickelt und entwickeln sich weiter, so aber, daß das Erkennen eine formende, gesetzgebende Aktivität des Geistes bleibt, welche aus dem Chaos der Erlebnisse erst einen sinnvollen, verständlichen, einheitlichen Zusammenhang gestaltet. Die Kategorien usw. stammen aus »der dem Geiste eigenen Fähigkeit, zu verbinden, zu vereinheitlichen«, können aber als historische Gebilde die Totalität der Weltinhalte nie völlig adäquat aufnehmen. Das Ich hat die Funktion der Einheitsetzung, das Streben zur Einheit. Die Wahrheit ist, rein logisch, etwas Zeitloses, Absolutes, vom subjektiven Denken Unabhängiges, sie gehört dem »dritten Reich«, dem »Reich der ideellen Inhalte« an; diese Inhalte sind wahr, gleichviel ob sie gedacht werden oder nicht. Das Geistige bildet inhaltlich einen geschlossenen Zusammenhang, den unser individuelles Denken unvollkommen nachzeichnet. Die ideellen Inhalte sind nicht, sie gelten, sie sind nicht mit den psychologischen Vorgängen zu verwechseln. Anderseits hat die Wahrheit auch eine biologisch-evolutionistische Seite. Wahr sind hier jene Vorstellungen, die, als reale Kräfte in uns wirksam, »uns zu nützlichem Verhalten veranlassen« (vgl. James). Durch Selektion haben sich bestimmte Vorstellungen als wahr erhalten, nämlich jene, »die sich als Motive des zweckmäßigen, lebenfördernden Handelns erwiesen haben« (vgl. Nietzsche). »Die Nützlichkeit des Erkennens erzeugt zugleich für uns die Gegenstände des Erkennens.« Es gibt so viele prinzipielle »Wahrheiten«, als es verschiedene Organisationen und Lebensanforderungen gibt. Das Objektive und Wahre bedeutet die »gattungsmäßige Vorstellung«.
Auch in der Ethik verbindet S. die genetisch-relativistische Betrachtungsweise betreffs der empirischen Einzeltatsachen mit einem gewissen Apriorismus und Idealismus. So ist das Sollen etwas Ursprüngliches und Objektives, als eine Forderung, die mit der Sache selbst gegeben ist, als ein »in dem Verhältnis von Seele und Welt präformiertes Sollen, das einer besonderen, aber nicht weniger übersubjektiven Logik unterliegt, wie das Sein«. Unser Bewußtsein empfindet Forderungen an sich, die es durch den Willen realisieren kann. Das Sollen schlechthin ist eine »Urtatsache«, eine »ursprüngliche Kategorie«, mag auch der Inhalt des Sollens noch so wechseln und sozial-historisch bedingt sein. Tatsächlich sind es immer »historische Zustände der Gattung, die in dem Einzelnen zu triebhaftem Sollen werden«. Der »Wille der Gattung« kommt in uns zum Ausdruck, kündigt sich imperativisch an. Ein ungeheurer Teil der an uns gestellten Ansprüche ist sozialen Inhalts, ohne daß dadurch die Unbedingtheit des idealen Sollens überhaupt, die »innere Logik ideeller Ansprüche« beeinträchtigt wird. Das sittlich Gute besteht nicht im Anstreben des Glücks u. dgl. (gegen den Eudämonismus), sondern es ist eine »unmittelbare Qualität und Lebensform des Willensprozesses«. Etwas ist gut, weil und wofern es Inhalt eines an sich guten Willens ist. Die moralischen Imperative sind »Ausmündungen, Ausformungen, Substantialisierungen des guten Willens«. Die Sittlichkeit liegt nicht im Material des Willens, sondern in diesem selbst, in dessen Funktion. Das Ideal des sittlichen Verhaltens liegt im Unendlichen. Das Sollen kann sich an den verschiedensten Inhalten verwirklichen; die Einheit des Zieles ist nicht notwendig, es genügt die Einheit der psychologisch-ethischen Funktion, die den Zweck trägt. Ursprünglich ist das sozial Erforderte die Norm des Verhaltens der Einzelnen. Den »kategorischen Imperativ« Kants kritisiert S. nach der Richtung der Versöhnung des Individualismus mit der Allgemeinheit des Handelns. Das Gewissen ist nach S. gleichsam ein »rückwärts gewandter Instinkt«; es ist die.Lust oder Unlust der Gattung über die Tat, die in uns zum Ausdruck kommt. Der Altruismus ist ebenso primär wie der Egoismus, er ist »Gruppenegoismus«, ein vererbter Instinkt. Sehr oft. »machen die Motivierungen unserer Handlungen... an Punkten Halt, die völlig und definitiv außerhalb unser selbst liegen«. Auch enthält das Ich noch eine Fülle von Motiven außer dem »Glück«. – Die Freiheit des Willens bedeutet, daß sich der Charakter des Ich ungehindert im Wollen ausprägen kann, das Vermögen, das für uns wertvolle Wollen realisieren zu können. Freiheit ist »Selbstbestimmung«, sie ist zugleich, weil das Ich nur so sein kann, wie es ist, Notwendigkeit. Die Verantwortlichkeit ist nicht aus der Willensfreiheit abzuleiten, sondern umgekehrt: »Derjenige ist frei, den man mit Erfolg verantwortlich machen kann.« Zurechnungsfähig ist jemand, wenn die strafende Reaktion auf seine Tat bei ihm den Zweck: der Strafe erreicht.
Die Grundfrage der Geschichtsphilosophie ist die: wie ist Geschichte möglich? Geschichte ist nur durch Kategorien, apriorische Verbindungsformen möglich, sie ist kategorial verbreitete Wirklichkeit und daher hat die Geschichtsphilosophie die »Aprioritäten festzustellen und zu erörtern, durch welche aus dem Erleben... Geschichte als Wissenschaft wird«. Die Kompliziertheit des historischen Geschehens gestattet nicht die Aufstellung eigener historischer Gesetze, wenn auch das Historische auf (biologisch-psychologischen) Gesetzmäßigkeiten beruht. Das ganze Spiel der Geschichte ist die Folge, Erscheinung oder Synthese dieser primären Gesetzmäßigkeiten, geht aber nicht aus einem besonderen Gesetz hervor.
Die Soziologie ist die »Wissenschaft vom Gesellschaftlichen als solchen, von den Formen der Vergesellschaftung, von den Beziehungsformen der Menschen zueinander«. Die Soziologie ist keine Universalwissenschaft vom Menschen u. dgl., sondern eine besondere Methode; sie abstrahiert vom Inhalt des Gesellschaftlichen, achtet nur auf dieses, wie der Mathematiker etwa nur auf die geometrische Form, nicht auf das Material der Körper achtet. Die Soziologie, hat die »Kräfte, Beziehungen und Formen zum Gegenstand, durch die die Menschen sich vergesellschaften«, sie ist die »Lehre von dem Gesellschaft-Sein der Menschheit«. »Gesellschaft im weitesten Sinne ist offenbar da vorhanden, wo mehrere Individuen in Wechselwirkung treten. Die besonderen Ursachen und Zwecke, ohne die natürlich nie eine Vergesellschaftung erfolgt, bilden gewissermaßen den Körper, das Material des sozialen Prozesses; daß der Erfolg dieser Ursachen, die Förderung dieser Zwecke gerade eine Wechselwirkung, eine Vergesellschaftung unter den Trägern hervorruft, das ist die Form, in die jene Inhalte sich kleiden.« Solche Formen sind Über- und Unterordnung, Konkurrenz, Arbeitsteilung usw.; wichtig sind besonders auch die kleinen, flüchtigen Wechselwirkungen von Person zu Person. Die sozialen Verbindungen erwachsen aus bestimmten Trieben oder Willenstendenzen (Zielen), sind etwas Psychisches, aber nichts Psychologisches, denn die Soziologie hat es nicht mit psychologischen Vorgängen, sondern mit Inhalten solcher zu tun, mit Kombinationen soziologischer Kategorien, mit etwas Sachlichem. Es gibt keinen Gesamtgeist, wohl aber eine seelische Beeinflussung der Individuen durch ihre Vergesellschaftung. In der Gesellschaft herrscht Arbeitsteilung und Differenzierung, verbunden mit Integrierung, indem jede Befreiung zu einer neuen Bindung führt. Die Religion wurzelt in den Gesamttendenzen der Persönlichkeit und ihrer Beziehung zum All.
SCHRIFTEN: Das Wesen der Materie nach Kants physischer Monadologie, 1881. – Über soziale Differenzierung, 1890; 3. A. 1906, – Einleit. in die Moralwissenschaft, 1892-93; 2. A. 1901. – Die Probleme der Geschichtsphilosophie, 1892; 2. A. 1905; 3. A. 1907. – Philosophie des Geldes, 1900; 2. A. 1907. – Vorlesungen über Kant, 1904; 2. A. 1905. – Die Religion, 1906. – Schopenhauer u. Nietzsche, 1906. – Soziologie, 1908. – Hauptprobleme der Philosophie, 1910. – Das Problem der Soziologie, Schmollers Jahrbücher, Bd. 18, 1894. – Skizze einer Willenstheorie, Zeitschr, f. Psychol. d. Sinnesorgane, Bd. 9, – Beitrag zur Erkenntnistheorie der Religion, Zeitschr. f. Philos., Bd. 118. – Über eine Beziehung der Selektionslehre zur Erkenntnis, Archiv f. systemat, Philos., 1895. – Über die Grundfrage des Pessimismus, Zeitschr. f. Philos., Bd. 90. – Zur Psychologie der Frau, Zeitschr. f. Völkerpsychol, 1890, u. a.
Die Überstimmung - Eine soziologische Studie
Das Wesen der Gesellschaftsbildung, aus dem die Unvergleichlichkeit ihrer Erfolge wie die Ungelöstheit ihrer inneren Probleme gleichmäßig hervorgeht, ist dies: dass aus in sich geschlossenen Einheiten - wie die menschlichen Persönlichkeiten es mehr oder weniger sind - eine neue Einheit werde.
Man kann doch sonst nicht ein Haus aus Häusern bauen, es entsteht doch kein Baum aus Bäumen; das Ganze und Selbständige erwächst nicht aus Ganzheiten, sondern aus unselbständigen Teilen.
Ganz allein die Gesellschaft macht das Ganze und in sich Zentrierende zum bloßen Gliede eines übergreifenden Ganzen.
All die ruhelose Evolution der gesellschaftlichen Formen im großen wie im kleinen ist im letzten Grunde nur der immer erneute Versuch, die nach innen hin orientierte Einheit und Totalität des Individuums mit seiner sozialen Rolle als eines Teiles und Beitrages zu versöhnen, die Einheit und Totalität der Gesellschaft vor der Sprengung durch die Selbständigkeit ihrer Teile zu retten.
Indem nun jeder Konflikt zwischen den Gliedern einer Gesamtheit deren Weiterbestand zweifelhaft macht, ist es der Sinn der Abstimmung, in deren Resultat auch die Minorität sich zu fügen einwilligt, dass die Einheit des Ganzen über den Antagonismus der Überzeugungen und Interessen unter allen Umständen Herr bleiben soll.
Sie ist, in all ihrer scheinbaren Einfachheit, eines der genialsten unter den Mitteln, den Widerstreit der Individuen in ein schließlich einheitliches Resultat münden zu lassen.
Aber diese Form, auch den Dissentierenden einzuschließen, mit der jeder, an der Abstimmung teilnehmend, ihr Resultat praktisch akzeptiert, es sei denn, dass er auf dies Resultat hin überhaupt aus dem Kreise austritt - diese Form ist keineswegs immer so selbstverständlich gewesen, wie sie uns heute vorkommt.
Teils eine geistige Ungelenkheit, die die Herstellung einer sozialen Einheit aus dissentierenden Elementen nicht begreift, teils ein starkes Individualgefühl, das sich keinem Beschluss ohne volle eigene Zustimmung fügen mag, haben in vielerlei Gemeinschaften das Majoritätsprinzip nicht zugelassen, sondern für jeden Beschluss Einstimmigkeit gefordert.
Die Entscheidungen der deutschen Markgenossenschaft mussten einstimmig sein; was keine Einstimmigkeit erreichen konnte, unterblieb.
Bis tief in das Mittelalter hinein hat der englische Edle, der bei der Bewilligung einer Steuer dissentiert hatte oder nicht anwesend war, sich oft geweigert, sie zu bezahlen.
Wo für die Erwählung eines Königs oder Führers Einstimmigkeit gefordert wird, ist jenes Individualitätsgefühl wirksam; von dem, der den Herrn nicht selbst gewählt hat, wird auch nicht erwartet oder verlangt, dass er ihm gehorche.
Im Stammesrat der Irokesen, wie im polnischen Reichstag war kein Beschluss gültig, bei dem auch nur eine Stimme dissentiert hatte.
Dennoch hat das Motiv: dass es widerspruchsvoll wäre, eine Gesamtheitsaktion mitzumachen, der man als Individuum widerspricht - solche Forderung von Einstimmigkeit noch nicht zur logischen Folge, denn wenn ein Vorschlag bei nicht völliger Stimmeneinheit als zurückgewiesen gilt, so ist damit zwar die Vergewaltigung der Minorität verhindert, aber nun ist umgekehrt die Majorität durch diese vergewaltigt.
Auch das Unterlassen einer von einer Majorität gebilligten Maßregel pflegt etwas durchaus Positives, von fühlbaren Folgen Begleitetes zu sein, und eben dies wird der Gesamtheit, vermöge des Prinzips notwendiger Einstimmigkeit, durch die Minorität oktroyiert.
Abgesehen von dieser Majorisierung der Majorität, mit der das Einstimmigkeitsprinzip die erstrebte individuelle Freiheit prinzipiell negiert, ist es grade im Historisch-Praktischen oft genug in denselben Erfolg ausgelaufen.
Für die spanischen Könige gab es gar keine günstigere Situation für die Unterdrückung der aragonesischen Cortes als eben diese "Freiheit": bis 1592 konnten die Cortes keinen Beschluss fassen, wenn auch nur ein Mitglied der vier Stände widersprach - eine Lähmung ihrer Aktionen, die deren Ersatz durch eine weniger behinderte Instanz direkt forderte.
Wo nun das Fallenlassen eines Antrages, der Verzicht auf ein praktisches Resultat nicht möglich ist, sondern das letztere unter allen Umständen gewonnen werden muss, wie bei dem Verdikt einer Jury, da ruht die Forderung ihrer Einstimmigkeit, der wir z. B. in England und Amerika begegnen, auf der mehr oder weniger unbewusst wirkenden Voraussetzung, dass die objektive Wahrheit auch immer subjektiv überzeugend sein müsse, und dass umgekehrt die Gleichheit der subjektiven Überzeugungen das Kennzeichen des objektiven Wahrheitsgehaltes sei.
Ein bloßer Majoritätsbeschluss enthalte also wahrscheinlich noch nicht die volle Wahrheit, da es ihm sonst gelungen sein müsste, die Gesamtheit der Stimmen auf sich zu vereinigen.
Der, trotz seiner scheinbaren Klarheit, im Grunde mystische Glaube an die Macht der Wahrheit, an das schliessliche Zusammenfallen des Logisch-Richtigen mit dem Psychologisch-Wirklichen vermittelt hier also die Lösung jenes prinzipiellen Konfliktes zwischen den individuellen Überzeugungen und der Forderung an sie, ein einheitliches Gesamtresultat zu ergeben.
In seinen praktischen Folgen biegt dieser Glaube nicht weniger als jene individualistische Begründung der Stimmeneinheit seine eigne Grundtendenz um: wo die Jury eingesperrt bleibt, bis sie zu einem einstimmigen Verdikt gelangt ist, liegt für eine etwaige Minorität die Versuchung fast unüberwindlich nahe, entgegen ihrer Überzeugung, die sie nicht durchzusetzen hoffen kann, sich der Majorität anzuschließen, um damit das sinnlose und eventuell unaushaltbare Verlängern der Sitzung zu vermeiden.
Wo umgekehrt Majoritätsbeschlüsse gelten, kann die Unterordnung der Minorität auf zwei Motive hin geschehen, deren Unterscheidung von äußerster soziologischer Bedeutung ist.
Die Vergewaltigung der Minorität kann nämlich, erstens, von der Tatsache ausgehen, dass die vielen mächtiger sind als die wenigen.
Obgleich, oder vielmehr, weil die einzelnen bei einer Abstimmung als einander gleich gelten, würde die Majorität - mag sie sich durch Urabstimmung oder durch das Medium einer Vertreterschaft als solche herausstellen - die physische Macht haben, die Minorität zu zwingen.
Die Abstimmung dient dem Zwecke, es zu jenem unmittelbaren Messen der Kräfte nicht kommen zu lassen, sondern dessen eventuelles Resultat durch die Stimmzählung zu ermitteln, damit sich die Minorität von der Zwecklosigkeit eines realen Widerstandes überzeuge.
Es stehen sich also in der Gruppe zwei Parteien wie zwei Gruppen gegenüber, zwischen denen die Machtverhältnisse, repräsentiert durch die Abstimmung, entscheiden.
Die letztere tut hier die gleichen methodischen Dienste wie diplomatische oder sonstige Verhandlungen zwischen Parteien, die die ultima ratio des Kampfes vermeiden wollen.
Schließlich gibt auch hier, Ausnahmen vorbehalten, jeder einzelne nur nach, wenn der Gegner ihm klar machen kann, dass der Ernstfall für ihn eine mindestens ebenso große Einbuße bringen würde.
Die Abstimmung ist, wie jene Verhandlungen, eine Projizierung der realen Kräfte und ihrer Abwägung auf die Ebene der Geistigkeit, eine Antizipation des Ausgangs des konkreten Kämpfens und Zwingens in einem abstrakten Symbole.
Immerhin vertritt dieses die tatsächlichen Machtverhältnisse und den Unterordnungszwang, den sie der Minorität antun.
Manchmal aber sublimiert sich dieser aus der physischen in die ethische Form.
Wenn im späteren Mittelalter oft das Prinzip begegnet: Minderheit soll der Mehrheit folgen, so ist damit offenbar nicht nur gemeint, dass die Minderheit praktisch mittun soll, was die Mehrheit beschließt; sondern sie soll, wenn auch nachträglich, auch den Willen der Mehrheit annehmen, soll anerkennen, dass diese das Rechte gewollt hat.
Die Einstimmigkeit herrscht hier nicht als Tatsache, sondern als sittliche Forderung, die gegen den Willen der Minorität erfolgte Aktion soll durch nachträglich hergestellte Willenseinheit legitimiert werden.
Die altgermanische Realforderung der Einstimmigkeit ist so zu einer Idealforderung abgeblasst, in der freilich ein ganz neues Motiv anklingt: von einem inneren Rechte der Majorität, das über das Übergewicht der Stimmenzahl und über die äußere Übermacht, die durch dieses symbolisiert wird, hinausgeht.
Die Majorität erscheint als die natürliche Vertreterin der Gesamtheit und hat teil an jener Bedeutung der Einheit des Ganzen, die, jenseits der bloßen Summe der Individuen stehend, nicht ganz eines überempirischen mystischen Tones entbehrt.
Wenn später Grotius behauptet, die Majorität habe naturaliter jus integri, so ist damit jener innerliche Anspruch an die Minorität fixiert; denn ein Recht muss man nicht nur, sondern man soll es anerkennen.
Dass aber die Mehrheit das Recht des Ganzen "von Natur", d. h. durch innere, vernunftmäßige Notwendigkeit habe, dies leitet die jetzt hervorgetretene Nuance des Überstimmungsrechtes zu dessen zweitem, bedeutsamen Hauptmotiv über.
Die Stimme der Mehrheit bedeutet jetzt nicht mehr die Stimme der größeren Macht innerhalb der Gruppe, sondern das Zeichen dafür, dass der einheitliche Gruppenwille sich nach dieser Seite entschieden hat.
Das Verhältnis zwischen Majorität und Minorität erzeugt jetzt nicht mehr den Gruppenwillen, sondern macht ihn nur kenntlich.
Die Forderung der Einstimmigkeit ruhte durchaus auf individualistischer Basis.
Das war die ursprüngliche soziologische Empfindung der Germanen: Die Einheit des Gemeinwesens lebte nicht jenseits der einzelnen, sondern ganz und gar in ihnen; daher war der Gruppenwille nicht nur nicht festgestellt, sondern er bestand überhaupt nicht, solange noch ein einziges Mitglied dissentierte.
Aber auch wo Überstimmung gilt, hat sie noch eine individualistische Begründung, wenn ihr Sinn ist, dass die vielen mächtiger sind als die wenigen, und dass die Abstimmung nur das eventuelle Ergebnis der realen Messung der Kräfte ohne diese Messung selbst erreichen soll.
Demgegenüber ist es nun eine prinzipiell neue Wendung, wenn eine objektive Gruppeneinheit mit einem ihr eigenen einheitlichen Willen vorausgesetzt wird, sei es bewusst, sei es, dass die Praxis so verläuft, als ob ein solcher für sich seiender Gruppenwille bestünde.
Der Wille des Staates, der Gemeinde, der Kirche, des Zweckverbandes besteht nun ebenso jenseits des Gegensatzes der in ihm enthaltenen Individualwillen, wie er jenseits des zeitlichen Wechsels seiner Träger besteht.
Er muss, da er nur einer ist, in bestimmter, einheitlicher Weise agieren, und da dem die Tatsache der antagonistischen Wollungen seiner Träger entgegensteht, so löst man diesen Widerspruch durch die Annahme, dass die Majorität diesen Willen besser kennt oder repräsentiert als die Minorität.
Die Unterordnung der letzteren hat hier also einen ganz anderen Sinn als vorher, denn sie ist prinzipiell nicht aus- sondern eingeschlossen, und die Majorität agiert nicht im Namen ihrer eigenen größeren Macht, sondern in dem der idealen Einheit und Gesamtheit, und nur dieser, die durch den Mund der Majorität spricht, ordnet sich die Minorität unter, weil sie ihr von vornherein zugehört.
Dies ist das innere Prinzip der parlamentarischen Abstimmungen, insofern jeder Abgeordnete sich als der Beauftragte des ganzen Volkes fühlt, im Gegensatz zu Interessenvertretungen, für die es schließlich immer auf das individualistische Prinzip der Kräftemessung herausläuft.
Wo dagegen der einheitliche Gruppenwille supponiert wird, da dissentieren die Elemente der Minorität sozusagen als bloße Individuen, nicht als Gruppenglieder.
Dies allein kann der tiefere Sinn der Lockeschen Theorie über den Urvertrag sein, der den Staat begründen soll.
Dieser muss, weil er das absolute Fundament der Vereinigung bildet, durchaus einstimmig abgeschlossen sein.
Allein er enthält nun seinerseits die Bestimmung, dass jeder den Willen der Majorität als den seinigen ansehen werde.
Indem das Individuum den Sozialvertrag schließt, ist es noch absolut frei, kann also keiner Überstimmung unterworfen werden.
Hat es ihn aber geschlossen, so ist es nun nicht mehr freies Individuum, sondern Gesellschaftswesen und als solches ein bloßer Teil einer Einheit, deren Wille seinen entscheidenden Ausdruck in dem Willen der Mehrheit findet.
Es ist nur eine entschiedenere Formulierung dafür, wenn Rousseau in der Überstimmung deshalb keine Vergewaltigung erblickt, weil nur ein Irrtum des Dissentierenden sie provozieren könne; er habe etwas für die volonté générale gehalten, was sie nicht sei.
Es liegt dem eben auch die Überzeugung zu Grunde, dass man als Gruppenelement nichts andres wollen könne als den Willen der Gruppe, über den sich wohl der einzelne, aber nicht die Mehrheit der einzelnen täuschen könne.
Darum trennt er sehr fein die formale Tatsache der Stimmabgabe von deren jeweiligem Inhalt, und erklärt, dass man schon durch jene an und für sich an der Bildung des Gemeinwillens teilnähme.
Man verpflichtet sich dadurch, so könnte man den Rousseauschen Gedanken explizieren, sich der Einheit dieses Willens nicht zu entziehen, sie nicht zu zerstören, indem man den Eigenwillen der Mehrheit entgegensetze.
So ist die Unterordnung unter die Majorität nur die logische Konsequenz der Zugehörigkeit zu der sozialen Einheit, die man durch die Stimmabgabe deklariert hat.
Die Praxis steht dieser abstrakten Theorie nicht völlig fern.
Über die Föderation der englischen Gewerkvereine sagt ihr bester Kenner, dass Majoritätsbeschlüsse in ihnen nur in soweit berechtigt und praktisch möglich waren, als die Interessen der einzelnen Konföderierten gleichartige wären.
Sobald aber die Meinungsverschiedenheiten der Majorität und der Minorität aus einer wirklichen Interessenverschiedenheit hervor gingen, so führte jeder durch Überstimmung ausgeübte Zwang unvermeidlich zu einer Trennung der Teilnehmer; d.h. also, dass eine Abstimmung nur dann Sinn hat, wenn die vorhandenen Interessen zu einer Einheit zusammengehen können.
Verhindern auseinandergehende Bestrebungen diese Zentralisierung, so wird es widerspruchsvoll, einer Majorität die Entscheidung anzuvertrauen, da der Einheitswille, den sie sonst freilich besser als die Minderheit zu erkennen vermöchte, sachlich nicht vorhanden ist.
Es besteht der scheinbare Widerspruch, der aber gerade das Verhältnis von seinem Grunde her beleuchtet: dass gerade, wo eine überindividuelle Einheit besteht oder vorausgesetzt wird, Überstimmung möglich ist; wo sie fehlt, bedarf es der Einstimmigkeit, die jene prinzipielle Einheit durch die tatsächliche Gleichheit von Fall zu Fall praktisch ersetzt.
Es ist ganz in diesem Sinn, wenn das Stadtrecht von Leiden 1266 bestimmt, dass zur Aufnahme von Auswärtigen in die Stadt die Genehmigung der acht Stadtschöffen erforderlich ist, für Gerichtsurteile aber nicht Einstimmigkeit, sondern nur einfache Majorität unter diesen verlangt wird.
Das Gesetz, nach dem die Richter urteilen, ist ein für alle Mal einheitlich bestimmt, und es handelt sich nur darum, das Verhältnis des einzelnen Falles zu erkennen; was der Mehrheit voraussichtlich richtiger als der Minderheit gelingt.
Die Aufnahme eines neuen Bürgers aber berührt all die mannigfaltigen und auseinanderliegenden Interessen innerhalb der Bürgerschaft, so dass ihre Bewilligung nicht aus der abstrakten Einheit derselben, sondern nur aus der Summe aller Einzelinteressen heraus, d. h. bei Einstimmigkeit, ausgesprochen werden kann.
Diese tiefere Begründung der Überstimmung, nur den sozusagen ideell bereits bestehenden Willen einer maßgebenden Einheit zu offenbaren, hebt indes praktisch die Schwierigkeit nicht, die der Majorität als bloßem, vergewaltigendem Machtplus anhaftete.
Denn der Konflikt darüber, was denn nun der Willensinhalt jener abstrakten Einheit wäre, wird oft nicht leichter zu lösen sein als der der unmittelbaren, realen Interessen.
Die Vergewaltigung der Minorität ist keine geringere, auch wenn sie auf diesem Umwege und unter einem anderen Titel geschieht.
Wenigstens müsste dem Begriff der Majorität noch eine ganz neue Dignität zugefügt werden: denn es mag zwar plausibel sein, ist aber keineswegs von vornherein sicher, dass die bessere Erkenntnis auf Seiten der Mehrheit ist.
Insbesondere wird dies da zweifelhaft sein, wo die Erkenntnis und das ihr folgende Handeln auf die Selbstverantwortlichkeit des einzelnen gestellt ist wie in den vertiefteren Religionen.
Die ganze christliche Religionsgeschichte hindurch lebt die Opposition des individuellen Gewissens gegen die Beschlüsse und Aktionen der Majoritäten.
Als im zweiten Jahrhundert die christlichen Gemeinden eines Bezirkes Versammlungen zur Beratung religiöser und äußerer Angelegenheiten einführten, waren ausdrücklich die Resolutionen der Versammlung für die dissentierende Minderheit nicht verbindlich.
Allein mit diesem Individualismus trat die Einheitsbestrebung der Kirche in einen nicht lösbaren Konflikt.
Der römische Staat wollte nur eine einheitliche Kirche anerkennen, sie selbst suchte sich durch Imitation der staatlichen Einheit zu festigen - so wurden die ursprünglich selbständigen christlichen Gemeinden zu einem Gesamtgebilde verschmolzen, dessen Konzilien mit Stimmenmehrheit über die Glaubensinhalte entschieden.
Dies war eine unerhörte Vergewaltigung der Individuen oder mindestens der Gemeinden, deren Einheit bisher nur in der Gleichheit der von jedem für sich besessenen Ideale und Hoffnungen bestanden hatte.
Eine Unterwerfung in Glaubenssachen mochte es aus inneren oder persönlichen Gründen geben; dass aber die Majorität als solche die Unterwerfung forderte und jeden Dissentierenden für einen Nichtchristen erklärte - das ließ sich nur, wie ich andeutete, durch die Hinzunahme einer ganz neuen Bedeutung der Majorität rechtfertigen: man musste annehmen, dass Gott immer mit der Majorität wäre! Dieses Motiv durchzieht, als unbewusst grundlegendes Gefühl oder irgendwie formuliert die ganze spätere Entwicklung der Abstimmungsformen.
Dass eine Meinung nur deshalb, weil ihre Träger ein größeres Quantum ausmachen als die einer andern Meinung, den Sinn der überindividuellen Einheit aller treffen sollte, ist ein ganz unerweisliches Dogma, ja, von vornherein so wenig begründet, dass es ohne Zuhilfenahme einer mehr oder weniger mystischen Beziehung zwischen jener Einheit und der Majorität eigentlich in der Luft schwebt oder auf dem etwas kläglichen Fundament ruht, dass eben doch irgendwie gehandelt werden muss, und dass, wenn man auch schon von der Majorität nicht annehmen darf, sie wisse als solche das Richtige, doch erst recht kein Grund vorliegt, dies von der Minorität anzunehmen.
Alle diese Schwierigkeiten, die die Forderung der Einstimmigkeit wie die Unterordnung der Minorität von verschiedenen Seiten her bedrohen, sind nur der Ausdruck für die fundamentale Problematik der ganzen Situation: eine einheitliche Willensaktion aus einer Gesamtheit zu extrahieren, die aus verschieden gerichteten Individuen besteht.
Diese Rechnung kann nicht glatt aufgehen, so wenig man aus schwarzen und weißen Elementen ein Gebilde herstellen kann mit der Bedingung, dass das Gebilde als Ganzes schwarz oder weiß sei.
Selbst in jenem günstigsten Fall einer supponierten Gruppeneinheit jenseits der Individuen, für deren Tendenzen die Stimmzählung nur Erkenntnismittel ist - bleibt es nicht nur unausgemacht, dass die sachlich notwendige Entscheidung mit der aus der Stimmzählung folgenden identisch sei; sondern, selbst angenommen, die Elemente der Minorität dissentierten wirklich nur als Individuen, nicht als Elemente jener Gruppeneinheit, so sind sie doch als Individuen vorhanden, gehören doch jedenfalls der Gruppe im weiteren Sinne an und sind nicht vor dem Ganzen schlechthin ausgelöscht.
Irgendwie ragen sie doch auch als Individuen mit ihrem Dissens in das Ganze der Gruppe hinein.
Die Trennung des Menschen als Sozialwesen von ihm als Individuum ist zwar eine nötige und nützliche Fiktion, mit der aber die Wirklichkeit und ihre Forderungen keineswegs erschöpft sind.
Es charakterisiert die Unzulänglichkeit und das Gefühl des inneren Widerspruchs der Abstimmungsmethoden, dass an manchen Stellen, zuletzt wohl noch im ungarischen Reichstag bis in die dreißiger Jahre des 19. Jahrhunderts, die Stimmen nicht gezählt, sondern gewogen wurden; so dass der Vorsitzende auch die Meinung der Minorität als Ergebnis der Abstimmung verkünden konnte! Es erscheint unsinnig, dass ein Mensch sich einer für falsch gehaltenen Meinung unterwirft, bloß weil andre sie für richtig halten - andre, von denen jeder einzelne, grade nach der Voraussetzung der Abstimmung, ihm gleichberechtigt und gleichwertig ist; aber die Forderung der Einstimmigkeit, mit der man diesem Widersinn begegnen will, hat sich als nicht weniger widerspruchsvoll und vergewaltigend gezeigt.
Und dies ist kein zufälliges Dilemma und bloß logische Schwierigkeit, sondern es ist nur eines der Symptome der tiefen und tragischen Zwiespältigkeit, die jede Gesellschaftsbildung, jede Formung einer Einheit aus Einheiten, in ihrem Grunde durchzieht.
Das Individuum, das aus einem inneren Fundament heraus lebt, das sein Handeln nur verantworten kann, wenn seine eigene Überzeugung es lenkt, soll nicht nur seinen Willen auf die Zwecke anderer einstellen - dies bleibt, als Sittlichkeit, immer Sache des eigenen Willens und quillt aus dem Innersten der Persönlichkeit; sondern es soll mit seinem auf sich ruhenden Sein zum Gliede einer Gesamtheit werden, die ihr Zentrum außerhalb seiner hat.
Es handelt sich nicht um einzelne Harmonien oder Kollisionen dieser beiden Forderungen; sondern darum, dass wir innerlich unter zwei gegeneinander fremden Normen stehen, dass die Bewegung um das eigene Zentrum, die etwas völlig anderes ist, als Egoismus, ebenso etwas Definitives und der entscheidende Sinn des Lebens zu sein verlangt, wie die Bewegung um das soziale Zentrum dieses fordert.
In die Abstimmung über die Aktion der Gruppe nun tritt der einzelne nicht als Individuum, sondern in jener gliedmässigen, überindividuellen Funktion ein.
Aber der Dissens der Stimmen verpflanzt auf diesen schlechthin sozialen Boden noch einen Abglanz, eine sekundäre Form der Individualität und ihrer Besonderheit.
Und selbst diese Individualität, die nichts als den Willen der überindividuellen Gruppeneinheit zu erkennen und darzustellen verlangt, wird durch die Tatsache der Überstimmung noch verneint.
Selbst hier muss die Minorität, zu der zu gehören die unvermeidbare Chance eines jeden bildet, sich unterwerfen, und zwar nicht nur in dem einfachen Sinne, in dem auch sonst Überzeugungen und Bestrebungen von entgegengesetzten Mächten verneint und ihre Wirkung ausgelöscht wird: sondern in dem sozusagen raffinierteren, dass der Unterlegene, weil er in der Gruppeneinheit befasst ist, die Aktion positiv mitmachen muss, die gegen seinen Willen und seine Überzeugung beschlossen ist, ja, dass er durch die Einheitlichkeit der schließlichen Entscheidung, die keine Spur seines Dissenses enthält, als Mitträger derselben gilt.
Dadurch wird die Überstimmung, über die einfache praktische Vergewaltigung des einen durch die vielen hinaus, zu dem übersteigertsten Ausdruck des in der Erfahrung oft harmonisierten, im Prinzip aber unversöhnlichen und tragischen Dualismus zwischen dem Eigenleben des Individuums und dem des gesellschaftlichen Ganzen.
Friedrich Nietzsche - Eine moralphilosophische Silhouette
"Alles, was tief ist, liebt die Maske", sagt Nietzsche einmal. Anders aber, als er es geliebt hätte, ist ihm die Maske zum Verhängnis geworden. Tief in die Reize eines spielenden, sprühenden, sinnlich bezaubernden Ausdruckes liegt der strenge Ernst seiner Gedanken eingebettet - zu tief offenbar, um an das Ohr der deutschen Philosophen zu dringen.
So erfuhr er das Schicksal aller derer, die mehr können, als einer traditionellen Berufsaufgabe genügen: dass über dem, was sie über die Aufgabe hinaus leisten, von vornherein bezweifelt wird, ob sie der Aufgabe selbst gewachsen wären.
Nietzsche ist von den Berufsdenkern nicht ernst genommen worden, weil er mehr konnte, als ernst sein. Es spricht nicht für die Feinhörigkeit der deutschen Philosophen, dass sie bis in die jüngste Zeit hinein dem Denker Nietzsche verächtlich das Gehör verweigerten, weil ihn der Dichter Nietzsche mit dem Reize, der Fülle, der Freiheit seiner Formen für ihre Ohren übertönte.
Freilich, er hat kein "System" der Ethik gegeben; aber nicht nur, dass ihm bloss die äusserlichste Form desselben fehlt, zu der sich indes seine Aphorismen leicht und in den Hauptsachen lückenlos zusammenfügen liessen; sondern der Gedankenkern, zu dem jedes System doch nur Körper ist, und den schliesslich die Geschichte des menschlichen Denkens allein aufbewahrt - liegt in voller Sachlichkeit und Klarheit vor, bereit, sogar auf Schulformeln gezogen und in die historisch-sachliche Entwicklung der ethischen Kategorien eingestellt zu werden.
Dies letztere nun - eine umgekehrte Popularisierung, könnte man sagen - will ich hier andeutend versuchen: die moralphilosophischen Leitsätze Nietzsches auf ihren schmucklosesten, fachgemässesten Ausdruck zu bringen und so den Punkt festzulegen, den er in der Erkenntnis der sittlichen Dinge - oder in der Täuschung über sie - erreicht hat. - Wenn diese Einordnung Nietzsches in die geschichtliche Moralphilosophie also vor allem denen gilt, die ihn ex cathedra ignorieren oder deklassieren, so gilt sie auch seinen kritiklosen Anhängern gegenüber, die ihn als gelöst von der Kontinuität des menschlichen Geisteslebens ansehen, nicht ausdrückbar durch die bestehenden moralphilosophischen Kategorien, eine intellektuelle causa sui.