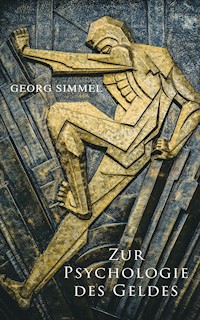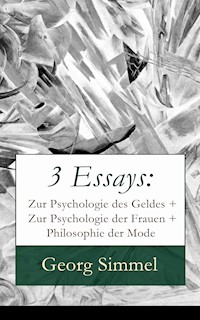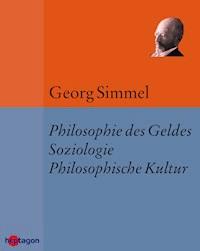Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: heptagon
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Als letztes Werk vor seinem Tode verfasste Georg Simmel das Werk 'Lebensanschauung', in dem er sein metaphysisches Weltbild erklärt. Das E-Book enthält als Randbemerkungen die Seitenzählung des Originalwerks von 1918 und ist somit zum Zitieren in wissenschaftlichen Arbeiten geeignet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum Veröffentlicht im heptagon Verlag Berlin 2012 ISBN: 978-3-934616-57-8 www.heptagon.de Der Text ist ursprünglich erschienen auf der CD-ROM: »Georg Simmel: Das Werk, herausgegeben von Martin Damken. Berlin 2001.« Die zu Grunde liegenden Textausgabe ist erschienen als: »Georg Simmel: Lebensanschauung. Vier metaphysische Kapitel, München und Leipzig: Duncker & Humblot 1918.« Die originalen Seitenzahlen der Printausgabe sind als pagelist
1. Die Transzendenz des Lebens
Die Weltstellung des Menschen ist dadurch bestimmt, daß er sich innerhalb jeder Dimension seiner Beschaffenheiten und seines Verhaltens in jedem Augenblick zwischen zwei Grenzen befindet. Dies erscheint als die formale Struktur unseres Daseins, die in dessen mannigfaltigen Provinzen, Betätigungen, Schicksalen sich jeweils mit immer anderem Inhalt füllt. Gehalt und Wert des Lebens und jeder Stunde fühlen wir zwischen einem höheren und einem tieferen stehen, jeden Gedanken zwischen einem klügeren und einem törichteren, jeden Besitz zwischen einem ausgedehnteren und einem beschränkteren, jede Tat zwischen einem größeren Maß an Bedeutung, Zulänglichkeit, Sittlichkeit und einem geringeren. Wir orientieren uns dauernd, wenn auch nicht mit abstrakten Begriffen, an einem Über-uns und einem Unter-uns, einem Rechts und Links, einem Mehr oder Minder, einem Fester oder Lockerer, einem Besser oder Schlechter. Die Grenze nach oben und nach unten ist unser Mittel, uns in dem unendlichen Raum unserer Welten zurechtzufinden. Damit, daß wir immer und überall Grenzen haben, sind wir auch Grenze. Denn indem jeder Lebensinhalt: Gefühl, Erfahrung, Tun, Gedanke – eine bestimmte Intensität und eine bestimmte Farbe besitzt, ein bestimmtes Quantum und eine bestimmte Stelle in irgend einer Ordnung, so setzt sich von jedem jeweils eine Reihe nach zwei Richtungen, nach ihren beiden Polen zu, fort; dadurch hat der Inhalt selbst an jeder dieser beiden Reihenrichtungen teil, die in ihm zusammenstoßen und die er begrenzt. Dieses Teilhaben an Wirklichkeiten, Tendenzen, Ideen, die ein Plus und ein Minus, ein Diesseits und ein jenseits unseres jetzt und Hier und So sind, mag dunkel und fragmentarisch genug sein; aber es gibt unserem Leben die beiden sich ergänzenden, wenn auch oft kollidierenden Werte: den Reichtum und die Bestimmtheit. Denn diese Reihen, von denen wir begrenzt werden und deren Teilrichtungen wir begrenzen, bilden eine Art Koordinatensystem, durch das gleichsam der Ort jedes Abschnittes und jedes Inhaltes unseres Lebens festgelegt wird.
Für die entscheidendste Bedeutung aber des Grenzcharakters unserer Existenz bildet diese Festgelegtheit erst den Ausgangspunkt. Denn die Grenze überhaupt ist zwar notwendig – jede einzelne bestimmte Grenze aber kann überschritten werden, jede Festgelegtheit verschoben, Jede Schranke gesprengt; jeder solche Akt freilich findet oder schafft die neue Grenze. Die beiden Bestimmungen: daß die Grenze unbedingt ist, indem ihr Bestand mit unserer gegebenen Weltstellung solidarisch ist – daß aber keine Grenze unbedingt ist, weil eine jede prinzipiell verändert, überlangt, umgriffen werden kann – diese beiden Bestimmungen erscheinen als die Auseinanderlegung des in sich einheitlichen Lebensaktes. Aus unzähligen nenne ich nur einen Fall, der für die Bewegtheit dieses Prozesses und die Dauerbestimmtheit unseres Lebens durch ihn sehr bezeichnend ist: das Wissen und das Nicht-Wissen um die Folgen unserer Handlungen. Wir alle sind wie der Schachspieler: wüßte er nicht, welche Folgen sich mit dem praktisch ausreichenden Wahrscheinlichkeitsgrade aus einem Zuge ergeben werden, so wäre das Spiel unmöglich; aber es wäre auch unmöglich, wenn diese Voraussicht bis zu jeder beliebigen Weite ginge. Platos Definition des Philosophen als dessen, der zwischen dem Wissenden und dem Nichtwissenden steht, gilt für den Menschen überhaupt; die geringste Überlegung zeigt, wie ausnahmslos jeder Schritt unseres Lebens dadurch bestimmt und möglich ist, daß wir seine Konsequenzen übersehen, aber als eben dieser dadurch bestimmt und möglich, daß wir sie nur bis zu einer gewissen Grenze übersehen, von der an sie verschwimmen und schließlich unserem Blick entschwinden. Und nicht nur, daß wir auf dieser Grenze zwischen Wissen und Nichtwissen stehen, macht unser Leben zu dem, als was wir es kennen; es wäre auch dann ein absolut anderes, wenn die Grenze jedesmal definitiv wäre, wenn nicht mit vorschreitendem Leben – sowohl im ganzen wie hinsichtlich jeder einzelnen Vorname – Unsicheres sicherer und sicher Geglaubtes fragwürdiger würde. Die konstitutionelle Verschiebbarkeit und Verschiebung unserer Grenzen bewirkt, daß wir unser Wesen mit der Paradoxe ausdrücken können: wir haben nach jeder Richtung hin eine Grenze, und wir haben nach keiner Richtung hin eine Grenze.
Aber sie bewirkt auch oder bedeutet unmittelbar das Weitere: daß wir unsere Grenze auch als solche wissen – zunächst die einzelne und dann die generelle. Denn nur wer in irgend einem Sinn, mit irgend einer Funktion außerhalb seiner Grenze steht, weiß, daß er innerhalb ihrer steht, weiß sie überhaupt als Grenze. Kaspar Hauser hat nicht gewußt, daß er in einem Gefängnis war, bis er ins Freie kam und die Mauern auch von außen sehen konnte. Auf dem theoretischen Gebiet z.B. ist unsere unmittelbare Erfahrung und unsere innerlich anschauende, phantasiemäßige Vorstellung bezüglich derjenigen Bestimmung der Dinge, die sich in Graduierungen bieten, auf bestimmte Größengrenzen angewiesen. Schnelligkeit und Langsamkeit etwa sind uns über gewisse Maße hinaus nicht eigentlich vorstellbar; von der Schnelligkeit des Lichtes und der Langsamkeit, mit der sich der Tropfstein bildet, haben wir kein eigentliches Bild; wir können uns in diese Tempi sozusagen nicht hineinfühlen; eine Temperatur von 1000° und den absoluten Nullpunkt können wir nicht nachfühlend vorstellen; von dem Sonnenspektrum ist uns, was jenseits des Rot und des Violett liegt, optisch überhaupt nicht zugänglich usw. Unser Vorstellen und primäres Erkennen schneidet eben aus der unendlichen Fülle des Wirklichen und seinen unendlichen Auffassungsmöglichkeiten Bezirke heraus, wahrscheinlich so, daß die damit jeweils umgrenzte Größe als Grundlage unserer praktischen Verhaltungsweisen ausreicht. Allein schon diese Angabe solcher Grenzen zeigt, daß wir sie irgendwie überschreiten können, überschritten haben. Über die Welt, die wir sozusagen in vollsinnlicher Realität haben, führen uns der Begriff und die Spekulation, die Konstruktion und die Berechnung hinaus und zeigen uns erst damit jene als eine begrenzte, lassen uns ihre Grenzen von außen sehen. Unser konkretes, unmittelbares Leben setzt einen Bezirk, der zwischen einer oberen und einer unteren Grenze liegt; das Bewußtsein aber, die Rechenschaft hierüber, hängt daran, daß das Leben, zu einem abstrakten, weitergreifenden werdend, die Grenze hinausrückt oder überfliegt und sie damit als Grenze konstatiert. Es hält sie dabei dennoch fest, steht diesseits ihrer – und in demselben Akt jenseits ihrer, sieht sie zugleich von innen und von außen. Beides gehört gleichmäßig zu ihrer Konstatierung, und wie die Grenze selbst an dem Diesseits und jenseits ihrer teil hat, so schließt der einheitliche Akt des Lebens das Begrenztsein und das Überschreiten der Grenze ein, gleichgültig dagegen, daß dies, gerade als Einheit gedacht, einen logischen Widerspruch zu bedeuten scheint.
Dieses Sich-selbst-Überschreiten des Geistes vollzieht sich nicht nur an einzelnen Abschnitten, um deren quantitative Begrenzung wir von Fall zu Fall eine weitergehende legen, um sie so, indem wir sie sprengen, erst wirklich als Begrenzung zu erkennen. Auch die beherrschendsten Prinzipien des Bewußtseins werden von ihm beherrscht. Eine der ungeheuerlichsten Grenzüberschreitungen, die zugleich ein sonst unerreichbares Wissen um unsere Begrenztheit bewirkt, liegt in der Erweiterung unserer Sinneswelt durch Fernrohr und Mikroskop. Zuvor hatte die Menschheit eine durch den natürlichen Sinnesgebrauch bestimmte und begrenzte Welt, die also zu ihrer ganzen Organisation harmonisch war. Seit wir uns aber Augen gebaut haben, die auf Milliarden von Kilometern hin das sehen, was wir natürlicherweise nur auf kürzeste Entfernungen hin wahrnehmen, und andere, die uns die feinsten Strukturen von Objekten in einer Ausbreitung auseinanderlegen, die in den Dimensionen unserer natürlich-sinnlichen Raumanschauung gar keinen Platz hätte, ist diese Harmonie durchbrochen. Ein höchst besonnener Biologe äußert sich in diesem Sinn: Ein Wesen, dessen Augen den Bau eines Riesenfernrohres hätten, wäre auch im übrigen ganz anders gestaltet als wir. Es besäße ganz andere Fähigkeiten, das Gesehene praktisch zu verwerten. Es würde neue Gegenstände formen und besäße vor allen Dingen eine unermeßlich längere Lebensdauer als wir. Vielleicht wäre auch seine Zeitauffassung eine fundamental verschiedene. Sobald wir uns der Disharmonie zwischen den Raum- und Zeitverhältnissen jener Welten und unserem Dasein bewußt werden, brauchen wir uns nur daran zu erinnern, daß wir auch mit einem Stelzfuß von einem halben Kilometer Länge nicht laufen könnten. Ob wir aber unsere Sinnesorgane oder unsere Bewegungsorgane über Gebühr vergrößern, ist im Prinzip das Gleiche – in jedem Falle durchbrechen wir die natürliche Zweckmäßigkeit unseres Organismus. Wir haben also nach gewissen Richtungen hin den Umfang unseres natürlichen Seins, d.h. die Anpassung zwischen unserer Gesamtorganisation und unserer Vorstellungswelt, überschritten. Wir haben jetzt eine Welt um uns, die, wenn wir uns als irgendwie einheitliche Wesen, d.h. in angemessener Korrelation unserer Wesensbestandteile zu einander, denken, nicht mehr die unsere ist. Von dieser aber, durch die Überschreitung unseres Seins durch dessen eigene Kräfte gewonnenen, nun zurücksehend, erblicken wir uns selbst in einer zuvor unerhörten kosmischen Verkleinerung. Indem wir unsere Grenzen ins Maßlose hinausschieben, drücken die Relationen zu so ungeheuren Räumen und Zeiten uns in unserem Bewußtsein auf die Größengrenze verschwindender Pünktchen zurück. Entsprechendes gilt für die ganz allgemeine Gestaltung unseres Erkennens. Setzen wir die Bildung von Wahrheit darein, daß apriorische Kategorien den gegebenen Weltstoff zum Erkenntnisgegenstand gestalten – so muß das Gegebene doch für jene bildsam sein. Nun mag entweder unser Geist so angelegt sein, daß ihm überhaupt nichts gegeben werden kann, was sich diesen Kategorien nicht fügte, oder diese mögen von vornherein die Art, auf die eine Gegebenheit stattfinden kann, bestimmen. Ob diese Bestimmung nun so oder anders stattfindet – es besteht keine Gewähr dafür, daß das Gegebene, sei es auf sinnlichem oder metaphysischem Wege gegeben, auch wirklich ganz in die Formen unseres eigentlichen oder definitiven Erkennens eingeht. So wenig wie alles, was uns von der Welt gegeben ist, in die Formen der Kunst hineingeht, so wenig die Religion jeden Inhalt des Lebens sich einbilden kann, so wenig vielleicht kommt die Totalität des Gegebenen in jenen Formen oder Kategorien des Erkennens unter. Allein: daß wir als erkennende Wesen und innerhalb der Möglichkeiten des Erkennens selbst die Idee überhaupt fassen können: die Welt ginge in die Formen unseres Erkennens nicht hinein, daß wir, selbst rein problematischer Weise, eine Weltgegebenheit denken können, die wir eben nicht denken können – das ist ein Hinausschreiten des geistigen Lebens über sich selbst, Durchbruch und Jenseitigkeit nicht nur einer einzelnen, sondern seiner Grenze überhaupt, ein Akt der Selbsttranszendenz, der die – gleichviel, ob wirkliche oder nur mögliche – immanente Grenze selbst erst setzt. Und nicht weniger gilt diese Formel für die nächstbesondere Ausgestaltung dieses Allgemeinsten. In den Einseitigkeiten der großen Philosophien kommt das Verhältnis zwischen der unendlichen Vieldeutigkeit der Welt und unseren beschränkten Deutungsmöglichkeiten zum unzweideutigsten Ausdruck. Allein daß wir diese Einseitigkeiten als solche wissen und nicht nur die einzelne, sondern die Einseitigkeit als prinzipielle Notwendigkeit – das stellt uns über sie. Wir verneinen sie in dem Augenblick, in dem wir sie als Einseitigkeit wissen, ohne daß wir darum aufhörten, in ihr zu stehen. Dies ist das einzige, was uns der Verzweiflung über sie, über unsere Beschränktheit und Endlichkeit zu entheben vermag: daß wir nicht einfach in diesen Grenzen stehen, sondern weil wir uns ihrer bewußt sind, sie überflügelt haben. Daß wir unser Wissen und Nichtwissen selbst wissen und auch dieses umgreifende Wissen wiederum wissen und so fort in das potentiell Endlose – dies ist die eigentliche Unendlichkeit der Lebensbewegung auf der Stufe des Geistes. Hiermit ist jede Schranke überschritten, aber freilich nur dadurch, daß sie gesetzt ist, daß also etwas zu überschreiten da ist. Mit dieser Bewegung in der Transzendenz seiner selbst erst zeigt sich der Geist als das schlechthin Lebendige. Dies setzt sich in den ethischen Bezirk mit der in vielerlei Formen immer von neuem auftretenden Idee fort, daß die Überwindung seiner selbst die sittliche Aufgabe des Menschen sei, von der ganz individualistischen Form an: Von der Gewalt, die alle Wesen bindet, Befreit der Mensch sich, der sich überwindet – bis zu der geschichtsphilosophischen: Der Mensch ist etwas, das überwunden werden soll. Auch dies ist, logisch genommen, ein Widerspruch: wer sich selbst überwindet, ist zwar der Überwinder, aber doch auch der Überwundene. Das Ich unterliegt doch selbst, indem es siegt; siegt, indem es unterliegt. Aber erst in der Verfestigung zu entgegengesetzten, einander eigentlich ausschließenden Verfassungen entsteht der Widerspruch. Es ist eben der ganz einheitliche Prozeß des sittlichen Lebens, der jeden niederen Zustand durch einen höheren und diesen wieder durch einen höheren überwindet, übergreift. Daß der Mensch sich selbst überwindet, bedeutet, daß er über die Grenzen hinausgreift, die der Augenblick ihm steckt. Es muß etwas zu überwinden da sein, aber es ist auch nur da, um überwunden zu werden. So ist der Mensch auch als ethischer das Grenzwesen, das keine Grenze hat.
Diese flüchtige Skizzierung eines sehr allgemeinen und keine besondere Vertiefung fordernden Aspekts des Lebens bereitet den Begriff vom Leben vor, den es hier zu gewinnen gilt. Ich nehme den Ausgangspunkt in einer Überlegung über die Zeit.
Gegenwart, in der vollen logischen Schärfe ihres Begriffes, geht nicht über die absolute Unausgedehntheit eines Momentes hinaus; sie ist so wenig Zeit, wie der Punkt Raum ist. Sie bedeutet ausschließlich das Zusammenstoßen von Vergangenheit und Zukunft, welche beide allein Zeitgrößen, das heißt Zeit überhaupt sind. Da nun aber die eine nicht mehr, die andere noch nicht ist, so haftet Realität ganz allein an der Gegenwart; das heißt also, Realität ist überhaupt nichts Zeitliches, der Zeitbegriff ist auf ihre Inhalte nur anwendbar, wenn deren Unzeitlichkeit, die sie als Gegenwart besitzen, zu einem Nicht-Mehr oder einem Noch-Nicht, jedenfalls also zu einem Nicht geworden ist. Die Zeit ist nicht in der Wirklichkeit, und die Wirklichkeit ist nicht Zeit. Allein nur für das logisch betrachtete Objekt erkennen wir den Zwang dieser Paradoxe an. Das subjektiv gelebte Leben will sich ihm nicht fügen; es empfindet sich, gleichviel, ob logisch legalisiert oder nicht, als ein in zeitlicher Ausdehnung Reales. Der Sprachgebrauch deutet diesen Sachverhalt, wenn auch ungenau und oberflächlich genug, an, indem er unter Gegenwart niemals die bloße Punktualität ihres begrifflichen Sinnes versteht, sondern sie immer aus einem Stückchen Vergangenheit und einem kleineren Stückchen Zukunft zusammensetzt, die freilich, je nachdem es sich um persönliche oder politische, um kulturelle oder erdgeschichtliche Gegenwart handelt, von sehr variabler Ausdehnung sind. Tiefer angesehen nun, hat die jeweilige Wirklichkeit des Lebens dessen Vergangenheit in ganz anderer Art in sich als ein mechanisches Geschehen. Denn dieses ist gegen seine Vergangenheit, aus der es als Wirkung hervorgegangen ist, so gleichgültig, daß der gleiche Zustand prinzipiell von einer Mannigfaltigkeit von Ursachenkomplexen bewirkt sein kann. In die Erbmasse dagegen, aus der ein Organismus sich aufbaut, sind unzählige individuelle Elemente eingegangen, und zwar so, daß die zu seiner Individualität führende Vergangenheitsreihe schlechterdings durch keine andere ersetzt werden kann: die Wirkungen sind hier nicht mit derselben Spurlosigkeit in der jetzt allein realen Wirkung aufgegangen, wie bei einer mechanischen Bewegung, die aus beliebig verschiedenen Komponentenpaaren resultieren kann. In voller Reinheit aber tritt das Hineinleben der Vergangenheit in die Gegenwart erst auf, wo das Leben das Stadium des Geistes erreicht hat. Dafür hat es zwei Formen zur Verfügung: die Objektivierung in Begriffen und Gebilden, die, über den Moment ihrer Entstehung hinaus, tale quale der reproduzible Besitz unbegrenzt vieler Nachkommen werden, und das Gedächtnis, mit dem die Vergangenheit des subjektiven Lebens nicht nur die Ursache des gegenwärtigen wird, sondern sich in relativer Ungeändertheit ihres Inhaltes in dieses überträgt. Indem das früher Erlebte als Erinnerung in uns lebt, nicht als zeitlos gewordener Inhalt, sondern in unserem Bewußtsein an seine Zeitstelle gebunden, ist es nicht restlos in seine Wirkung umgesetzt, wie in der mechanistischen und kausalen Betrachtung, sondern die Sphäre des realen gegenwärtigen Lebens erstreckt sich bis zu ihm zurück. Freilich ersteht damit nicht das Vergangene als solches aus seinem Grabe; aber da wir das Erlebnis nicht als ein gegenwärtiges, sondern als ein dem damaligen Moment verhaftetes wissen, so ist unsere Gegenwart eben keine punktuelle, wie die einer mechanischen Existenz, sondern sozusagen nach rückwärts ausgedehnt. Wir leben in solchen Augenblicken über den Augenblick hinaus in die Vergangenheit hinein.
Entsprechend ist unser Verhalten zur Zukunft, das mit der Bestimmung des Menschen als des zwecksetzenden Wesens keineswegs genügend bezeichnet ist. Der irgendwie entfernte Zweck erscheint als ein starrer Punkt, von der Gegenwart diskontinuierlich geschieden, während das Entscheidende gerade das unmittelbare Hineinleben des gegenwärtigen Willens – und Fühlens und Denkens – in die Zukunft ist: die Gegenwart des Lebens besteht darin, daß es die Gegenwart transzendiert. Mit jeder, im jetzt verlaufenden Willensbewegung erweisen wir, daß eine Schwelle zwischen dem jetzt und der Zukunft gar nicht real ist, da wir, wenn wir sie setzen, zugleich diesseits und jenseits ihrer sind. Der Zweck läßt die stetige Lebensbewegung um einen Punkt herum koagulieren – wodurch sie freilich den Forderungen des Rationalismus und der Praxis in höherem Maße genügt –, er reißt das Stück ununterbrochenen zeitlichen Lebens zwischen jetzt und später in sich hinein und schafft damit eine Lücke, an deren einem und anderem Ufer der Gegenwartspunkt und der Zweckpunkt in substanzieller Verfestigtheit stehen. Indem die Zukunft, gerade wie die Vergangenheit, an einem, wenn auch unbestimmt schwebenden Punkte lokalisiert wird, der Lebensprozeß zu der logischen Geschiedenheit der drei grammatikalisch gesonderten Tempora auseinandergeschoben und verhärtet wird, verdeckt sich das unmittelbare, schwellenlose Sich-Strecken in die Zukunft, das jedes Gegenwartsleben bedeutet. Die Zukunft liegt nicht vor uns wie ein unbetretenes Land, mit scharfer Grenzlinie von der Gegenwart geschieden, sondern wir leben dauernd in einem Grenzbezirk, der der Zukunft so angehört wie der Gegenwart. Alle Lehren, die unser seelisches Wesen in den Willen setzen, drücken nur aus, daß die seelische Existenz sozusagen über ihren Gegenwartspunkt hinauslebt, daß das Zukünftige in ihr Realität ist. Ein bloßer Wunsch mag sich auf ferne, noch unlebendige Zukunft richten; der wirkliche Wille aber steht unmittelbar jenseits des Gegensatzes von Gegenwart und Zukunft. Noch innerhalb des aktuellen Momentes des Wollens sind wir schon über ihn hinaus, denn in seiner logisch scheinbar notwendigen Unausgedehntheit käme die Festlegung der Richtung nicht unter, in der das wollende Leben sich weiterzubewegen hat – sie als virtuell in dieser Punktualität angelegt zu bezeichnen, wäre ein bloßes Wort zur Verdeckung der Unbegreiflichkeit. Das Leben ist wirklich Vergangenheit und Zukunft; diese werden nicht nur, wie zu der unorganischen, bloß punktuellen Wirklichkeit, ihm hinzugedacht. Und man wird, auch diesseits der Stufe des Geistes, an der Zeugung und am Wachstum die gleiche Form anerkennen müssen: daß das jeweilige Leben sich selbst überschreitet, seine Gegenwart mit dem Noch-Nicht der Zukunft eine Einheit bildet. Solange man Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft mit begrifflicher Schärfe trennt, ist die Zeit irreal, weil nur der zeitlich unausgedehnte, d.h. unzeitliche Gegenwartsmoment wirklich ist. Das Leben aber ist die eigentümliche Existenzart, für deren Tatsächlichkeit diese Scheidung nicht gilt; erst in nachträglicher, dem mechanistischen Schema folgender Zerlegung sind die drei Zeitarten in ihrer logischen Auseinandergeschnittenheit darauf anwendbar. Nur für das Leben ist die Zeit real (die ganze Idealität der Zeit bei Kant ist möglicherweise dem mechanistischen Element in seiner Weltanschauung tief verknüpft). Zeit ist die – vielleicht abstrakte – Bewußtseinsform dessen, was das Leben selbst in nicht aussagbarer, nur zu erlebender unmittelbarer Konkretheit ist; sie ist das Leben unter Absehen von seinen Inhalten, weil nur das Leben den zeitfreien Gegenwartspunkt jeder anderen Wirklichkeit nach beiden Richtungen hin transzendiert und erst damit und ganz allein die Zeitausdehnung d.h. die Zeit realisiert. Halten wir an Begriff und Tatsache von Gegenwart überhaupt fest, wozu wir berechtigt und genötigt sind, so bedeutet diese Wesensgestaltung des Lebens ein fortwährendes Hinausgreifen über sich selbst als gegenwärtiges. Dieses Hinausgreifen des aktuellen Lebens in dasjenige, was nicht seine Aktualität ist, so aber, daß dieses Hinausgreifen dennoch seine Aktualität ausmacht – ist also nichts, was zum Leben erst hinzukäme, sondern dieses, wie es in Wachstum und Zeugung und in den geistigen Prozessen sich vollzieht, ist das Wesen des Lebens selbst. Die Existenzart, die ihre Realität nicht auf den Gegenwartsmoment beschränkt und damit Vergangenheit und Zukunft ins Irreale rückt – deren eigentümliche Kontinuität vielmehr sich realiter jenseits dieser Scheidung hält, so daß ihre Vergangenheit wirklich in die Gegenwart hineinexistiert, die Gegenwart wirklich in die Zukunft hinausexistiert – diese Existenzart nennen wir Leben.
Daß sie sich aber in der Form, die ich als Hinausgreifen über sich selbst bezeichnete, vollzieht, gründet sich in einem eigentlich antinomischen Verhältnis. Wir stellen uns das Leben vor als ein kontinuierliches Strömen durch die Geschlechterfolgen hindurch. Allein die Träger davon (d.h. nicht solche, die es haben, sondern die es sind) sind Individuen, d.h. geschlossene, in sich zentrierte, gegeneinander unzweideutig abgesetzte Wesen. Indem der Lebensstrom durch oder richtiger: als diese Individuen fließt, staut er sich doch in jedem von ihnen, wird zu einer fest umrissenen Form und hebt sich sowohl gegen seinesgleichen wie gegen die Umwelt mit all ihren Inhalten als ein Fertiges ab und duldet keine Verwischung seines Umfanges. Hier liegt eine letzte metaphysische Problematik des Lebens: daß es grenzenlose Kontinuität und zugleich grenzbestimmtes Ich ist. Und nicht nur am Ich als einer Totalexistenz, sondern an allen erlebten Inhalten und Objektivitäten wird die Lebensbewegung irgendwie stillgestellt, wie an einem Punkte festgehalten; wo immer ein bestimmtes, formfestes Etwas erlebt wird, fängt sich das Leben gewissermaßen darin wie in einer Sackgasse oder fühlt seine Strömung in und zu einem solchen Etwas kristallisiert und durch dessen Form selbst geformt, d.h. begrenzt. Indem nun aber sein Weiterfließen dennoch unaufhaltsam ist, die dauernde Zentralität des Gesamtorganismus, des Ich, oder die relativere seiner Inhalte doch die wesenhafte Kontinuität dieses Fließens nicht annullieren kann, so entsteht die Vorstellung, daß es über die jeweilige organische, seelische, sachliche Form hinausdrängte, sie über die Stauung hin überspülte. Ein nur kontinuierliches heraklitisches Fließen, ohne ein bestimmtes beharrendes Etwas, enthielte ja die Grenze gar nicht, über die ein Hinauslangen geschehen soll, nicht das Subjekt, welches hinausgreift. Sobald aber irgend etwas als für sich bestehende, nach einem Zentrum hin gravitierende Einheit existiert, so ist das Hinausfluten des Geschehens von diesseits ihrer Grenzen zu jenseits ihrer Grenzen nicht mehr eine subjektlose Bewegtheit, sondern es bleibt mit dem Zentrum irgendwie verbunden, so daß auch die Bewegung jenseits ihrer Grenze ihm zugehört, ein Hinausgreifen, bei dem dieses Gebilde immer das Subjekt bleibt und das doch über dieses Subjekt hinausgeht. Daß das Leben absatzloses Fließen ist und zugleich ein in seinen Trägern und Inhalten Geschlossenes, um Mittelpunkte Geformtes, Individualisiertes, und deshalb, in der anderen Richtung gesehen, eine immer begrenzte Gestaltung, die ihre Begrenztheit dauernd überschreitet, das ist seine wesenbildende Konstitution. Gewiß ist die Kategorie, die ich das Hinausgreifen des Lebens über sich selbst nenne, damit nur symbolisch, nur mit einer wahrscheinlich verbesserungsfähigen Hinweisung bezeichnet. Allein, in ihrer Essenz gefaßt, halte ich sie allerdings für eine ganz primäre. Sie ist freilich bisher nur schematisch und abstrakt bezeichnet, so nur die Vorzeichnung oder Form für das konkret erfüllte Leben hergebend, insofern dessen Wesen ist (nicht etwas, was zu seinem Sein hinzukäme, sondern sein Sein ausmachend): daß ihm die Transzendenz immanent ist.
Die einfachste und grundlegende Tatsachenform des hier Gemeinten ist das Selbstbewußtsein, das zugleich das Urphänomen des Geistes als eines menschlich-lebendigen überhaupt ist. Indem das Ich nicht nur sich selbst sich gegenüberstellt, sich, als das wissende, zum Gegenstand seines eigenen Wissens macht, sondern auch sich wie einen Dritten beurteilt, sich achtet oder verachtet, und sich damit auch über sich stellt, überschreitet es dauernd sich selbst und verbleibt doch in sich selbst, weil sein Subjekt und Objekt hier identisch sind; es legt diese Identität, da sie keine starr substanzialistische ist, in den geistigen Lebensprozeß des Sich-Selbst-Wissens auseinander, ohne sie zu zerreißen. Die Übergipfelung des wissenden Bewußtseins über sich selbst als gewußtes aber steigt ins Unbegrenzte: ich weiß nicht nur, daß ich weiß, sondern ich weiß auch, daß ich dies weiß, und diesen Satz niederschreibend, erhebe ich mich abermals über die bisherigen Stadien dieses Prozesses usf. Man hat hierin eine Denkschwierigkeit gefunden, als wäre das Ich sozusagen immer auf der Jagd nach sich selbst, ohne sich je einholen zu können. Allein sie verschwindet, sobald man das Übergreifen über sich selbst als das Urphänomen des Lebens überhaupt erfaßt hat, das sich hier am sublimiertesten, von allem zufälligen Inhalt ganz gelöst, darstellt. Mit dem jeweilig höchsten, uns selbst überschreitenden Bewußtsein sind wir das Absolute über unserer Relativität. Indem aber das Weiterschreiten dieses Prozesses jenes Absolute wieder relativiert, zeigt sich die Lebenstranszendenz als die wahre Absolutheit, in der der Gegensatz des Absoluten und des Relativen aufgehoben ist. Mit solcher Erhebung über die Gegensätze, die in der Grundtatsache, daß dem Leben die Transzendenz immanent ist, beschlossen liegt, beruhigen sich die von je am Leben gefühlten Widersprüche: es ist zugleich fest und variabel, geprägt und sich entwickelnd, geformt und formdurchbrechend, beharrend und weitereilend, gebunden und frei, in der Subjektivität kreisend und objektiv über den Dingen und über sich selbst stehend – all diese Gegensätze sind nur die Auseinanderlegungen, Strahlenbrechungen jener metaphysischen Tatsache: daß sein innerstes Wesen ist, über sich selbst hinauszugehen, seine Grenze zu setzen, indem es über sie, d.h. eben über sich selbst, hinausgreift. Und wie die geistige Selbstübergipfelung des Lebens sich an dem Bewußtsein des Ich-Bewußtseins zeigt, so die gleiche Form an dem ethischen Willensproblem. Wir können uns den menschlichen Willensverlauf nur unter dem Bilde vorstellen, daß typischerweise eine Mehrheit willentlicher Bestrebungen in uns lebendig ist, zwischen denen dann ein höherer definitiver Wille entscheidet, welche sich weiter und zum eigentlichen Akt entwickeln soll. Nicht an jenen Wollungen, für deren Auftauchen wir uns im allgemeinen nicht verantwortlich fühlen, sondern an diesem letztinstanzlichen Willen empfinden wir das, was wir Freiheit nennen und was unsere Verantwortung begründet. Es ist natürlich ein und derselbe Wille, der sich in diesem Prozeß der Selbsttranszendenz auseinanderlegt, gerade wie es ein und dasselbe Ich ist, das sich im Selbstbewußtsein in Objekt und Subjekt scheidet. Nur daß ihn im ersteren Falle die Mannigfaltigkeit von Inhalten zu einer Gabelung und Entscheidung veranlaßt, die für das theoretische Ich-Bewußtsein nicht in Frage kommt. Und auch die Unendlichkeit im Prozeß des letzteren hat hier eine gewisse Analogie. Auch von der durch die Erhebung des Willens über sich selbst getroffenen Entscheidung empfinden wir oft, daß sie unserem eigentlichen Willen doch nicht entspricht, daß eine noch höhere Instanz in uns ist, die auch jene Entscheidung noch virtuell kassieren könnte; andererseits, das Gefühl, daß das Leben ganz rein zu sich selbst gekommen ist, wird man symbolisch so beschreiben können, daß dieser Gang der praktischen Selbstbeurteilung, so hoch er auch aufsteige, sozusagen nirgends eine Hemmung findet, oder, scheinbar paradox, daß der Wille auch wirklich unseren Willen will. Ein jeder kennt die spezifische innere Unruhe in solchen Lagen, in denen wir uns praktisch für das entschieden haben, was wir doch nicht als unseren letzten Willen fühlen. Vielleicht liegen viele Schwierigkeiten des Freiheitsproblems, ganz ebenso wie des Ich-Problems, darin, daß man Stadien der angedeuteten Prozesse zu sozusagen substantiellem Bestand verfestigt hat, was der sprachliche Ausdruck zwar kaum vermeiden kann. Dann erscheinen solche Stadien jeweils als geschlossene, eigenkräftige Parteien, zwischen denen nur ein mechanistisches Spiel stattfinden kann. Dies wäre anders, sähe man in alledem das Urphänomen, in dem das Leben sich als der kontinuierliche Prozeß des Sich-über-sich-selbst-Erhebens offenbart, und in dem, logisch nicht recht faßbar, dieses Sich-Steigern und stetige Sich-Verlassen gerade die Art seiner Einheit, seines In-sich-Bleibens ist.
Zwischen der Kontinuität und der Form, als letzten weltgestaltenden Prinzipien besteht ein tiefer Widerspruch. Form ist Grenze, Abhebung gegen das Benachbarte, Zusammengehaltenheit eines Umfangs durch ein reales oder ideelles Zentrum, auf das sich die ewig fortströmenden Reihen der Inhalte oder Prozesse gleichsam zurückbiegen und das jenem Umfang einen Halt gegen die Auflösung in diesem Strom gewährt. Macht man mit der Kontinuität – der extensiven Darstellung der absoluten Einheit des Seins – wirklich Ernst, so kann es zu keinem solchen Eigenbestand einer Seinsenklave kommen, man kann dann nicht einmal mehr von fortwährender Zerstörung der Formen reden, weil etwas, das zerstört werden könnte, von vornherein nicht zu entstehen vermöchte. Darum hat Spinoza aus der Konzeption des schlechthin einheitlichen Seins heraus keine Positive determinatio anerkennen können. Die Form ihrerseits kann sich nicht ändern, sie ist das zeitlos Invariable; die Form eines stumpfwinkligen Dreiecks bleibt ewig nur diese, und wenn durch sprunglose Verschiebung der Seiten daraus ein spitzwinkliges wird, so ist die Form des Gebildes, in welchem Moment des Prozesses ich sie auch erfasse, eine absolut feste und gegen die in einem anderen Moment, so gering die Abweichung auch sein möge, absolut verschiedene. Der Ausdruck, das Dreieck habe sich verändert, legt ihm in anthropomorpher Weise eine lebensmäßige Innerlichkeit bei, die allein – worüber noch zu sprechen sein wird – eines Sichänderns fähig ist. Form aber ist Individualität. Sie kann sich an unzähligen Materialstücken identisch wiederholen; aber daß sie, als reine Form, zweimal da sein sollte, ist ein Ungedanke, wie wenn es den Satz zweimal zwei gleich vier, als ideelle Wahrheit, zweimal geben sollte – obgleich er von unzähligen Bewußtseinen realisiert werden kann. Mit dieser metaphysischen Einzigkeit ausgestattet, macht die Form das von ihr geprägte Materialstück zu einem individuellen, einem für sich bezeichenbaren, von anders geformten abgehobenen, entreißt es der Kontinuität des Nebeneinander und des Nacheinander, gibt ihm einen eigenen Sinn, dessen Grenzbestimmtheit mit der Strömung des Gesamtseins, wenn sie wirklich stauungslos ist, nicht zusammenzubringen ist. Ist nun das Leben – als kosmische, als gattungshafte, als singuläre Erscheinung – ein solches kontinuierliches Strömen, so gründet sich darin nicht nur sein tiefer Gegensatz gegen die Form, der als der unaufhörliche, meistens unmerkliche und unprinzipielle, oft aber auch revolutionär ausbrechende Kampf des weiterschreitenden Lebens gegen die historische Festgeprägtheit und formale Erstarrtheit des jeweiligen Kulturinhalts auftritt und damit das innerste Motiv des Kulturwandels wird. Sondern die Individualität als geprägte Form scheint sich der Kontinuität des Lebensstromes, die keine geschlossene Prägung zuläßt, entziehen zu müssen: was sich empirisch damit andeutet, daß die höchsten Aufgipfelungen der Individualität, die großen Genies, fast durchgehends keine oder eine vital nicht geratene Nachkommenschaft erzeugen, vielleicht auch damit, daß die Frauen in emanzipatorischen Epochen, in denen sie aus ihrer Nivellierung als Frauen überhaupt zu stärkerer Ausprägung und Berechtigtheit ihrer Individualität streben, eine sinkende Fruchtbarkeit zu zeigen scheinen. In mannigfaltigen Andeutungen und Verkleidungen spürt man bei stark Individualisierten Menschen höherer Kulturen eine Feindseligkeit gegen ihre Funktion, eine Welle in dem durch sie hin weiterrauschenden Lebensstrom zu sein. Das ist keineswegs nur ein anmaßliches Übersteigern ihrer persönlichen Bedeutung, eine Sucht, sich qualitativ aus der Masse herauszuheben, sondern ein Instinkt für den unversöhnlichen Gegensatz von Leben und Form, oder, anders ausgedrückt, von Kontinuität und Individualität. Die Beschaffenheit der letzteren, die eigenschaftliche Besonderheit oder Einzigkeit, ist hier gar nicht das Entscheidende, sondern das Fürsichsein, Insichsein der individuellen Form in ihrem Kontrast gegen die allbefassende kontinuierliche Strömung des Lebens, die nicht nur alle formenden Grenzen löst, sondern es eigentlich gar nicht zu ihnen kommen läßt. Dennoch, die Individualität ist überall lebendig, und das Leben ist überall individuell. So könnte man meinen, die ganze Unvereinbarkeit beider Prinzipien sei eine jener bloß begrifflichen Antinomien, die sich allenthalben ergeben, wenn die unmittelbare und gelebte Wirklichkeit auf die Ebene der Intellektualität projiziert wird; dort zerlegt sie sich unvermeidlich in eine Mehrheit von Elementen, die so in ihrer primär-objektiven Einheit gar nicht bestanden und nun, erstarrt und logisch eigensinnig, Diskrepanzen gegeneinander zeigen, um deren Wiederversöhnung der Intellekt sich nachträglich und selten ganz erfolgreich bemüht; denn sein unablegbar analytischer Charakter verhindert ihn, schlechthin reine Synthesen zu schaffen. So aber liegt es doch nicht ganz. In der Tiefe des Lebensgefühles liegt jene Zweiheit eingebettet, nur daß sie hier freilich von einer Lebenseinheit umgriffen und nur, wo sie gleichsam deren Rand überschreitet, als dualistische Zerreißung bewußt wird (was nur in bestimmten geistesgeschichtlichen Lagen geschieht); an dieser Grenze erst überliefert sie sich als Problem dem Intellekt, der sie, weil er bei seinem Charakter gar nicht anders kann, als Antinomie auch in jene letzte Lebensschicht zurückprojiziert. In dieser Schicht aber herrscht dasjenige, was der Intellekt nur Überwindung der Zweiheit durch die Einheit nennen kann, was aber an sich selbst ein Drittes, jenseits von Zweiheit und Einheit ist: eben das Wesen des Lebens als Überschreiten seiner selbst. In einem Akt bildet es etwas, was mehr ist als die vitale Strömung selbst: die individuelle Geformtheit – und durchbricht eben diese, von seiner Stauung in jene Strömung hineingezeichnete, läßt sie über ihre Grenzen hinausgreifen und wieder in seinen Weiterfluß zurücktauchen. Wir sind nicht in grenzenfreies Leben und grenzgesicherte Form geschieden, wir leben nicht teils in der Kontinuität, teil in der Individualität, die sich gegenseitig aufheben. Vielmehr, das Grundwesen des Lebens ist eben jene in sich einheitliche Funktion, die ich, symbolisch und unvollkommen genug, das Transzendieren seiner selbst nannte und die das unmittelbar als ein Leben aktualisiert, was dann durch Gefühle, Schicksale, Begrifflichkeit in den Dualismus von kontinuierlicher Lebensströmung und individuell geschlossener Form gespalten wird. Will man aber zunächst die eine Seite des Dualismus als Leben schlechthin, die andere als individuelle Geformtheit und einfachen Gegensatz zu jenem bezeichnen, so gilt es nun weiter, einen absoluten Begriff des Lebens zu gewinnen, der jenen, noch von einem Gegensatz sich abhebenden, als einen deshalb nur relativen unter sich begreift. Wie es einen weitesten Begriff des Guten gibt, der Gutes und Böses in deren relativem Sinne einschließt, einen weitesten Begriff des Schönen, der den Gegensatz von Schönem und Häßlichem in sich befaßt, so ist das Leben in dem absoluten Sinne etwas, was sich selbst im relativen Sinne und seinen Gegensatz, zu dem es und der zu ihm eben relativ ist, einschließt, oder sich zu ihnen als seinen empirischen Phänomenen auseinanderfaltet. Und darum erscheint die Transzendenz seiner selbst als der einheitliche Akt des Aufbauens und Durchbrechens seiner Schranken, seines Anderen, als der Charakter seiner Absolutheit – der die Auseinanderlegung in verselbständigte Gegensätze sehr wohl begreiflich macht.
In der Richtung der konkreten Erfüllung dieser Idee vom Leben liegen zweifellos Schopenhauers Wille zum Leben und Nietzsches Wille zur Macht; wobei Schopenhauer mehr die grenzenfreie Kontinuität, Nietzsche mehr die Individualität in ihrer Formumschriebenheit als das Entscheidende fühlt. Daß dies Entscheidende, das Leben Ausmachende, eben die absolute Einheit von beidem ist, ist ihnen vielleicht deshalb entgangen, weil sie die Selbsttranszendenz des Lebens einseitig als willensmäßig fassen. Sie gilt aber tatsächlich für alle Dimensionen der Lebensbewegung. Damit hat das Leben zwei, einander ergänzende Definitionen: es ist Mehr-Leben und es ist Mehr-als-Leben. Das Mehr kommt nicht dem in seiner Quantität eigentlich stabilen Leben noch per accidens zu, sondern Leben ist die Bewegung, die auf jedem ihrer Abschnitte, auch wenn dieser, mit anderen verglichen, ein ärmlicherer, herabgesetzter ist, doch in jedem Augenblick etwas in sich hineinzieht, um es in ihr Leben zu verwandeln. Leben kann, gleichviel welches sein absolutes Maß ist, nur dadurch existieren, daß es Mehr-Leben ist; solange das Leben überhaupt besteht, erzeugt es Lebendiges, da schon die physiologische Selbsterhaltung fortwährende Neuerzeugung ist: das ist nicht eine Funktion, die es neben anderen übte, sondern indem es das tut, ist es eben Leben. Und wenn, wie ich überzeugt bin, allerdings der Tod dem Leben von vornherein einwohnt, so ist auch dies ein Hinausschreiten des Lebens über sich selbst. In seiner Zentriertheit verbleibend, streckt es sich sozusagen nach dem Absoluten des Lebens hin und wird in dieser Richtung Mehr-Leben – aber es streckt sich auch nach dem Nichts hin und, wie es sich erhaltendes und sich steigerndes Leben in einem Akt ist, so ist es auch sich erhaltendes und sinkendes Leben in einem Akt, als ein Akt. Es ist wiederum der vorhin aufgebrachte absolute Begriff des Lebens, des Mehr-Lebens, der das Mehr und das Minder als Relativitäten einschließt, das genus proximum zu beiden ist. Die tiefe Beziehung, die man von je zwischen Zeugung und Tod empfunden hat, als bestände zwischen ihnen, als Lebenskatastrophen, eine Formverwandtschaft, hat hier einen ihrer metaphysischen Angelpunkte: beide Ereignisse haften an dem subjektiven Leben und transzendieren es, gleichsam nach oben und nach unten; das Leben, über das sie hinausreichen, ist dennoch ohne sie nicht denkbar; sich in Wachstum und Zeugung über sich selbst zu steigern, in Altern und Tod unter sich selbst herabzusinken, dies sind keine Hinzufügsel zum Leben, sondern solche Aufhebung, Überspülung der Umgrenztheit des individuellen Bestandes ist das Leben selbst. Vielleicht bedeutet die ganze Idee von der Unsterblichkeit des Menschen nur das akkumulierte, in ein einmaliges ungeheures Symbol hineingesteigerte Gefühl für dieses Hinausgehen des Lebens über sich selbst.
Die logische Schwierigkeit von seiten des Satzes der Identität: daß das Leben zugleich es selbst und mehr als es selbst sei – ist nur Sache des Ausdrucks. Wenn wir den Einheitscharakter des Lebens begrifflich ausdrücken wollen, so bleibt nach unserer Begriffsbildung nichts übrig, als ihn in solche zwei Parteien zu spalten, die als einander ausschließende dastehen und nun erst wieder zu jener Einheit zusammengehen sollen – was, nachdem sie erst einmal in der gegenseitigen Repulsion festgeworden sind, freilich einen Widerspruch ergibt. Es ist natürlich eine nachträgliche Deutung des unmittelbar gelebten Lebens, wenn man es als Einheit von Grenzsetzung und Grenzüberschreitung, von individueller Zentriertheit und Hinausgreifen über die eigene Peripherie bezeichnet, denn gerade an dem Einheitspunkt hat man es hiermit ja zerschnitten. Für den begrifflichen Ausdruck können sich die Beschaffenheit des Lebens in seinem Quantum und Quale und das jenseits dieses Quantums und Quale gewissermaßen in diesem Punkte nur berühren, während das Leben, das sich an ihm befindet, dies Diesseits und jenseits als reale Einheit in sich schließt. Das geistige Leben kann, wie ich andeutete, gar nicht anders, als sich in irgendwelchen Formen dartun: in Worten oder Taten, in Gebilden oder überhaupt Inhalten, in denen sich die seelische Energie jeweilig aktualisiert. Aber diese Ausformungen seiner Gebilde haben in dem Augenblick des Entstehens schon eine sachliche Eigenbedeutung, eine Festigkeit und innere Logik, mit der sie sich dem Leben, das sie gestaltete, entgegensetzen, denn dieses ist ein rastloses Weiterströmen, das nicht nur diese und jene bestimmte, sondern jede Form, weil sie Form ist, überflutet; schon wegen dieses prinzipiellen Wesensgegensatzes kann das Leben gar nicht in die Form hineingehen, es muß über jede gewonnene Gestaltung hinaus sogleich eine andere suchen, an der das Spiel der notwendigen Gestaltung und dem notwendigen Ungenügen an der Gestaltung rein als solcher sich wiederholt. Indem es Leben ist, braucht es die Form, und indem es Leben ist, braucht es mehr als die Form. Mit diesem Widerspruch ist das Leben behaftet, daß es nur in Formen unterkommen kann und doch in Formen nicht unterkommen kann, eine jede also, die es gebildet hat, überlangt und zerbricht. Als Widerspruch freilich erscheint dies nur in der logischen Reflexion, für die die einzelne Form als ein für sich gültiges, real oder ideell festes Gebilde dasteht, die eine diskontinuierlich neben der anderen und in begrifflichem Gegensatz zu Bewegtheit, Strömung, Weitergreifen. Das unmittelbar gelebte Leben ist eben die Einheit von Geformtsein und Hinüberlangen, Hinüberfließen über Geformtheit überhaupt, was sich im einzelnen Augenblick als Zerbrechen der jeweiligen aktuellen Form darstellt – das Leben ist eben immer mehr Leben als dasjenige, das in der ihm jeweils beschiedenen, aus ihm selbst gewachsenen Form Raum hat. Soweit das seelische Leben auf seine Inhalte angesehen wird, ist es jeweils endlich und in sich begrenzt; es besteht dann aus diesen ideellen Inhalten, die jetzt die Form des Lebens haben. Der Prozeß aber greift über sie und über sich hinaus. Wir denken, fühlen, wollen dies und jenes – das sind fest umschriebene Inhalte, dies ist ein Logisches, das jetzt nur realisiert ist, ein prinzipiell völlig Definites und Definierbares. Aber indem wir es erleben, ist noch etwas anderes dabei, das Unaussprechbare, Undefinierbare, das wir an jedem Leben als solchem fühlen: daß es mehr ist als jeder anzugebende Inhalt, daß es über jeden hinausschwingt, jeden nicht nur von ihm aus ansieht und hat, wie es das Wesen der logischen Inhaltsangabe ist, sondern zugleich von außen, von dem, was jenseits seiner ist. Wir sind in diesem Inhalt und sind zugleich außerhalb seiner; indem wir diesen Inhalt – und nichts Angebbares weiter – in die Form des Lebens aufnehmen, haben wir eo ipso mehr als ihn.
Damit ist in die Dimension gewiesen, in die das Leben transzendiert, wenn es nicht nur Mehr-Leben, sondern Mehr-als-Leben ist. Überall ist dies der Fall, wo wir uns schöpferisch nennen – nicht nur in dem spezifischen Sinn einer selteneren, individuellen Kraft, sondern in dem, für alles Vorstellen überhaupt selbstverständlichen, daß das Vorstellen einen Inhalt erzeugt, der einen eigenen Sinn besitzt, einen logischen Zusammenhalt, irgend eine Gültigkeit oder einen Bestand, unabhängig von seinem Erzeugtsein und Getragenwerden durch das Leben. Diese Selbständigkeit des Geschaffenen spricht so wenig gegen seinen Ursprung aus der reinen ausschließlichen Schöpferkraft des individuellen Lebens, wie die Entstehung des körperlichen Nachkommen aus keiner anderen Potenz als der des Erzeugers dadurch in Frage gestellt wird, daß der Nachkomme ein völlig selbständiges Wesen ist. Und wie das Erzeugen dieses selbständigen, von dem Erzeuger fortan unabhängigen Wesens dem physiologischen Leben immanent ist und gerade das Leben als solches charakterisiert, so ist dem Leben auf der Stufe des Geistes das Erzeugen eines selbständig sinnvollen Inhaltes immanent. Daß unsere Vorstellungen und Erkenntnisse, unsere Werte und Urteile mit ihrer Bedeutung, ihrer sachlichen Verständlichkeit und geschichtlichen Wirksamkeit ganz jenseits des schöpferischen Lebens stehen – das gerade ist das Bezeichnende für das Leben. Wie das Transzendieren des Lebens über seine aktuell begrenzende Form hin innerhalb seiner eigenen Ebene das Mehr-Leben ist, das aber doch das unmittelbare, unausweichliche Wesen des Lebens selbst ist, so ist sein Transzendieren in die Ebene der Sachgehalte, des logisch autonomen, nicht mehr vitalen Sinnes, das Mehr-als-Leben, das von ihm völlig unabtrennbar ist, das Wesen des geistigen Lebens selbst. Dieses bedeutet überhaupt gar nichts anderes, als daß das Leben eben nicht bloß Leben ist – obgleich es doch auch nichts anderes ist, sondern als weiterer, weitester Begriff, sozusagen als absolutes Leben den relativen Gegensatz zwischen seinem engeren Sinne und dem lebensfreien Inhalt umgreift.