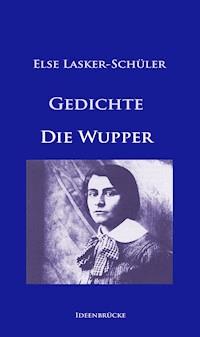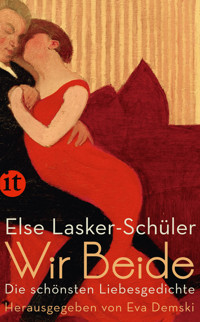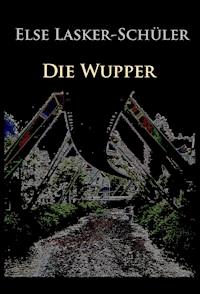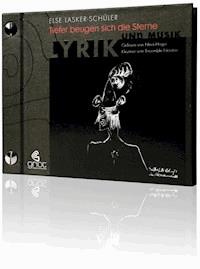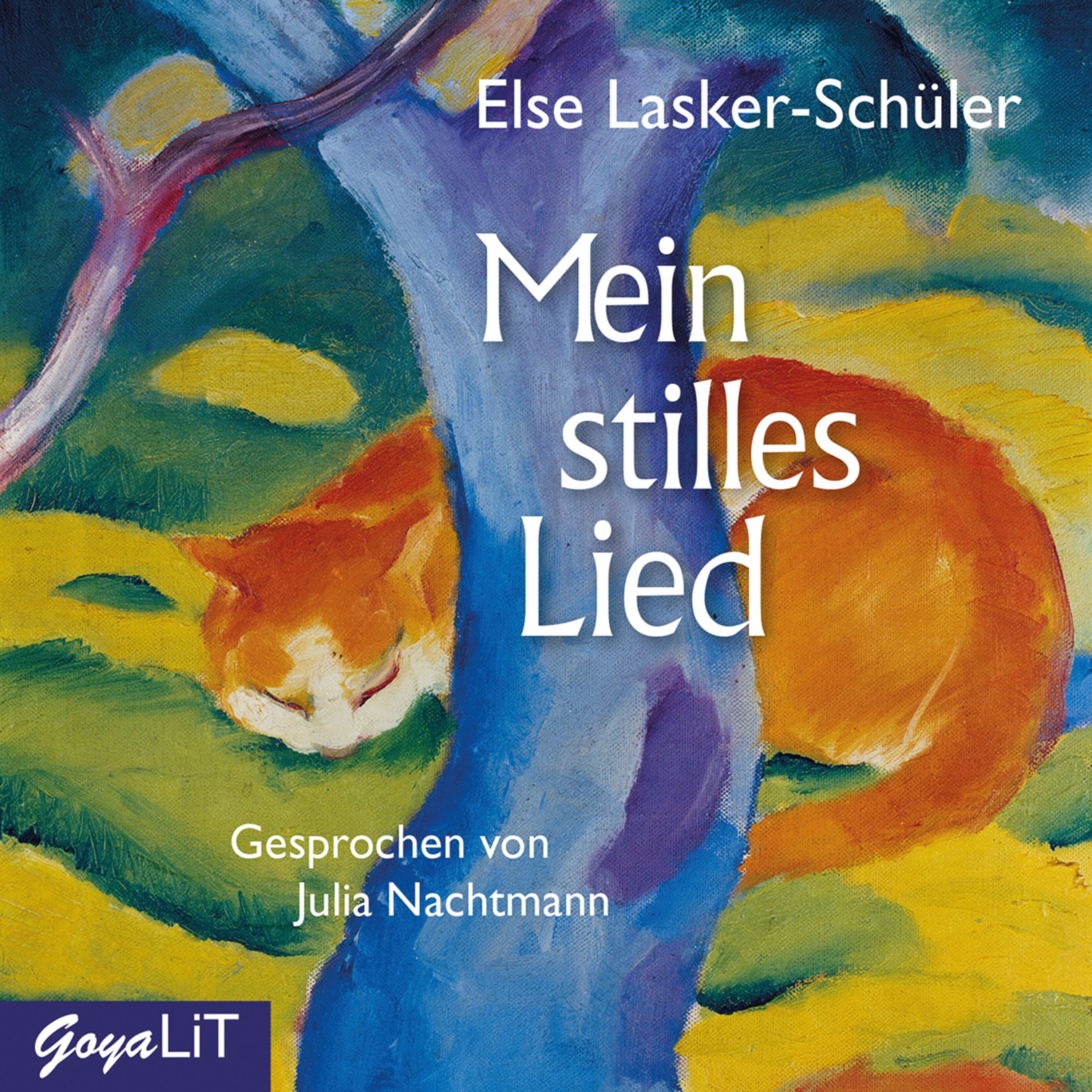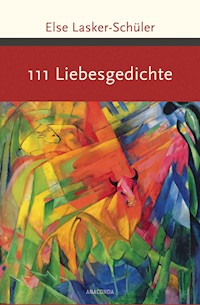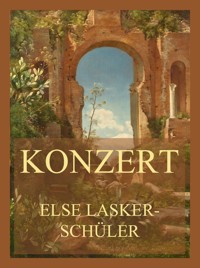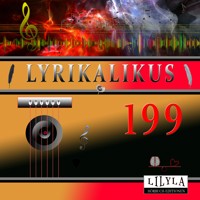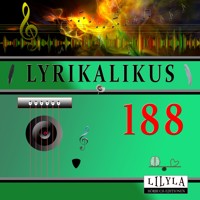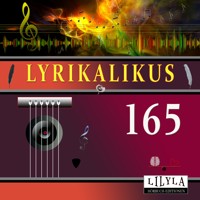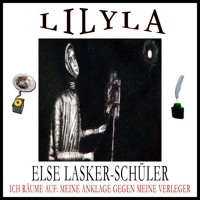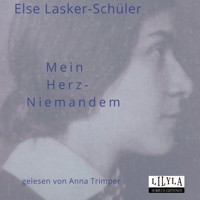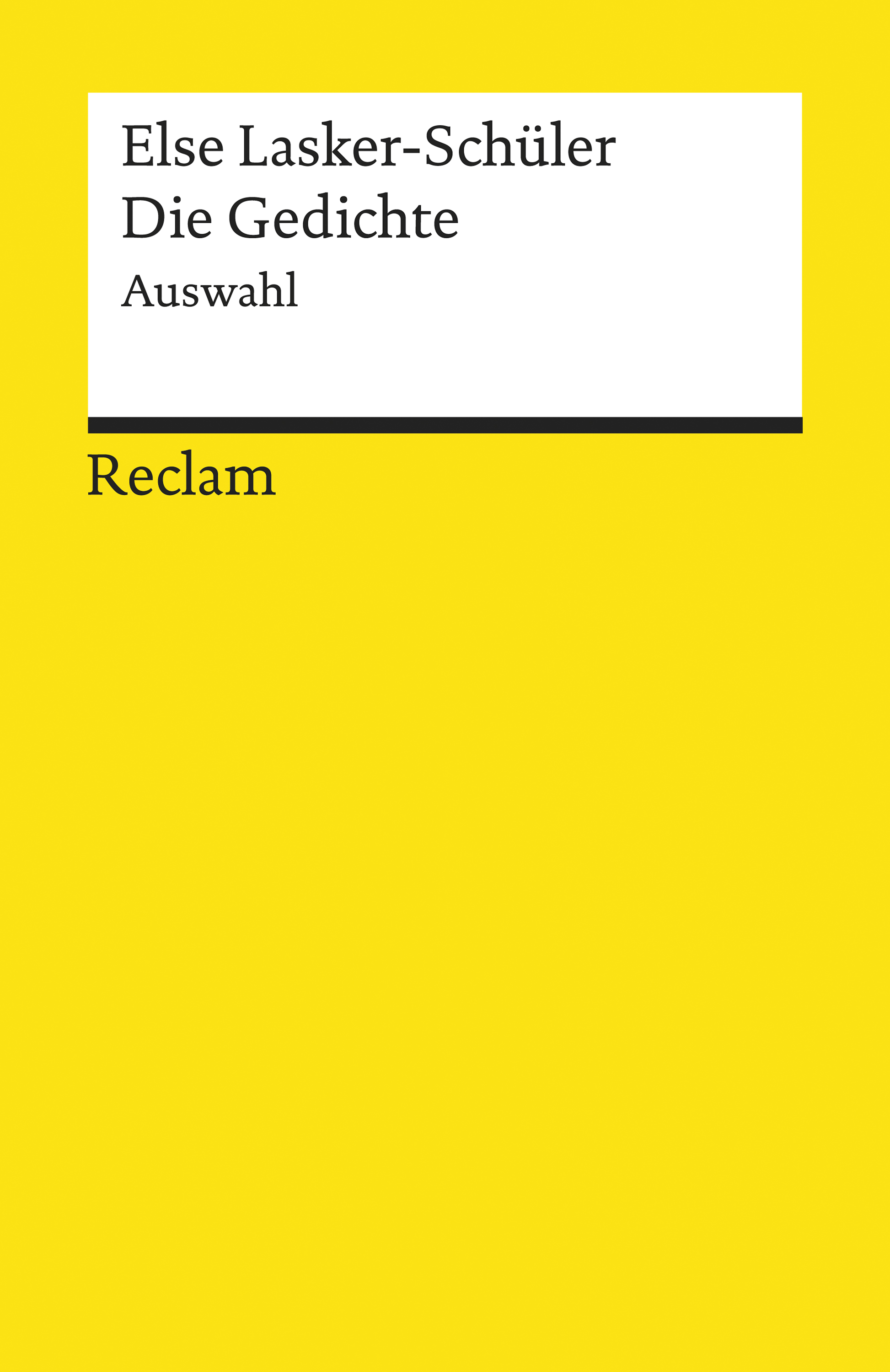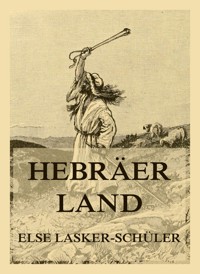
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jerusalem ist die Braut Gottes – so sieht Else Lasker-Schüler das Heilige Land in ihrem außergewöhnlichen Palästina-Buch. Dies ist keine gewöhnliche Reisebeschreibung, sondern die poetische Vision einer großen Dichterin, die uns die innere Wahrheit dieses Landes offenbart. Eigenwillig und faszinierend schildert sie ihre Begegnungen: den Feiertag an der Klagemauer, jüdische Hochzeiten, Autobusfahrten, Kamelkarawanen und das bunte Treiben der Straßen. Manchmal grotesk, oft berührend, immer authentisch – so entstehen Bilder von unvergesslicher Intensität. Die Luft Palästinas weht dem Leser entgegen, wenn die Autorin schreibt: »In Jerusalem vernimmt man tickend die Weltuhr; ihr Zifferblatt leuchtet, liebreich zeigen ihre Zeiger immer noch auf heiligere Stunden und am Mittag läutet es Frieden.« Ein einzigartiges Dokument dichterischer Palästina-Erfahrung, das weit über eine bloße Reiseschilderung hinausgeht und zu den besonderen Büchern der deutschen Literatur gehört.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Das Hebräerland
ELSE LASKER-SCHÜLER
Das Hebräerland, E. Lasker-Schüler
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
Quelle: http://digital.bib-bvb.de/view/bvb_mets/viewer.0.6.5.jsp?folder_id=0&dvs=1741097255968~86&pid=18433718&locale=de&usePid1=true&usePid2=true
ISBN: 9783988682352
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
I1
II3
III10
IV.. 20
V.. 23
VI27
VII27
VIII28
IX.. 39
X.. 40
XI49
XII56
XIII59
XIV.. 61
XV.. 67
XVI69
XVII73
XVIII75
XIX.. 77
XX.. 77
XX.. 80
XXI84
XXII87
XXIII95
XXIV.. 97
XXV.. 100
XXVI102
XXVII104
XXVIII107
XXIX.. 107
XXX.. 111
XXI113
I
Aus der Höhe Jerusalems stürzt der Geier und ordnet sein Gefieder, bevor er sich in einer Grube niederlässt. Feder auf Feder glättet er sorgfältig, als gehe es zum Festflug. Nie sah ich einen Menschen, der, im Begriff, sich auszuruhen, mit glorreicherer Geste sein Gewand betrachtete wie der edle Raubvogel. Ich erinnere mich gern der mächtigen Tiere, die uns so oft durch die Wüste, kühn und voll Unternehmungslust, auf der Fahrt im Omnibus eine Strecke Wegs nach Tel-Aviv begleiteten. Unwillkürlich legt die besorgte Mutter fester um ihr Schoßkindlein ihren Arm.
Heute fahre ich wieder unten ans Meer. Neben mir sitzt ein Beduine im gestreiften Atlaskleid, den Kopf in ein gelbes Tuch gehüllt. Wir sprechen englisch zusammen, auch ein paar Worte arabisch, die ich wohl auf der Straße aufgefangen, aber deren Sinn ich nicht verstehe. Darum lacht der bunte Mitreisende verstohlen – und ich weiß schon warum. Im Grunde versteht man sich im Heiligen Lande – ohne was zu sagen. Die Sonne bringt hier alles an den Tag. Sie scheint so hell durch die Sinne und Herzen der Geschöpfe, vergisst nicht, am geringsten Menschen ihr Rosengold, am winzigsten Tierlein und dem kleinsten Feigenbaum auf vergessenen Schutthaufen gewissenhaft zu verteilen. Und man wundert sich jedes Mal wieder, wenn ihr Dorn einen Einwohner Palästinas in den Nacken sticht. Um 5 Uhr morgens pflegt die Sonne am heißesten zu scheinen und weckt den Langschläfer mit einem goldenen Kuss. Der Araber legt sich schon um die Nachmittagsstunde zur Ruhe, der orientalische Jude – kaum ist es Abend. Mich brachte der Mond als unwiderruflich »Letzte« heim.
Will man von Palästina erzählen – geschmacklos, sich einen Plan zu konstruieren. Ganz Palästina ist eine Offenbarung! Palästina getreu zu schildern, ist man nur imstande, indem man das Hebräerland dem zweiten – offenbart. Man muss gerne vom Bibelland erzählen; wir kennen es ja alle schon von der kleinen Schulbibel her. Nicht wissenschaftlich, nicht ökonomisch; Palästina ist das Land des Gottesbuchs, Jerusalem – Gottes verschleierte Braut. Ich kam von der Wüste aus, reiste zur heiligen Hochzeit, eingeladen zur Feier, die immer Jerusalem umgibt. Immer ist Hochzeit unter dem Baldachin seines Himmels. Gott hat Jerusalem lieb. Er hat es in Sein Herz geschlossen. Er hat diese ewige Stadt der Städte erwählt. Jeder Gast, der in diese Stadt kommt, wechselt sein Kleid mit der Weihe des Gewands. Diese fromme Wandlung verpflichtet den Menschen, sich feierlich und artig zu benehmen, die andächtige Stimmung der auserlesenen, erhobenen Stadt nicht zu erschrecken. Ich muss sagen, ich habe nie ein überlautes Wort, nie einen schrillen Ton in Jerusalem vernommen, weder in seinen Straßen noch in seinen Häusern und Palästen. Man hört darum deutlicher Gott atmen. Überwältigt von Seiner Nähe, beginnt der Mensch zu beben. Man muss sich an Gott gewöhnen. Und tut gut, sich zu reinigen, immer besser zu werden. Die Seele wird von tiefer Furcht ergriffen, beginnt zu brennen. Manchmal hätte ich mich gern vor Gott versteckt.
Nicht alle Menschen, die in das Land Palästina reisen, leben dort im Bewusstsein ihrer Aufgabe. Palästina verpflichtet!!! Sich erholen, namentlich im seelischen Sinne, ist Jerusalem, Palästinas Hauptstadt, der rechte Ort, das heilende Bad der Seele. Denn die Stadt segnet den Menschen, der sich nach dem Segen sehnt, die fromme Stadt tröstet den, der getröstet werden möchte. Jerusalem ist die Sternwarte des Jenseits, der Vorhimmel des Himmels. In dieser himmlischen Schöpfung wurde der erste Tempel gebaut.
Nach greisen Zeiten war es Herzl, der tote Melech, der lebendige, unsterbliche Wegweiser, Theodor Herzl, der auf seines Herzens Papyros den Wiederaufbauplan des Hebräerlandes entfaltete. Er begann die ehrwürdige, ehrfürchtige Mumie auszugraben. Amen... Ich verweile andächtig. Palästina ist gedanklich das fernste Land der Welt. Ich wollte ja nur feststellen, ob man überhaupt wieder auf die Erde zurückkomme – und reiste ab. Mir ist – ich bin auf einem anderen Stern gewesen. Mich bringt niemand von diesem Glauben ab! Am allerwenigsten der Geograph. Ich reiste nach Europa zurück auf dem mächtigen Schiff »Jerusalem«. Wenn nicht am Morgen und am Abend die fröhlichen hebräischen Kolonisten, die kindlichen Judenbauern, auf Deck ihre rührenden Volkslieder gesungen, hätte ich mich, trotz der vielen netten Passagiere, als einsamste Passagierin gefühlt. Welcher Jude wäre auch fähig gewesen, den Grund meiner Rückfahrt zu verstehen und zu billigen. Ach, ich hätte mir so gerne in der italienischen Hafenstadt Trieste unseren Lloyd »Gerusalemme« zum Andenken als Enveloppe an mein Armband gehängt! Er führte uns an Griechenland vorbei, an Ithaka. Er zeigte mir den Zeus auf dem Olymp thronend und aus blaublauem Wasser hörte ich die Sirenen singen.
Es tanzten auf unserem Schiff die kernigen jüdischen Landleute, die Chaluzim mit ihren bildhübschen Bäuerinnen unter freiem Himmel. Die Söhne und Töchter etlicher wohlhabender Judenfamilien Europas pilgerten schon vor vielen, vielen Jahren nach Palästina, ins Gebenedeite Land. Verließen Elternhaus und seine Obhut, sich der Erde des Heiligen Landes zu weihen, die Sümpfe Tiberias zu trocknen, ja ihr Leben zu opfern, mit Freuden hinzugeben für den Dienst des Herrn.
Denn Palästina ist Seine Wohnung. Mit großer Bewunderung und Verehrung begegnete ich diesen Reisegenossen, den mutigen Pionieren des Bibellandes, seinen Helden! Es verstummte mein Mund vor Hochachtung, da ich in einer der nächstliegenden Kolonien noch vor kurzem den fleißigen, schlichten Menschen begegnete. Rügte auch die kleine Reisegesellschaft, der ich mich am Morgen zum Aufbruch ins Emek angeschlossen, meine »Oberflächlichkeit in wirtschaftlichen Dingen«, besonders meine Unerfahrenheit im Dunst, allerdings im gesunden, der großzügigen Kuhställe der Kolonie; wetteiferten in Ratschlägen, die sie dem sachverständigen, gewissenhaften Verwalter zu erteilen sich erlaubten. Die kleinen ein- und zweijährigen Judenkosaken auf ungesattelten Pferden hatten es mir angetan! Sie galoppierten zwischen den Hecken der roten Erde. Am Schabbat wird es den Kindern erlaubt, sich herumzutummeln mit ihren wiehernden Lieblingen. Es ruht vom Hauch des Feiertags noch lässig die Arbeit. Zu Zweien, zu Dreien sitzen die glücklichsten jüngsten Adonis und die zauberhaft niedlichen, lieblichen Geweretts auf den Rücken der lieben, geduldigen Tiere, die ihre kleinen Reiter und Reiterinnen lieben und – mitmachen! Über die hebräische Puszta jauchzend und schnaubend sausen sie über Stock und Stein. Ich gestehe, schon auf dem Schiff wieder nach Europa, empfand ich eine brennende Sehnsucht sondergleichen zurück nach unserm lieben Heiligen Lande, nach Jerusalem namentlich, wie nach einem von mir verlassenen urverwandten versteinten Geschöpf. Ein Skarabäus ist Palästina! Ein jeder Jude ist mit seinem Erzstoff geimpft!
II
Neu wird gekleidet vom Judenvolke von Jahrhundert zu Jahrhundert Palästina, das liebliche Land: im neuen Einband Gott gereicht. Gerade die Juden, die zurück in das Land kommen, entdecken seine Brüchigkeiten und Vergilbtheiten. Die Eingeborenen, die von ahnher nie die rote, blutgeronnene Erde verließen, wohnen zufrieden zwischen den Steinspalten der alten Stadt, viele in den Kammern ihrer Bazare oder auf den Höhen zwischen Schlucht und Schlucht. Oder wie die wilden Juden – vor Jerusalems Tor, anspruchslos und einträchtig, mit ihren arabischen Brüdern in Zelten. Es sind die schlechtesten Hebräer nicht.
Man bewegt sich keineswegs zwischen einzelnen Menschen in den Hängen und Gängen Zions, aber zwischen Völkern! Die sich gefundenen Stämme Judas ruhen methodisch geborgen, jeder einzelne Stamm der bunten Blöcke, im Stadtviertel seines Bilderbaukastens. Um diese gewaltigen Stammbausteine bewegen sich die verschiedenartigsten morgenländischen und abendländischen Völker und Religionen. Und doch geht hier Jude und Christ, Mohammedaner und Buddhist Hand in Hand. Das heißt, ein jeder begegnet dem Nächsten mit Verantwortung. Es ziemt sich nicht, hier im Heiligen Lande Zwietracht zu säen.
Griechische Mönche und abessinische hebräische Mönche verbindet eine besondere Innerlichkeit. Die Priesterwürde vererbt sich wie in ehemaligen Zeiten vom Judenpriester Abessiniens auf den Sohn. Sie tragen schwarze Gewänder, feierlich wallend über ihre hochgewachsenen Gestalten, schwarze hohe Turbane auf stolzen Häuptern. Sie sind die schönsten der Juden im Liladunkel ihrer Haut. Auch sah ich selten schönere Gesichtszüge und edelgeschnittenere, wie die aus atmendem Amethyst. Keusch und tiefliegend der dunkeln Rabbi Augen, schmal und ernst ihre schweigenden Lippen. Ich zitiere das Hohelied, in dem König Schlôme die feinen Muscheln der Nase seiner Sulamith besingt. Auch des Abessiniers edle Nase steht gen Osten gerichtet. Das heißt: die sanften, bebenden Nüstern wittern immer Gottes Hauch.
Die Städte Palästinas sind alle räumlich kleine Städte, aber ihr Inhalt tausendfältig. Dafür überbieten die Dimensionen der sie umgürtenden Landschaften an Weite und unübersehbarer Ausdehnung, an Maß die Umgegenden der Städte und Dörfer aller Länder aller Erdteile. Ich baue keine Kulissen phantastisch, und doch glaube ich, die grenzenlosen Fernen mit ihren Felspyramiden und schwindelnden Abhängen noch betonen zu müssen, eine annehmbare Vorstellung dem, der nie Palästina mit seinen Augen sah, von dem Zauberlande zu ermöglichen. Das Wort reicht nicht, es mit ihm zu messen. Jerusalem selbst ist klein an Wuchs, Gottes auserwählte Braut im Lande Palästinas, und doch an Gestaltung so ungeheuer im Mantel ihrer Lilahimmel und steinernem Schluchtenkleide. Eine kleine Stadt, eine liebliche Burg – Sein Zion; hebt sich aus Stein und Stein empor, umrahmt von Gestein. Palästina ist mit keinem Lande der Erde zu vergleichen. Palästina ist nicht ganz von dieserWelt, grenzt schon ans Jenseits und ist wie die Himmelswelt nicht zeitlich und räumlich zu messen. Mögen etliche auch die »Übertreibungen« – ? einer Dichterin wohlwollend hinnehmen, aber – eine Dichterin musste kommen, das gebenedeite Land zu feiern.
Nur der dichtende Mensch, der sich bis auf den Grund der Welt Versenkende, zu gleicher Zeit sich zum Himmel Emporrichtende, erfasst, inspiriert von begnadeter Perspektive aus, Palästina, das Hebräerland! Und teilt mit dem Herrn die Verantwortung Seiner Lieblingsschöpfung.
Der hebräische Pionier erweckte Palästina aus seinem tausendjährigen biblischen Sagenschlaf. Er hob das verlorene gelobte Land, ein Becher, empor! Füllte ihn mit der Rebe seines Blutes, opferte sein Leben Gott, es neu zu gewinnen – in höherer Form. Die Pioniere, die ersten Kolonisten sind es, die das Fieber der kühlen Wasser auf sich nahmen; etliche starben. Sie gruben nicht nach Gold, aber nach Gott! Sie alle, die ihr junges Leben ließen, und die, die leben geblieben, sind die Fürsten des Landes! Und doch bewegen sie sich, sie, die die Äcker bestellen und die Frucht reifen lassen, mit Bescheidenheit zwischen den Brüdern und Schwestern der Städte. Stolz ist der Stein, blüht zwischen ihm und dem anderen ein kleiner grüner Busch, ruht unter ihm rastend ein müder Pionier. Ein Bergbeduine lockt sein Kamel zärtlich: »Ana hatu inaha ana! La la la, la... la la la, la!«
Wenig Grün und Bunt wächst auf den Bergen um Jerusalem; der März und der Aprilmonat besticken um so fleißiger die Teppiche des Landes mit unvergleichlichen Blumen und Gräsern. Auf den Höhen pflegt der Wanderer ab und zu kleinem Mohn, in sich rotversunkene, verklungene Urahnen der entfaltenden Mohnblume Europas, zu begegnen. Ich könnte so eine Urblume nicht abpflücken, aus Übermut keinesfalls. Und doch brach ich einige von den eben aufgeblühten roten Blumen auf Golgatha, ein paar fromme Christen an der Spree zu erfreuen, zwei meiner lieben Freunde. Ich hatte mir Golgatha ganz anders vorgestellt. Auch stand ich einmal im Traum mit Spielgefährten auf der einsamen Anhöhe, zu wachen die Nacht, nachzuholen, was unbezwingbare Müdigkeit nicht vermochte. Drei Hügel stritten noch vor kurzem über ihre Echtheit. Bis vor einigen Wochen auf der zerfallenen Landstraße, unterhalb des einsamen kleinen Berges, auf dem ich gegenwärtig stehe, grabende Juden, im Begriff, ein neues Häuserviertel anzulegen, auf ein verstorbenes Tor stießen, »auf das Stadttor« unterhalb der Hügelstätte der Ewigen Stadt. Das bis dahin schlummernde Tor wurde, nachdem man es wieder einbalsamierte, zurück in seiner Erde bestattet. Golgatha, von Mohnblumen bewachsen, misst nicht höher wie eine Trauerweide. Und ich machte mir doch Sorgen, wie ich den »Fels« ersteigen könne. Die alten, urwüchsigen Quergassen der Jaffa Road stellten schon täglich neue Aufgaben an mein Herz. Nun stand ich mühelos, aber sehr bewegt und sinnend über unaufgeklärtes Geschehnis, auf dem Hügel der Trauer und blickte hinab ins Tal. Dominikanermönche wandeln schweigend über die Wege des Gartens noch, denn der Abend ist hell, der Himmel hat nicht mit Licht gespart. Mir nur nicht den Weg nach Emmaus entgehen zu lassen, versprach ich den heiligen Männern. Sie gaben mir noch manche religiöse Aufmerksamkeit mit auf den Weg, für die ich ihnen dankte. An Kaktushecken vorbei und Steinen, überall Steine, Steine, die den angelangten Juden, erzählt man in Palästina, bei ihrer Ankunft im Heiligen Lande vom Herzen gefallen sind. An Riesenkrallen vorsintflutlicher Felsungeheuer, ja Steinichthyosauriern, fuhr ich vorbei, spähend nach der Straße, die der edle Jude mit seinen Jüngern erstieg. Unten in der vorweltlichen Schlucht versteinter Rachen reißt sie sich ab zur Höhe fahrend, in die Heilige Stadt. Der aufwirbelnde Staub einer weißen Karawane wehte fast meinen kleinen Wagen bis unten in die Tiefe. Zwei, drei dunkelhäutige Kinder sitzen auf jedem Rücken der geduldigen Tiere; lässig auf dem nachtrabenden Esel, in weiße Tücher gehüllt, eine Frau. »Schalom!« rufen wir uns gegenseitig zu, und mit Entzücken folgen meine Augen dem friedlichen Ausflug. Nun befand ich mich wieder mitten in Jerusalem, und die holde Stille tat mir wohl. Man muss in Palästina leben oder eine Weile gelebt haben, um an die Wahrheit unserer gebenedeiten Bücher nicht mehr zu rühren. Der Aufenthalt im Gelobten Lande, vor allen Dingen in Jerusalem, stärkt den Glauben an Gott, an die »Ruhende Gottheit«. An ihrer Wange lehnt Jerusalem.
Ich fragte die lieben Talmudschüler, ob sie mir wohl sagen könnten, wie alt Gott sei? Diese Frage, meinten sie einstimmig, möchte wohl selbst ihr großer Raw nicht zu beantworten wissen, aber ich möchte den Rabbiner Kook persönlich fragen oder – seine kleine zweijährige Enkelin Zipora, da Adoneu nicht nur der Älteste der Ältesten, auch der Jüngste der Jüngsten sei – nach Seinem Eigenen Kundtun: »Ich Bin, Der Ich Sein Werde.« Unaufhörlich umschwebt der Schmelz zukünftiger Ewigkeit den Herrn. Ein beistimmendes Murmeln schallt aus einem der dämmernden Winkel der Talmudstube zu uns plaudernden Schülern herüber. Die baten mich, ihnen eine meiner mir liebsten hebräischen Balladen vorzutragen.
An Gott
Du wehrst den guten und den bösen Sternen nicht –
All ihre Launen strömen.
In meiner Schläfe schmerzt die Furche,
Die tiefe Krone mit dem düsteren Licht.
Und meine Welt ist still –
Du wehrtest meiner Laune nicht.
...Gott, wo bist du?...
Ich möchte nah an deinem Herzen lauschen,
Mit deiner fernsten Nähe mich vertauschen,
Wenn goldverklärt in deinem Reich
Aus tausendseligem Licht,
Alle die guten und die bösen Brunnen rauschen.
Ich beabsichtige mich wohl bei Gott einzuschmeicheln...? riefen schelmisch meine lieben, lieben jungen Zuhörer leuchtend. Eine wertvollere Kritik konnten sie mir nicht spenden. Immer sitzen etliche fleißige hebräische Schüler im kleinen Vorraum, aber auch in der Synagoge selbst, in neu aufsprudelnden Weisheiten der großen Gottesbücher versunken. Innige Rührung streichelt in der Erinnerung an diese sanft streitenden Menschen wehmütig mein Herz. Liebreiches Lächeln scheint aus ihren mandelförmigen Augen und lässt keine Bitternis ein. Er habe verlassen Vaters und Mutters Garten, sein frisches Bächlein, erzählte mir der jüngste der Talmudisten, aus Deutschlands Sauerlanden her gepilgert, wo auch meine Wiege stand. Dafür aber moussierte heiliger Fanatismus in seinem Blut. Ich aber wandte mich, denn ich musste weinen, mich an unser längst verfallenes Haus an Krücken erinnernd und an seinen greisen Turm, einst stolz zu seiner Rechten.
Die kleine zweijährige Zipora sauste nur so durch die schlichten Vorräume der alten Synagoge, in der ich von den Gottesmännern vielerlei Frommes lerne. Zipora ist so wild wie die niedlichen Reiter und Reiterinnen in den Kolonien. Auch trägt Zipora seitlich gescheiteltes, kurzgeschnittenes, kohlpechrabenschwarzes Haar. Sie will zum Großpapa Kook, erklärt mir ihr Vater, ebenfalls wie sein heiliger Schwiegervater ein Geistlicher, doch noch jung, kaum umbartet. Seine liebevolle Höflichkeit tut den Fremdhingereisten nach dem Gelobten Lande wohl. Munter und spielerischer wie sein Großschwiegerpapa, erinnert er mich an einen mir lieben Freund in Berlin, den jungen Bernardo, hervorragenden Kaplan, dessen Eltern sich nicht einverstanden erklärten mit seinem Entschluss, katholischer Geistlicher zu werden. Er sei zu lustig für einen Kaplan. Damals habe er seinen guten Eltern geantwortet: »Der liebe Gott muss doch auch einmal einen lustigen Kaplan haben.«
Gibt es einen fröhlicheren Beweis, einen ungetrübteren, als den Tanz der erwachsenen greisen Gottesdiener im Tempel? Mit ihrem Jauchzen beweisen sie Adoneu die Dankbarkeit ihrer auferstandenen Herzen – immer wieder. Knaben gewordene Männer mit wallenden Bärten, schwarzen, rostig roten und weißen, weißer noch als der Jerusalemjasmin, der so gern auf dem Gipfel des Sinaï wächst! Ein Bräutigam, der die Braut einholt, tanzte König David dem Zuge der Bundeslade voraus.
In den Synagogenstuben Rabbi Kooks weile ich mit Vorliebe. Meine Besuche, die so oft ihm allein galten, habe ich eingestellt. Mein Erscheinen entzückte das allzu sehr beschäftigte Oberhaupt der Juden Jerusalems keinesfalls. Das Impulsive störe ihn in seinem Gleichmut; verriet mir schonend des Raws Schwiegersohn, den, im Gegensatz zu seinem mächtigen Lehrer und Schwiegervater, meine Art und Weise, sei ich auch ein Sturmwind und reiße die Fugen der Türen aus den Angeln, zu beleben schien. Demungeachtet kam ich über die Stufe der einfachen Eisentreppe, geläutert in aller Wetterstille des Herzens, noch einmal gestiegen, ein kleines Präsent für den großen bescheidenen Rabbi schüchtern im Arm tragend. Immer traf ich den Rabbuni im ärmsten aller Röcke, nie im prunkenden Kaftan oder den feinen Kopf in brokatenem Turban. So pauvre bekleidet hatte ich ihn mir nicht vorgestellt. Es enttäuschte mich sogar fast. Doch auch ohne innere luxuriöse Pose empfängt Jerusalems Großpriester, sich nicht überhebend, den ihn geistlich Konsultierenden. Mit besonderer Geduld – seine Landsleute, seine Juden aus dem Osten Europas gereist; opfert den Bedürftigen seine letzten Piasterstücke. Hat man Glück, trifft man den Großrabbi mit ihnen versammelt am schweren Tisch im Konferenzzimmer plaudernd und mit jedem einzelnen Geschick des Freundes kämpfend. Schließlich, der weise Freund Rat schafft. Dann gleicht der vertraute Kreis treu zueinanderhaltenden Schulkameraden in struppigen Bärten. Man liebt dann den Großrabbiner Kook. Vornehm in der Schlichtheit engerer Familientreue, zu der alle seine Brüder zählen mit den leiernden, frommen Locken, einfältig zu ihrer breiten Hüte beider Seiten, schließt der Raw leise murrend die »gesetzvergessenen« Juden und Hebräer westlicher Himmelsgegenden Europas in sein Gebet. Bindet mit heimlicher Überwindung schier die Zweige der anverwandten Spezies, misstrauisch, missmutig, doch gewissenhaft, mit der Faser seines stämmigen Herzens zu dem göttlichen Strauß seiner teuren, gottesfürchtigen Geschöpfe Galiziens.
Die herzliche Harmonie der plaudernden Gesellschaft respektierend, legte ich den Zweig eines wilden Oleanderbaums dicht neben seine feingegliederten Hände. Ich erkannte unter den Vätern einige Väter der schüchternen Kinderlein aus der Vater Lewone-Street. Ich taufte diese Straße fürsorglich nach dem goldenen Hirten in den Wolken. Wie ihre frommen Väter, tragen die kleinsten Söhne, kleine Väter schon, den Kopf bedeckt; schwarze Käppchen auf ihren braunen, vor der Heiligkeit des Herrn demütigst nach alter Vorschrift geschorenen Haaren. Die zwei rührenden Löckchen, Lammöhrchen, baumeln sanft bis auf ihre zarten Schultern herab, und bangen bei jedem fremden Ton. Als es aber heißer wurde, spielten die artigen ostjüdischen Kleinen, entfesselt ihres Kaftans, in der anspruchslosesten Gasse der Kolonie Rehavias. Ich freue mich mit ihnen. Der Väter Furcht vor den Verfolgern des verlassenen Landes zitterte noch zaghaft aus ihrem scheuen Wesen. Ja, die lieben Kinder verschmähen, jede Zuckerfreude anzunehmen, selbst von uns Juden in den – »neumodischen« Kleidern.
Ein kaum merklich sich erhebender Hügel trennt Rehavia von dem kleinsten Örtchen, das ich je im Leben gesehen habe, einem winzigen Weltchen, einem ganz kleinen Jerusalem. Das war mir genug zu wissen und ich fragte nicht nach dem Namen des plötzlich entdeckten Erdteils. Am Abend kamen viele, viele Lichter herüber zu uns nach Rehavia über den karg mit Gras und Kraut bewachsenen Höcker des Damms. Oft rastete ein Beduine und sein Esel oder sein ledernes Dromedar auf dem Hügelrücken. Vom Garten meiner Freundin aus konnte man so schön die Sternchen von nebenan am Himmelszelt und ihren roten Mondnachen am Abend beschauen.
Tags darauf besuchten wir beide, Hand in Hand, wie Kinder zu gehen pflegen, neugierig das kleinste der arabischen Judenviertel, angrenzend Rehavias. Es hatte ja selbst in den Jahrtausenden seinen Namen vergessen. Wir kletterten über seine gesäuberten Schabbatstraßen. Es liefern Gässchen und wilde Pfade zur Befestigung des kleinen Erdkörpers: Schlamm, Mörtel und Öl der Wegkräuter. Mit naiver Selbstverständlichkeit leert sein Bewohner die Behälter der Gemüse- und Obstschalen ins große Reservoir: Draußen! Um, bevor der Schabbat naht, Straße, Hof und Haus und seiner Pforte Treppe, darauf sich die Kinder platzieren, vom Unrat zu säubern. Diese beiden hygienischen Tage bewahren den Bewohner des Orts vor Epidemie. Spielende Knaben und Mädchen betreuen einen fünfjährigen Heiligen und küssen und streicheln ihn. Seine säumenden Samtsterne blicken uns beide friedlich sinnend an und streifen still über den Sand der Wüste. Eine gelbe Kinderwolkenhand malt sie ganz, ganz sonnig. Die Kleinen dieses Jerusalems fliehen uns nicht wie die verängstigten Kleinen aus der von mir fürsorglich benameten Vater Lewonestreet Rehavias. Ahnungslose, nie bedrohte Kinder nähern sich heute zutraulich uns zwei hebräischen Nikolassen; umklammern dankbar unsere Schöße. Es sind die echten eingeborenen jüdischen Kinder Palästinas; verließen wie ihre Ahnen niemals das Heilige Land. Anders verhält es sich um die mit ihren Eltern eingewanderten Geschöpfchen vertriebener Ostjuden oder nach der Eltern Einwanderung geborenen Knaben und Mädchen, die zu gleicher Zeit mit der jungen Vorstadtkolonie: Rehavia – in Sandwindeln lagen.
Auf der untersten Terrasse Rehavias in der Rambamstreet besuche ich manchmal den netten Professor und Bibliothekar der Jerusalemer Universität, den jetzigen Rektor und seine Gewerett. Der Ähnlichkeit ihres Zwillingsnestes verdanke ich die Bekanntschaft ihres Nachbars, des Kabbalisten Scholem der Heiligen Stadt. Vor vielen, vielen Jahren, an einem Herbstnachmittag, zogen die beflügelten Menschen mit ihren Familien mit den Zugvögeln nach Asien. Nur mit den Dachluken gucken ihre beiden zusammengewachsenen Häuser über den Erdboden gerade; einige Stufen abwärts schlüpft man ins Innere.
Unter dem frommen Scheine des Schabbatleuchters segnet der liebreiche Professor Hugo Bergmann seine Kinder. Zuerst seinen ältesten Sohn Schlôme; nach ihm sein wunderschönes Töchterlein, nach ihr den Wildfang. Der spricht, so ist es Sitte in den Judenfamilien, das jüngste der Kinder, die Schabbatgebete zum Herrn. Beinahe hätte ich gesagt, er galoppierte auf dem Schabbatgebet fröhlich gesattelt um den bestrahlten Tisch, über seine mit Mohnsamen bestreuten Brote, um gefüllte Schüsseln und Teller und Gläser, zuguterletzt über unsere Köpfe! An Alltagen tummelt er sich mit seinen Spielgefährten unbekümmert im Sand der Kolonie herum; und seine blauäugige Mama, die sich in ihrem Kleinsten widerspiegelt, labt sich an ihren einstigen Streichen. Hingegen bringt sie meinem Säumen und Träumen auf den Straßen, meinem Verweilen vor den interessanten Schaufenstern, meinem Lauschen vor arabischen Grammophonläden weniger Sympathie entgegen; selbst mein Entzücken beim Herannahen einer Karawane bringt sie außer Fassung.
Im Zwillingsneste des zweiten Baus bereichert sich an der Lehre der Kabbâla: Scholem, der angesehene kabbalistische Gelehrte. Mein irrtümlicher, unverschuldeter Besuch – ich verwechselte die Pforte – scheint den Kabbalisten in der Lektüre nicht zu beglücken. Doch ich bleibe! Reichlich in meinem Beharren Rache übend, bemüht sich Adon Scholem mit dem Gift der Logik, mir die Legenden des heiligen Israels zu enthimmeln. Zuguterletzt den Papyros, auf dem die erste Initiale unseres Volkes geschrieben steht, zu entwurzeln. »Das Wunder«, sage ich, »mit Schulmeisterlogik zu verehelichen, ergebe eine Mesalliance.« Ich schob ungehalten ab. Aber es kreuzten sich nach einiger Zeit unsere Wege. Beide warteten wir an einer Haltestelle auf den Omnibus nach Jerusalem-City. Wir setzten uns nebeneinander auf die noch unbesetzten Plätze. War mein Nachbar besser gelaunt oder wirkte die nicht vom staubigen Foliant verhangene Natur aufatmend auf sein Gemüt günstig? Verjüngt begann er über unseren, wenn auch – religiösen Disput zu scherzen; er habe nur versuchen wollen, wieweit ich zu beeinflussen sei, und machte den Vorschlag, wir beide uns nicht mehr zu erhitzen über das Leben unserer Heiligen. Ich zeigte über die grandiose Landschaft – zu unserer Rechten und zu unserer Linken und dann streckte ich mich hoch zum Himmelsgewölbe auf und versicherte den aufgetauchten jugendlichen Gelehrten, aus dem Buch der himmlischen Bilderfibel lernte ich im Originaldruck die Geschichten der Propheten unseres Volkes kennen.
III
Auf dem Berg El Kantara bei Safed, wo noch die Ruine des Tempels »Der Leuchte Israels« steht, strömen Züge von fackeltragenden Männern und Frauen Palästinas, aus allen Gegenden, mit Söhnen und Töchtern und Kindeskindern, sich zur Erinnerungsfeier Simeon Ben Jochays zu begeben. Es erwacht die Zimbel, das sinaï-alte Instrument der Hebräer, und begleitet den ekstatischen Tanz. Um den frommen Bergrücken im Frieden des Tempelgebeins erfasst die blühende Hand – die greise zum Reigen. Den jüdischen Knaben aus Buchara, mit Vater und Mutter von Samarkand ins Gelobte Land gereist, werden die herrlichen Zöpfe, die ihnen bis zu den Knien gewachsen, zur Opfergabe abgeschnitten und in einer Feuergarbe dem Geiste Simeons, der Leuchte Israels, gereicht. Tage vor dem Fest begegnete ich diesen bucharischen Knaben, die ich als Prachtexemplare hebräischer schöner Kosakenmädchen immer wieder bewunderte. Etwas heidnisch mutet einem diese qualmende Freudenfeier an, bewegen sich auch die Jauchzenden um unschuldige Altäre des Einigen Einzigen Gottes! Und doch erlebt man ein urwildes Überbleibsel aus Baal und der Astartezeit; als das Volk Israel noch in Kindersandalen aus Fellen, in Rudeln, ein noch kindlich lallendes Volk, Wüsten durchstreifte in der sich ihm noch nicht offenbarten Welt. Seltsam erinnern an unser ursprüngliches Heidentum die schmorenden Widder im wehenden Feuerschein beleuchteten Dunkel. Früh am Morgen der heiligen Tanzfeuer lagern sich zur Ruhe im Mohn, müde unter dem übernächtlichen bleichen Mond, an die Wandung des vornehmen Felsens gelehnt, die Festgäste. Ringsum: Gestein, Menschenodem und Schlummer.
Asiens Palästina heiligt den Schlummer, und nimmermehr würde sich ein Jude noch ein Araber getrauen, den Schlafenden zu wecken, ausströmende Ruhe einer Lappalie wegen zu unterbrechen. Ungefährdet schlafen ihren Schlaf bei unverschlossenen Toren und Türen die Bewohner der Häuser und die Gäste der Gaststätten; vor allem dem müden Wanderer, der Einlass und Lager sucht, die wohltuende Rast in Gottes Lieblingswelt nicht vorzuenthalten. Es weiß der Araber und der arabische Jude nichts vom Einbruch und seinem Diebstahl. Über seinen Balkon pflegt der Haremsbesitzer einen Teppich, fast bis zum Boden des Wegs, auszubreiten, zur Kenntnisnahme – seiner Abwesenheit. Dieses mit kostbaren Arabeskenzeichen gewebte Schreiben an den Freund verpflichtet diesen, des abwesenden Freundes Hab und Gut zu schützen, vor allem seine Frauen in respektvoller Distanz zu betreuen.
Einmal vernahm ich um Mitternacht leise leiernde Karawanenmusik und dumpfe Trommel. An meinem interessanten Gasthaus Nordia vorbei zog eine nubische Karawane. Es war die erste nächtliche Karawanenreise, die ich in Jerusalem zu sehen und zu hören erlebte. Ich sprang von meinem Lager sofort auf den Balkon, die bunte Reisegesellschaft und ihre Trampeltiere ganz nahe zu betrachten. Der Wächter gegenüber meinem Hause wünschte mir: »Good morning«, mitten in der Geisterstunde. Aufatmend entdeckte ich ihn schon vor ein paar