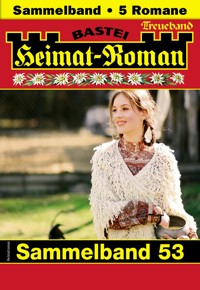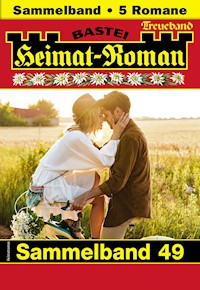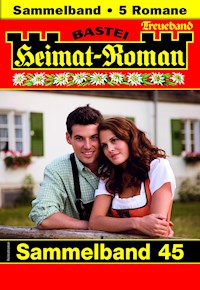5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lesen, was glücklich macht. Und das zum Sparpreis!
Seit Jahrzehnten erfreut sich das Genre des Heimat-Bergromans sehr großer Beliebtheit. Je hektischer unser Alltag ist, umso größer wird unsere Sehnsucht nach dem einfachen Leben, wo nur das Plätschern des Brunnens und der Gesang der Amsel die Feierabendstille unterbrechen.
Zwischenmenschliche Konflikte sind ebenso Thema wie Tradition, Bauernstolz und romantische heimliche Abenteuer. Ob es die schöne Magd ist oder der erfolgreiche Großbauer - die Liebe dieser Menschen wird von unseren beliebtesten und erfolgreichsten Autoren mit Gefühl und viel dramatischem Empfinden in Szene gesetzt.
Alle Geschichten werden mit solcher Intensität erzählt, dass sie niemanden unberührt lassen. Reisen Sie mit unseren Helden und Heldinnen in eine herrliche Bergwelt, die sich ihren Zauber bewahrt hat.
Dieser Sammelband enthält die folgenden Romane:
Alpengold 237 - Du bist mein Stern in dunkler Nacht
Alpengold 238 - Als das Glück auszog ...
Der Bergdoktor 1825 - Dreimal Glück im alten Haus
Der Bergdoktor 1826 - Oft trügt der Schein
Das Berghotel 171 - Wenn's mal krieselt im Paradies
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 628
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
BASTEI LÜBBE AG
Vollständige eBook-Ausgaben der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgaben
Für die Originalausgaben:
Copyright © 2016/2017/2018 by
Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2024 by
Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Covermotiv: © Shutterstock AI
ISBN: 978-3-7517-8617-1
https://www.bastei.de
https://www.luebbe.de
https://www.lesejury.de
Heimat-Roman Treueband 76
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Alpengold 237
Du bist mein Stern in dunkler Nacht
Alpengold 238
Als das Glück auszog …
Der Bergdoktor 1825
Dreimal Glück im alten Haus
Der Bergdoktor 1826
Oft trügt der Schein
Das Berghotel 171
Wenn's mal kriselt im Paradies
Guide
Start Reading
Contents
Du bist mein Stern in dunkler Nacht
Ihre Liebe ist stärker als die bösen Gerüchte
Von Rosi Wallner
Jonas Poschinger ist gerade einmal fünfzehn Jahre alt, als er der dreizehnjährigen Benita Anstetter das Leben rettet. Seit diesem Ereignis sind die beiden unzertrennlich und treffen sich fortan heimlich – bis Benitas Vater hinter die Freundschaft der beiden kommt. Er wütet und tobt. Auf gar keinen Fall duldet der reiche Anstetter-Bauer, dass sich seine Tochter mit dem Sohn eines Hungerleiders trifft!
Kurzerhand steckt er Benita in ein strenges Internat. Sie darf sich nicht einmal von ihrem Lebensretter verabschieden.
Doch auch wenn Benita und Jonas sich durch die Anstrengungen des Anstetters vorläufig aus den Augen verlieren, bleiben sie einander immer im Sinn. Nichts kann die zarte Flamme ihrer unschuldigen Jugendliebe löschen, und eines Tages sehen sie sich wieder …
Jonas Poschinger war aus dem Bus gestiegen, der mit einiger Verspätung aus der Kreisstadt, in der er zur Schule ging, in seinem abgelegenen Heimatdorf angelangt war. Unterwegs hatte es so stark zu schneien begonnen, dass die Sicht weitgehend eingeschränkt war und sie nur sehr langsam vorwärtsgekommen waren.
Nun sanken nur noch vereinzelte Flocken vom Himmel, und Jonas ging die Dorfstraße entlang. Die Häuser waren hoch eingeschneit, Dachlawinen waren herabgestürzt und bildeten mit dem Schnee, den die Dorfbewohner bereits weggeschaufelt hatten, rechts und links Wälle. Es war eine stille, gedämpfte Welt, jeder Schritt wurde aufgesogen, kaum jemand ging vor die Tür.
Die Häuser waren schon adventlich geschmückt, dicke Kerzen in Gläsern standen in den Fenstern, die Simse waren mit Tannenreisig bedeckt, und an den Türen hingen weihnachtliche Kränze.
Während die anderen Kinder sich beeilten, nach Hause zu kommen, wo ihre Mütter schon auf sie warteten und sie sich an einen gedeckten Tisch setzen konnten, wurden Jonas’ Schritte immer zögerlicher. Schließlich bog er in einen kleinen Seitenweg kurz vor dem Dorfausgang ein, der halb eingeschneit war.
Wie immer, wenn Jonas das kleine Anwesen erblickte, in dem er mit seiner Familie wohnte, befiel ihn tiefe Niedergeschlagenheit. Es schien, als sei das kleine Gehöft mutwillig dem völligen Niedergang preisgegeben worden. Die einstigen Stallungen und die Wirtschaftsgebäude, die schon lange nicht mehr genutzt wurden, waren verfallen. Die Holzlatten der Scheune waren zersplittert und bogen sich teilweise nach außen, davor lagen verrostete landwirtschaftliche Geräte und ein altes Fahrrad herum.
Auch das Wohnhaus, aus dessen Schornstein sich ein dünner Rauchfaden schlängelte, sah verwahrlost aus. Die Fensterläden waren schadhaft, eine Scheibe im Obergeschoss war nachlässig mit einem Brett zugenagelt. Rechts und links von der Eingangstür waren Holzstöße aufgeschichtet, und es war zu hoffen, dass sie ausreichten, um das untere Stockwerk bis ins Frühjahr hinein zu beheizen.
Die kleine Wiese hinter dem Haus ging in Latschengestrüpp und schließlich in einen dunklen Bergwald über. Dahinter erhoben sich schroff die Felswände eines Gebirgsmassivs, das beide Seiten des Dorfs begrenzte. Heute hingen die Wolken tief herab, was noch dazu beitrug, die bedrückende Atmosphäre, die von dem Anwesen ausging, zu erhöhen.
Schon von Weitem hörte Jonas die streitenden Stimmen seiner Eltern. Offensichtlich war es seinem Vater zu viel gewesen, bei diesem Winterwetter aufzustehen und irgendeiner Arbeit nachzugehen. Auch seine Mutter, die gelegentlich in Lokalen in der Umgebung aushalf, schien heute zu Hause geblieben zu sein, was unweigerlich zu Streitigkeiten führte. Vermutlich war auch der Alkohol ausgegangen, ohne den sie ihr Leben nicht aushalten konnten, und nüchtern waren seine Eltern noch reizbarer als in angetrunkenem Zustand.
Jonas verhielt den Schritt, und wie immer durchströmten ihn Angst und Verzweiflung. Er fühlte sich wie ein Fremder, wie ein ungebetener Gast in seiner Familie, und jedes Mal, wenn er nach Hause kam, verspürte er heftigen Widerwillen. Schließlich öffnete er die Haustür und trat in den Flur, wo ihm der unangenehme Geruch nach angebranntem Essen, Zigarettenrauch und Alkohol entgegenschlug.
In der geräumigen Wohnküche standen sich wie befürchtet seine Eltern gegenüber und schrien sich wütend an. Sein Vater, ein ungeschlachter, massiger Mann, der weitaus älter wirkte als Ende dreißig, ging drohend auf seine Frau zu. Doch Anna Poschinger wich nicht vor ihm zurück, sondern schleuderte ihm mit funkelnden Augen giftige Beschimpfungen entgegen, die Jonas zusammenzucken ließen.
Obwohl sie schlecht gekleidet und ungepflegt war, lag auf ihren verlebten, bleichen Zügen immer noch der Abglanz einstiger Schönheit. Anna hatte üppige schwarze Haare, die sie achtlos nach hinten gebunden hatte, und grüne Augen. Sie war eine Dorfschönheit gewesen, rank und schlank, das wusste Jonas von den vielen Fotografien, die sie ihren Kindern in besseren Stunden voller Stolz gezeigt hatte.
Und sein Vater war ebenfalls ein stattlicher, gut aussehender Mann gewesen, wie das Hochzeitsbild zeigte. Jonas hatte mit zunehmendem Alter nie begreifen können, wie es geschehen konnte, dass seine Eltern so heruntergekommen waren. Vielleicht lag es daran, dass sie sich gegenseitig immer tiefer ins Unglück zogen, weil sie sich schon längst hassten und nicht vom Alkohol lassen konnten.
»Du liegst den ganzen Tag nur faul herum, und es schert dich net, dass kein Essen im Haus ist«, kreischte seine Mutter gerade, und rote Flecken erblühten auf ihren Wangen.
»Du weißt ganz genau, dass ich um diese Zeit schwer etwas find. Und warum arbeitest du net? Weil du so eine Bissgurn bist, dass dich keiner haben will«, erwiderte ihr Mann gehässig.
Damit hatte er allerdings recht. Anna Poschinger benahm sich den Gästen gegenüber oft so ausfällig, dass sie für die Wirtsleute nicht mehr tragbar war. Inzwischen hatte sich das auch in den Nachbarortschaften herumgesprochen, sodass sie nirgends mehr als Aushilfe angenommen wurde.
Als Jonas den Raum betrat, richteten sich alle Blicke auf ihn. Sein um ein Jahr jüngerer Bruder Alfons, genannt Fonsi, der aber wesentlich älter als vierzehn wirkte, lümmelte sich faul auf der Eckbank. Er war ganz nach dem Vater geraten, hochgewachsen, muskulös und mit breiten Schultern.
Fonsi widmete sich jeden Tag hingebungsvoll seinem Krafttraining. Das war das Einzige, was er mit Ausdauer und Leidenschaft tat. Er wirkte bereits jetzt bedrohlich, und da er eine Neigung zur Gewalttätigkeit hatte, stand zu befürchten, dass er in nicht allzu langer Zeit ein gefürchteter Wirtshausschläger werden würde.
Am anderen Ende der Eckbank saß in sich zusammengekrümmt seine zwölfjährige Schwester Johanna, wie immer verschüchtert und verängstigt, wie es die Art von Kindern ist, die wissen, dass sie unerwünscht sind. Von den Eltern vernachlässigt und immer in der Furcht, Opfer von Fonsis hinterhältigen Attacken zu werden, hatte sie nur den einen Wunsch, nämlich ihr Elternhaus, sobald es möglich war, zu verlassen.
Johanna war die Einzige, mit der Jonas etwas verband.
»Was starrst du uns denn so an?«, fragte ihn Fonsi gehässig. »Ist der höhere Schüler doch noch in unser Elend zurückgekehrt?«
Jonas besuchte im Gegensatz zu seinen Geschwistern das Gymnasium in der Kreisstadt. Das war auf Betreiben von Hochwürden hin geschehen, der sich überhaupt des ältesten Sohns der Poschingers sehr annahm. Und das hatte auch seinen Grund, denn Jonas war von überragender Intelligenz und selbst am Gymnasium geistig unterfordert.
Jonas gab keine Antwort. Auf dem Tisch standen die Überreste einer kärglichen Mahlzeit, und es war nicht das erste Mal, dass für ihn nichts mehr zu essen übrig geblieben war, wenn er hungrig und müde nach Hause kam.
»Ich geh zu Hochwürden, heut hab ich Latein.«
Das stimmte nicht ganz. Jonas benötigte schon lange keinen Unterricht mehr, aber Hochwürden hatte ihm angeboten, seine Bibliothek im Pfarrhaus zu benutzen, und davon machte Jonas regen Gebrauch.
Er wurde an der Tür von der Haushälterin, der grimmigen Martha, freudig begrüßt und in den kleinen Raum geleitet, dessen Wände mit hohen Bücherregalen ausgestattet waren. Eine breite Terrassentür führte in den Garten, der auch im Winter idyllisch wirkte. Die großen Buchskugeln trugen Schneehauben, um einen Rosenbogen wanden sich kahle, weiß bestäubte Zweige. Der Rest war im Schnee versunken, an manchen Stellen deutete ein Polster an, dass eine Pflanze darunter dem Frühling entgegenschlummerte.
Zwei breite Lehnsessel luden zum Verweilen ein, dazwischen stand ein runder Tisch, den Magda mit einem Adventsgesteck geschmückt hatte, aus einer Obstschale daneben sollte sich Jonas bedienen. Sonst befand sich nur noch eine Stehlampe im Raum, deren Licht nun alles in ein warmes Licht tauchte, denn draußen dunkelte es bereits.
Für Jonas war diese kleine Bibliothek ein Refugium, der Trost für alle Widrigkeiten, die er erleiden musste. Denn nicht nur zu Hause gab es Schwierigkeiten, sondern auch in der Schule. Man hielt ihn für einen Streber und Sonderling, doch wie hätte er jemals einen Schulkameraden zu sich nach Hause einladen können? Und so hielt er sich fern und fehlte sogar bei schulischen Unternehmungen.
Hochwürden hatte ihn auf ein Regal hingewiesen, in dem sich historische Werke befanden, die auch für jugendliche Leser geeignet waren. Jonas hatte schon zwei oder drei Bände gelesen und war zunehmend fasziniert davon.
Er hatte gerade wieder nach einem Buch gegriffen, als Martha mit einem Tablett hereintrat. Die Pfarrhaushälterin, eine gedrungene Frau mit harten Zügen und streng zurückgekämmtem Haar, das sie zu einem altmodischen Dutt zusammengesteckt hatte, war im ganzen Dorf gefürchtet. Sie bewachte die Privatsphäre von Hochwürden mit eifersüchtiger Beflissenheit, außerdem hatte sie eine derart scharfe Zunge, dass sich niemand mit ihr anzulegen wagte.
Eigenartigerweise hatte sie aber eine starke Zuneigung zu Jonas Poschinger entwickelt, obwohl er von diesem heruntergekommenen »Gschwerl« abstammte, das sie zutiefst verachtete. Zunächst hatte sie starke Bedenken geäußert, als Hochwürden ihn ins Haus mitgebracht hatte, und hatte sich sogar verstockt geweigert, sich mit ihm zu befassen.
Dann hatte sie ihn dabei ertappt, wie er einen Apfel aus der Obstschale, die sie so liebevoll für Hochwürden zusammengestellt hatte, in seiner Hosentasche verschwinden ließ. Erbost, beide Arme in die Hüften gestemmt, hatte sie sich vor ihn hingestellt.
»Man merkt halt doch, woher du kommst …«, hatte sie ihn giftig angefaucht.
Tiefe Röte der Scham war in Jonas Poschingers Wangen gestiegen, er nahm den Apfel aus der Tasche und legte ihn in die Schale zurück.
»Hochwürden hat mir erlaubt, von dem Obst zu essen. Der Apfel war außerdem net für mich«, versuchte sich Jonas zu rechtfertigen.
»Ach so, für wen denn?«
»Für die Johanna, meine Schwester. Manchmal bleibt für sie nichts übrig.«
Jonas verstummte, er war außerstande, dieser unfreundlichen Frau weitere Einzelheiten aus seinem Elternhaus zu eröffnen.
»Was heißt das, es bleibt nichts für sie übrig?«, fragte Martha nach, obwohl sie es sich denken konnte.
»Es ist nicht genug Essen da für alle.«
Daraufhin schien Martha in tiefes Nachsinnen zu verfallen, und sie verließ den Raum. Wenig später kehrte sie mit einem Teller belegter Brötchen zurück. Den stellte sie vor ihn hin, daneben ein Glas Milch und eine Tafel Schokolade, denn Hochwürden mochte Süßes.
»Das ist bei uns übrig geblieben, Hochwürden lässt immer so viel stehen. Wenn du net alles essen kannst, dann nimmst du’s halt mit. Hier ist ein Tüterl.«
Das stimmte zwar nicht, Hochwürden hatte einen gesegneten Appetit, was sich allmählich auch äußerlich abzuzeichnen begann, doch Martha fand, dass dies eine gottgefällige Lüge im Rahmen der Nächstenliebe war. Und dieses Spiel wiederholte sich immer wieder, wenn Jonas im Pfarrhaus auftauchte.
Seitdem waren sich die beiden zugetan, auch wenn sie nie ein Wort darüber verloren. Hochwürden war erleichtert und bestärkte Martha darin, den Buben ja ordentlich zu versorgen und seine Schwester mit dazu.
Und so hatte sie auch heute wieder eine Vesper und allerlei Leckereien für ihn, und sie erkannte an seinem Blick, wie dankbar er dafür war. Sie beeilte sich, wieder aus dem Raum zu kommen, denn er griff erst zu, nachdem sie ihn allein gelassen hatte.
Heut ist er ganz blass und ausgehungert, eine Schand ist das, wie die Poschingers ihre Kinder halten, dachte sie bitter. Andere Eltern wären dankbar, wenn sie Kinder wie den Jonas und die Johanna hätten.
Niemand wusste, wie sehr sie unter ihrer eigenen Kinderlosigkeit gelitten hatte. Und Enkel würde es auch keine für sie geben, die ihr das Alter leichter machen würden.
Die Tür hatte sich kaum hinter Martha geschlossen, als Jonas schon hungrig über das Essen herfiel und es hinunterschlang. Heute hatte die Pfarrhaushälterin ihm einen großen Becher mit heißer Schokolade hingestellt, was ihm angesichts der Kälte guttat. Dann hielt er inne und steckte eine Butterbrezen und eine Käsesemmel in die dafür vorgesehene Tüte. Auch ein paar Süßigkeiten ließ er in seiner Schultasche verschwinden, die er immer dabeihatte, wenn er ins Pfarrhaus ging.
Endlich wurde ihm warm, und auch der pochende Kopfschmerz verging. Jonas leerte den Becher und genoss die Ruhe, die im Pfarrhaus herrschte. Nach einer Weile holte er sich das Buch aus dem Regal, mit dem er fast zu Ende gekommen war und das ihn so fesselte, dass er beständig daran denken musste.
Dann betrat er eine andere Welt, in der ihm nichts und niemand etwas anhaben konnte.
»Ist der Bub noch da?«, fragte Hochwürden, als er spät nach Hause zurückkehrte, weil er einer trauernden Familie Beistand geleistet hatte.
»Nein, natürlich net, es ist ja schon nachtschlafende Zeit. Magst du noch etwas essen, Hochwürden?«, fragte sie ihn.
Der Priester war ein Nachbarsbub gewesen, den sie hatte aufwachsen sehen, und so duzte sie ihn noch ganz selbstverständlich. Aber gleichzeitig nannte sie ihn auch respektvoll »Hochwürden«, denn das gehörte sich so.
»Mach dir keine Umstände, Martha. Außerdem haben mich die Breitners zum Essen eingeladen, das konnte ich nicht ablehnen.«
»Ach so.«
»Du hast doch noch was auf dem Herzen, oder?«
Hochwürden kannte seine Pappenheimer, besonders aber seine Martha, die für ihn so etwas wie eine Verwandte war.
»Der Bub, der Jonas, war heut in keiner guten Verfassung. Blass, ausgehungert und niedergeschlagen, tät ich amal sagen.«
Hochwürden seufzte tief auf.
»Wenn du wüsstest, was ich mir schon für Gedanken wegen ihm gemacht hab.«
»Solche Rabeneltern, solche sakrischen«, begann sie zu schimpfen, »und das Madel, die Johanna, ist auch übel dran.«
»Das Beste wär, die beiden aus der Familie zu nehmen. Bei dem Fonsi, fürcht ich, ist schon Hopfen und Malz verloren. Aber wohin mit ihnen? Etwa in ein Heim?«
»Jesus, Maria.« Martha bekreuzigte sich.
»Du sagst es. Also bleibt uns nichts anderes übrig, als den Jonas wie bisher zu unterstützen. Und ich glaub, er ist stärker, als es den Anschein hat. Wenn es aber noch schlimmer wird, werde ich den Poschingers ins Gewissen reden.«
»In welches Gewissen?«, grummelte Martha.
Dann wünschten sie sich eine gute Nacht, denn Hochwürden musste für die Frühandacht beizeiten aufstehen. Dasselbe galt auch für Martha, sie war sogar gewöhnlich schon vor dem Morgengrauen auf den Beinen.
Als Jonas nach Hause gegangen war, hatte es wieder angefangen zu schneien. Mühsam kämpfte er sich vorwärts, denn der Seitenweg zu dem Anwesen der Poschingers war nicht ausgeleuchtet. Das Haus lag auch still und dunkel da. Als er endlich die Haustür mit klammen Händen öffnete, fühlte es sich an, als ob seine Bewohner es überstürzt verlassen hätten.
Wahrscheinlich hatten sich die Eltern dazu entschlossen, ihrem trostlosen Zuhause den Rücken zu kehren und wieder einmal im Wirtshaus anschreiben zu lassen, was fast schon zur Regel geworden war. Fonsi, der schon längst alles Kindliche abgestreift hatte, war vermutlich bei einem seiner älteren Freunde untergekrochen und würde voraussichtlich morgen sogar die Schule, wie so oft, schwänzen.
»Johanna?«, rief er nach oben.
Eine Tür öffnete sich zögernd.
»Komm herunter, Johanna, hier ist es noch einigermaßen warm am Kachelofen. Ich hab was für dich mitgebracht.«
Johanna kam heruntergehuscht und schaute sich scheu um, als hätte sie Angst, dass ihr Vater oder Fonsi plötzlich aus einem dunklen Winkel auftauchen könnten. Sie war in mehrere Westen und einen alten Anorak gehüllt und zitterte immer noch, denn die Räume im oberen Stockwerk waren so gut wie ungeheizt.
»Ich mach dir eine Milch warm.«
Johanna setzte sich neben den Kachelofen, der noch schwache Wärme ausströmte, und trank dann gierig von der warmen Milch, die ihr Jonas in einem großen Glas reichte. Dann legte er die Butterbrezen und die Käsesemmel vor ihr auf einen Teller, daneben die Süßigkeiten.
Mit einem glücklichen Aufseufzen griff Johanna nach der Brezen, und in kürzester Zeit war der Teller leer und die Hälfte der Süßigkeiten ebenfalls verzehrt. Einen Teil der Schokolade behielt sie zurück, denn vielleicht gab es morgen wieder nicht genug zu essen.
Jonas spülte das Geschirr, das sie benutzt hatten, denn die Eltern durften nichts von ihren heimlichen Mahlzeiten erfahren. Er sah mit Befriedigung, dass ein rosiger Schimmer auf den Wangen seiner Schwester lag und sie sich etwas aufgerichtet hatte.
»Wenn ich dich net hätt, Jonas, wär ich schon längst auf dem Friedhof«, sagte sie, und ihr Bruder zuckte erschrocken zusammen.
»Was redest du denn da, Hannerl.«
»Einfach, weil ich es nimmer aushalten könnt daheim ohne dich.«
Jonas wusste, dass das stimmte. Johanna litt am meisten unter den ständigen Streitigkeiten der Eltern und unter der Heimtücke von Alfons. Einmal, sie war gerade einmal acht, war sie von zu Hause weggelaufen und hatte sich im Wald versteckt, was jedoch nur dazu geführt hatte, dass ihr Vater sie so geschlagen hatte, dass sie ein paar Tage nicht zur Schule gehen konnte.
»Wenn ich erst amal älter bin, Johanna, dann hol ich dich hier heraus«, sagte Jonas mit heiserer Stimme.
»Versprochen?«
»Ja, versprochen. Du kannst dich auf mich verlassen.«
Johanna glaubte ihm, und ein schwaches Lächeln verschönte ihr Gesicht auf überraschende Weise.
Plötzlich war von draußen her Lärm zu vernehmen. Eine raue Männerstimme sang unmelodisch, und eine Frau kreischte vor Lachen.
»Die Eltern sind zurück«, flüsterte Johanna angstvoll.
Sie löschten das Licht und stiegen im Dunkeln die Treppe hoch in ihre kalten Zimmer. Doch nicht nur wegen der Kälte fanden sie keinen Schlaf, sondern weil ihre betrunkenen Eltern laut und rücksichtslos im Haus herumrumorten. Ein Poltern erklang, danach eine fluchende Stimme, anscheinend war ihr Vater gestürzt.
Anna lachte schrill auf und verhöhnte ihn, sodass die Stimmung umschlug. War er eben noch bester Laune gewesen, begann Poschinger wieder seine Frau zu beschimpfen, was sich bis Mitternacht hinzog. Dann kehrte Ruhe ein, wahrscheinlich waren die beiden vor Erschöpfung auf der Ofenbank eingeschlafen.
***
Im neuen Jahr brachen bessere Zeiten für die Poschingers an. Anna erhielt eine Anstellung in einem Vereinsheim, das abends so früh schloss, dass sie noch den letzten Bus von der Kreisstadt in das kleine Bergdorf erreichte. Dort fühlte sich Anna in ihrem Element. Der raue Umgangston, der in der Gaststätte am Rande eines Fußballfelds herrschte, störte sie nicht, sondern kam ihr sogar entgegen.
Erinnerungen an ihre Jugendzeit stiegen in ihr empor, als sie in ihrem Heimatdorf »die wilde Anna« genannt wurde und alle Burschen – und nicht nur die – hinter ihr her gewesen waren. Sie hatte ihre Gunst großzügig verteilt, ihr Leben war ein einziger Rausch gewesen.
Allmählich hatte es im Dorf geheißen, dass die schöne Anna nicht wisse, was gut für sie sei. Denn es dauerte lang, bis sie begriffen hatte, dass sie ihr Leben mit Liebschaften vergeudet und ihre Schönheit mit Alkohol ruiniert hatte. Doch da war es schon zu spät gewesen. Schließlich heiratete sie, bereits schwanger, Anton Poschinger, denn keiner der reichen Großbauernsöhne wollte sie noch zum Altar führen.
Sie liebte ihren Mann nicht und hasste das Leben, das ihr durch diese Heirat aufgezwungen worden war. Doch jetzt sah sie die Möglichkeit, ihrem Leben endlich wieder eine neue Wendung zu geben. Noch war sie jung genug, um neu anzufangen, und das feste Einkommen verlieh ihr mehr Selbstständigkeit.
Obwohl es ihr schwerfiel, trank sie weniger und ernährte sich gesünder, was sich auch äußerlich bemerkbar machte. Das Dirndlkleid, das sie jetzt immer trug, betonte ihre üppigen Formen, was nicht unbeachtet blieb. Ihr schwarzes Haar fiel ihr nun wieder in glänzenden Locken auf ihre Schultern, und sie schminkte sich so geschickt, dass sie um Jahre verjüngt wirkte.
Bald stand sie im Mittelpunkt des Vereinslebens, und wenn ihr etwas raues Lachen aufklang, gab es nicht wenige, in denen das eine gewisse Spannung auslöste.
Anna lebte auf, fühlte sich manchmal sogar in ihre Jugend zurückversetzt, und dann wich alle Bitterkeit von ihr. Aber sie war klüger und vorsichtiger geworden, ließ sich auf nichts mehr ein. Die Vereinsstätte wurde bald zu einer Art Zuhause für sie. Dafür nahm sie die beschwerliche Busfahrt auf sich, oft half sie sogar an ihren freien Tagen aus.
Anton Poschinger wollte seiner Frau in nichts nachstehen und hatte sich einer Gruppe von Waldarbeitern angeschlossen. Es hatte viel Schneebruch gegeben, die Wege mussten freigeräumt und gefährdete Bäume gefällt werden. Zwar vertrank er seinen Lohn oft genug im Wirtshaus, dennoch hatte sich die Situation verbessert. Das obere Stockwerk konnte nun richtig beheizt werden, und es war auch immer etwas Essbares im Haus.
Da sich das Ehepaar nun aus dem Weg gehen konnte, kam es nicht mehr zu jenen Streitigkeiten, die die Atmosphäre vergiftet hatten. Auch Fonsi, der inzwischen vierzehn geworden war, trieb sich meistens irgendwo herum, und so senkte sich Frieden über das Anwesen.
Besonders Johanna kam das zugute, und ihre Ängstlichkeit fiel allmählich von ihr ab. Sie hatte inzwischen eingesehen, dass sie eine bessere Ausbildung brauchte, wenn sie von zu Hause wegkommen wollte, und so bereitete sie sich mit Jonas’ Unterstützung auf einen verspäteten Übergang zur Realschule vor.
Jonas verbrachte weiterhin viele Nachmittage im Pfarrhaus. Die Bibliothek hatte sogar eher noch an Anziehungskraft gewonnen, und er las mit wachsender Begeisterung, was ihm von Hochwürden empfohlen wurde. Gern unterhielt sich der Pfarrer mit dem Jungen, dessen wacher Verstand ihn immer wieder in Erstaunen versetzte. Oft lenkte er das Gespräch auf religiöse Themen, denn Hochwürden wollte in Jonas die Saat legen für etwas, das er schon lange in seinem Herzen trug.
Auch die mütterliche Freundlichkeit von Martha wollte Jonas nicht missen. Von seiner Mutter erfuhr er nur wenig Zuwendung, manchmal hatte er sogar den Eindruck, dass sie ihn ablehnte, obwohl sie sich äußerlich so glichen. Doch darüber sprach er mit niemandem.
Und so vergingen die Tage in gewissem Gleichmaß, ohne dass Jonas ahnen konnte, dass sich bald etwas ereignen würde, was sein Leben für immer verändern sollte.
***
Etwas außerhalb von Hochkirchen, in unmittelbarer Nähe des Poschingerhofes, befand sich ein Bergsee, der die ganze Freude der Kinder und Jugendlichen des kleinen Dorfes war. Im Sommer konnte darin gebadet werden, sobald sich das Wasser genügend erwärmt hatte. Alte, gekrümmte Weidenbäume boten am Uferrand Schatten, und es war ein offenes Geheimnis, dass sich dort heimlich Liebespaare trafen.
Auf dem angrenzenden Wiesenstück feierte die Dorfjugend Feste, die bis zum Morgengrauen andauerten und bei den Älteren, wenn sie von dem Lärm nachts aufschraken, sehnsüchtige Erinnerungen erweckten.
Auch im Winter war der See, der jedes Jahr zufror, bevölkert. Es war geradezu eine Tradition in Hochkirchen, Schlittschuhlaufen zu können, und es gab etliche beeindruckende Eistänzer. An Wochenenden fand sich oft die Musi ein, Stände mit Glühwein und Bratwurst wurden aufgeschlagen, und dann drehten sich die Tänzer ausgelassen unter dem Beifall der Dörfler im Walzertakt auf dem Eis. Dass es dabei auch viel Spott gab, wenn ein Paar schmählich zu Fall gekommen war, wurde hingenommen. Das gehörte einfach zur Gaudi.
Dieses Jahr wollte der Winter nicht aus dem Hochtal weichen, obwohl es schon Anfang März war und die Tage länger wurden. Immer noch war der See zugefroren, und Schneeschauer trieben durch das Tal, sodass die Alten klagten und mehr denn je nach den tröstenden Sonnenstrahlen des Frühjahrs verlangten.
Jonas ging hin und wieder mit Johanna zu dem Treiben am See, wagte sich aber nicht auf das Eis, wofür er viel Hohn von seinem Bruder Fonsi erntete.
»Du bist halt ein feiger Bücherwurm! Später wirst du amal keine abkriegen, denn die Madeln mögen so einen nicht«, rief er ihm hämisch zu und glitt dann weit auf das Eis hinaus, um seine Kreise zu ziehen.
Wenn Johanna dabei war, griff sie nach seiner Hand und tröstete ihn.
»Du gefällst jedem Madel, Jonas. Du bist viel klüger als alle anderen und dann noch so schön wie ein Märchenprinz«, flüsterte sie ihm zu.
Jonas lachte und zog seine kleine Schwester an sich.
»Was meinst du, Hannerl, wie der Märchenprinz lang hinschlagen tät nach ein paar Schritten auf dem Eis.«
Johanna fiel in sein Lachen ein, und ihr kam zu Bewusstsein, wie sehr sie ihren Bruder liebte.
In einer dieser Nächte wachte Jonas auf. Von Ferne hörte er ein leises Krachen und dann einen singenden Laut. Doch er schlief gleich wieder ein und hatte es am nächsten Morgen schon vergessen.
Der nächste Tag war wolkenverhangen und grau, und falls die Temperaturen tatsächlich gestiegen waren, so war es kaum spürbar. Nach der Schule beschloss er, ins Pfarrhaus zu gehen und ein spannendes Buch über die Kreuzritter zu Ende zu lesen. Johanna war erkältet und lag schlafend im Bett, seine Eltern waren nicht zu Hause.
Er ließ sich ein wenig von Martha verwöhnen und wechselte ein paar Worte mit Hochwürden, der aber in Eile war, dann versank wieder die Welt um ihn. Als er das Buch beendet und das Pfarrhaus verlassen hatte, fühlte er sich etwas benommen. Da er hoffte, dass sich sein Zustand an der frischen Luft bessern würde, schlug er den schmalen Fußweg ein, der um den See herumführte.
Als er an einem Ausläufer des Sees ankam, der wegen des dichten Bewuchses kaum einsehbar war, entdeckte er eine schmale Gestalt, die einsam Pirouetten drehte. Er wusste, wer das Mädchen war, Benita Anstetter, die einzige Tochter des reichsten Bauern im Tal.
Bewundernd sah Jonas ihr zu, scheinbar schwerelos schwebte Benita – sie mochte jetzt ungefähr dreizehn sein – über das Eis. Sie war so selbstvergessen in ihrem lautlosen Tanz, dass sie nicht bemerkte, dass sie beobachtet wurde.
Doch plötzlich ein Unheil verkündendes Bersten – Benita schrie auf und verschwand in einer dunklen Öffnung, die sich aufgetan hatte.
Das Eis, an dieser Stelle immer etwas dünner, war gebrochen!
Jonas stand wie erstarrt da, dann aber sah er, dass Benita wieder aufgetaucht war. Ihr Mund öffnete sich, aber sie brachte keinen Ton hervor.
»Benita! Halte dich am Rand fest! Ich komme sofort zurück!«, schrie er durchdringend, und sie schien ihn verstanden zu haben.
So schnell er konnte, rannte er nach Hause und öffnete die Scheune, wo eine große Leiter stand, die zu dem einstigen Heuboden geführt hatte. Mit Aufbietung all seiner Kräfte schleifte er sie zu dem See, der Ausläufer befand sich glücklicherweise nicht allzu weit entfernt.
»Benita«, rief er.
Ein schwacher Jammerlaut wehte zu ihm hinüber, und er atmete auf. Sie war nicht untergegangen.
»Gib nicht auf. Ich schiebe jetzt die Leiter über das Eis. Halte dich daran fest, damit ich dich herausziehen kann.«
Kaum hatte er ein paar Schritte auf dem Eis getan, da fiel er auch schon hin. Auf dem Bauch kroch er weiter und schob die Leiter vor sich her. Erbarmungslose Kälte drang durch seinen ganzen Körper, und er bildete sich ein, dass die Eisfläche leise zu schwanken begonnen hatte. Wie eine Scholle, die losgelöst auf dem Wasser trieb …
Doch er bewegte sich weiter vorwärts, bis die Leiter den Eisrand erreichte und Benita sich daran festklammern konnte. Und nun begann der schwierigste Teil des Unterfangens. Zweimal brach der Rand ab, bis Benita endlich auf dem Eis lag, und er sie – immer noch liegend – langsam rückwärts in Richtung Ufer ziehen konnte.
Benita gelang es schließlich, auf die Knie zu kommen und kriechend das Ufer zu erreichen, wo Jonas schwer atmend zusammengebrochen war. Beide waren außerstande zu sprechen, Benita zitterte am ganzen Körper. Sie kauerten nebeneinander, und wie durch einen Zwang sahen sie sich plötzlich an.
Benitas Augen waren von einem hellen Braun, sie schienen golden aufzuleuchten, als sich ihre Blicke fanden.
Wie Sterne, ging es Jonas unwillkürlich durch den Sinn, und ihm stockte der Atem.
Und Benita dachte, dass sie noch nie bei einem Menschen so schöne Augen gesehen hatte, Augen von einem tiefen Grün, die Geheimnisse bargen.
Beide waren keine Kinder mehr, und sie spürten mit untrüglicher Gewissheit, für die sie keine Worte gefunden hätten, dass sie von jetzt an untrennbar miteinander verbunden waren. Dann verlor Benita das Bewusstsein, und auch um Jonas schien sich alles in wirbelnden Kreisen aufzulösen.
Er kam erst wieder richtig zu sich, als sich ein Notarzt über ihn beugte und ihm eine Infusion anlegte. Glücklicherweise war die Rettungsaktion nicht unbemerkt geblieben, und der Pensionär, der jeden Nachmittag seinen Hund dort ausführte, hatte die Rettungskräfte alarmiert.
»So, da ist unser Held ja wieder bei uns. Gleich wird es dir viel besser gehen«, sagte der Arzt freundlich.
»Benita«, murmelte Jonas.
»Deine kleine Freundin wird sich auch wieder erholen, keine Sorge.«
Jonas’ eben noch bleiche Wangen wurden feuerrot.
»Benita ist nicht meine kleine Freundin.«
Der Arzt unterdrückte mit einiger Mühe ein Lächeln, doch Jonas waren schon wieder die Augenlider zugefallen.
***
Als Benita erwachte, saß ihr Vater an ihrem Bett. Er sah völlig anders aus als sonst, so, als hätte ihn die kraftvolle Energie, die ihn sonst auszeichnete, vorübergehend im Stich gelassen. Pirmin Anstetter war sogar unrasiert, was noch nie vorgekommen war, soweit sich Benita entsinnen konnte.
»Endlich, Madel! Du hast uns einen schönen Schrecken eingejagt«, sagte Anstetter sichtlich erleichtert.
Er griff aber nicht nach ihrer Hand oder küsste sie. Pirmin Anstetter war kein Mann, der zu Zärtlichkeiten oder zu Gefühlsausbrüchen neigte. Aber wenigstens machte er ihr keine Vorhaltungen, denn eigentlich war es ihr von den Eltern streng verboten worden, allein zum Eislaufen zu gehen.
»Kann ich bald nach Hause?«, fragte Benita, die von ihrer Umgebung eingeschüchtert war, obwohl Anstetter dafür gesorgt hatte, dass seine Tochter ein Einzelzimmer erhielt.
»Ja, bald. Aber sie behalten dich noch einen Tag oder zwei zur Beobachtung hier. Schließlich warst du stark unterkühlt.«
Das Mädchen bewegte sich unruhig im Bett.
»Und der Jonas?«
»Dem geht es auch gut.«
»Ich möchte mich bei ihm bedanken. Ohne ihn …«
Benita verstummte, ein Schauder erfasste ihren Körper.
»Das werde ich machen. Ich gehe anschließend zu ihm und bedanke mich bei ihm. Das hatte ich sowieso vor«, erwiderte Anstetter bestimmt.
»Das wollt ich lieber …«
»Du darfst das Bett nicht verlassen. Hast du gehört?«
Ihr Vater schlug wieder diesen strengen Ton an, der sie schon seit frühester Kindheit in Angst versetzte. Und so nickte sie gehorsam. Doch insgeheim begehrte sie zum ersten Mal auf. Sie würde Mittel und Wege finden, Jonas wiederzusehen, auch wenn sie sich in Geduld fassen müsste.
Anstetter stand auf.
»So, jetzt ruh dich aus und halt dich dran, was die Ärzte dir sagen«, sagte ihr Vater zum Abschied, und es klang nicht nach einem Genesungswunsch, sondern eher nach einer Maßregelung.
»Ja«, sagte Benita tonlos.
Sie atmete erleichtert auf, als er das Krankenzimmer verlassen hatte. Das Obst und die Süßigkeiten, die der Vater ihr mitgebracht hatte, rührte Benita nicht an, sie würde sie verschenken. Sie legte sich zurück, und vor ihrem geistigen Auge erschien Jonas Poschinger.
Ein glückliches Lächeln breitete sich auf ihrem Gesicht aus.
Anstetter ging tatsächlich zu Jonas Poschinger, so wie er es seiner Tochter versprochen hatte. Als er das Krankenzimmer betrat, fand er den Jungen schlafend vor. Jonas schien seine Gegenwart nicht wahrzunehmen, auf seinen Zügen zeichnete sich immer noch tiefe Erschöpfung ab. Lange stand Anstetter da und betrachtete ihn.
Wie sehr er Anna, der wilden Anna, in ihrer Jugend ähnlich sah, auch wenn schon männliche Herbheit erkennbar war. Die üppigen schwarzen Haare, das regelmäßige, schöne Gesicht ohne jeden Makel. Aber er las noch etwas anderes aus diesen Zügen – einen starken Willen, der sich vor nichts und niemandem beugen wollte. Ein Wille, der ihm dabei geholfen hatte, Benita aus höchster Gefahr zu retten.
Und dieser Wille, diese Zielstrebigkeit hatten der schönen Anna gefehlt, sodass sie zu jemandem geworden war, dem er nur Verachtung entgegenbringen konnte.
Anstetter unterdrückte ein Seufzen und wandte sich zum Gehen. Leise schloss er die Zimmertür hinter sich. Auf der Heimfahrt war er in tiefes Sinnen versunken, die widerstreitendsten Empfindungen rangen in ihm.
***
Der Empfang in seinem Elternhaus, als Jonas aus der Klinik zurückkam, hätte kühler nicht sein können.
»Bild dir bloß net ein, dass du jetzt ein Held bist. Das hätt jeder zuwege bringen können«, meinte Fonsi abschätzig.
Poschinger maß dem Ganzen überhaupt keine Bedeutung zu, es war ihm noch nicht einmal aufgefallen, dass sein Sohn im Krankenhaus gewesen war. Auch seine Mutter ließ sich nicht weiter darüber aus, nur Johanna schmiegte sich an ihn, als sie allein waren, und griff nach seiner Hand.
»Ich bin so froh, dass du heil und gesund bist. Du bist so mutig gewesen. Net auszudenken, wenn du …«
Die Stimme versagte ihr.
»Es ist ja alles noch amal gut gegangen, Hannerl«, beschwichtigte Jonas seine Schwester, doch das Mädchen war nicht so schnell zu beruhigen.
Zu sehr hatte Jonas in Gefahr geschwebt. Der Bergsee, der von heimtückischen unterirdischen Strömungen gespeist wurde, hätte Benita und Jonas in seine Untiefen ziehen können. Es gab die Legende, dass der See, hatte er erst einmal jemanden verschlungen, den Leichnam nie wieder freigab.
Jonas nahm sein alltägliches Leben wieder auf wie zuvor. Hochwürden lobte ihn für seinen selbstlosen Einsatz, wie er die Rettung Benitas nannte, und schien sehr stolz auf ihn zu sein. Und Martha war es nicht weniger. Sie empfing Jonas bei seinem ersten Besuch nach dem Krankenhausaufenthalt mit einem großen Kuchen, den sie ihm zu Ehren gebacken hatte. Und Jonas kam es sogar so vor, als hätte sie Tränen in den Augen.
»Der gehört dir ganz allein. Aber du kannst natürlich auch deiner Schwester etwas abgeben«, erklärte sie.
Sosehr er sich darüber auch freute, so waren seine Gedanken jedoch ständig auf Benita gerichtet. Ob sie ihn schon vergessen hatte? Oder ob man ihr verboten hatte, mit ihm in Verbindung zu treten? Sicher wollten die reichen Anstetters nichts mit dem »Gschwerl«, den Poschingers, zu tun haben.
Er sah immer noch ihr süßes Gesicht vor sich und ihre Sternenaugen, in denen er sich verloren hatte.
»Benita«, flüsterte er nachts oft vor sich hin, und ihr Name klang wie eine geheimnisvolle Melodie.
Und dann stellte er sich vor, wie es wäre, im Frühling mit ihr über die blühenden Almwiesen zu laufen oder weit hoch bis zu der einsamen Klamm zu steigen, wo sie ganz für sich allein sein würden.
Manchmal träumte er auch davon, dass sie beieinander waren, draußen in der freien Natur, wo niemand sie kannte und niemand sie auseinanderreißen würde. Aber meistens löste sich dieser Traum wieder auf, Benita verschwand im Ungewissen, und vergeblich streckte er die Arme nach ihr aus.
Im März jedoch, als es zu tauen begann und es wärmer wurde, stand plötzlich eine Handwerkertruppe vor dem baufälligen Haus der Poschingers. Ihr Anführer trat vor und verkündete, dass das Wohnhaus grundsaniert werden würde, alle Kosten übernehme der Auftraggeber.
Die Poschingers versuchten vergeblich herauszubekommen, um wen es sich bei dem Auftraggeber handelte, sie fürchteten auch, einem Betrug zu erliegen. Schließlich gaben sie nach, und von da an hatten sie keinen Tag Ruhe mehr. Die Schindeln wurden abgetragen, danach die maroden Balken, die schäbigen Fensterläden und die alten gesprungenen Scheiben entfernt und die alten Reste des Verputzes abgeklopft.
Die nutzlosen Wirtschaftsgebäude und Stallungen wurden abgerissen, lediglich die Scheune wurde mit frischen Latten versehen. Und schließlich verschwanden auch die rostigen Gerätschaften vom Hofplatz. Es war ein stetes Hämmern und Klopfen, und hin und wieder erschallten laute Flüche, wenn sich wieder ein neuer Schaden auftat.
Als die Handwerker schließlich die Renovierung für beendet erklärten und abzogen, erkannten die Poschingers das Anwesen kaum wieder. Türen und Fensterläden waren dunkelgrün gestrichen und hoben sich wirkungsvoll von den weiß gekalkten Mauern ab. Die neuen Dachschindeln sahen sehr solide aus und würden jedem Sturm trotzen können. Auf dem Hofplatz waren neue Steinplatten verlegt worden, und er wirkte jetzt viel großzügiger.
Mit einem Mal besaßen die Poschingers ein Zuhause, dessen sie sich nicht mehr schämen mussten. Auch im Innenbereich waren die Holzböden erneuert worden, Wände und Decken frisch gestrichen. Selbst Elektrogeräte für die Küche waren angeliefert worden.
So bewies Pirmin Anstetter seine Dankbarkeit dafür, dass Jonas das Leben seiner Tochter gerettet hatte.
***
Seltsamerweise verloren die Poschingers kaum ein Wort über die ganzen Veränderungen, über die sie doch eigentlich hätten glücklich sein müssen. Doch sie empfanden diesen Fortschritt auch als Beweis ihres eigenen Versagens, denn aus eigener Kraft hätten sie ihn niemals bewerkstelligen können. Und eine neue Fassade konnte auch nichts gegen den schlechten Ruf, den sich die Poschingers nun einmal erworben hatten, ausrichten.
Es schien sogar, als ob sie sich nun nicht mehr richtig zu Hause fühlten. Anton Poschinger ging nun immerhin einer einigermaßen geregelten Tätigkeit als Waldarbeiter nach, und die Abende verbrachte er im Dorfgasthaus.
Anna fühlte sich nach wie vor im Vereinsheim in der Kreisstadt am wohlsten und war der Meinung, dass ihre Nachkommenschaft alt genug sei, um für sich selbst zu sorgen.
Fonsi war der gleichen Meinung, zusätzlich war er davon überzeugt, dass man ihm auf der Schule nichts mehr beibringen konnte.
Jonas und seine Schwester kamen ganz gut allein zurecht und waren eng miteinander verbunden. Und wenn sie später zurückblickten, so war das keine unglückliche Zeit für die beiden. Bis auf Jonas’ Sehnsucht nach Benita, die nicht in ihm erlöschen wollte.
Doch auch das sollte sich ändern.
Als endlich der Frühling in dem Gebirgstal Einzug gehalten hatte, entdeckte Jonas, als er aus dem Küchenfenster blickte, eine schmale Gestalt zwischen den blühenden Bäumen der Streuobstwiese hinter dem Haus.
Benita!
Durch die Hintertür verließ er rasch das Haus und ging auf sie zu. Sein Herz pochte, die Gedanken wirbelten nur so hinter seiner Stirn, und für einen Augenblick dachte er, dass er einem Trugbild erlegen war, weil er sich so sehr wünschte, sie wiederzusehen.
Doch dann machte sie ein paar zögerliche Schritte auf ihn zu und stand vor ihm.
»Benita! Endlich!«
Sie errötete und senkte den Kopf.
Schließlich sah sie auf, und Jonas’ Blick versank wieder in ihren goldenen Augen.
»Hat sich mein Vater bei dir bedankt?«, fragte sie befangen und wagte es endlich wieder, zu ihm hochzuschauen.
»Ja, ja, gewissermaßen«, sagte Jonas etwas unbestimmt.
»Ich wollte mich selbst bei dir bedanken, aber dem Vater war das net recht. Er ist sehr streng, musst du wissen.«
»Nun, er will dich halt beschützen.«
Darauf gab Benita keine Antwort. Etwas unschlüssig stand sie da und schien nach Worten zu suchen.
»Du musst dich jetzt nimmer bei mir bedanken. Dass es dir nun wieder gut geht, ist die größte Freude für mich.«
Ein scheues Lächeln spielte um ihren schön geschwungenen Mund und verlieh ihrem Gesicht einen besonderen Liebreiz. Sie war schlicht, beinahe altmodisch gekleidet. Zu einem Dirndlrock trug sie eine weiße Bluse und darüber eine offensichtlich selbst gestrickte Trachtenweste. Benita wirkte überhaupt nicht wie die Tochter eines reichen Großbauern.
Ein Sonnenstrahl verfing sich in ihrem Haar und ließ es goldrot aufleuchten. Und auch ihre Augen leuchteten, als sie ihn anlächelte. Ein Windstoß ließ Blüten auf sie regnen, wie verzaubert standen Jonas und Benita da.
»Hast du ein bisserl Zeit?«, fragte er, denn er hatte Angst, dass sie sich allzu bald wieder von ihm verabschieden würde.
Sie nickte, und wie von allein gingen sie zu dem Fußweg, der um den See herumführte, und standen bald vor dem Ausläufer, wo Benita beinahe ihr junges Leben eingebüßt hätte. Nun bot sich die Bucht in einem ganz anderen Licht dar. Die Sonne gleißte auf dem Wasser, das einen blaugrünen Schimmer hatte, sanft schlugen kleine Wellen an das von tief hängenden Weidenästen überschattete Ufer.
»Ich war noch kein einziges Mal hier«, sagte Benita leise. »Jetzt sieht alles so schön und friedlich aus.«
»Die Natur hat immer ein doppeltes Gesicht. Die Gletscher leuchten so wunderbar in der Sonne, aber gleichzeitig sind sie eine große Gefahr für den Bergsteiger«, sagte Jonas, und fürchtete im gleichen Augenblick, dass er einen allzu belehrenden Ton angeschlagen hätte.
»Du bist wohl ein Lesewurm?«
Benita legte den Kopf schief und sah ihn schelmisch an. Ihre Augen leuchteten, und Jonas war entzückt.
»Ja, nein, ich wollt net …«, stammelte sie dann.
Benitas helles Lachen erlöste ihn von seinen Qualen. Dann aber wurde sie unvermittelt wieder ernst.
»Ich hab oft an dich gedacht. Und an das, was du für mich getan hast.«
»Ich hab auch viel an dich gedacht«, gestand er ein.
»Dann sind wir uns ja einig«, sagte sie in scherzhaftem Ton.
Sie schwiegen und sahen sich an.
»In manchen Kulturen ist es üblich, dass man immer für jemanden verantwortlich ist, wenn man dessen Leben gerettet hat«, brachte Jonas das Gespräch wieder in Gang.
»Das hast du wohl irgendwo gelesen, oder?«
Jonas nickte bestätigend.
»Also doch ein Lesewurm! Aber wenigstens weißt du jetzt, woran du bist. Von jetzt an musst du immer auf mich aufpassen.«
»Das werde ich.«
Und obwohl das leichthin gesagt war, schwang doch eine große Bestimmtheit mit, die Benita anrührte.
Dann aber ergriffen sie sich bei den Händen und rannten übermütig über die Wiese, bis sie lachend ins Gras fielen. Sie kicherten und neckten sich wie Kinder, die sie im Herzen eigentlich noch waren.
Als sie sich schließlich wieder trennen mussten, denn Benita hatte große Angst vor ihrem Vater, war es Jonas, als wäre jede Freude aus seinem Leben verschwunden. Aber es gab dennoch einen Trost, an den er sich verzweifelt klammerte – es sollte nicht das letzte Mal sein, dass Benita und er sich trafen.
Es gelang Benita, jede Woche zur selben Zeit aus dem Haus zu schlüpfen, da ihre Eltern dann beide unterwegs waren. Ihr Vater war auf einer Gemeinderatsitzung, und ihre Mutter tagte mit ihrem Landfrauenverein. Sie waren davon überzeugt, dass Benita in ihrem Zimmer zuverlässig wie immer über ihren Hausaufgaben saß.
Die empfindsame Benita, sonst ein sehr aufrichtiges Kind, verspürte deswegen nicht die geringsten Gewissensbisse. Denn von Jonas empfing sie etwas, was sie in ihrem Elternhaus schmerzlich vermisste – Aufmerksamkeit und Zuwendung.
Gewöhnlich trafen sie sich am See, und sie hatten auch am Ufer unter den Weiden ein Versteck entdeckt, in dem sie sich vor neugierigen Blicken sicher fühlten. In dieser Höhlung saßen sie eng nebeneinander, und das Weidengeflecht war so dicht, dass sie selbst vor Regen geschützt waren. Sobald der Himmel aber wolkenlos war, tanzten Sonnenflecken vor ihren Füßen, und die Wellen des Sees flimmerten zu ihnen hinein.
Wenn Benita nicht kommen konnte, was glücklicherweise selten geschah, war es ihnen, als ob sich ihr Leben verdüsterte. Denn inzwischen hatten sie so großes Vertrauen zueinander gefasst, dass sie über alles, was sie bekümmerte, sprechen konnten. Ohne diesen Austausch empfanden beide ihr Alltagsleben als noch bedrückender.
Denn auch Benita, die im Gegensatz zu Jonas keine Not kannte und als zukünftige Erbin eines großen Vermögens immer mit Respekt behandelt wurde, fühlte sich in ihrem Elternhaus keineswegs wohl.
»Es ist nicht so, dass meine Eltern mich vernachlässigen oder misshandeln würden. Ganz im Gegenteil, es ist so, dass fast jeder meiner Schritte kontrolliert wird, sowohl von meinem Vater als auch von meiner Mutter. Ich werde großzügig mit allem versorgt, was ich brauche, und wenn ich zum Beispiel den Wunsch hätte, Reitstunden zu nehmen, bekäme ich sie sofort. Doch das Wort meines Vaters ist Befehl, und es ist sinnlos, sich dagegen aufzulehnen. Auch meine Mutter ist sehr streng. Sie hat mir zwar Manieren und sonst alles beigebracht, was ihrer Meinung nach nützlich für ein Mädchen ist, aber …«
Sie verstummte mit tränenerstickter Stimme.
»Wenigstens meinen sie es gut mit dir«, wandte Jonas ein, in dem vergeblichen Versuch, sie zu trösten.
»Schon. Aber was ich sagen wollte, ist, dass meine Mutter mich nie in den Arm nimmt und nie ein liebevolles Wort für mich übrig hat. Das ist es, was ich entbehren muss, und es ist schlimmer, als auf teure Kleider oder sonst etwas verzichten zu müssen.«
»Vielleicht liegt das halt in ihrer Natur, und sie liebt dich nicht weniger als andere Mütter ihre Kinder«, wandte Jonas ein.
»Meine Eltern lieben mich überhaupt nicht. Ich bin das falsche Kind«, erklärte Benita mit Entschiedenheit.
»Woher willst du das denn wissen?«
»Ich hab einmal gehört, wie mein Vater sich beklagt hat, dass er nur eine Tochter hat. Immer hat er sich sehnlichst einen Sohn gewünscht. Er hat sogar gesagt, dass ich nutzlos wäre. Denn ich sei zu schwach, um den Hof zu bewirtschaften, und wenn ich heiraten tät, würde meine Mitgift aus dem Hof gezogen werden.«
»Heutzutage bewirtschaften doch viele Frauen erfolgreich Bauernhöfe, sogar oft allein«, erwiderte Jonas empört.
»Er hat eben doch recht. Ich liebe meine Heimat, aber für die Landwirtschaft taug ich einfach net. Das weiß ich schon lang. Wenn ich nur noch Geschwister hätt, aber meine Mutter hat leider keine Kinder mehr bekommen.«
»Vielleicht ist das der Grund, warum sie so geworden ist.«
»Mag sein. Aber bei uns zu Hause herrscht immer eine Kälte, die mich frieren lässt. Nie gibt es Neckereien oder Gelächter, es ist, als ob man in einem Mausoleum wohnt. Meine Eltern streiten sich zwar nicht, aber sie gehen sich aus dem Weg, und das schon lange«, schloss Benita unglücklich.
»Wenigstens hast du noch ein Elternhaus«, meinte Jonas.
»Ich kann gar nicht erwarten, es zu verlassen. Damit ich mir das Leben endlich selbst einrichten kann.«
»So geht es mir auch.«
Jonas fiel es weitaus schwerer, sich von der Seele zu reden, was ihn bedrückte. Auch er fühlte sich ungeliebt, sehnte sich nach Selbstständigkeit. Benita schien zu ahnen, wie sehr ihn der schlechte Ruf seiner Familie bedrückte, und drängte ihn nicht, Einzelheiten zu erzählen. Dafür war er ihr dankbar.
»Manchmal glaube ich, dass ich nicht das Kind meiner Eltern bin«, gestand Jonas schließlich, »nichts scheint mich mit ihnen zu verbinden. Ich fühle mich wie ein Fremdkörper zwischen ihnen. Nur meine Schwester Johanna hat mich gern, und ich sie auch.«
»Angeblich soll das ja vielen jungen Leuten in unserem Alter so gehen«, sagte Benita nachdenklich.
»Das stimmt schon. Aber später werden sie dann halt doch ihren Eltern immer ähnlicher«, fand Jonas.
»Ich glaub net, dass ich jemals meinem Vater ähnlicher werde«, meinte Benita, und beide mussten lachen.
»Und ich meinem Vater gewiss auch net.«
»Aber deiner Mutter bist du wie aus dem Gesicht geschnitten. ›Die schöne Anna‹ hat man sie früher genannt, hab ich gehört.«
Jonas mochte es nicht, wenn man Anspielungen auf sein gutes Aussehen machte. Denn es war nicht sein Verdienst, sondern nur ein Zufall der Natur. Dafür konnte er dem Schicksal vielleicht dankbar sein, doch es war nichts, womit er sich brüsten wollte.
»Und später hieß sie dann nur noch ›die wilde Anna‹. Und das hing ihr ewig an«, erwiderte er bitter.
»Dafür kannst du nichts«, sagte Benita schnell.
»Aber ich habe mich schon immer darüber gewundert, dass ich überhaupt nichts von meinem Vater geerbt habe. Weder vom Äußeren und noch viel weniger vom Wesen her«, sagte Jonas nachdenklich.
Zum ersten Mal hatte er gegenüber jemandem ausgesprochen, was ihn schon länger innerlich beschäftigte. Nichts, rein gar nichts hatte er von Anton Poschinger. Und einmal hatte er auch bemerkt, dass sein Vater, als er ausnahmsweise mal nüchtern war, ihn lange und forschend gemustert hatte.
»Wahrscheinlich liegt es daran, dass du eine bessere Ausbildung bekommst«, vermutete Benita.
»Dafür werde ich Hochwürden ewig dankbar sein. Denn dadurch kann ich meinen eigenen Weg gehen.«
Dann wandte sich ihr Gespräch der Schule zu, denn die Ferien standen unmittelbar bevor. Eigentlich hatten sie gehofft, sich dann öfters sehen zu können, doch die strenge Aufsicht, unter der Benita stand, machte alle Pläne zunichte. Außerdem würde sie mit ihrer Mutter zwei Wochen lang verreisen, was Jonas geradezu mit Entsetzen erfüllte.
»Dann sehe ich dich nicht«, sagte er geradezu töricht.
Benita schüttelte traurig den Kopf.
Es war ihr auch nicht erlaubt, ein Handy zu besitzen, und Jonas fehlte das Geld dafür. So konnten sie auch nicht auf diese Weise miteinander reden, und Briefe zu schreiben war einfach zu gefährlich.
So schieden sie ziemlich betrübt voneinander, auch wenn sie sich noch die nächsten beiden Wochen wiedersehen konnten. Doch nicht nur Benitas vorübergehende Abwesenheit, so schmerzlich sie auch war, ging Jonas nicht mehr aus dem Sinn, sondern vor allem das Gespräch über seinen Vater.
Jonas war nun alt genug, um zu begreifen, dass das, was man sich über seine Mutter zuflüsterte, bedeutete, dass sie sich nicht nur mit einem Mann abgegeben hatte. Mit der Treue hätte sie es nie so genau genommen, hieß es. Konnte es sein, dass sie gar nicht gewusst hatte, wer der Vater ihres Sohnes war?
Dieser Gedanke war verstörend. Doch Jonas hätte es niemals gewagt, seine Mutter danach zu fragen.
***
Dieser Sommer war der schönste in Jonas Poschingers bisherigem Leben, und auch Benita empfand es so. Trotz der Vertrautheit und trotz der körperlichen Nähe, wenn sie zusammen in der Weidenhöhle saßen, kam es nie zu Zärtlichkeiten zwischen ihnen. Jonas verlangte es danach, denn er war älter und schon im Begriff, ein Mann zu werden, doch die kindliche Unschuld des Mädchens verbot es ihm.
»Du bist mein Stern«, sagte Jonas mit zärtlicher Stimme, wenn Benita ihn anschaute und ihre Augen golden aufleuchteten.
Und sie lächelte dann und legte den Kopf an seine Schulter.
Die Trennung, als Benita mit ihrer Mutter verreist war, hatte Jonas als unerträglich empfunden. Der einzige Trost für ihn war gewesen, dass er fast jeden Tag zu Hochwürden ging, um diesem dabei zu helfen, die Bibliothek umzuordnen. Er verbrachte die Mittage zwischen hohen Bücherstapeln, hin und wieder reichte er Hochwürden, der auf einer kleinen Leiter stand, auf dessen Geheiß ein paar Bücher hoch. Wenigstens das lenkte ihn etwas ab.
Und als sie sich wiedersahen, Benita und er, flog sie in seine Arme. Lange verweilten sie so und nahmen die Nähe des anderen in sich auf. Dann krochen sie wieder in ihren Unterschlupf, und Benita begann von ihren Erlebnissen zu erzählen.
»Ach, es hat mir gar net gefallen, weil ich immer nur an dich gedacht hab«, berichtete sie ohne Scheu.
»Ich hab auch immer nur an dich gedacht. Hochwürden hat gemeint, dass ich richtig zerstreut sei, noch schlimmer als er.«
»Meine Mutter hat gemeint, dass ich undankbar und verzogen wäre und meine Launen an ihr auslassen tät. Aber ich kann doch nichts dafür, dass ich …«
»Dass ist ja nun glücklicherweise vorbei. Und der Sommer ist ja noch lang«, beschwichtigte Jonas sie.
Das stimmte nicht ganz. Es konnte schon im September grimmig kalt werden, und ein vorzeitiger Wintereinbruch war nicht selten. Dann konnten sie nicht mehr ihr Versteck besuchen, und sie wussten nicht, wo sie bei Kälte sonst hingehen sollten.
Doch darüber sprachen sie nicht, und wenn sie doch daran dachten, verdrängten sie die Vorstellung schnell.
Einmal, als sie still beieinandersaßen, hörten sie ein Rascheln und dann ein Geräusch, das sich wie entfernende Schritte anhörte.
Sie fuhren zusammen und erstarrten.
»Hörst du das? Da ist jemand«, flüsterte Benita, doch Jonas legte ihr schnell die Hand auf den Mund.
Dann verharrten sie regungslos, und erst als sie sicher waren, dass niemand mehr in unmittelbarer Nähe war, kroch Jonas aus ihrem Versteck, trat aber nicht ganz hervor. Es war vom Uferweg aus, der an dieser Stelle einen Bogen schlug, so weit entfernt, dass es nicht einsehbar war. Schließlich ging Jonas in Richtung des Pfads und spähte in alle Richtungen aus, doch es war niemand zu sehen.
»Keine Menschenseele«, sagte Jonas, als er zu ihr zurückgekehrt war, erleichtert. »Und wenn jemand vorbeigegangen ist, dann hat er uns bestimmt net gesehen.«
»Hoffentlich«, sagte Benita.
Der Gedanke an ihren Vater ließ sie erschauern.
Sie unterhielten sich wieder, lachten miteinander wie jedes Mal, wenn sie beieinander waren. Aber im Hintergrund lauerte doch verstärkt die Angst vor Entdeckung und den Folgen, die das besonders für Benita nach sich ziehen würde.
***
Als Pirmin Anstetter nach einer Ratssitzung mit anschließendem Umtrunk, bei dem er sich allerdings zurückgehalten hatte, seinen Wagen in einer Nebengasse ansteuerte, bemerkte er, dass sich jemand daran zu schaffen machte.
Wutschnaubend eilte Anstetter auf den vermeintlichen Autodieb zu, der ihm den Rücken zugewandt hatte.
»Lass deine Pratzen weg von meinem Wagen!«
Nun erkannte er, dass es Fonsi Poschinger war, der ins Wageninnere gestarrt hatte und sich nun aufrichtete. Gemächlich drehte er sich nach ihm um. Anstetter, selbst ein kräftiger Mann, erschrak unwillkürlich und wäre beinahe einen Schritt zurückgetreten, so hochgewachsen und breitschultrig war Fonsi inzwischen geworden. Es ging etwas Gewalttätiges, Bedrohliches von ihm aus, in seinen hellen Augen glomm es bösartig auf.
»Ich hab mir nur dein neues Auto von innen angesehen. Statt mich zu verdächtigen, solltest du lieber amal aufpassen, wer die Pratzen net von deiner Tochter lassen kann«, sagte Fonsi mit einem widerwärtigen Grinsen.
»Wag es net, den Ruf meiner Tochter zu verunglimpfen, sonst kannst du was erleben«, fuhr ihn Pirmin an.
»Dafür sorgt die schon selber. So jung noch und so zart …«
»Du willst mir doch etwas sagen. Also rück heraus mit der Sprache«, forderte ihn Anstetter auf, dessen Gesicht sich ungesund gerötet hatte.
»Nun ja, aber was ist schon umsonst.«
Pirmin Anstetter zog wortlos seine Brieftasche heraus und überreichte Fonsi zwei größere Geldscheine.
»Reicht das, um dich gesprächig zu machen?«
Fonsi grinste wieder, wobei er ungepflegte Vorderzähne entblößte.
»Wie ein Wasserfall.«
Und dann erzählte er Pirmin Anstetter, dass er durch einen Zufall entdeckt hatte, dass sich seine Tochter mit einem Jungen am See traf.
»In einer Höhle unter den Weiden verstecken sie sich, da sind sie ganz ungestört und nah beieinand.«
Anstetter hätte Fonsi, obwohl dieser beinahe noch ein Kind war, am liebsten das hämische Grinsen aus dem Gesicht geschlagen.
»Wer ist der Junge?«, herrschte er ihn an.
»Das fällt mir jetzt schwer …«
Anstetters Brieftasche kam erneut zum Einsatz, dieses Mal sogar mit noch einer größeren Geldsumme.
»Wird es dir so leichter?«
»Wie man’s nimmt. Also es schaut so aus, als ob derjenige zwar das Leben deiner Tochter gerettet hat, aber ihre Tugend will er wohl net retten.«
Anstetter prallte mit einem Ausdruck des Entsetzens auf seinen Zügen zurück, der Fonsi in Erstaunen versetzte.
»Du meinst, dein Bruder trifft sich mit ihr?«, kam es keuchend aus seinem Mund.
»Schon. Aber es gibt Schlimmere als ihn. Ich hätt schon längst …«
»Halt die Goschen und scher dich!«
Mit einer zornigen Handbewegung scheuchte Anstetter Fonsi davon, der nur einen verächtlichen Laut von sich gab und mit provozierender Langsamkeit davonschlenderte. Für ihn hatte sich das Treffen gelohnt. Den hochnäsigen Anstetter hatte beinahe der Schlag gerührt, und seinem verhassten Bruder hatte er auch eins ausgewischt.
Der würde sich noch wundern, dachte Fonsi, und tastete zufrieden nach seiner Beute in der Hosentasche.
Pirmin saß einen Augenblick regungslos hinter dem Steuer, ehe er den Motor anließ. Am liebsten wäre er sofort zu den Poschingers gefahren und hätte sich den Jungen vorgeknöpft, doch gerade das ging eben nicht.
Nein, er würde die Dinge auf ganz andere Weise regeln, so wie er es meistens tat. Denn darin hatte er Erfahrung.
Auf dem Heimweg kam ihm der erlösende Gedanke, wie er diese leidige Sache aus der Welt schaffen konnte. Noch heute würde er mit seiner Frau sprechen, und sie würde – davon war er überzeugt – seinem Vorhaben zustimmen.
Thekla Anstetter war zu Hause, wie er erwartet hatte, und er fand sie in der Stube damit beschäftigt, Rechnungen durchzusehen. Er hatte sie auf Wunsch seiner Eltern geheiratet, denn als Miterbin eines Sägewerks ließ sie sich auszahlen und mehrte so das Vermögen der Anstetters.
Eigentlich hatte er keinen Grund, sich über diese Heirat zu beklagen, außer dass der männliche Erbe ausgeblieben war. Doch das konnte er Thekla nicht anlasten, denn sie füllte sonst die Rolle der Hofbäuerin vorbildlich aus. Und an die Kälte, die zwischen ihnen herrschte und die im Laufe der Jahre immer stärker geworden war, hatte er sich gewöhnt.
Auch dafür hatte er Lösungen gefunden.
»Bist du net noch länger im Ratskeller geblieben?«, fragte seine Frau, nachdem sie sich begrüßt hatten.
Thekla war eine hochgewachsene, schlanke Frau, die ihr mattblondes Haar im Nacken zu einem Knoten geschlungen hatte, was ihr gut stand. Ähnlich streng war auch ihre Kleidung. Sie trug fast ohne Ausnahme die dunkle Tracht der Bäuerinnen des Tals. Ihre Züge waren regelmäßig, und man hätte sie als schön empfinden können, wenn nicht ständig etwas Kühles und Abweisendes auf ihnen gelegen hätte.
»Wo ist Benita?«, fragte er kurz.
»Wir haben schon gegessen, weil ich dachte, dass du erst später kommst. Sie ist oben auf ihrem Zimmer.«
»Das ist gut.«
Thekla musterte ihren Mann prüfend, sein ganzes Verhalten verriet, dass irgendetwas vorgefallen sein musste. Doch bevor sie auch nur eine Frage stellen konnte, kam er ihr schon zuvor.
»Wir müssen dringend über Benita sprechen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass sie Umgang mit jemandem hat, der net zu ihr passt.«
Auf Theklas sonst eher unbewegtem Gesicht malte sich Erstaunen, und sie schüttelte ungläubig den Kopf.
»Das kann net sein. Ich lass die Benita doch net aus den Augen. Wie soll sie denn so jemanden kennengelernt haben?«
Anstetter zuckte mit den Schultern.
»Durch Zufall vielleicht? Oder als du bei deinen Landfrauen warst?«
Thekla errötete verärgert. Sie hasste es, wenn man ihr für irgendetwas die Schuld zuschob. Vor allem aber, wenn es sich um ihre einzige Tochter handelte.
»Auf jeden Fall muss das ein Ende haben. Ich hab das Madel net dazu erzogen, dass sie sich mit irgendeinem Dorfhallodri einlässt«, erklärte sie mit großer Bestimmtheit.
»Da sind wir ja einer Meinung«, sagte ihr Mann befriedigt.
Es war wesentlich leichter gewesen als gedacht, Thekla auf seine Seite zu bekommen. Für gewöhnlich trachtete sie danach, ihren Willen durchzusetzen, was nicht selten zu anhaltenden Verstimmungen führte.
»Hast du nicht einmal davon geredet, dass die Benita am besten in einem Internat aufgehoben wäre? Bei den Ursulinerinnen beispielsweise …«
»Ja, aber damals war sie noch zu jung dafür. Sie hätte bestimmt Heimweh gehabt, und man hätte sie uns zurückgeschickt.«
Es war ihr deutlich anzumerken, dass sie an dem Vorschlag ihres Mannes nun Gefallen fand. Thekla war auch im Frauenkreis der Kirche, und dass ihre Tochter ihre weitere Ausbildung durch Ordensschwestern erfahren sollte, sagte ihr sehr zu.
»Doch jetzt erscheint sie mir wahrhaftig alt genug dafür«, erwiderte Anstetter mit großer Bestimmtheit.
Thekla erklärte sich sofort einverstanden. Wenn die Gefahr drohte, dass Benita vom rechten Weg abkam, wie sie das bei sich nannte, dann war es höchste Zeit, dass sie in die sichere Obhut der Ursulinerinnen gelangte.
Man hätte Thekla unrecht damit getan, sie eine herzlose Mutter zu nennen. Auf ihre Weise liebte sie Benita, obwohl ihre Geburt eine herbe Enttäuschung gewesen war. Denn wie ihr Mann hatte sie sich einen Sohn gewünscht. Doch sie wünschte das Beste für ihre Tochter, und so wie die Dinge standen, erschien ihr ein Internat als beste Lösung.
Gleichzeitig, und das gab sie sich selbst gegenüber offen zu, verspürte sie aber auch eine gewisse Erleichterung. Thekla war eine sehr umtriebige Frau, Mitglied zahlreicher Vereine und Verbände, und wenn Benita aus dem Haus wäre, hätte sie endlich weitaus mehr Freiraum für ihre vielseitigen Aktivitäten.
»Hoffentlich ist so kurzfristig noch ein Platz frei«, meinte Thekla und zog zweifelnd die Brauen zusammen.
»Ich hab da so meine Verbindungen«, sagte Anstetter. »Ich will net, dass die Benita noch aus dem Haus geht. Sobald alles geregelt ist, sagen wir ihr Bescheid, und ich bringe sie mit dem Wagen zu den Schwestern.«
Anstetters Verbindungen verfehlten wie meistens nicht ihren Zweck, und es wurde wunschgemäß vereinbart, dass sich seine Tochter bereits vor Ferienende in dem Internat einleben könnte. Es gab immer Schüler, die auch die Ferien über dort blieben, entweder, weil sie Waisen waren, oder weil sich ihre Eltern im Ausland aufhielten.
Es fiel Thekla zu, ihre Tochter auf diese grundlegende Veränderung in ihrem Leben vorzubereiten, was sie ohne viele Umstände in Angriff nahm.
»Dein Vater und ich haben uns entschlossen, dich zu den Ursulinerinnen zu schicken. Dort erhältst du eine bessere Ausbildung als auf dem Gymnasium in der Kreisstadt, wo dauernd der Unterricht ausfällt.«
Entsetzt wollte Benita aufbegehren, aber ihre Mutter schnitt ihr das Wort ab.
»Es ist der ausdrückliche Wunsch deines Vaters, und es hat keinen Zweck, dass du dich dagegen wehrst. Sei vernünftig! Wir packen jetzt deine Sachen, du musst dir genau überlegen, was du alles brauchst.«
»Jetzt schon? Aber ich will noch …«
Benita brachte den Satz nicht zu Ende, sie zitterte am ganzen Körper.
»Es ist besser, wenn du vor Schulbeginn Zeit hast, dich einzugewöhnen. Der Vater fährt dich morgen hin.«
»Morgen schon?«
Um Benita begann sich alles zu drehen. Wie sollte sie Jonas Bescheid sagen, dass sie sich nicht mehr sehen konnten? Ihr Herz zog sich schmerzhaft zusammen, und sie unterdrückte nur mühsam ein Schluchzen.
»Je eher, desto besser.«