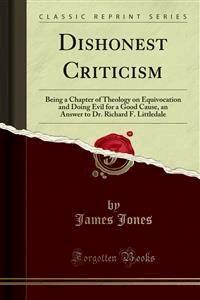11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Nach seinem auch als Film weltberühmt gewordenen Erstling ›Verdammt in alle Ewigkeit‹ und dem Folgeband ›Insel der Verdammten‹ beschließt James Jones mit diesem Roman seine große Trilogie über den Zweiten Weltkrieg. Die Helden kommen zurück. Jones erzählt die Geschichte von vier Männern, Angehörigen einer Infanteriekompanie, die mit der ersten großen Welle der Verwundeten vom Kriegsschauplatz im Südpazifik auf einem Lazarettschiff zurücktransportiert werden. Dabei zeichnet er ein nuancenreiches Porträt der Psyche der heimkehrenden Verwundeten, ihrer inneren Zerrissenheit, ihrer paradoxen Schuldgefühle, ihrer totalen Entfremdung von denen, »die nicht da draußen waren«. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 747
Ähnliche
James Jones
Heimkehr der Verdammten
Roman
Aus dem Amerikanischen von Emil Bastuk
FISCHER Digital
Inhalt
Gewidmet allen Männern, die im Zweiten Weltkrieg in der amerikanischen Armee dienten – ob sie überlebt haben oder nicht; ob sie gekämpft haben oder nicht; ob sie eingelocht waren oder nicht; ob sie verrückt wurden oder nicht.
Es gab so etwas wie eine Standardbemerkung, die die Nachtpfleger den neu angekommenen Patienten im Lazarett gegenüber machten:
»Wenn Sie irgend etwas wollen, dann pfeifen Sie einfach.«
R.J. Blessing
Memoiren 1918
Hüpf und tanz, hüpf und tanz, Zapple an deinen Schnüren.
Pfeif dir eins auf dem Weg zum Grabe.
Keiner weiß, wer oder was an den Drähten zieht.
Du wirst es nie erfahren.
Alter französischer Reim
Einführung von Willie Morris
James Jones starb am 9. Mai 1977 im Krankenhaus von Southampton, Long Island, an kongestivem Herzversagen; er war fünfundfünfzig Jahre alt.
Heimkehr der Verdammten war auf vierunddreißig Kapitel angelegt. Jones hatte das Kapitel 31 zur Hälfte fertig, als er neuerlich schwer erkrankte; der Verlauf der Handlung in den letzten Kapiteln stand jedoch bereits fest, und Jones hatte sogar schon partienweise Details ausgearbeitet.
Ich war sein Freund und Nachbar, und in Tonbandaufzeichnungen und in zahllosen Gesprächen mit mir in den Monaten vor seinem Tode hat er sehr genau erklärt, wie er sich die restlichen drei Kapitel dieses Buches dachte. Noch zwei Tage vor seinem Tode sprach er im Krankenhaus Notizen dazu auf ein Tonband.
Diese letzten Kapitel sollten alle ziemlich kurz sein. Das Ende des Romans hatte er in Gedanken fixiert, nur fehlte es ihm an Zeit. Ein weiterer Monat hätte gereicht, die Arbeit zu beenden, wie er sie geplant hatte. Was er hinterließ, war dennoch im wesentlichen ein abgeschlossenes Werk.
In seiner Vorbemerkung (Seite 11) hat Jones gesagt, welchen Platz er diesem Buch in seinem Gesamtwerk zuteilt; es ist das letzte einer Trilogie über den Zweiten Weltkrieg, die mit Verdammt in alle Ewigkeit (1951) beginnt, mit Der tanzende Elefant (1962) fortgeführt wurde und mit Heimkehr der Verdammten jetzt abschließt.
Von diesem seinem letzten Roman war er förmlich besessen. Er arbeitete über viele Jahre hin daran – mit langen Pausen dazwischen. Immer wieder kehrte er zu diesem Thema zurück, »es hat sich in meinem Kopf mehr als dreißig Jahre wie am Spieß gedreht«. Als auf seinen ersten Herzanfall 1970 zwei weitere folgten, schien mir, daß er den Eindruck hatte, der ihm verbleibenden Zeit dieses Buch noch abringen zu müssen. In seinen beiden letzten Lebensjahren arbeitete er in der Mansarde seiner Farm in Sagaponack täglich zwölf bis vierzehn Stunden daran. Im Januar 1977 überstand er einen weiteren Herzanfall und schrieb fortan bis zu seinem Tode täglich mehrere Stunden. Vorsichtshalber besprach er noch die Tonbänder und machte Notizen.
Er beabsichtigte, dem Buch eine Erklärung vorauszuschicken, warum er darin die Stadt Memphis, Tennessee, nicht bei ihrem richtigen Namen, sondern Luxor nennt. Er hat dazu in einem Essay und in seinen Notizen bemerkt:
Dieses Luxor gibt es nicht. Weder in Tennessee noch überhaupt in den USA.
Luxor ist in Wirklichkeit Memphis. Ich habe dort 1943 im Alter von zweiundzwanzig Jahren acht Monate im Kennedy General Army Hospital zugebracht.
Luxor ist aber zugleich auch Nashville. Aus dem Lazarett entlassen, wurde ich nach Camp Campbell in Kentucky versetzt, unweit von Nashville. Statt nach Memphis, fuhren wir fortan nach Nashville, wenn wir Ausgang hatten. In Luxor finden sich Merkmale beider Städte. Ich wollte innerhalb des Romans nicht die handelnden Personen, ihre Liebesaffären, ihre Gewohnheiten, Stammkneipen und die persönlichen Beziehungen, die sie an Memphis banden, verändern, darum mußte ich aus Camp Campbell das erdachte Camp O’Bruyerre machen und es in die Nähe von Memphis verlegen.
Ich nannte meine Stadt also Luxor und brachte in sie die Erinnerungen ein, die ich an Memphis hatte oder zu haben glaubte. Wer Memphis kennt, dem wird mein Luxor vertraut vorkommen, streckenweise aber auch wieder ganz fremd. Man sollte deshalb bei der Lektüre nicht an Memphis denken, sondern diese Stadt als Luxor nehmen. Eigentümer und Inhaber ist ausschließlich der Autor, der auch die volle Verantwortung übernimmt.
Auf Seite 449 ist die Stelle, an der Jones zu schreiben aufhörte, durch Sternchen markiert. Der anschließende Text wurde von mir seinen Absichten, Notizen und mündlichen Mitteilungen entsprechend niedergeschrieben. Diese Kapitel enthalten nichts, was nicht ausdrücklich von Jones vorgesehen war. Der letzte, eingezogen gesetzte Absatz enthält den Wortlaut eines Tonbandes, das der Autor wenige Tage vor seinem Tode besprochen hat.
Bridgehampton, Long Island
28. Mai 1977
Vorbemerkung des Verfassers
Die eigentliche Arbeit an diesem Buch begann 1968, doch beschäftigte ich mich mit dem Stoff bereits viele Jahre. Der Plan dazu entstand schon 1947, als ich noch mit Maxwell Perkins über meine Helden Warden und Prewitt korrespondierte, die in einem Buch vorkommen sollten, das ich über den Zweiten Weltkrieg zu schreiben beabsichtigte. Als ich Verdammt in alle Ewigkeit zu schreiben begann (damals hatte es noch keinen Titel), wollte ich, daß die handelnden Personen darin erst in Friedenszeiten im Heer agieren, dann die Schlachten von Guadalcanal und New Georgia mitmachen und schließlich als Verwundete in die Heimat zurückkehren. Diese Zeitspanne konnte ich aus eigener Erfahrung schildern. Doch schon lange bevor ich die erste Romanhälfte fertig hatte, wurde mir klar, daß der Rahmen zu weit gesteckt war. Die Handlung des Romans brauchte längst nicht so viel Stoff, und der Umfang eines solchen Buches wäre einfach zu groß geworden.
Damals verfiel ich auf den Gedanken, den Stoff in eine Trilogie zu gliedern, und Heimkehr der Verdammten (ohne diesen Titel, und als Roman noch nicht angelegt) sollte ein Teil davon sein. Als ich etwa elf Jahre später mit Der tanzende Elefant begann, bestand also schon der Plan für eine Trilogie. Heimkehr der Verdammten sollte der dritte Band werden.
Und das war durchaus in Ordnung so. Die Trilogie war von mir so konzipiert, daß jeder der drei Romane für sich allein stehen sollte. Die ausgezeichneten drei Romane, die John Dos Passos’ USA ausmachen, tun dies nicht. Der 42. Breitengrad, 1919 und Hochfinanz stehen als Romane nicht unabhängig voneinander, vielmehr ist das Gesamtwerk ein einziger großer Roman, nicht eine Trilogie.
Meine Absicht war, sogleich nach Beendigung der Arbeit an Der tanzende Elefant mit dem dritten Roman zu beginnen, doch kamen mir andere Projekte dazwischen. Ich stellte ihn immer wieder zurück, gleichsam um den Stoff ablagern zu lassen. Das bedeutete aber, daß ich jedesmal, wenn ich die Arbeit wiederaufnahm, ganz von vorn anfangen mußte. Die Niederschrift zeugt denn auch davon, daß ich unterdessen neue stilistische Erfahrungen machte und daß der Blickpunkt des Erzählers sich verändert hatte.
Als ich Der tanzende Elefant begann, stand ich vor der Frage, ob es möglich sei, die handelnden Personen, wie ursprünglich geplant, mit unveränderten Namen in allen drei Romanen auftreten zu lassen. Die dramatische Struktur des ersten Bandes, ich könnte auch sagen der geistige Gehalt, verlangte bedauerlicherweise, daß Prewitt am Ende des ersten Bandes nicht überlebt. Überlebte er, würde das dem Buch erheblich an Gewicht nehmen.
Als sich am Ende von Verdammt in alle Ewigkeit der Pulverdampf verzogen hatte, überblickte ich das Schlachtfeld und sah, daß Prewitt, wie es nicht anders sein konnte, fehlte.
Heute könnte man mit einem Achselzucken darüber hinweggehen, doch damals war das anders. Eigentlich hatte Prewitt auch im zweiten und dritten Roman eine tragende Rolle spielen sollen, doch konnte ich ihn nicht einfach von den Toten auferwecken, ihn wieder unter dem gleichen Namen einführen.
Ich entschloß mich daher, alle Namen zu ändern, jedoch auf eine Weise, die es dem aufmerksamen Leser erlaubte, die Charaktere aus dem ersten Roman in den folgenden wiederzufinden. Heute scheint dieses Verfahren naheliegend, damals war es das durchaus nicht.
In Der tanzende Elefant erscheint also der Hauptfeldwebel Warden als Welsh, Prewitt als Witt, Stark als Storm, und doch sind sie unverändert als Personen. In Heimkehr der Verdammten wird aus Welsh ein Mart Winch, aus Witt wird Bobby Prell, und aus Storm wird John Strange.
Aufmerksame Leser von Der tanzende Elefant haben mich gefragt, ob die Ähnlichkeit der Namen beabsichtigt sei. Ich bestätigte ihnen das und gab auch meine Gründe dafür an. Meines Wissens hat aber kein Rezensent diese Eigentümlichkeit je hervorgehoben.
Es bleibt mir nur noch zu sagen, daß mit der Publikation von Heimkehr der Verdammten ein Ende erreicht sein wird. Wenigstens für mich, nämlich das Ende einer langen Arbeit. Ich habe fast dreißig Jahre darüber zugebracht. Man wird darin alles das finden, was ich über den Krieg zu sagen habe, darüber, was er wirklich für uns bedeutet, und das ist etwas anderes, als wir gemeinhin behaupten.
Paris, 15. November 1973
Erstes Buch Das Schiff
1
Daß alle vier unterwegs waren, erfuhren wir bereits einen Monat vor ihrem Eintreffen. Wenn man bedenkt, daß wir über Lazarette im ganzen Land verstreut lagen, ist es erstaunlich, wie rasch wir von allen Veränderungen erfuhren, die in der Kompanie vorgingen. Wir berichteten einander davon auf Postkarten oder in Briefen. Man kann sagen, wir hatten unsere eigene Nachrichtenverbindung wie ein Netz über das ganze Land gespannt.
Diesmal sollten es nur vier sein, aber welche vier! Winch. Strange. Prell. Und Landers. Das waren so etwa die vier Säulen der Kompanie gewesen.
Anfangs ahnten wir nicht, daß alle vier in dasselbe Lazarett kommen würden, hierher zu uns, nach Luxor.
Meist waren wir in Luxor es, die am zeitigsten solche Nachrichten erhielten, und das, weil wir die größte Gruppe waren. Einmal waren wir sogar zwölf. Damit bildeten wir sozusagen den Mittelpunkt des Netzes. Die damit verbundenen Pflichten nahmen wir klaglos auf uns, wir verständigten die anderen gewissenhaft per Post.
Für uns gab es nichts Wichtigeres als Neuigkeiten von jener Kompanie, die immer noch im fernen Dschungel kämpfte. Die war für uns wirklicher als alles, was wir um uns herum sahen, als alles, was uns selber zustieß.
Winch war draußen unser Spieß gewesen, Strange der Furier, Landers war Kompanieschreiber, und Prell, obwohl zweimal degradiert und derzeit nur Korporal, war die treibende Kraft unserer Truppe und ein Tollkopf.
Daß wir hier in der Heimat wie die Kletten aneinanderhingen, war eigentlich sonderbar, doch bildeten wir eine Art Familie, fühlten uns wie verwaiste Kinder, wegen Seuchengefahr in unterschiedliche Krankenhäuser evakuiert. Daß wir Opfer einer Seuche waren, bekamen wir immer wieder zu fühlen. Man behandelte uns nett, man kümmerte sich gewissenhaft um uns, nur wusch sich jeder sogleich die Hände, wenn er uns berührt hatte. Wir waren irgendwie unrein, ansteckend. Und wir fanden das selber, wir nahmen es hin, wir verstanden, daß Zivilisten die Augen von unseren Wunden abwandten.
Wir Lazarettinsassen merkten, daß wir in der sauberen, gesunden Umwelt nicht am richtigen Platze waren. Wir gehörten in das umkämpfte, verseuchte Katastrophengebiet, dort mochten wir unterliegen, sterben, für immer verschwinden, gemeinsam mit denen, die uns als die einzigen Verwandten erschienen, die wir je gehabt hatten. So empfand man als Verwundeter. Wir glichen unnützen Eunuchen; unserer baumelnden Anhängsel beraubt, fraßen wir den Weibern im Park Süßigkeiten aus der Hand und warteten auf Neuigkeiten von den noch an der Front stehenden Kriegern.
Immerhin waren wir nicht frei von Arroganz. Schließlich kamen wir aus den Katastrophengebieten, wohin die anderen nie einen Fuß gesetzt hatten. Das ließen wir keinen je vergessen. Wir kamen aus der verseuchten Zone, waren der Pest ausgesetzt gewesen, trugen ihre Erreger in uns und konnten es beweisen. Darin bestand unser Stolz.
Für alle, die zu uns gehörten, empfanden wir eine schier irrsinnige Loyalität. Wir waren bereit, es ihretwegen mit jedem aufzunehmen, und wenn wir Ausgang in die Stadt hatten und betrunken genug waren, taten wir es auch. Wir prügelten uns mit jedem, der nicht mit uns da draußen gewesen war. Als Kennzeichen trugen wir die Nahkampfspange der Infanterie. Andere Auszeichnungen, egal welcher Art, verachteten wir. Die mochten dem gesitteten Bürger Eindruck machen.
Die Kompanie war unser eigentliches Zuhause gewesen. Eltern, Ehefrauen, Bräute existierten in Wahrheit nicht für uns. Ihnen galt nicht unsere fanatische Loyalität. Verstümmelt, rasend vor Wut, geschwächt, entmannt in einem durchaus realen Sinne und haßerfüllt klammerten wir uns aneinander in den weit verstreuten Lazaretten, erwarteten gierig auch die geringsten Neuigkeiten von der Kompanie und zeichneten alles gewissenhaft auf, zur Weitergabe an unsere Brüder.
Daß diese vier unterwegs waren, entnahmen wir einer verdreckten Feldpostkarte, die von einem der Glücklich-Unglücklichen stammte, der immer noch da draußen lag. Es hieß darauf, alle vier seien beinahe gleichzeitig in ein und dasselbe Feldlazarett geschafft worden. Weiter nichts. Als nächstes erfuhren wir, daß alle vier mit demselben Lazarettschiff unterwegs in die Heimat waren. Die Nachricht stammte von einem jener Unglücks- oder Glücksraben, die zwar verwundet, nicht aber in die Heimat abgeschoben worden waren. Etwas später schrieb einer unserer Sergeanten ausführlicher.
Winch litt an einer Krankheit, die dort draußen offenbar nicht zu diagnostizieren war und über die er selber kein Wort verlor. Er hatte mehrere Fieberthermometer zerbissen, einen Lazarettgehilfen verscheucht, war in seine Schreibstube zurückgewankt, und dort hatte man ihn über der Tagesmeldung zusammengebrochen an seinem behelfsmäßigen Schreibtisch gefunden.
John Strange hatte einen Granatsplitter in die Hand bekommen, der steckengeblieben war; die Wunde heilte schlecht, die Hand wurde immer steifer. Strange war auf dem Weg in die Heimat, weil er sich komplizierten Operationen an Knochen und Sehnen unterziehen und den Splitter entfernen lassen mußte.
Landers war der rechte Fußknöchel zerschmettert worden, ebenfalls von einem Granatsplitter, einem dicken Brocken. Auch ihm standen mehrere Operationen bevor. Prell war von einer MG-Garbe an beiden Oberschenkeln erwischt worden, er hatte mehrere Schußbrüche.
Auf solche Neuigkeiten brannten wir förmlich. Hörten wir sie etwa insgeheim mit Freude? Gefiel uns der Gedanke, daß andere sich uns in unserem halb entmannten Zustand beigesellten? Hätte jemand uns das vorgeworfen, wir hätten es gewiß abgestritten, hätten jeden verprügelt, der so was andeutete. Zumal was jene vier Männer angeht.
Als Corello in die blitzblanke scheußliche Cafébar des Lazaretts kam und den Brief in der Hand schwenkte, saßen wir dort gerade zu mehreren. Die Morgenvisite war vorüber. Corello war leicht erregbar, italienischer Abstammung und stammte aus McMinnville in Tennessee. Warum er in Luxor im Lazarett lag und nicht in Nashville, blieb unerklärlich, so unerklärlich wie der Umstand, daß seine italienischen Vorfahren ausgerechnet in McMinnville Fuß gefaßt und ein Restaurant eröffnet hatten. Seit seiner Einlieferung ins Lazarett von Luxor hatte Corello ein einziges Mal Heimaturlaub gehabt, war aber nur einen Tag geblieben. Er könne es nicht aushalten, behauptete er. Nun also drängte er sich zwischen den weißen Tischen zu uns durch und hielt den Brief in die Höhe.
Vorübergehend wurde es ganz still, dann begann die allgemeine Unterhaltung von neuem. Die alten Hasen hier hatten zu oft Ähnliches gesehen. Die beiden Kellnerinnen schauten zwar ängstlich von ihren Tabletts auf, beim Anblick des Briefes beruhigten sie sich aber sogleich wieder und schenkten weiter Kaffee aus.
Die südliche Sonne knallte durch die große Scheibe in all das Weiß hier. In den Ecken saßen Männer über Briefe gebeugt, die sie lieber hier in dem Lärm schrieben als in der ruhigen Bibliothek. Von unserer Kompanie saßen fünf Mann um einen Tisch, und bei dem blieb Corello stehen.
Sogleich gesellten sich andere von der Kompanie zu uns, die anderswo gesessen hatten. Sekunden später hockten wir allesamt eng beieinander. Schon ging der Brief von Hand zu Hand. Patienten, die zu anderen Einheiten gehörten, schauten in ihre Kaffeetassen und ließen uns in Frieden.
»Les’ doch einer vor!« wurde verlangt.
»Ja, los, vorlesen«, sagten mehrere.
Der Mann, der den Brief gerade hielt, blickte auf und wurde rot. Er lehnte kopfschüttelnd ab und reichte den Brief weiter. Der Empfänger glättete den Brief auf der Tischplatte und räusperte sich. Er überflog das Blatt, dann begann er zu lesen, gestelzt wie ein Schüler beim Vortrag.
Das Vorlesen wurde von mehreren Zuhörern mit leisen, bewundernden Pfiffen belohnt.
Nachdem er geendet hatte, legte er den Brief zwischen die Kaffeetassen auf den Tisch, nahm ihn aber gleich wieder auf, damit er nicht fleckig würde, und reichte ihn Corello zurück.
»Alle vier auf einmal«, sagte jemand, der hinter ihm stand, mit hohler Stimme.
»Stimmt«, sagte ein anderer.
»Praktisch alle am gleichen Tag.«
Wir wußten alle, daß keiner von uns je wieder zur alten Kompanie zurückkehren würde. Seit wir in der Heimat waren, stand das fest. Wer so weit zurückgeschickt wurde, den teilte man nach der Entlassung aus dem Lazarett einer neuen Einheit zu. Wir alle aber redeten uns ein, daß die Kompanie weiterbestehen würde, wie sie uns vertraut war, daß sie den Krieg von Anfang bis Ende überstehen würde. Intakt.
»Das ist ja, als ob … als ob …«
Der Sprecher, wer er nun auch war, brach ab, doch wußten wir alle, was er meinte.
Wir waren von einer Art abergläubischer Furcht befallen. Aberglaube war für uns überhaupt ein Lebenselement. Notwendigerweise. Geschick und Erfahrung reichten nicht aus – das Ergebnis eines Feuergefechtes blieb doch immer großenteils Glückssache. Wie die Glücksspieler fürchteten wir das Unerklärliche, es war unsere Gottheit, die das Glück distanziert kühl in sich bewahrte, als eines ihrer machtvollen Werkzeuge. Zum Kommandeur wünschten wir uns einen, der Glück hatte.
Die nur umsichtigen, sachkundigen Kommandeure überließen wir gern anderen.
Wir glichen jenen Vorzeitmenschen, die ihre Hütten vom Blitz zerstört sehen und sich einen Gott erdenken, dessen Handlungen das Unbegreifliche erklären. Unsere Gottheit glich noch am ehesten der Roulettekugel.
Bislang hatten wir geglaubt, die Gottheit blicke gnädig auf unsere Kompanie, doch nun schien es, als wolle das Glück sich wenden. Tun konnte man dagegen nichts, als abergläubische Menschen begriffen wir das sogleich. So waren nun mal die Spielregeln. Man mußte sich hüten, unter Leitern hindurchzugehen, es durften einem keine schwarzen Katzen über den Weg laufen, und die Ritzen zwischen den Steinplatten durften nicht betreten werden.
Daß die alte Kompanie sich so verändern sollte, war nicht hinzunehmen ohne Angst, es bedrückte uns, daß sie jetzt anderen als Zuhause, als Familie diente.
Die Kompanie war das letzte, was uns geblieben war.
»Hm –« Einer unter uns räusperte sich so laut, daß es klang, als feuere man eine Schrotflinte in ein Faß.
Was er damit meinte, verstanden wir ohne weiteres. Er wollte das Thema nicht weiter verfolgen, da das Pech der Kompanie sonst womöglich auf uns abfärbte.
»Trotzdem«, sagte ein anderer, »gleich alle vier auf einmal?«
»Vielleicht kommt einer zu uns.«
»Winch vielleicht. Das wäre schon was.«
»Dann würden wir alles aus erster Hand erfahren, wären nicht mehr auf die Post angewiesen.«
»Und es wäre wie früher.«
»Wenn schon von Post die Rede ist«, sagte jemand, »sollten wir am besten gleich anfangen.«
Zugleich mit ihm standen zwei oder drei andere auf und setzten sich an freie Tische. Ihnen folgten zwei weitere, Papier und Schreibgerät kam zum Vorschein, Briefumschläge, Postkarten, Briefmarken.
Im Schein der südlichen Sonne, die grell in all das Weiß hier unten fiel, begannen sie jene Briefe und Postkarten zu schreiben, welche die Neuigkeit im ganzen Lande verbreiten würden. Manche steckten beim Schreiben die Zungenspitze heraus.
Wir übrigen blieben sitzen. Eine Weile wurde erstaunlich wenig geredet. Plötzlich winkten alle nach Kaffee. Danach saßen wir wieder ein Weilchen reglos. Die meisten stierten die weißen Wände oder die weiße Decke an.
Wir dachten ausnahmslos an jene vier Männer, von denen sich mit Recht sagen ließ, daß sie den Kern der Kompanie ausgemacht hatten. Diese vier waren also nun auf der Heimreise, einer befremdlichen Reise, die wir alle hinter uns hatten, einer gespenstischen, unwirklichen Reise. Wir hatten sie entweder mit den großen schnellen Flugzeugen zurückgelegt oder auf den langsamen weißen Schiffen mit dem riesigen Roten Kreuz an den Bordwänden, so wie diese vier jetzt.
Da saßen wir in unserer grell weißen Halbwelt und dachten an jene vier Männer, die die gleiche Reise machten, die auch wir gemacht hatten, und fragten uns, ob auch sie jenes sonderbare Gefühl der Entrückung empfänden, des Losgelöstseins, des Nichtmehrteilnehmens, dessen wir uns alle noch gut erinnerten.
2
Winch gammelte in seiner Kajüte herum, als es hieß, die heimatliche Küste sei in Sicht gekommen. Irgend so ein blöder Soldat steckte den Kopf in die Kammer, brüllte atemlos seine Neuigkeit heraus und lief weiter.
Sogleich schien das ganze Schiff wie elektrisiert. Winch hörte Getrampel im Korridor. Seine Mitbewohner legten die Karten weg, zogen die Gürtel ihrer Bademäntel straff und machten Anstalten, an Deck zu gehen.
Die Kajüte wurde von lauter Feldwebeln bewohnt. Die Morgenvisite, im Lazarett der Höhepunkt des Tages, auf diesem Fleischtransporter aber nur eine jämmerliche Karikatur davon, war vorüber. Den Rest des Tages konnte jeder verbringen, wie er wollte. Winch schaute beobachtend zu und rührte sich absichtlich nicht vom Fleck. Er hatte aus purer Dickköpfigkeit beschlossen, nicht an diesem Ausflug teilzunehmen und auch nicht mit sich reden zu lassen.
»Kommst du nicht, Winch?«
»Nein.«
»Sei nicht so stur, Mann, schließlich ist es die Heimat.«
»Nein.«
Winch drehte sich zu dem Sprecher um, den er aber nicht mit Bestimmtheit ausmachen konnte. Genaugenommen, waren diese Männer ihm allesamt fremd. Er beglückte sie mit dem verzerrten Lächeln des nach Fleisch gierenden Kannibalen und sagte: »Hab’ ich schon mal gesehen.«
»Aber nicht so wie diesmal«, widersprach einer und deutete auf seinen Arm im Gipsverband. »Nicht so wie diesmal.« Der Gipsverband reichte um Hals und Schultern und hielt, durch eine Aluminiumschiene abgestützt, den Arm vom Körper abgewinkelt. Die unverbundene Hand war purpurrot.
»Laß ihn, den kennen wir doch allmählich. Bescheuert ist er, nichts als bescheuert.«
Sie zogen ab, schwerfällig, zwei wegen ihrer Beinverletzung hinkend, alle vier bedächtig, langsam, mit der Achtsamkeit versehrter Menschen. Bescheuert? Genau diesen Eindruck hatte Winch bei seinen Mitbewohnern erwecken wollen. Seit Jahren schon bemühte er sich, auf alle möglichen Leute so zu wirken.
Allein geblieben, streckte er sich auf seiner Koje aus und betrachtete die glatte Unterseite der Koje über sich. Er verspürte nicht die geringste Lust, an Deck zu gehen und die Westküste von Nordamerika zu betrachten.
Heimat. Heimat hatten die gesagt. Ihm bedeutete das nichts. Bedeutete es denen denn wirklich was?
An einem bestimmten Punkt empfinden wir allesamt das gleiche, dachte er. Jedenfalls alle, die etwas wissen. Die Heimat kann etwas sehr Unwirkliches werden. Überdies kommt es einem irgendwie ungerecht vor, daß ausgerechnet wir vom Glück begünstigt sein sollen, daß uns erlaubt wird, zu Schnaps und Weibern zurückzukehren, nur weil wir Arme oder Beine oder ein Auge verloren haben, während die anderen, die Unversehrten, dort draußen bleiben, zu überleben versuchen und in Qualm und Gestank Luft holen müssen.
Winch angelte eine Flasche Whiskey aus seinem Kleiderbeutel und setzte sie an den Mund. Er hielt sich vor, daß Alkohol für ihn schädlich sei, daß er nicht aus dieser Flasche trinken dürfe, doch nahm er gleichwohl zwei tüchtige, heiße Schlucke.
Auf euer Wohl, ihr Scheißer da draußen, Gott schenke euch ein langes Leben!
Er senkte grüßend den Flaschenhals. Schnaps mochte derzeit ja Gift für ihn sein, aber wenn das zutraf, war er doch ein wunderbares, vollmundiges Gift.
Er ließ seine Gedanken wandern. Kommandeure. Zum Kommandieren ist man geboren oder nicht, so wurde gern behauptet. Erlernen lasse sich das nicht. Blödsinn. Was war denn damit gemeint? Doch nur das, was man seit Jahrhunderten unter Charisma verstand. Charisma hat man oder hat man nicht, und wer welches hat, kann von anderen verlangen, was er will, man wird ihm gehorchen. Doch angeboren ist es keinesfalls, sondern es wird demjenigen, der es besitzt, von den anderen sozusagen verliehen. Die Herde braucht einen Anführer, jemanden, zu dem sie aufblicken kann, jemanden, der ihr sagt, was zu tun ist. Der Kommandeur ist das Geschöpf der von ihm Kommandierten. Es ist eine Art Verschwörung. Beschränkte Kommandeure glauben wohl selber daran, aber gescheite Kommandeure durchschauen das Spiel. Sie spielen einfach mit. Er selber tat das doch seit Jahren.
Seufzend schob er einen Unterarm unter den Kopf. Seit Jahren gehörte er zu den Männern mit Charisma, zählte er zu den »Stars« der Division. Man kannte ihn im ganzen Heer. Und aus Erfahrung wußte er, daß solche Berühmtheiten wie er gewisse Eigenschaften gemeinsam hatten. Sie bildeten eine geheime Bruderschaft von Dieben. Sie erkannten einander auf den ersten Blick und rivalisierten niemals im Ernst miteinander. Das geheime Erkennungszeichen war eine gewisse Gerissenheit in den Augen, ein Blick komplizenhaften Einverständnisses. Von Charisma war nie die Rede zwischen ihnen. Immerhin hatte Winch von diesen Menschen, zu denen er selber gehörte, gelernt, daß sie eine Gattung für sich sind, ein Club von ganz raffinierten Betrügern.
Hatte man das einmal begriffen, dann ging zugleich damit alles zum Teufel, die Befriedigung, die Motivierung, alles. Alles verlor seinen Wert. Wurde albern. Man fühlte sich unmittelbar unter die Herde zurückversetzt, man wußte, daß man aussah – und roch – wie die anderen. Wie die Herde, zu der man um keinen Preis hatte gehören wollen.
Und ihn betrachtete man als den Helden seiner Kompanie. Soll sie doch der Teufel holen, dachte Winch wütend. Es lohnt nicht, sie allesamt mit einem nassen Handtuch zu erschlagen. Was gehen mich diese Scheißkerle überhaupt an?
Die Flasche hielt er immer noch auf der Brust; nun umfaßte er den Hals und ließ sie neben sich zu Boden gleiten.
Kanonenfutter sind sie, einer wie der andere, und der Teufel soll sie holen alle miteinander. Schließlich kann ich sie nicht in alle Ewigkeit am Leben erhalten. Er drehte sich auf die Seite, stützte sich auf einen Ellenbogen und schaute zur offenen Tür hinaus über den Korridor. Gegenüber lag, was einstmals der Salon Erster Klasse gewesen war. Und dort hatte man das Kanonenfutter angehäuft.
Es waren gewiß mehrere hundert. Statt der Teetische und der Sesselchen standen im Salon dicht an dicht Krankenhausbetten, und darin lagen die Schwerverwundeten, die ständige Beaufsichtigung brauchten. Der Salon hatte eine ziemlich hohe Decke, und darunter bewegten sich weißgekleidete Gestalten zwischen den Betten; hier und dort hockte ein Lazarettgehilfe auf einer Bettkante und überwachte die Übertragung von Glukose oder Plasma aus einem über dem Patienten aufgehängten Glasbehälter. Man hatte an der Dekoration des Salons nichts geändert, und die Verwundeten litten in einer mit Spiegeln verzierten, in edlen Rot- und Goldtönen gehaltenen Hölle.
Aus Winchs Kompanie waren vier Männer an Bord auf dieser Reise, er mitgezählt, und einer davon lag im Salon. Als Winch dort zum ersten Mal hineingeschaut hatte, war ihm beinahe übel geworden. So ergeht es bestimmt uns allen, dachte er. Der Anblick, der sich einem da bietet, macht einem schlagartig klar, welchen Preis der Krieg fordert. Die einzigen, denen das nicht auffiel, waren die, die im Salon lagen, und sie waren auch die einzigen, die nicht unter dem Gestank dort litten.
Offenbar war auch im Salon bekanntgeworden, daß Land in Sicht gekommen war, denn es herrschte dort eine schwächliche, gedämpfte Erregung. Von den Liegenden hatten einige sich mit Mühe im Bett aufgerichtet. Ein gespenstischer Anblick. Manche hatten Kopfverbände, die nur Augenschlitze frei ließen. Winch starrte hingerissen hinüber. Der Gestank, der aus dem Salon entwich, war fast unerträglich.
Menschliche Ausdünstungen. Wie sehr hatte er sich in den vergangenen Jahren doch daran gewöhnt. Ausdünstungen mannigfachster Art. Achselschweiß, Fußschweiß. Dreckige Socken und Unterwäsche. Stinkender Atem, übler Mundgeruch. Rülpser und Fürze. Schon am frühen Morgen das Pissoir und die türlose Sechserbrille. Klosettgestank vermischt mit dem Geruch von Seife und Zahnpasta, der über den Waschbecken hing, nicht weit davon entfernt im gleichen Raum.
Dazu gesellte sich nun ein neuer Geruch, der von Eiter. Eiter und Granulome. Süßlich faulendes Fleisch im Heilungsprozeß unter den mit Wundsekret getränkten Verbänden. Der Gestank nistete in allen Winkeln des Salons und quoll nach draußen. Diesen Gestank würde man wohl ebenso wie die Erinnerung an die anderen Ausdünstungen sein Leben lang nicht mehr loswerden.
Lange allerdings dürfte das in meinem Fall nicht sein, dachte Winch. Nicht jedenfalls, wenn ich mich nicht sehr in acht nehme. Trinken zum Beispiel dürfte ich überhaupt nicht. Und rauchen auch nicht. Und schon nahm er die Flasche wieder hoch, tat einen kräftigen Schluck und setzte eine Zigarette in Brand.
Beide Gesten brachten ihm nichts ein. Er fand sich an der gleichen Weggabelung wie zuvor. Nachts. Lastwagen donnerten vorüber, keiner hielt an. Wie unmännlich konnte er eigentlich noch werden, jetzt, am Ende der Reise und ohne Zuschauer? Er, ein alternder, erbarmungsloser, verhärteter alter Infanterist und Spieß, er sollte sich wirklich nach Mitgefühl sehnen? Das war ja lächerlich.
Nicht mal verwundet war er. Bloß krank. Bei dem Wort krank verspürte er ein ungewohntes Gefühl der Leere. In seinem ganzen Leben war er nicht krank gewesen. In die Leere sickerte der Schnaps, einschmeichelnd, verführerisch und tückisch, täuschte Sonnenschein vor und Wohlbehagen.
Er schaute noch einmal hinüber in den Salon. Welches Glück, daß dort nur ein einziger Mann aus seiner Kompanie lag. Bobby Prell. Winch bekam Durst, und diesmal nahm er einen Schluck Wasser aus der Feldflasche, die in ihrem Filzüberzug unter seiner Koje lag.
»Mit dem Denguefieber werden Sie bald fertig«, hatte Oberstabsarzt Harris zu ihm gesagt, der rangälteste Arzt der Division. Der war höchstpersönlich auf den Verbandplatz im Dschungel gekommen, um nach Winch zu sehen. »Es ist zwar schmerzhaft, aber man übersteht es.«
»Besten Dank, Doktor«, hatte Winch geknurrt.
Das Fieber hatte ihn schließlich in die Knie gezwungen, und er war über seinem Schreibtisch zusammengebrochen wie ein grüner Rekrut.
»Und mit der Malaria werden Sie auch noch fertig«, fuhr Harris fort. »Das dauert zwar länger, denn Sie haben den übelsten Erreger erwischt und hätten sich rechtzeitig krank melden sollen.«
Zwei Monate lang war es ihm gelungen, seine Malaria zu verheimlichen. Nun lag er mit Ausschlag und rot geschwollenen Händen auf seiner Pritsche im Lazarett und hatte den ersten schweren Denguefieberanfall hinter sich, auch die vierundzwanzig Stunden währende Euphorie, die darauf folgt, und den zweiten Fieberanfall. Er fühlte sich erbärmlich.
»Schön, schön, aber was soll das alles?«
Doktor Harris stieß sanft mit dem Radiergummi am Ende seines langen gelben Bleistiftes gegen seine Vorderzähne. Neue lange gelbe Bleistifte waren seine Leidenschaft.
»Das ist leider nicht alles. Sie haben einen viel zu hohen Blutdruck.«
Darauf wußte Winch keine Antwort. Schließlich lachte er verächtlich. »Hoher Blutdruck? Sie machen wohl Witze.«
»Keineswegs. Im Gegenteil. Das Fieber bewirkt im allgemeinen ein Absinken des Blutdruckes. Das alles muß noch genauer untersucht werden, aber ich zweifle nicht daran, daß Sie an Hypertension leiden.«
»Was ist das?«
»Zu hoher Blutdruck eben. Das sagte ich doch schon.«
Als er zwei Tage später noch einmal zur Visite kam, konnte Winch sich schon wieder auf den Füßen halten, wenn auch mit Mühe. Auf der Pritsche liegend, kam er sich besonders unmännlich vor. Warum nur maßen intelligente Menschen alles und jedes an ihrer körperlichen Vitalität? Aber das taten sie nun mal.
»Für die Infanterie sind Sie nicht mehr tauglich, Winch. Sie müssen Diät halten. Kein Alkohol. Keine Zigaretten. Kein Kaffee und kein Tee. Keine Aufregungen. Wenn ich könnte, würde ich Ihnen sofort salzlose Kost verordnen. Daß Sie an die Front zurückgehen, kommt nicht in Frage.«
»Na, das klingt ja wunderbar«, versetzte Winch. »Ich werde mir vorkommen wie in einem Damenstift. Kein Kaffee und kein Tee?«
»Zurück zu Ihrer Einheit kommen Sie auf keinen Fall.«
»Da habe ich also Glück, was?«
»Wie alt sind Sie?«
»Zweiundvierzig. Warum?«
»Noch etwas jung für zu hohen Blutdruck.«
»Na und?« Er kam sich keinesfalls vom Glück begünstigt vor.
Einerseits freute es ihn wegzukommen, aber ebensosehr drängte es ihn zu bleiben. Nur Versager waren untauglich für die Front.
Er schämte sich, er empfand Schuldgefühle, weil er zurückgeschickt wurde. Das geht uns allen so, dachte Winch, egal wie krank oder wie schwer verwundet wir sind. »Wie hat man sich denn diese Krankheit vorzustellen?« fragte er.
Es stellte sich heraus, daß man die Krankheit nun so genau auch wieder nicht kannte. Der Verlauf war nicht exakt vorherzusagen. Man konnte schon anderntags einen Herz- oder Schlaganfall erleiden, konnte aber ebensogut achtzig werden. Bei Winch könnte der erhöhte Blutdruck etwas mit ständigem unmäßigem Alkoholgenuß zu tun haben, meinte der Oberstabsarzt. Und mit übermäßigem Rauchen. Immerhin hatte die Forschung in letzter Zeit recht interessante neue Ergebnisse über die Wirkungen von Alkohol erbracht.
»Das ist ja ein schlechter Witz«, bemerkte Winch verbittert.
Das heiße nicht, daß er Winch als Alkoholiker betrachte, versicherte der Arzt. Ein Alkoholiker wäre nie und nimmer imstande, Winchs Arbeit zu tun. Aber immerhin sei er dafür bekannt, daß er eine Menge vertragen könne. Wieviel er denn nun wirklich durchschnittlich am Tage trinke?
»Naja, märchenhafte Quantitäten eben«, sagte Winch boshaft.
»Wieviel genau? Eine halbe Flasche? Eine ganze?«
»O ja, mühelos.«
»Vielleicht anderthalb?«
»Wenn ich so viel kriegen kann, allemal.« In Wahrheit wußte er nicht, wieviel er trank.
Und wieviel er rauche? Täglich zwei Päckchen Zigaretten? Drei? Aber wie dem auch sei, sobald man sein Fieber unter Kontrolle gebracht habe, müsse er damit rechnen, daß der Blutdruck merklich ansteige.
Darauf nickte Winch nur. Zum ersten Mal spürte er so etwas wie Resignation. Er kam sich vor wie jemand, der sich zehn Stockwerke über der Straße an einen Fenstersims klammert und spürt, wie die Kraft in seinen Fingern nachläßt. Das war in gewisser Weise geradezu eine Erlösung. So was Ähnliches fühlen wohl alle Krüppel, dachte er.
»Sie wollen also sagen, ich bin erledigt.«
»Ich fürchte, ja. Mindestens untauglich für die Infanterie.«
So war das also. Winch kannte den Arzt seit Jahren und wußte, daß er sein Handwerk verstand. Seine Vorhersage traf dann übrigens prompt ein. Der Blutdruck war gestiegen. Die Ärzte, denen er später in die Hände fiel, machten daraus zwar ein Geheimnis, aber Winch ließ sich nicht täuschen. So war es.
Die Ärzte handelten nach dem Motto: je weniger die Patienten wissen, desto weniger werden sie sich ängstigen. Winch schätzte diese Medizinmänner nicht sehr. Und darum kam er auf den Gedanken, sich von Dr. Harris, bevor er endgültig heimgeschafft wurde, noch einmal genau ins Bild setzen zu lassen.
Er erfuhr, daß der ihn erwartende Herztod meist zwischen fünfzig und sechzig Jahren eintritt, vorausgesetzt, er erlitt bis dahin nicht einen Schlaganfall oder eine Herzattacke. Es gab aber auch zahlreiche Fälle, in denen Patienten wie er alt wurden mit dieser Krankheit. Die Kongestionen entwickelten sich im Laufe von Jahren, sie schwächten das Herz, vergrößerten es, der Puls beschleunigte sich. Das führte im Laufe der Zeit zur Bildung von Ödemen, und im letzten Stadium griffen diese auf die Lungen über, die sich mit Flüssigkeit füllten. In fünfzig Prozent der Fälle trat der Tod auf diese Weise ein. Eigentlich war es weniger eine Krankheit als ein Zustand – und als solcher eben unheilbar. Immerhin gab es Leute, die nur Monate damit lebten, während andere Jahrzehnte vor sich hatten.
»Merken Sie sich: wenn Sie sich in acht nehmen, können Sie damit alt werden«, versicherte Harris.
Winch hörte ihm aufmerksam zu. Das tut wohl jeder, dachte er, wenn es um die Prognose der eigenen Krankheit, um die eigene Diagnose geht. Nur kommt man sich dabei recht sonderbar vor. Man fühlt sich wie der arme Sünder, den der gestrenge Richter, nachdem er zuvor gut gefrühstückt hat, zu einer ungeheuerlichen Strafe verdonnert, weil man irgendwas ausgefressen hat – was, weiß man nicht mal mehr genau.
»Leben Sie enthaltsam«, riet Harris.
»Enthaltsam?« fauchte Winch. »Na ja, wenn Sie meinen. Also schön, Sie haben mir alles genau erklärt, ich habe alles gut verstanden, und jetzt schlage ich Ihnen vor: vergessen wir das alles, schreiben Sie mich dienstfähig, und schicken Sie mich zurück zur Kompanie. Wie wäre das?«
»Ausgeschlossen«, sagte Harris verärgert. »Sie wissen genau, daß ich das nicht tun kann. Übrigens verstehe ich Sie nicht. Andere wären froh, wenn sie mal Ferien machen dürften. Ihre Kameraden würden mit Freuden den linken oder rechten Arm hergeben, um in die Heimat zu kommen.«
»Schon, schon«, gab Winch zu.
»Sie haben daheim doch Frau und Kinder?«
»Hab’ ich wohl. Irgendwo.«
»Sie wissen nicht mal, wo?«
»Doch, doch. Soweit ich weiß, wohnen sie in St. Louis.«
»Ich verstehe Sie wirklich nicht.«
»Dabei ist es gar nicht schwer, mich zu verstehen«, sagte Winch. Er stand auf. »Das ist also wirklich Ihr allerletztes Wort?«
»Ich fürchte, ja.«
Winch machte genüßlich eine stramme Ehrenbezeigung und eine Kehrtwendung. Danach sah er Dr. Harris nicht wieder. Tags darauf wurde er mit einer Lazarettmaschine nach den Neuen Hebriden ausgeflogen.
Auf dem Schiff herrschte zwar allgemeine Aufregung, die Dieselmotoren tuckerten aber im immer gleichen Rhythmus. Die durch das Insichtkommen der Küste ausgelöste Unruhe war aber trotzdem nicht zu überhören. Er blieb liegen, auf einen Ellenbogen gestützt, und starrte über den Korridor in den Salon, wo die Schwerverwundeten lagen, die auf diesem schwimmenden stinkenden Viehtransporter nach Hause geschafft wurden.
Warum hatte Harris ihn damals so sonderbar angesehen? War ihm etwa nie zu Ohren gekommen, daß es Männer gab, die ihre Frauen und Kinder satt bekamen und auf und davon gingen? Was dieser Harris wohl für ein Privatleben führte? Bestimmt hatte er eine Frau, die sich bemühte, es dem Herrn Oberstabsarzt recht angenehm zu machen. Er sah seine dickärschige Frau vor sich, samt den zwei blonden Bälgern, die er ihr gemacht hatte, verdrängte dieses Bild aber rasch aus seinem Bewußtsein. Wenn er es vor sich sah, befiel ihn unweigerlich Wut. Die Frau und diese Kinder, die ihr wie aus dem Gesicht geschnitten waren, lockten ihn nicht die Spur. Vermissen tat sie ihn bestimmt nicht. Sie war schon früher bei jeder sich bietenden Gelegenheit fremdgegangen, in den entlegenen Garnisonsstädten, wo er stationiert gewesen war. So war das nun mal, wenn man die Tochter eines Sergeanten heiratete, die man in einer stinklangweiligen Garnison am Ende der Welt kennenlernte. Sie bezeichnete sich gern als statuenhaft, und die Kinder sahen ihr immerhin so ähnlich, daß sie mit den Vätern, wer die nun auch sein mochten, keinerlei Ähnlichkeit aufwiesen. Allerdings hielt er sich selber für den Vater. Meistens jedenfalls. Darauf kam es aber gar nicht an. Es wäre ihm recht gewesen, sie nie mehr wiederzusehen.
Jetzt schob sich ein Kopf in den Türrahmen, und Augenschlitze wie die eines Scharfschützen richteten sich auf Winch. Der Durchblick in den Salon wurde ihm solcherart verwehrt.
Winch stellte sich blitzartig auf den zwischen ihm und seinem Furier seit Jahren üblichen Umgangston ein, der bereits zu einem Ritual erstarrt war. »Hau ab, Johnny Strange«, sagte Winch. »Schleich dich. Los, mach schon. Geh an Deck und spiel mit den anderen Kindern.«
Der Kopf, bislang um neunzig Grad geneigt, richtete sich auf, und darunter kam ein Körper zum Vorschein, bedächtig, so langsam, wie John Strange grinste. Auch sein Gesicht verzog sich ganz allmählich. Strange führte alle Bewegungen sozusagen mit Verzögerung aus. Für den Körper waren die Beine etwas zu kurz geraten, und das gab ihm ein sonderbares Aussehen. Seine rechte Hand baumelte nutzlos in Höhe des Oberschenkels, die Finger zu Klauen gebogen.
»Mach schon, Strange«, wiederholte Winch. »Wir haben uns nichts mehr zu erzählen. Deine Geschichten kenne ich schon alle, und sie langweilen mich zu Tode.«
Strange nickte voller Hochachtung. »Ich habe mir schon gedacht, daß du nicht an Deck gehst.«
»Was soll ich da?« knurrte Winch.
»Ich war eine Weile oben«, gestand Strange und blickte etwas beschämt drein. »Hübscher Anblick.« Er bewegte langsam den Kopf. »Da schreien sie nun wie die Irren da oben.«
Stranges Grinsen wirkte abschreckend, verzerrt. Sein breites bäuerliches Gesicht zeigte meist den Ausdruck des Farmers, der mit dem Universum Geduld hat, eine bekümmerte Geduld. Im übrigen verliehen ihm die buschigen, über der Nasenwurzel zusammengewachsenen Brauen, die das obere Drittel seines Kopfes wie eine Barriere aus Haar abteilten, einen wütenden Ausdruck.
Nur wer Strange kannte, hätte sagen können, daß er jetzt wohlwollend grinste und nicht boshaft. Die Angehörigen seiner Kompanie hatten bald genug gemerkt, daß er zu den Leuten gehörte, die gern bellen, nichtsdestoweniger aber auch beißen, und zwar höchst schmerzhaft.
»Wie geht’s denn immer, Spieß?« fragte er jetzt.
»Besser als dir jedenfalls«, entgegnete Winch. Er hatte niemandem von seinem hohen Blutdruck erzählt, und Strange ahnte gewiß nichts davon. »Und nenn mich nicht Spieß. Ich bin kein Spieß mehr, sondern genau wie du ein Kranker auf dem Transport in die Heimat.«
»Trotzdem, den Dienstgrad hast du noch und die Löhnung auch.«
»Arschloch.«
»Schon recht.«
»Wir verstehen uns?«
»Ich wollte mal nach Bobby Prell sehen«, fuhr Strange leiser fort.
Dazu sagte Winch nichts.
»Kommst du mit?«
»Nein.«
Strange richtete sich auf. »Geh’ ich eben allein.«
»So ein Idiot. Hätte er nicht den Helden gemimt, läge er jetzt nicht da drüben.«
»Manche müssen eben den Helden spielen«, gab Strange zu bedenken. »Und im Moment geht es ihm bestimmt dreckig. Von den Ärzten hört man, daß er wahrscheinlich ein Bein abgenommen kriegt. Richtig gehen kann er dann nie mehr.«
»Egal, was sie mit ihm machen, er ist selber dran schuld«, versetzte Winch, ohne zu zögern.
»Er gehört immer noch zur Kompanie.«
»Diese ganze Scheiße hat doch nun endlich aufgehört! Kriegst du das nicht in deinen Dickschädel, Johnny Strange? Sind alle Texaner so bekloppt?«
Strange grinste. »Nicht alle. Nur bei mir da dauert’s ’ne Weile. Also – kommst du nun mit?«
»Nein.«
»Mach, was du willst. Du bist ein elender Rohling. Gerade eben noch hab’ ich jemand gesagt, was für ein Rohling du bist.« Er verzog die Lippen. »Dabei wollte ich was zu trinken mitbringen für dich, weil wir doch sozusagen die Heimat in Sicht haben. Aber offenbar hab’ ich die Flasche vergessen.«
Winch sah ihn scharf an, dann schob er Strange seinen Kleiderbeutel hin, aus dem Handgelenk, wie man einen dicken Briefumschlag über die Tischplatte segeln läßt. Strange bekam ihn mit seiner unverletzten Hand zu fassen.
»Schönen Dank auch, Spieß!« Und er salutierte Winch übertrieben höflich mit der Flasche, bevor er sie ansetzte. Die Flasche hielt er mit den klauengleichen Fingern der rechten Hand, die er offenbar nur mit Mühe bewegen konnte.
Nach einem prüfenden Blick auf die Flasche reichte er sie zurück.
»Viel ist nicht mehr drin, Spieß. Falls du was brauchst – wende dich nur vertrauensvoll an den alten Strange.«
»Ich sollte Schnaps brauchen?« Winch schüttelte die Flasche. »Das soll wohl ein Witz sein? Mann, ich kriege jede Menge Schnaps, wenn ich will.«
»Du könntest ja auch mal was anderes wollen.«
»Meinst du etwa einen alten Kumpel? Mann, Mann, du hast nicht alle Tassen im Schrank. Ich, in meinem Alter?«
»Kann man nie wissen.« Der Furier deutete einen Gruß an mit der verkrüppelten Hand. Ein trüber Scherz. Dann ging er über den Korridor, hinein in den Salon.
Winch starrte ihm nach, dann legte er sich zurück. Hätte Winch zu Heldenverehrung geneigt, Strange wäre sein Vorbild gewesen. Was er an diesem bewunderte, war, daß Strange sich wirklich und wahrhaftig aus nichts etwas machte. Die anderen, Winch nicht ausgenommen, taten zwar ebenfalls, als machten sie sich aus nichts was, doch stimmte das eben nicht. Nur Strange, dem war alles egal, das Militär, sein Job, die Kameraden, Weiber, das Leben, der Erfolg, die Menschheit. Strange tat so, als nähme er Anteil, aber in Wahrheit war ihm alles einerlei. Er war absolut allein mit sich selber und zufrieden dabei. Und eben das bewunderte Winch an ihm. Er langte unter die Koje und kitzelte den Hals der Flasche in seinem Kleiderbeutel. Ulkig, daß Schnaps und Sex irgendwie zusammengehörten. Insbesondere wenn einem der Schnaps verboten war. Heimlich verbotenerweise zu trinken war ebenso aufregend und auf genau die gleiche Weise aufregend, wie eine Frau zu lecken. Morgen. Morgen würde er mit dem Trinken aufhören.
Plötzlich dachte er an seinen Vertreter, den Sergeanten, der an seiner Stelle jetzt für die Kompanie verantwortlich war. Würde er mit dieser Horde zurechtkommen?
Halb dösend und geplagt von einer nagenden Verzweiflung, die inzwischen nicht mehr unerträglicher war als mäßige Zahnschmerzen, stellte Winch sich die Idioten vor, die da oben an der Reling standen und eine Küste beglotzten, von der sie sich in ihrer Dummheit himmlische Genüsse versprachen.
3
Es erging übrigens allen auf dem Transport in die Heimat befindlichen Kranken und Verwundeten so, daß der Anblick der amerikanischen Küste sie in einen inneren Tumult stürzte, denn kaum einer von ihnen hatte ernstlich daran geglaubt, daß er diese Küste tatsächlich je wieder betreten würde. Indessen, zur vorausberechneten Zeit stieg sie über dem Horizont herauf, bläulich, im Osten, ganz wie angekündigt.
Das Lazarettschiff, das eine schwarze Wolke Dieselqualm hinter sich herzog, war auf dem sanft von der langen Dünung bewegten Wasser weit und breit das einzige Lebendige. Das weiße Schiff mit den großen roten Kreuzen an den Bordwänden zog gemächlich über die glatte See, die augenscheinlich ein ganz eigenes Leben hatte und mit dem Schiff nichts zu schaffen haben wollte. Dieses pflügte sich voran. Das Wasser glänzte, hin und wieder warf es gar winzige Schaumkrönchen auf, die im Sonnenlicht glitzerten.
Am östlichen Horizont erschien und verschwand wie eine Fata Morgana ein blauer Streifen, wolkengleich, nur eine Spur dunkler als der Himmel. Das war die Heimat. Die Nachricht davon überzog das Schiff wie mit einer Gänsehaut. Je näher das Schiff kam, desto mehr verfestigte sich der blaue Streifen über der Wasserlinie und verschwand nun nicht mehr, während man hinstarrte.
Von den Männern an Bord waren fast alle seit mehr als einem Jahr oder länger nicht in der Heimat gewesen. Heimat. So wie sie einander dieses Wort zuflüsterten, zeugte es mehr von Angst, ja Verzweiflung, als von freudiger Erwartung, von Hoffnung auf Erlösung. Wie würde die Heimat sein? Wer würden sie selber sein in dieser Heimat?
Auch in diesem Fall erwartete man, daß alles sein würde wie immer: Man hatte ihnen gesagt und sie hatten am Schwarzen Brett gelesen, daß sie in die Heimat verlegt würden, doch Ankündigungen, ob mündlichen oder solchen an Schwarzen Brettern, trauten sie längst nicht mehr, denn die dienten vornehmlich zur Stärkung der Moral der Truppe und hatten mit der Wirklichkeit wenig zu tun. Die Moral war selbstverständlich immer und überall gut, schlecht durfte sie nun mal nicht sein, aber was speziell diese Verlautbarung betraf, wußte man eben nicht: diente sie zur Stärkung der Moral, oder war wirklich damit zu rechnen, daß dieser bläuliche Streifen Küste je in Sicht kommen würde?
Übrigens war sie keineswegs von überall auf dem Schiff zu sehen, vielmehr konnte man sie nur vom Bug und von den Oberdecks her ausmachen. Für die Mannschaften war aber nur das ehemalige Promenadendeck zugänglich, und dort drängte sich denn auch alles, was gehen konnte und sehen wollte.
Einen traurigen Anblick boten sie, diese Gestalten in grauen Schlafanzügen und kastanienbraunen Lazarettschlafröcken, flache Pantoffeln an den Füßen, die man immer wieder verlor. So drängten sie sich durch die Aufgänge an Deck, gegen die Reling oder gegen Kameraden, die bereits einen Platz an der Reling ergattert hatten. Da hasteten und taumelten sie die Treppen herauf, unsicher auf den Füßen, mager und abgezehrt, mit gelb verfärbten Augen, durcheiterten Verbänden und Gipsen, humpelnd, einander stützend. Ein jammervolles Schauspiel. Dabei waren sie von allen Verwundeten noch am besten dran. Sie galten als so schwer versehrt, daß es gerechtfertigt war, sie in die Heimat zu schicken.
Manche weinten, andere lachten, klatschten in die Hände, schlugen einander gegenseitig auf die Schulter. Alle blickten einander voll ängstlich gespannter Erwartung an. Weil sie so unverschämtes Schwein gehabt hatten. Angst, die sie zu verbergen trachteten und die doch in ihren Augen zu lesen stand, ließ erkennen, daß sie keinen Anspruch darauf zu haben glaubten, die Heimat wiederzusehen.
Unten, auf dem ehemaligen Arbeitsdeck der Besatzung, standen Matrosen und Lazarettpersonal beisammen, lauter Menschen, die dafür angestellt waren und bezahlt wurden, daß sie der stets wachsenden Menge menschlichen Abfalls, die der Krieg erzeugte, ihre Dienste erwiesen, diesem Abfall, der sich da oben drängte, den Hals verdrehte wie Truthähne, sich nach vorn schob, um einen Blick auf die Heimat zu erhaschen, für die keiner von ihnen sein Leben hatte lassen müssen, wie jedem einzelnen nun freudig klar wurde.
In seiner Kajüte unter Deck bemühte Marion Landers sich derweil, der Versuchung zu widerstehen, an Deck zu gehen, doch gelang ihm dies nicht. Er ließ sich aus seiner Koje rollen und stellte sich mühsam auf die Füße, was nicht einfach war, weil sein rechtes Bein bis zum Knie eingegipst war. Er fand es aber einfach unmöglich, sich von der allgemeinen Erregung nicht anstecken und an Deck locken zu lassen.
Landers war Kompanieschreiber gewesen im Rang eines Unteroffiziers, daher hatte man ihn in eine Innenkajüte verwiesen, er verfügte nicht wie Winch und Strange über ein Bullauge. Er hatte sich unterdessen an das Dasein in dem fensterlosen Raum bei matter elektrischer Beleuchtung gewöhnt. Jetzt tastete er nach der Sonnenbrille unter seinem Kopfkissen.
Daß er dabei stöhnte, hatte nicht so sehr mit seiner Verwundung zu tun, denn die verursachte ihm keine Schmerzen mehr, vielmehr war es die Folge der Unbequemlichkeit, die ihm das Gipsbein verursachte. Damit konnte man einfach weder bequem liegen, noch sitzen oder stehen.
In der winzigen Kajüte mit ihren sechs Kojen lag außer Landers derzeit nur der junge Bordschütze von der Luftwaffe, der eben wieder einen Weinkrampf gehabt hatte, diesmal ausgelöst durch die Neuigkeit, daß die Heimat in Sicht war. Jetzt hob er den Kopf und fragte klagend:
»Gehst du auch noch weg?«
»Ja, ich gehe mal an Deck, werfe mal einen Blick«, sagte Landers und bemühte sich, seine Gereiztheit zu unterdrücken. Er langte die Krücken vom Garderobenhaken.
»Bitte bleib hier.«
Landers blieb an der Tür stehen und machte auf seinen Krücken geschickt kehrt. Man gewöhnte sich allmählich an diese elenden Dinger. Nun starrte er den Kleinen an.
So ein jämmerliches Bürschchen gibt es bestimmt in jeder Kajüte, dachte Landers, das ist ein Kreuz, das man tragen muß. In jeder Kajüte entstand über kurz oder lang eine Hackordnung, und solche Schwächlinge rangierten dabei selbstverständlich zu allerunterst. Und daraus ergab sich ein moralisches Problem. Alle mußten auf diese Typen Rücksicht nehmen, das gehörte sich nun mal so. Das paßte keinem in den Kram, aber wer dazugehören wollte, mußte sich nach den Spielregeln richten. Die Waschlappen konnten daraus Nutzen ziehen, daß man sich an die Spielregeln hielt, und sie taten es auch. Diesen Vorteil gewannen sie daraus, daß sie aufgaben und sich mit der Rolle des Schwächsten abfanden.
Die anderen waren seit einer halben Stunde schon an Deck, und während dieser Zeit war zwischen Landers und dem Bordschützen kein Wort gefallen. Landers war nicht nach einer Unterhaltung zumute, er lag still auf dem Rücken und glotzte an die Decke. Der Jüngling hatte dann angefangen zu heulen, und das war zum Teil die Ursache, die Landers veranlaßte, aufzustehen und hinauszugehen.
»Hör schon auf, Junge«, sagte er darum jetzt.
»Du bist wie die andern«, kam es mit piepsiger Stimme von der anderen Koje her. »Und dabei dachte ich, du bist nicht so. Ich dachte, du bist wenigstens anständig. Du weißt, ich halte es nicht aus, allein gelassen zu werden.«
»Ich sage dem Kajütenjungen Bescheid, der kommt und leistet dir Gesellschaft.« Und nach einer Pause fügte Landers an: »Bestimmt hat der uns allesamt bis obenhin satt.«
»Klar hat er das, du siehst doch, daß er die ganze Zeit Schwänze und Fotzen auf seinen Rezeptblock malt, wenn er hier rumsitzt.«
Landers wünschte sich dringend nach draußen. Ihm war, als müsse er aus der Haut fahren. Es war nicht der Junge, der ihm auf die Nerven ging, sondern irgendwas anderes fraß an ihm, seit er gehört hatte, daß die Küste in Sicht gekommen war. Es war schon schlimm genug, daß man hier zu sechst in einer Kammer hausen mußte, die mal für vier gesunde Personen konzipiert gewesen war, nein, man hatte ihnen auch noch diesen jämmerlichen Jüngling in die Bude gelegt, mit seinen tellergroßen Augen im abgemagerten Gesicht und Wundbrand in beiden Beinen.
Dabei war er ein Held gewesen, einen kurzen Tag lang. Eine fehlerhaft befestigte Bordkanone hatte sich während des Fluges gelöst, war aus dem Turm gefallen, hatte zu feuern begonnen und das Innere der Maschine bestreut wie ein Gartenschlauch. Der Junge hatte sich über die Kanone geworfen und den Abzug gesperrt und dabei vier großkalibrige Geschosse in die Beine bekommen. Als die schwer beschädigte Maschine endlich aufsetzen konnte, hatte der Wundbrand bereits eingesetzt. Man verlieh ihm an Ort und Stelle eine Auszeichnung und brachte ihn an Bord des Schiffes, wo er sich als Heulsuse entpuppte. Der von seinen grünlich verfärbten Beinen ausgehende Gestank war schier unerträglich, und die ebenso kupfergrünen Füße waren bereits verschrumpelt wie die einer Mumie. Er jammerte unentwegt, meist heulte er dabei auch noch, und dieses Häufchen Elend nannte sich Collegeabsolvent! Landers ahnte nicht, durch welches Versehen der Bursche hier an Bord gelandet war. Er gehörte schließlich zur Luftwaffe, und man hätte ihn als Luftfracht in die Heimat transportieren müssen.
»Ich weiß, ich stinke, aber bitte, bleib hier.«
»Ich sag’ dem Kajütenjungen Bescheid«, wiederholte Landers.
»Besten Dank, du egoistischer Lump. Ich hoffe bloß, daß es dir eines Tages genauso beschissen geht wie mir.«
»Nichts zu danken. Selbst wenn dir das einfältig vorkommt, muß ich dich doch darauf hinweisen, daß wir allesamt mit unserem Leben allein fertig werden müssen. Das mußt du endlich mal begreifen. Ich kann dir nicht helfen. Niemand kann dir helfen.«
»Ich will das aber nicht begreifen!« Er begann zu heulen. »Ich will meine Mama.«
Landers fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. »Du wirst von San Diego aus schnurstracks zum Walter Reed Hospital geflogen, und es gibt nirgendwo auf der Welt bessere Ärzte als dort. Falls deine Beine gerettet werden können, dann dort. Deine Mutter erwartet dich da schon, das hat man dir versprochen.«
»Und das glaubst du? Der Arzt hat mir übrigens gestern gesagt, daß es für meine Beine keine Hoffnung gibt«, setzte er winselnd hinzu.
Das war schlichtweg gelogen, wie Landers wohl wußte. »Ich habe davon kein Wort gehört, und ich war bei der Visite anwesend«, sagte er deshalb. Meist machten alle, daß sie aus der Kajüte kamen, wenn die Verbände des Jünglings gewechselt wurden. Landers indessen fühlte sich moralisch verpflichtet, dazubleiben und zu tun, als habe er keine Geruchsnerven, jedenfalls manchmal.
»Doch hat er.«
»Hat er nicht, verflucht noch mal, ich war schließlich hier!«
»Hat er doch. Du hast es bloß nicht gehört. Hör mal, du bist der einzige Mann hier mit Collegebildung, wahrscheinlich überhaupt der einzige auf diesem ganzen Deck.«
»Ich habe alles gehört, was der Arzt gesagt hat. Die Jahre im College haben mir übrigens nichts eingebracht. Nichts jedenfalls, was ich jetzt gebrauchen könnte. Ich schicke den Jungen her.«
Damit schwang Landers sich, auf seine Krücken gestützt, herum und entfloh.
Er kam allerdings nicht rasch genug voran, um nicht mehr zu hören, wie der Jüngling hinter ihm her schimpfte und dann wieder losplärrte. Landers fand, der Junge machte es sich zu leicht, er überschritt die Grenzen des Erlaubten, und jedermann würde ihm, Landers, in dieser Auffassung zustimmen.
Er winkte den Lazarettgehilfen heran, der als Kajütenjunge Dienst tat und widerwillig sein Comic-Heftchen aus der Hand legte. Danach machte er sich an den schwierigen Aufstieg die steile eiserne Treppe hinauf. Für einen Mann an Krücken war das nicht ungefährlich.
Landers erreichte das langgestreckte verglaste Hauptdeck. Dessen Vorderteil war nicht offen wie das des Promenadendecks, und deshalb hielt sich hier jetzt kaum jemand auf. Meist saßen über die ganze Länge des Decks verteilt kleine Grüppchen beim Poker. Landers trat an ein geöffnetes Fenster und hielt den Kopf in die Brise.
Eine Weile empfand er die kühle Luft als ausreichend. Selbst die Seeluft brauchte eine Weile, um den Gestank zu vertreiben, der einem in Nase und Rachen saß. War er gegen den Jungen von der Luftwaffe nicht doch zu grausam gewesen? Wie weit reichte eigentlich die Verantwortung, die man für seine Mitmenschen trug?
In Wahrheit war es aber nicht dieser Jüngling gewesen, der ihn an Deck getrieben hatte, sondern etwas anderes. Bei der Nachricht, die Heimatküste sei in Sicht, hatte ihn eine scheußliche Depression befallen. Das schlimmste war, daß er deren Ursache nicht kannte. Und daß sie ihn ganz unerwartet überfiel. Noch gestern hätte er seinen gesamten noch ausstehenden Sold gewettet – eine erhebliche Summe –, daß diese Neuigkeit ihn mit Freude erfüllen würde.
Jetzt stierte er auf die undeutlich sichtbare ferne Küstenlinie. Von wo er stand, konnte er sie nur unscharf ausmachen. Jetzt bog sie sogar nach Süden und wurde für ihn unsichtbar. Da packte ihn das Gefühl, ausgeschlossen zu sein, so heftig, daß er am liebsten laut geschrien hätte. Was war das doch für ein riesenhaftes Land. Dies wurde ihm jetzt zum ersten Mal bewußt; es versetzte ihm einen Schock, daß er erst jetzt deutlich sah, was er schon immer gewußt, sich aber nie klargemacht hatte. Dieses Land war so riesig, daß man nichts dafür empfinden konnte. Dabei hatte man ihm doch von Kindheit an eingeprägt, daß nichts so wichtig sei, wie Anteil zu nehmen, woran auch immer.
Für den einundzwanzig Jahre alten Landers gab es in diesem Lande mit Gewißheit keinen Platz, nicht für den Landers, der jetzt aus dem Bullauge dieses großen Schiffes auf die Küste starrte. Dieses Schiffes, das eine ganze Ladung Menschenfleisch transportierte. Das machte ihm Angst, eine Angst, die er bis in die unzugänglichste Tiefe spürte. Zugleich quälte ihn wie ein vom Kontrabaß gespieltes Gegenthema der Gedanke, daß er es nicht verdiente, in die Geborgenheit zurückzukehren.
Zwei Männer, die auf dem Promenadendeck gewesen waren, gingen an ihm vorüber. Einer hatte das Bein in Gips und setzte es bei jedem zweiten Schritt mit einem metallischen Klirren auf die Decksplanken.
Ihre Anwesenheit störte Landers in seiner Versunkenheit.
»Na, Landers?« fragte einer, »denkst du schon an die einheimischen Fotzen, die wir demnächst aufspießen werden?«
Landers wehrte stumm ab. Er traute sich nicht zu sprechen. Er bemerkte, daß der andere Mann einen rechtwinklig vom Körper abstehenden Gips trug. Es schien ihm auf diesem Schiff besonders viele Verwundete zu geben, die entweder im Bein oder in den Schultern Schußbrüche hatten, aber vielleicht lag es nur daran, daß deren Gipsverbände besonders auffielen? Die Männer gingen weiter.
Die Küste wurde nicht deutlicher und schien nicht näher zu kommen. Jedenfalls dem unbewaffneten Auge kam es so vor. Das war eine Täuschung.
Die schwache Dünung wiegte das Schiff nur unmerklich. College? Lieber Himmel.
Landers war auf New Georgia nicht nur verwundet worden, zugleich mit dem Granatsplitter hatte noch etwas anderes ihn getroffen, aber was, das war schwer auszumachen. Die Verwundung war nichts Besonderes gewesen. Eine schwere Werfergranate war in seiner Nähe eingeschlagen, er war hochgeschleudert worden und bewußtlos gewesen. Das war überhaupt nicht weiter schlimm, er empfand weder Angst noch Schmerzen. Er hatte die Granate kaum heranfauchen gehört. Schon hüllte ihn summende Schwärze ein. Falls er überhaupt etwas gedacht hatte, dann vielleicht: »Na, so schlimm ist das ja gar nicht …«
Damit hatte er wohl das Sterben gemeint. Jedenfalls war darin eingeschlossen die Vorstellung, er werde niemals wieder das Bewußtsein erlangen. Er kam aber wieder zu sich, benommen, unfähig, einen Gedanken zu fassen, mit blutender Nase und schwerem Kopf. Sein Helm war verschwunden, am Kopf blutete er. Entgegen den Grundsätzen der Ersten Hilfe hatte ihn jemand umgedreht und versetzte ihm leichte Klapse ins Gesicht. Ein flüchtiger Moment der Angst, eigentlich zum Lachen, da er zwischen den Beinen tastete, ob noch alles vorhanden war. Dann rappelte er sich auf und ging zum Verbandplatz. Dort sagte ihm der Unterarzt, er habe eine leichte Gehirnerschütterung erlitten und brauche zwei Tage Ruhe. Erst als er wieder aufstehen wollte, stellte sich heraus, daß sein Fußknöchel zerschmettert war. Vorher hatte er beim Gehen nichts davon gemerkt.
Während er auf den Jeep wartete, der ihn ins Feldlazarett bringen sollte, stieß ihm das Sonderbare zu, das er immer noch nicht erklären konnte. Man hatte seinen Stiefel aufgeschnitten, der voller Blut war, und ihm den Fuß verbunden. Vier Sanitäter hatten ihn auf eine Trage gelegt und diese dort abgestellt, wo schon andere nicht gehfähige Verwundete versammelt waren. Hier hockte er nun, am oberen Rande einer Schlucht, und betrachtete mit den anderen das Gefecht, das sich im Talkessel abspielte, gelassen, beinahe zufrieden.
Landers war damals Melder beim Bataillonsstab. Eigentlich war er Kompanieschreiber und hätte vorn bei den Infanteristen nichts zu suchen gehabt, doch hatte er sich vier Tage zuvor seinen Kameraden da draußen zugesellt und war überraschend vom Bataillonskommandeur zum Melder bestimmt worden, als Ersatz für den, der eben gefallen war. Als die Werfergranate ihn erwischte, war er mit einem Befehl vom Bataillonsstab zu einem der Infanteriezüge unterwegs, die da vorne lagen.