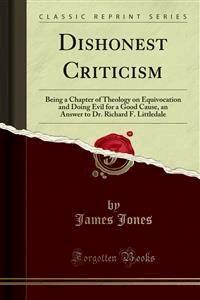11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Vor der Kulisse einer idyllischen Insel im griechischen Archipel, Sommertraum gammelnder Hippies und abgetakelter Aristokraten, verdüstern zwei Morde den Touristenhimmel. Privatdetektiv Lobo Davies entwirrt die turbulente Handlung. Mit der Kraft eines Dickhäuters, den nichts umschmeißt, und dem Charme eines Humphrey Bogart schlägt er sich durch alle Hinterhalte und Prügeleien hindurch, um am Ende dem Mörder und einem gefährlichen Ring von Heroindealern das Handwerk zu legen. Und wenn er nicht gerade auf Jagd ist, zeigt sich Lobo Davies als echter Held von James Jones: empfänglich für die weiblichen Reize der süßen Marie und der Baronin Chantal sowie für den Zauber der Tiefsee. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 512
Ähnliche
James Jones
Das Sonnenparadies
Roman
Aus dem Amerikanischen von Emil Bastuk
FISCHER Digital
Inhalt
Würde doch unter Göttern und Menschen die Zwietracht vertilget,
Und der Zorn, der auch die Herzen der Weisen empöret!
Süßer scheinend im Anfang als niederträufelnder Honig
Steiget er, wallend wie Rauch, empor im Busen der Menschen.
HOMER, ILIAS. ACHTZEHNTER GESANG, V. 107–110.
Übers. Christian und Friedrich Grafen zu Stolberg
Für Gloria,
jung und schön,
den erprobten Kampfgefährten
1
Das Taxi brummte auf seinem Weg vom Athener Hilton zum Hafen durch die letzte Kurve der neuen Straße und bremste am Bordstein wie ein erschreckter Fußballer an der Seitenlinie: die Stollen nach oben. Beinahe brach ich mir die Halswirbel. Die bereits reichlich eingebeulten Radkappen knirschten an der schlecht gegossenen Betonkante entlang, und bevor der Wagen zum Stehen gekommen war, sprang der spitzbäuchige, schnurrbärtige Fahrer hinaus, um armewedelnd zum Anleger zu rennen, wo etliche uniformierte Gestalten sich wichtig machten.
Unbedachterweise hatte ich etwas von Eile gesagt, also erweckte er nach Kräften den Eindruck, er allein halte noch im letzten Moment das Schiff zurück – um so größer mußte ja das Trinkgeld ausfallen. Ich packte meinen alten Trenchcoat sowie Hut und Aktentasche und stieg aus. Der Fahrkartenverkäufer reichte mir ein rosafarbenes Ticket nach Tsatsos aus seinem Brutkasten und zählte mir an den Fingern vor, was ich zu zahlen hatte.
Die Ebene von Athen war vom Hitzedunst eingehüllt, und die neuen Gebäude hinter der großen Straßenbaustelle schienen nach Luft zu schnappen. Das kränkliche Gras zu meinen Füßen bedeckte Zementstaub. Athen, das Athen des Sokrates, des Aristophanes und der Jackie Kennedy, war von hier aus nicht zu sehen.
Der Taxifahrer kam zurück. »Alles o.k., Boß!« grinste er. »Ich habe alles erledigt.«
»Nur mein Koffer ist noch in Ihrem Gepäckraum.«
Er riß die Augen auf. Den Koffer hatte er glatt vergessen. Jetzt zerrte er ihn ans Licht, reichte ihn mit großer Geste einem schwankenden Greis mit blauer Schürze und Mütze, der sich den vertrottelten Fremden als Gepäckträger anpries. Ich entlohnte den Taxifahrer, gab ihm ein üppiges Trinkgeld, denn mit Leuten, die so tun, als reißen sie sich für mich ein Bein aus, während sie sich in Wahrheit nicht vom Stuhl bewegen, kann ich nun einmal nicht richtig umgehen. Eigentlich sollte ich als ein einigermaßen abgebrühter und agiler Privatdetektiv das gelernt haben, doch mir ist es bisher nie gelungen. Das ist wohl mit ein Grund, warum ich immer knapp bei Kasse bin.
Ich folgte dem Greis und meinem Koffer zum Schiff in der Hoffnung, er möchte nicht vorher zusammenbrechen. Das Schiff lag mit dem Heck zur Mole, durch eine Gangway aus schwankenden Brettern mit dem Land verbunden. Schiffsoffiziere trieben eine Horde mit Tüten und Pappschachteln beladener Griechen an Bord. Ein Offizier nahm mir den Fahrschein ab, betrachtete ihn und reichte ihn einem Kollegen. Dieser riß nach längerem Hinsehen die perforierte Ecke ab und reichte den Fahrschein einem Dritten. Der musterte den Fahrschein so genau, als halte er Ausschau nach Falschgeld, und gab ihn mir mit einem durchdringenden Blick zurück. So teilten sich drei Leute in eine Arbeit, die nicht einmal einen einzigen Erwachsenen ausfüllen würde. Ich starrte ebenso eindringlich zurück – das waren sie offenbar nicht gewöhnt.
Ich folgte dem Greis über die Gangway und paßte meinen Gang dem Schwanken der Bretter an. Ich machte mir Sorgen um den Alten: Wie es sich am Rande des Zusammenbruches lebt, war mir nicht unbekannt. Immerhin, der Alte taperte ganz rüstig herum, aber er schonte seine Kräfte. Er stellte meinen Koffer an die Reling zu dem Gepäck anderer Reisender. Obstsaft rann aus Papiertüten, schmelzender Zucker tropfte aus Kartons. Auch der Greis erhielt ein übergroßes Trinkgeld. Das mache ich immer so zur Gedächtnisstärkung des Trinkgeldempfängers, damit er sich das nächstemal revanchiert. Leider hat mir diese Großzügigkeit noch nie eine Dienstleistung oder ein Lächeln eingebracht, das über das Übliche hinausging.
Als ich mich endlich durch das Gewimmel von brüllenden Erwachsenen, kreischenden Kindern und kläffenden Vierbeinern zum Speisesaal durchgearbeitet hatte, erwies sich der zwar als recht hübsch, doch bis auf den letzten Platz von Engländern besetzt. In ihren Phantasiekostümen sahen sie aus wie lauter schwule Bühnenbildner. So holte ich mir auf dem Vorderdeck einen rostigen Klappstuhl, baute ihn unter dem Sonnensegel auf und legte die Füße auf die Reling. Nach einem Weilchen heulte die Schiffssirene zweimal auf, und wir legten ab. Hafen und Ebene verschwanden hinter uns im Dunst.
Das also war der Beginn meines Urlaubs, meines vierwöchigen bezahlten Urlaubs! Noch ehe ich an Bord gegangen war, schwante mir, daß ich einen Mißgriff getan hatte. Die Insel Tsatsos war sechs Stunden entfernt.
»Es wird Ihnen großartig gefallen«, hatte Freddy Tarkoff mir versichert. Tarkoff war mein Klient, ein reicher Klient, der mit meiner Arbeit sehr zufrieden war.
»In der Sonne liegen, schwimmen, in der Kneipe herumhocken, mal richtig ausspannen. Sie sind doch scharf auf Unterwasserjagd?«
»Das war ich mal«, erwiderte ich.
»Betrachten Sie es als ein Dankgeschenk, Lobo. Alles ist vorbereitet. Ich habe da unten eine Bekannte, die sich Ihrer annehmen wird. Anders heißt sie, Baronin Chantal von Anders. Haben Sie sich das notiert?«
Irgendwas in seinem Ton gab zu verstehen, daß es sich um mehr als nur eine Bekannte handelte.
»Ich habe sie angewiesen, Ihnen jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Sie hat ein Haus für Sie gemietet und ein Boot, dazu einen Experten mit der Harpune.«
»Schon gut, ich werde fahren.« Es fiel mir nicht leicht, das zu sagen, denn ich bin ein sehr stolzer Mensch.
»Es wird Ihnen bestimmt gefallen.«
Und da war ich also. Unter dem Sonnensegel saßen ein Haufen Hippies, Amerikaner die meisten, doch auch einige Engländer darunter. Kaum lag die Küste hinter uns, brachten sie ihre Gitarren zum Vorschein, dazu gut fünfzig Flaschen billigen Rotwein. Sie besoffen sich planmäßig an ihren Songs und dem Wein und hielten sich damit alle übrigen Passagiere vom Leibe. Neben diesen Hippies kam ich mir ungeheuer alt vor. Ich hörte, daß auch sie nach Tsatsos reisten, und richtete mich auf sechs Stunden in ihrer geistsprühenden Gesellschaft ein. Übrigens hatte ich für sechs Stunden reichlich zu denken. Tarkoffs Auftrag. Mein bisheriges Leben. Meine kürzlich erfolgte Scheidung. Lauter unerquickliche Gedanken. Tarkoffs Auftrag hatte mich nicht halb so gefreut wie meinen Klienten; auch mein Leben mißfiel mir, aber wie ich davon etwas ändern könnte, fiel mir nicht ein; und bei der Scheidung wußte ich nicht: Freute sie mich oder nicht? Mit Tarkoff war ich schon fast befreundet. Er kannte mich gut. Und vermutlich hatte er darum diesen Ausflug für mich organisiert. Daß jemand mich so genau kannte, paßte mir gar nicht.
Ich genoß ein Weilchen den Anblick des Meeres, dann besorgte ich mir mittschiffs an der Bar einen großen Whisky und setzte mich wieder auf meinen Stuhl. Wie die meisten Amerikaner aus dem Landesinnern habe ich eine sonderbare Liebe zum Meer. Widerstandslos ließ ich mich von den Hippies, die sich mehr und mehr ausbreiteten, näher zur Reling schieben, und ich legte die Füße hoch.
Die Sonne verwandelte die Oberfläche des Wassers in gehämmertes Silber, und die Verdunstung war so stark, daß die Luft einen Hauch von Opal gewann, der sich rosig über die vorübergleitenden Inseln und Schiffe legte. Die Schiffsmotoren stampften munter, und ich. nippte an meinem Whisky. Reichlich Zeit, auch später noch an Unangenehmes zu denken. Damit eilte es nicht.
Ich ließ mich vom Stampfen der Maschine einlullen. Das war ein Fehler. Ich hätte mir eine Rettungsboje schnappen und über Bord springen oder einen vorbeikommenden Frachter anhalten sollen – ich hätte unbedingt ins Hilton und zum Flugplatz zurückkehren müssen.
2
In den folgenden sechs Stunden kamen wir an etwa zwanzig Inseln vorbei, und an sieben legten wir an. Ringsum ragten schroffe blaue Vorgebirge auf. Ohne Karte konnte man unmöglich die Inseln von Festland unterscheiden. Zweimal ließ ich mir Whisky nachfüllen. Das Glas war schmierig, aber der Alkohol würde es schon sterilisieren.
Schließlich steuerte das Schiff einen schwarzen Landrücken an, der mich an einen Buckelwal erinnerte. Hinter mir verstauten die Hippies ihre Gitarren und schmissen Butterbrotpapiere und leere Weinflaschen über Bord. Ich sah ihnen dabei zu. Gerade eben hatten sie sich noch über Umweltverschmutzung aufgeregt.
Tsatsos ist auffallend grün, sonst ist das Land karg und öde. Alle Griechen, denen ich begegnete, versicherten mir, nicht die Griechen hätten Griechenland abgeholzt, sondern die Türken. Wer es auch getan haben mag, hat gründliche Arbeit geleistet. Nur Tsatsos ist offenbar übersehen worden.
Als wir uns näherten, hob sich auf dem Küstenstreifen die einzige Ortschaft kalkig weiß von dem grünen Hintergrund ab. Ein ältlicher englischer Pensionär, wohl ehemals Kolonialoffizier, erklärte mir, die weißen Punkte auf den Bergen seien orthodoxe Kirchen, und eine jede stehe am Ort einer alten heidnischen Kultstätte.
Am östlichen Ende des Städtchens erhob sich ein schwarz-weißer Leuchtturm wie eine Spindel. Das westliche Ende wurde von einer weniger reizvollen Landmarke bezeichnet: Ein geschmackloser Narr hatte den vorspringenden Küstenstrich mit modernen Ferienwohnungen verbaut und vorzeitig aufgegeben. Da standen also die unfertigen Appartements auf ihren dünnen Betonstelzen und schauten bedrohlich auf die Häuser hinunter. Die meisten zeigten unverputzte Backsteinwände und leere Fensterhöhlen, das Ganze war ein jammervoller Anblick.
Darunter erkannte ich ein modernes Luxushotel für den Massentourismus, komplett mit üppigen Gartenanlagen für die Gäste.
Neben mir deuteten zwei amerikanische Hippiemädchen auf die Neubauruinen und kicherten. Offenbar war das ihr Reiseziel. »Da, das ist die Baustelle!« flüsterte die eine der anderen ins Ohr.
Die Sirene unseres Schiffes tutete einmal lang, dann drehte die Schraube rückwärts, und wir glitten auf die Betonmole zu, die hier zugleich als Wellenbrecher diente. Niemand holte mich vom Schiff ab. Falls die Baronin beauftragt war, mich abzuholen, schwänzte sie bereits jetzt ihren ersten Auftrag. Meine Depression kehrte zurück. Ich nahm den Koffer auf und sah mich nach einer Taxe um.
Es erwies sich, daß keine Autos auf der Insel geduldet wurden, statt dessen gab es zweirädrige Kutschen von der Art, die man im 19. Jahrhundert Cabriolet nannte. Und auf dem Platz nahe der Mole standen auch eine ganze Menge davon herum.
Die kleine Stadt strahlte so hell erleuchtet wie ein Raketenstartplatz beim Countdown, und es herrschte eine Stimmung wie im Fasching, denn die Hochsaison hatte begonnen. Touristen und sehr viele Hippies schlenderten umher. Oberhalb des durch den Wellenbrecher geschützten Hafens zog sich eine Mauer hin, die von Bäumen überragt wurde, in deren Schatten sich Terrassencafés angesiedelt hatten. Unter den Zweigen hingen bunte Glühlampen.
Zum Glück wußte ich, wie die Frau hieß, in deren Haus ich wohnen sollte; als ich sagte: »Zum Haus von Mrs. Georgina Taylor«, nickte der Kutscher, dann lachte er boshaft, ohne sich näher zu erklären. Dieses Lachen gefiel mir nicht.
Bis auf die Gegend unmittelbar am Hafen erloschen jetzt die Lichter des Städtchens. Wir rollten in östlicher Richtung dem niedlichen Leuchtturm zu, entlang der Kaimauer; hier flanierten wiederum eine Menge Hippies. Wir umrundeten einen Küstenvorsprung und sahen uns plötzlich vor dem Leuchtturm, dem Jachthafen und den Lichtern einer Taverne.
Der Leuchtturm stand am Ende einer gekrümmten Landzunge, an deren Anfang die erhellte Taverne lag, zwischen uns und der Landzunge schaukelten sanft kleine Boote und fünf Jachten im stillen Wasser. Der Kutscher hielt beim letzten Haus vor der Taverne; beide Gebäude trennte steiles, unbebautes Gelände. Haus Taylor lag am Hang und war von einer Mauer umgeben, in der ich eine Tür mit verblichenem blauem Anstrich ausmachte.
»Haus Georgina Taylor«, sagte der Kutscher.
Ich hielt ihm eine Handvoll Geld hin, er sollte sich einen angemessenen Betrag nehmen, und natürlich haute er mich übers Ohr. Ich machte die Gartentür auf. Dahinter war es dunkel durch den Schatten einiger kümmerlicher Bäume. Ein Pfad führte den Hang hinauf, über eine weitere, hier oben den Hang querende Straße, an ein zweites verwaschen blaues Gartentor, über dem eine Schiffsglocke hing. Im Haus war kein Licht zu sehen, allerdings war eine Art Souterrain beleuchtet, und davor brannte qualmend eine Petroleumlampe. In dieser trübseligen Beleuchtung saßen auf Gartenmöbeln zwei Männer und zwei Frauen, und einer der Männer näherte sich mir auf dem Kiesweg.
Er sei, so eröffnete er mir, Con Taylor, Hauseigentümer und Ehemann der Georgina Taylor. Man erwarte mich seit Ankunft der Fähre und habe bereits vermutet, ich hätte das Schiff verpaßt. Ich erwiderte: »Ich habe mir erst eine Kutsche suchen müssen«, und er schmunzelte.
»Chantal hat Sie also nicht abgeholt? Nun, macht nichts, sie ist gelegentlich zerstreut.«
Er sei Mediziner, arbeite in Athen, in einem großen Forschungslabor, und müsse auch mit dieser Fähre zurück nach Athen fahren. Er sprach ein fast perfektes Englisch. Der Name Taylor klingt englisch oder amerikanisch, doch dieser Bursche war Grieche. Später erfuhr ich, daß einer seiner Vorfahren, ein romantischer Engländer, mit Byron nach Griechenland gekommen war und in eine griechische Familie eingeheiratet hatte.
Er machte mich mit den anderen bekannt. Georgina Taylor, unverkennbar eine Engländerin mit ungewöhnlich runden Augen, war groß und trug ihr Haar straff zurückgekämmt. Sie wirkte so, als würde sie von der Salzluft und dem heißen Klima ganz allmählich ausgetrocknet und eingeschrumpft. Jedenfalls bemerkte ich an ihr nichts, was das boshafte Lachen des Kutschers hätte rechtfertigen können.
Das andere Paar hieß Sonny und Jane Duval. Amerikaner. Sonny Duval war ein großer, struppiger Mensch mit langem Haar und Schnurrbart. Er sah aus wie Mitte Vierzig, jedenfalls zu alt, um sich als Hippie auszugeben, was er aber seiner Aufmachung nach tat. Jane Duval war bestimmt zwanzig Jahre jünger als er, mehr fiel mir an ihr nicht auf. Sie schmollte und schien sich auch nicht um ihre dreijährige Tochter kümmern zu wollen, die ebenfalls da war, die ich jedoch anfangs bei dem unzureichenden Licht übersehen hatte. Es war deutlich, daß die Taylors sich zankten, das aber vor mir verheimlichen wollten. Spannung lag in der Luft. Offenbar war ich mitten in einen Ehekrach hineingeplatzt. Duval und Frau waren als Zeugen da. Ich hatte den Eindruck, sie hätten bei meinem Erscheinen eine recht lebhafte Diskussion abgebrochen. In meinem Beruf lernt man bald genug solche Situationen einschätzen. Nun, mich ging das nichts an. Aber sollte mein Urlaub wirklich so anfangen?
»Und das ist Mr. Frank Davies«, stellte Taylor mich vor, »der das Haus übernimmt. Soweit ich weiß, nennt man Sie auch Lobo? Das ist doch eine Wolfsart, nicht wahr?«
»Stimmt. Und im Westen, meiner Heimat, nennt man auch Einzelgänger so.«
»Wie entzückend! Haben Sie was dagegen, wenn wir Sie ebenfalls so nennen, Lobo?« fragte Taylor. »Mir gefällt der Name.«
»Wie Sie wollen …«
»Sonny ist Ihr Bootsmann!« rief Georgina etwas gezwungen munter und schrill. »Bei Licht betrachtet, sind wir alle Ihre Dienstboten – hoffentlich haben Sie nichts dagegen, daß wir die Wohnung hier unten benutzen.«
»Keineswegs.« Ich schaute mir noch einmal den überalterten Hippie an.
Als spüre er, daß ich ihn musterte, stand er auf und reckte sich zu seiner vollen, imposanten Größe auf. Er überragte mich um ein gutes Stück und schmunzelte gutmütig hinter seinem Schnauzbart. Dabei schien er mit seinen Gedanken meilenweit entfernt. Ein tellergroßes Friedensmedaillon baumelte auf seiner Brust. Seine Frau blieb sitzen und schmollte weiter. »Stimmt, Sie sind jetzt mein Arbeitgeber«, sagte er und streckte mir eine fleischige Pratze hin. »Baronin Anders hat mich für den Monat Ihres Aufenthaltes hier mitsamt meinem Boot angeheuert. Ich stehe Ihnen von morgens neun bis abends sechs zur Verfügung.« Damit setzte er sich und versank in stummes Grübeln.
»Kommen Sie«, sagte jetzt Con Taylor, »ich zeige Ihnen das Haus und erkläre Ihnen, was Sie wissen müssen.« Dabei lächelte er selbstgefällig.
Ich folgte ihm, und es war mir sehr recht, von da unten wegzukommen.
Das Haus war sehr hübsch, allerdings für einen alleinstehenden Menschen viel zu geräumig. Gleich rechter Hand führten drei Stufen in ein großes Wohnzimmer mit offenem Kamin, einem fliesenbelegten Fußboden und hohen Fenstern, die bis zum Boden reichten. Die Decke ruhte auf einem langen, mächtigen Balken. Am anderen Ende des Zimmers lag eine halbrunde Veranda, deren bogenförmige Fenster den Blick auf den Hafen freigaben und dem Hinausschauenden das angenehme Gefühl vermittelten, in einer behaglichen Höhle zu stehen. Die Einrichtung bestand aus Holz, Chintz und anderen Materialien, die die feuchte Seeluft vertrugen. Die Schlafzimmer lagen im Oberstock. Ich konnte mir gut vorstellen, daß jeden Moment James Mason und der Fliegende Holländer hereinkämen und sich einen Schnaps eingössen.
Taylor zeigte mir den Sicherungskasten und den Badeofen sowie die Wanne. Eine Dusche gab es nicht. Ferner übernahm ich von Taylors eine griechische Haushälterin, die meinen einzigen Koffer beschnupperte, als enthielte er Ratten, ehe sie ihn hinaufbrachte, um auszupacken.
»Tut mir leid, daß ich schon weg muß«, sagte Taylor, »in vierzehn Tagen bin ich zurück. Und dann bleibe ich zwei Wochen. Sommerferien.«
»Das ist ja wunderbar«, sagte ich, und wir verabschiedeten uns mit Handschlag.
Nachdem ich mir die Schlafzimmer angeschaut hatte, trat ich mit dem Glas in der Hand auf meine Veranda und hörte, wie sich im Untergeschoß Taylors zankten. Er packte seinen Koffer, und wie zu erwarten, handelte es sich um irgendwelche Weibergeschichten. Ich trank auf das Wohl des abnehmenden Mondes. Taylor knallte die Tür hinter sich zu und eilte durch den Garten zur Kutsche, die ihn zum Hafen bringen sollte. Der Mondschein auf dem leicht gekräuselten Wasser des Hafens sah schön aus.
3
Ich sagte meiner Haushälterin, sie brauche für mich nichts zu kochen, und machte ihr damit eine große Freude. In der hell erleuchteten Taverne nebenan stopfte ich ein klebriges Lammfrikassee in mich hinein und stand dann wieder mit einem Glas Whisky auf der Veranda und schaute auf den mondbeschienenen Hafen, als Georgina Taylor mich von unten anrief.
»Sind Sie ganz allein da oben?«
Mit meiner angeborenen Höflichkeit lud ich sie ein, auf ein Glas heraufzukommen. Das war ein Fehler, und ich wußte es. Wer sich abends Leute auf ein Gläschen ins Haus lädt, begeht langsamen Selbstmord.
Sie war schon etwas angesäuselt und stürzte sich sofort auf den Whisky, wie ein Matrose bei seinem ersten Landgang. Taylors hatten mir vorsorglich guten schottischen Whisky bereitgestellt (samt der Rechnung), und sie war rasch betrunken.
Sie konnte es kaum abwarten, mich mit ihren Kümmernissen zu behelligen, und brachte nur mit Mühe die bei einem ersten Besuch unumgänglichen Höflichkeitsfloskeln heraus.
»Ein Jammer, daß Sie Ihre erste Nacht hier oben so einsam verbringen müssen.«
»Das ist mir durchaus recht«, sagte ich.
»Wie gefällt Ihnen das Haus?«
»Ein wenig groß für mich allein.«
»Das hab ich doch gleich gesagt. Aber offenbar fühlt sich Freddy Tarkoff in Ihrer Schuld.«
»Wir sind alte Bekannte.«
Den zweiten Scotch nahm sie schon ohne Wasser, wenn auch noch mit Eis.
»Sind Sie wirklich Privatdetektiv?«
Ich machte eine bejahende Gebärde.
»Dann sollte ich Sie beauftragen, Material gegen Con zu sammeln.«
»Scheidungssachen übernehme ich nicht. Das ist ein zu schmutziges Geschäft.«
»Na, dann nicht. Ich habe ohnehin genug Material gegen ihn. Er hat sich nie die Mühe gemacht, was zu verbergen.«
»Dann brauchen Sie also nur einen Anwalt.«
»Na ja …«, sagte sie. »Wahrscheinlich werde ich nie was gegen ihn unternehmen. Eine schöne Nacht, nicht wahr?«
»Sehr schön.«
»Reden tun Sie nicht gerade viel, was?«
Darauf schwieg ich.
Sie hielt mir ihr Glas hin und legte dann, den dritten Scotch in der Hand, richtig los.
»Con hat ein Verhältnis mit Sonny Duvals ›Frau‹.« Das Wort Frau setzte sie in höhnische Anführungszeichen, um mir klarzumachen, daß Jane Duval keine legitime Gattin sei.
»Soll ich das bedauerlich finden?« fragte ich schroff.
Sie achtete nicht darauf. »Duvals, oder was sich so nennt, sind überhaupt nicht richtig verheiratet. Sie glauben nicht an die Ehe.« Sie erwartete jetzt offenbar einen Kommentar von mir, der aber ausfiel. Es war übrigens einerlei.
»Und es ist durchaus nicht das erste Mal, daß Jane Duval sich hier auf der Insel einen Liebhaber leistet. Nur hat es sie diesmal richtig gepackt. Wahrscheinlich liegt das an meinem Con. Der könnte selbst dem Teufel Flöhe ins Ohr setzen. Jedenfalls behauptet sie, Con habe ihr fest versprochen, mit ihr durchzugehen. In Wahrheit denkt er natürlich nicht daran, und deshalb mußte er sich nach Athen verdrücken. Jane hat schon angekündigt, daß sie hinterherfahren will. Und wie üblich soll ich jetzt für ihn die Suppe auslöffeln.«
Sie schaute mich erwartungsvoll an, doch ich schwieg. Nun fing sie an zu jammern.
»Ich finde, Sonny und Jane benehmen sich ganz und gar nicht chic. Und wo sie noch dazu Geld haben wie Dreck! Amerikanische Millionäre sind sie, und angeblich glauben sie an freie Liebe.«
Diesmal hielt sie mir nicht erst ihr Glas hin, sondern griff selber zur Flasche. »Eis brauche ich keines«, murmelte sie dabei.
Ich stand auf in der Hoffnung, auch sie werde dann aufstehen und sich verabschieden. Sie stand wohl auf, doch machte sie dann einen Schritt auf mich zu und lehnte sich an mich. Bei uns daheim tun Frauen so etwas einfach nicht, oder sie haben es zu bereuen. Ihr Busen drückte sich gegen meinen Magen, und ich sagte: »Sie wissen sicher genau, daß ich in dieser Sache nichts unternehmen kann«, und schob sie sanft weg. Sie fuhr sich über die Augen und nahm noch einen Schluck aus dem Glas. »Tut mir leid, wirklich, ich hätte nicht herkommen und Sie mit diesem Kram belästigen dürfen. Glauben Sie mir, ich werde es nie wieder tun.«
»Ich glaube Ihnen. Schließlich bin ich ja Ihr Mieter.«
Sie lachte. »Ich gehe jetzt.« Es dauerte aber noch ein Weilchen, bis sie wirklich ging. Sie fühlte sich verpflichtet, die Besorgte zu spielen, die im Grunde nur heraufgekommen war, um sich nach meinem Wohlbefinden zu erkundigen, und keinesfalls, um sich über ihre derzeitigen Sorgen bei mir zu verbreiten; deshalb redete sie wie ein Wasserfall. Dabei erfuhr ich einiges. Ich erfuhr, daß Con die Abkürzung für Constantin war; daß Georgina Taylor wirklich Engländerin war und Constantin Taylor während des Krieges in Alexandria kennengelernt hatte, wo er als Marineoffizier stationiert war; und daß das Paar einen Sohn von 22 Jahren besaß, der derzeit in London lebte. Schließlich taumelte sie zur Tür hinaus und reichte mir noch das Glas mit den Resten ihres fünften Whiskys. Ich schloß die Tür hinter ihr und meinte nun zu verstehen, warum der Kutscher so boshaft gelacht hatte.
Ich löschte überall das Licht aus und nahm die Whiskyflasche mit nach oben ins Schlafzimmer. Auf dem Flur hingen scheußliche Gemälde. Ich hatte das Schlafzimmer über dem Wohnzimmer gewählt, mit Blick auf den Hafen. Oben machte ich kein Licht, sondern stellte mich ans Fenster, schaute auf das immer noch vom Mond beschienene Wasser und versuchte, den Lärm aus meinen Ohren zu vertreiben. Ich war hellwach. Ich mixte mir noch einen harten Drink, während ich mein Inneres klagen hörte, ich hätte mir für heute bereits viel zuviel Whisky eingeflößt.
Im Souterrain ließ Georgina den Plattenspieler laufen. Eine Flasche klirrte. Ich trat auf das flache Dach der Veranda hinaus und blieb gedankenversunken stehen. Der Jachthafen bot im Mondlicht einen unverändert schönen Anblick. Was für ein Urlaub! Am liebsten hätte ich Tarkoff in den Hintern getreten. Unerfreuliche Gedanken summten in meinem Hirn wie Hummeln, aber ich verscheuchte sie.
Unter den Booten im Hafen fiel mir eines besonders auf – eine Ketsch ohne Lichter und offenbar ohne Besatzung. Der Mast dieses seetüchtigen Bootes dürfte gegen 30 Meter hoch gewesen sein und beschrieb eine ungeheure Kurve gegen den mit Sternen besetzten Himmel, sobald das Schiff leicht dümpelte. Ich versuchte mir auszumalen, wie es wohl wäre, wenn ich mir ein solches Schiff finanziell leisten und als reicher Mann jeweils fahren könnte, wohin ich Lust hätte, und ganz nach Laune an Land gehen könnte. Aber ich vermochte es mir einfach nicht vorzustellen. Nach einem Weilchen ging ich hinein und legte mich aufs Bett. Schlafen konnte ich allerdings nicht. Also dachte ich an meine Ketsch. Entweder die Ketsch oder meine Sorgen. Ich erinnerte mich an jedes Detail, jede Klampe, jedes Kabel, die Segel, die Beschläge. Dann überlegte ich, wieviel Ersatzsegel sie mit sich führen mochte und wie die Kajüten aussehen könnten. Diesen Trick hatte ich im Krieg gelernt. Wenn man an etwas Unangenehmes nicht denken mag, muß man an etwas denken, das man sich wünscht, ganz brennend wünscht. Damals hatte ich mir ein Wochenendhaus auf der Wind River Range gewünscht. Von innen kannte ich es nicht, aber ich hatte mir die Zimmer Tausende von Malen vorgestellt. Und damals hatte ich mit diesem Trick Erfolg. Diesmal versuchte ich es mit der Jacht, und siehe da, es klappte. Es dauerte ziemlich lange, doch meine Gedanken ließen mich schließlich in Ruhe, und ich schlief ein.
4
Am folgenden Morgen ging es mir schon viel besser. Kein Wunder, bei dem Blick auf den Hafen mit seinen Booten und dem Menschengewimmel. Die Sonne hatte mich zeitig geweckt, und bald schon saß ich vor einem starken Kaffee, den die Haushälterin mir bereitet hatte, auf der Veranda und sah dem Treiben unter mir zu. Jane Duval hockte nahe der Taverne auf der Mauer und fühlte sich offenbar vernachlässigt, jedenfalls schaute sie verdrossen drein. Vor ihr im Dreck spielte das kleine Kind, um das sie sich nicht weiter kümmerte.
Gleich darauf versammelte Sonny ›Frau‹ und Kind um sich, trieb sie in ein kleines Beiboot und ruderte hinaus zu einem massiven, 20 Meter langen, ungepflegten Kajik, der mit Leinen auf der Höhe des Hauses an der Ufermauer festgemacht war. Von Georgina wußte ich, daß Duvals an Bord des Kajik wohnten. Ein kleines, aber schnittiges Motorboot lag längsseits.
Ich beobachtete, wie er Jane und das Kind an Bord hievte und zur Taverne zurückruderte. Er machte sein Beiboot fest und stieg auf einen bei der Mole vertauten Fischerkajik von gut 10 Metern Länge und fing an aufzuklaren. Das war offenbar mein Boot, und er brachte es jetzt für mich in Ordnung.
Im Haus klingelte es, und die Haushälterin ließ jemanden ein. Ich trat zurück ins Zimmer, im ersten Moment noch geblendet von dem grellen Sonnenlicht draußen. Eine weibliche Gestalt kam auf mich zu. Es dauerte etwa eine Minute, bis ich wieder sehen konnte – eine Alterserscheinung übrigens, es dauert mit den Jahren immer länger, sich Lichtverhältnissen anzupassen. Ich sah nun also meine Haushälterin, die sich aus irgendeinem Grund ungemein aufplusterte und sehr wichtig tat. Ich hörte auch gleich wieso: »Die Baronin von Anders!« meldete sie. Englisch sprach sie übrigens mit einem ausgeprägten deutschen Akzent, wie alle älteren unbegüterten Griechen auf den ehemals von den Deutschen besetzten Inseln.
Die Angekündigte trug ein leichtes, aber kostspieliges Sommerkleid mit wenigen ausgesuchten Schmuckstücken. Das Haar war weder kurz noch lang, aber gepflegt. Eine elegante aristokratische Erscheinung von vielleicht Anfang Vierzig. Und glänzend beieinander für ihr Alter, soweit ich das beurteilen konnte. Sie wirkte sehr weiblich und attraktiv. Gerade das Richtige für einen sturmgeprüften Fünfziger.
»Ihr Name hat offenbar Eindruck gemacht«, sagte ich zur Begrüßung.
»Das ist hier so üblich. Man spricht alle Titel bei jeder Gelegenheit mit Begeisterung aus. Wir selber hingegen erwähnen sie so gut wie nie.«
»Ich auch nicht«, sagte ich schmunzelnd, und sie wußte nicht so recht, wie sie das auffassen sollte. »Ich habe übrigens auch keinerlei Anspruch darauf«, sagte sie schließlich, »denn ich bin geschieden.«
Das also war die mir von Tarkoff verschriebene Dame, die sich auf der Insel meiner annehmen sollte. Und das war auch die Dame, die mich nicht vom Schiff abgeholt hatte.
»Tut mir leid, daß ich Sie nicht vom Schiff abgeholt habe«, sagte sie jetzt, als könne sie Gedanken lesen. »Ich habe mich im Datum vertan.«
»Das macht doch nichts! Es hat mich überhaupt nicht gestört, daß ich auf der Mole schlafen mußte.«
»Was denn, wirklich? Haben Sie wirklich auf der Mole geschlafen?«
»Nein, natürlich nicht. Ich wußte, daß das Haus Taylors gehört.«
Sie lächelte erleichtert, aber vielleicht spielte sie mir auch nur was vor. »Und wie gefällt Ihnen das Haus? Alles zufriedenstellend?«
»Alles ganz vortrefflich, viel zu üppig für einen Junggesellen.«
»Benimmt die Haushälterin sich ordentlich?«
»Ich finde nichts an ihr auszusetzen. Ob sie mit mir zufrieden ist, weiß ich allerdings nicht.«
»Und warum sollte sie nicht?«
»Nun … zum Beispiel habe ich nur einen einzigen Koffer mitgebracht.
Diesmal lachte sie. »Ja, ja, sie ist ein richtiger Snob. Mit der Zeit werden die Leute hier alle so.«
»Wer würde das nicht?«
Sie schaute mich zweifelnd an. »Sie haben ein loses Mundwerk. Freddy hat mich zum Glück schon davor gewarnt.«
Es hätte nun die Frage nahegelegen, ob Tarkoff sie auch in anderer Hinsicht vor mir gewarnt habe, doch verkniff ich mir diese Erkundigung. Die Baronin ging ans Fenster und deutete hinüber zum Anleger vor der Taverne.
»Das Boot da habe ich für Sie gechartert. Man braucht hier unbedingt ein Boot. Es gehört einem Amerikaner. Eigentlich ist er auf Geld nicht angewiesen. Er versteht was von Seefahrt, und außerdem können Sie englisch mit ihm reden.«
»Kann er mit der Harpune umgehen?«
»Das weiß ich nicht. Wenn Sie wollen, können wir ihn gleich fragen.«
»Ich habe ihn schon kennengelernt. Seine Frau übrigens auch.«
»Aha. Jane kennen Sie also schon.«
»Ganz recht.« Meinem Ton war nichts anzumerken.
Die Baronin lächelte. Es war ein echt niederträchtiges Lächeln und erhellte ihr ganzes Gesicht. Sie zeigte ihre winzigen, perlweißen Zähne, und auch als sie nicht mehr lächelte, sah ich dieses Lächeln immer noch vor mir. Es war das Lächeln einer hochgestellten Dame, die hochbeglückt über einen handfesten Zank die Ärmel aufkrempelt.
»Ist sie nicht reizend?« fragte sie.
Es war meine eigene Schuld. Warum mußte ich auch Sonnys Begleiterin erwähnen! Immerhin eröffnete sie das Feuer mit großem Kaliber.
Dies war nämlich auch die Dame, die Tarkoff nicht nur als gute Bekannte schätzte, wenn ich seinen Ton am Telefon richtig gedeutet hatte. Meinte er, ich sollte den gleichen Gebrauch von ihr machen? Das paßte mir nicht. Der Gedanke als solcher sagte mir schon zu, doch Tarkoffs Mutmaßungen waren mir zuwider. Falls es welche waren.
»Chantal ist doch ein französischer Name, oder? Dabei hatte ich geglaubt, Sie seien Engländerin.«
Sie lachte. »Das bin ich auch. Meine Mutter allerdings war Französin. Und ich habe fast meine ganze Kindheit in Frankreich verbracht. Sie dürfen aber nicht glauben, Engländerinnen wären weniger gemein als Französinnen.«
»Davon habe ich schon gehört.« Sie gefiel mir. Sie redete nun ausführlich über das Haus, seine Vorzüge und seine Nachteile, und erweckte den Anschein, selbst eine sehr kundige Hausfrau zu sein. Das stimmte ja wohl. Zugleich aber wirkte sie bei all ihrem sachverständigen Geschwätz irgendwie nervös, zerfahren. Dann lud sie mich zum Mittagessen ein. »Nichts Aufregendes. Nur ein paar Mumien, die ich meinen Griechischen Chor nenne. Aber das Essen ist gut, und ich möchte einiges in Ruhe mit Ihnen besprechen.«
»Warum machen wir das nicht hier? So, wie Sie es beschreiben, lockt mich Ihr Mittagessen überhaupt nicht.«
»Nein, hier nicht«, entgegnete sie.
Ich erkannte bereits einige vertraute Symptome. Mein Beruf ähnelt dem des Arztes. Erscheint ein Arzt in Gesellschaft, ist er gleich von Leuten umringt, die ihm ihre Krankengeschichte erzählen. Ein Privatdetektiv wird mit ihren sonstigen Kümmernissen behelligt. Mit der Zeit wird das sehr lästig, und ich hob abwehrend eine Hand.
»Ich will hier Urlaub machen, nicht Aufträge übernehmen.«
»Und wenn es sich um Erpressung handelt?«
Jedenfalls hielt sie mit ihrem Anliegen nicht hinter dem Berge. »Also schön, ich nehme die Einladung an. Aber versprechen kann ich nichts. Ist das klar? Und jetzt gehen Sie. Ich will mit meinem Boot und dem Bootsmann in die Stadt fahren.«
Sie streckte mir, plötzlich schüchtern geworden, die Hand hin, eine warme, trockene, magere Hand. Ein teures Armband klirrte. Zweifellos war sie eine attraktive Person, wenigstens für einen älteren Herrn wie mich, oder Tarkoff. Ich sah hinter ihr her und überlegte, ob ihr Hinterteil wirklich so stramm sei, wie es den Anschein hatte. Dann verbot ich mir derartige Spekulationen und machte mich fertig für die Bootsfahrt. Schließlich war ich nicht hergekommen, um mit Baroninnen Dummheiten zu machen. Weshalb ich hergekommen war, wußte ich ja nicht, aber deshalb bestimmt nicht. Ich konnte hier schließlich nicht den fahrenden Ritter spielen. Als Troubadour würde ich mich nur lächerlich machen. Im Hinausgehen grüßte ich Georgina, und sie warf mir einen sehr nachdenklichen Blick zu.
5
Sonny Duval erwartete mich bereits im Boot, das auf den Namen Daisy Mae getauft war. Er verholte sie am Tampen bis an die Mole und streckte mir die Hand hin. Ich übersah die Hand und kam mit einem langen Schritt an Bord. Ich wollte ihm gleich zu Anfang klarmachen, daß er es mit einem alten Seebären zu tun hatte. Er ging achselzuckend nach achtern, steuerte das Boot zwischen den festgemachten Fahrzeugen durch und ließ es dann parallel zur Küste laufen, vorbei an den weißen Häusern mit den hohen Mauern, die ich abends zuvor von der Kutsche aus betrachtet hatte.
»Sie verstehen sich auf Schiffe, was?« fragte er dann ganz freundlich.
»Ich bin früher ziemlich viel in kleineren Booten auf dem Wasser gewesen«, entgegnete ich. Es war ein Genuß, wieder auf einem Boot zu sein.
Sonny musterte mich eingehend. »Das sagen viele.« Er schaute weg, fragte aber ein Weilchen später: »Wollen Sie mal versuchen?«
Das überraschte mich. »Gern. Falls Sie nichts dagegen haben.« Ich ging nach achtern und übernahm das Ruder. Gesteuert wurde nicht mit einem Rad, sondern mit einer altmodischen Ruderpinne, die mit einem Bolzen am Ruderkopf befestigt war; ich kannte das von der Karibischen See her.
Das Boot war schmuck und lag vortrefflich im Wasser, wie alle griechischen Boote. Nach einem Weilchen drehte ich nach dem offenen Wasser ab und ließ den Bug durch die anlaufenden Wellen schneiden. Ich wendete auf einem Wellenkamm und nicht in einem Wellental, wo die Welle uns breitseits getroffen hätte. Das Boot ließ sich gut manövrieren. Ich lief dichter unter Land, machte eine Wendung über Steuerbord und gab Sonny die Pinne zurück.
»Sehr hübsch«, bemerkte er. »Gut gemacht. Wollen Sie nachher das Anlegemanöver fahren?«
Darauf war ich nicht gefaßt. »Wenn Sie meinen, daß ich es schaffe. Warum nicht?«
»Bestimmt schaffen Sie es.«
»Fürchten Sie nicht, daß ich Ihr Boot in Klump fahre?«
»O nein, Sie nicht.« Er schmunzelte. Was er damit meinte, ahnte ich nicht. Es schien, als sei ihm alles einerlei. Vielleicht lag es daran, daß er so reich war. Er konnte ohne weiteres ein neues Boot kaufen oder auch zwei. Ich jedenfalls hätte mein Boot keinem anderen zum Anlegen überlassen, bevor ich ihn nicht gründlicher geprüft hätte als Sonny mich. Ich verstand das alles nicht. Da läßt man Menschen in ein Paradies wie dieses hinein, und schon bilden sie einen Klub mit allerlei geheimen Spielregeln. Mir gefiel das nicht.
»Na schön. Dann fahre ich nachher das Anlegemanöver.«
Wir machten uns jetzt auf die Reise. Ich zog mein Hemd aus und verschränkte die Arme im Nacken. Ich bin ziemlich kräftig gebaut, und ich sah, daß Sonny das zur Kenntnis nahm. Er war selber ein kräftiger Mann, aber stellenweise schon wabbelig. Ich schaute zurück auf die Küste. Im Sonnenlicht sahen die Häuser allesamt sehr hübsch aus. Hinter weit auseinanderstehenden Olivenbäumen lag eine orthodoxe Kirche am Hang, umgeben von einer niedrigen, weißgekalkten Mauer. Alles Mauerwerk in dieser Gegend war weiß gekalkt. Ein herrlicher Tag, eine herrliche Aussicht, eine herrliche Fahrt.
Warum sich die Erinnerung an Tarkoffs Auftrag gerade jetzt unabweisbar aufdrängte, weiß ich nicht, doch so war es nun einmal.
6
Ich hatte diese Angelegenheit schon von allen möglichen Seiten betrachtet, und von keiner Seite her nahm sie sich gut aus. Wie auch immer ich es drehte, für den Friedensnobelpreis würde man mich deswegen nicht vorschlagen.
Ohne Regeln geht es im Leben einmal nicht. Meine Regel lautet: Solange du das Geld deines Kunden nimmst, hat der Kunde recht. Paßt dir entweder der Kunde oder der Auftrag nicht, läßt du die Finger von diesem Geld.
Der Fall Tarkoff lag klar. Tarkoff hatte einen Haufen Geld in Griechenland investiert, und ein Teil davon wurde von einem wohlhabenden griechischen Anwalt für ihn verwaltet. Der Grieche hatte Handlungsvollmacht, und kraft dieser beschwindelte er Tarkoff innerhalb eines Jahres um 130000 Dollar. Er überschrieb sein Vermögen seiner Frau und setzte sich ins Ausland ab, nachdem er Tarkoffs Geld offenbar für Wein, Weib und Gesang verjuxt hatte. Was allerdings seine Frau nicht hinderte, ihm die Stange zu halten, als es vor Gericht um sein eigenes Vermögen ging. Tarkoff bekam keinen Pfennig von der noch immer wohlhabenden Frau, deshalb ließ er den Griechen suchen und fand ihn schließlich denn auch in einer billigen Absteige in der Rue d’Amsterdam in Paris. Der Mann war völlig abgebrannt und arbeitete dort als Nachtportier. Das sah für Tarkoff nicht gut aus: Der Grieche war in Frankreich mittellos, die Frau lehnte ab, für seine Schulden zu haften, und vor den griechischen Gerichten war nichts zu holen.
Ein sauber ausgearbeiteter Plan dieses Anwalts! Tarkoff und ich verstanden beide genug von der Juristerei, um das zu erkennen. Tarkoff war allerdings nicht der Mann, der sich solche Sachen bieten läßt. Nicht umsonst zählte er in der Wallstreet zu den ›Jungtürken‹. Er beauftragte mich also, dem Griechen – egal wie – das Geld wieder abzuknöpfen, oder doch soviel als möglich.
Es lag auf der Hand, daß man der Frau das Geld aus der Nase ziehen mußte. »Ich möchte, daß Sie das machen, denn Sie können noch am ehesten was erreichen. Ich zahle Ihnen eine Erfolgsprämie und sämtliche Spesen. Fahren Sie.« Ich fuhr. Ich übernahm den Fall, weil ich mit Tarkoff einer Meinung war, daß der Grieche nur darauf spekulierte, als anständige Menschen würden wir ihn laufenlassen. Ich stand auf der richtigen Seite in dieser Sache, keine Frage. Der Bursche hatte übrigens schon früher Unterschlagungen begangen.
Tarkoff kannte ich damals seit etwa fünf Jahren. Unter meinen New Yorker Bekannten war er der vermögendste. Er hatte sich zunächst auf eine Empfehlung hin an mich gewandt, als seine Sekretärin von einem ehemaligen Liebhaber erpreßt worden war; den sollte ich außer Gefecht setzen. Ihm gefiel die Art, wie ich das erledigt hatte, und wir befreundeten uns. Er fand es sonderbar, daß ich als zugelassener Anwalt Privatdetektiv war. (Ich fand das gelegentlich ebenfalls sonderbar.) Dann erledigte ich einige Aufträge für ihn, Nachforschungen für seine geschäftlichen Unternehmungen. Ich fragte nie, warum er sich für seine Sekretärin so stark gemacht hatte. Er hatte eine Frau aus den richtigen Kreisen geheiratet, ging aber oft mit mir in die dubiosen Kneipen, wo die Unterwelt verkehrt. Auch begleitete er mich gern, wenn ich jugendliche Ausreißer aus gutem Haus wieder einfangen sollte.
Ob nun unsere Freundschaft den Ausschlag dafür gab, daß ich den Auftrag übernahm, weiß ich nicht. Ich könnte das als Entschuldigung vorschieben, aber ich verzichte darauf. Er bot mir eine große Summe, und ich brauchte damals dringend Geld. Meine Scheidung war eben rechtskräftig geworden, und das kostete eine schöne Stange, obwohl die Scheidung eigentlich von meiner Frau betrieben worden war. Das und dazu zwei heranwachsende Töchter in erstklassigen Privatschulen forderten an jedem Ersten eine hübsche Summe. Und Freddy wußte das natürlich.
Ich flog nach Europa, bereit, alle notwendigen Mittel einzusetzen. Übrigens hatte ich mich in New York schon lange nicht mehr recht wohl gefühlt – dort können ja nur noch berufsmäßige Verbrechensbekämpfer sich nach Einbruch der Dunkelheit auf die Straße trauen. Ich freute mich wegzukommen. In Europa allerdings fühlte ich mich dann ebenfalls nicht behaglich. Auf dem Flugplatz von Orly wurde mir klar, daß alle Europäer im Grunde seit Hunderten von Generationen entwurzelt sind. Nirgendwo gab es Sicherheit, sie erwarteten auch nichts dergleichen, und man sah es ihren Gesichtern an. Sie wiesen einen Ausdruck auf, als wüßten alle schon vom Tage ihrer Geburt an, daß auch die nächsten Angehörigen sie bei erster Gelegenheit betrügen würden. Also fühlte ich mich gleich daheim.
Als erstes machte ich einen Abstecher nach Athen, um mir mal die Frau des Griechen anzuschauen. Sie besaß ein Stadthaus in Athen, eine Villa am Meer und fruchtbares Ackerland. Wieviel Bargeld sie hatte, ahnte ich nicht. Immerhin reichte ihr Besitz zehnmal, um Tarkoff auszuzahlen.
Sodann nahm ich mir in Paris den Griechen selbst vor. Er steckte immer noch im gleichen Hotel. Er war klein und dick und tückisch und bestritt nichts. Nur zahlen konnte er nicht. Keinen Pfennig. Und seine Frau würde ebenfalls nichts herausrücken. Sie verabscheute ihn. »Das ist doch ganz natürlich, finden Sie nicht? Würden Sie an ihrer Stelle anders denken?« Und dabei grinste er gerissen. Er hatte sich alles so schön ausgedacht: das Geld verpufft, sich amüsiert, und nun war er pleite. Was konnte man ihm anhaben? Er besaß nichts mehr. Dabei hatte er nur eines nicht bedacht, nämlich daß jemand wie Tarkoff nicht verzeiht.
Geredet habe ich nicht viel. Warum auch? Vielmehr machte ich ihm nach und nach klar, was ich vorhatte. Ich knallte ihm eine, ohne jede Warnung. Dann prügelte ich ihn systematisch durch, was ihn offenbar nicht verwunderte. Ich weiß, wie man das so macht, daß von außen nichts zu sehen ist. Er schrie nicht, er wehrte sich nicht, und als ich ging, war er kaum noch bei Bewußtsein.
Von der Polizei hatte ich nichts zu fürchten. Die französische Polizei kannte ihn bereits, er war da nicht gut angeschrieben. Am nächsten Abend saß ein anderer Nachtportier am Tisch. Der Grieche liege krank auf seinem Zimmer, sagte er. Ich stieg nach oben, und da lag er, ziemlich bunt angelaufen. Er grinste wieder tückisch und hatte allerhand zu sagen. Ich könne ihn prügeln, könne ihn töten, seiner Frau würde es nichts ausmachen, sagte er. So bekäme ich keinen Pfennig. Er war geradezu geschwätzig.
Ich nickte düster. »Stimmt. Haben Sie Kinder?« Das wußte ich schon. Er riß die Augen auf. »Wollen Sie etwa …«
Ich blieb stumm.
»Das können Sie nicht.«
»Sie brauchen eine kleine Aufmunterung. Jetzt kriegen Sie erst mal eine aus der alten Kiste.« Ich schob ihm einen Knebel in den Mund und brach ihm einen Finger. Alles für den lieben alten Freddy Tarkoff. Er tat, als würde er ohnmächtig werden, doch sank er nur aufs Bett zurück, und seine Lider zitterten. »Morgen komme ich wieder«, kündigte ich an. »Dann haben wir gewiß alles mögliche zu besprechen. Laufen Sie nicht weg, ich finde Sie doch.« Er stöhnte noch, als ich ihn verließ. Ich schwitzte. Ich mußte den Hut abnehmen. Diese Art Arbeit ist nicht meine starke Seite. Ich hoffte nur, daß der Grieche dies nicht bemerkt hatte. Noch einmal würde ich es nicht fertigbringen.
Die Nacht war kühl und feucht, und ich befand mich in einem berüchtigten Stadtviertel. Es nebelte, das Straßenpflaster war schlüpfrig. In Hauseingängen standen Nutten mit hochtoupiertem Haar und klotzigen Umhängetaschen über der Schulter. Ich erwog, mit einer zu gehen, um das soeben Geschehene zu vergessen, aber schon beim Gedanken daran wurde mir übel. Mühsam hielt ich mich zurück, mit der Faust gegen die Mauern zu schlagen. Melodramatische Selbstdarstellung. Schließlich brauchte ich die Hand noch. Die Nutten schauten mir zu – ich ging weiter.
An der ersten Cafébar mischte ich mich unter die Zuhälter und nahm ein paar Schnäpse. Eigentlich dachte ich damals nur: Wie gut, daß nicht du an seiner Stelle bist. Nicht um die Welt hätte ich an seiner Stelle sein mögen, ich wäre vor Angst gestorben.
Viel anders erging es ihm offenbar auch nicht, jedenfalls war er wesentlich zugänglicher, als ich ihn neuerlich aufsuchte. Die Hand lag in Gips. Er wollte mit seiner Frau reden. Man vereinbarte eine Zusammenkunft in Zürich. Seine Frau war eine ebenso jämmerliche Person wie er. Nach einem langen, durch meine Anwesenheit überschatteten Gespräch mit ihm in einem Café bat sie mich um eine Unterredung unter vier Augen. Ob ich der Mann sei, der mit Kindesentführung drohe? Aber nein, wovon rede sie denn? Ich sei nur ein lieber Bekannter. Knurrend sagte sie, 80000 sei das Äußerste. Wie es denn mit der Villa am Meer stehe? fragte ich. »Alles, nur nicht meine Villa!« kreischte sie. Und überhaupt lasse sie sich nicht von heute auf morgen verkaufen. Ich sagte, das Haus ist schuldenfrei; nehmen Sie eine Hypothek auf, verkaufen Sie später. Ich gab keinen Zentimeter nach. Keine Woche, und die gesamte Summe wurde von ihrem Schweizer Konto auf ein von mir eröffnetes Schweizer Konto überwiesen, der Grieche war wieder in Paris, und ich fuhr nach Athen, um dort Tarkoffs Geldangelegenheiten fertig abzuwickeln. Er bedankte sich überschwenglich am Telefon und schlug mir diesen Urlaub in Tsatsos vor. Ich hatte nämlich gesagt, New York würde mich so bald nicht wiedersehen. Das schob er auf meine Scheidung, und ganz verkehrt war das ja nicht.
Duvals Boot stampfte durch die Wellen, und ich verbot mir, nun auch noch über meine anderen Probleme nachzudenken – meine Scheidung und mein Leben. Es reichte bereits. Ich schwitzte in der starken Sonne. Die Bewegung des Bootes tat mir gut. Wir würden gleich anlegen. Ich zog das Hemd an. Immer wieder mußte ich daran denken, wie er die Augen verdrehte, wie seine Lider zitterten, als ich ihm den Finger brach, und das Schreckliche war, daß ich im Notfall erneut dazu imstande war. Falls ich je wieder in so eine Lage käme. Und daher war ich entschlossen, nie wieder in solch eine Lage zu geraten. Man erledigt die Schmutzarbeit für diese Herren, dann bekommt man sein Geld hingeschmissen und muß die Klappe halten. Das ist Teil der Abmachung. Mit den scheußlichen Details wollen sie verschont bleiben.
Soeben näherten wir uns dem Kopf der Mole, die den Hafen vor der Dünung schützte. An der Außenseite brach sich die Dünung, spritzte Schaum über den Beton und lief entlang der Küste hoch auf den Strand.
7
Wir umrundeten den Molenkopf, und gleich lag das Wasser still da. Da waren wir also. Von jetzt an wollte ich nur noch daran denken, wie ich mir mit Freddys Geld recht erholsame Ferien machen konnte. Die Liegeplätze für Boote waren noch etwa zweihundert Meter entfernt, und Sonny nahm das Gas zurück. Er wollte immer noch, daß ich das Anlegemanöver fuhr, und winkte mich nach achtern. Ich schaute mir in aller Ruhe den Hafen an. Hübsch sah er bei Tage aus, bislang hatte ich ihn ja nur bei Dunkelheit gekannt. Bunt angestrichene Kajiken lagen an ihren Bojen, zwei Reihen Bäume spendeten den Cafés auf der Mauer Schatten. Hier und da ragten alte Kanonen aus den Scharten des Mauerrandes. Geschäfte und Cafés lagen im Schatten ihrer Sonnenschirme. Und das alles schien in der großen Hitze langsam zu backen. Ich ging nach achtern.
»Nervös?« fragte Sonny.
»Warum?«
»Na dann«, grinste er und überließ mir die Pinne.
Wollte er mich auf die Probe stellen? Mir Angst machen? Er kannte mich doch gar nicht. Aufgeben würde ich nie, eher schon sein Boot in Klump fahren und uns beide dazu. Hatte er wirklich keine Angst um sein Boot, nur weil er so reich war? Er war etwas zurückgetreten, aber noch in der Nähe. Die Liegeplätze waren in einem künstlich angelegten Becken mit enger Einfahrt. Ich steuerte hindurch. »Sehen Sie den freien Platz dort? Lassen Sie 25 Meter vorher den Anker fallen, und bremsen Sie das Schiff mit der Ankerleine.« Ich nickte. »In der Karibischen See macht man es ebenso.« Ich war voller Trotz, sehr aggressiv. Er muß doch wissen, daß du aus der Übung bist, dachte ich.
Jedenfalls beglückte ich ihn jetzt mit meinem schönsten, zuversichtlichsten Lächeln, das ich eigentlich für Klienten reserviere, die eines allerletzten Anstoßes bedürfen. Es hatte mir manchen Vorschuß eingetragen. Falls er gemeint hatte, ich würde im letzten Moment kneifen, wußte er jetzt Bescheid. Wenn man sich nicht nervös machen läßt, ist so ein Anlegemanöver einfach, und auch ohne jede Übung gelang es mir glatt. Sein Gashebel sah zwar zum Fürchten primitiv aus, aber er ließ sich leicht bedienen. Er war bloß ein Gewindestab mit Flügelschraube, drehte man die Schraube zu, öffnete sich die Drosselklappe am Vergaser und umgekehrt. Man konnte damit den Motor schlecht auf schnelle Touren jagen, aber das wollte ich ja nicht. Ich drehte die Flügelschraube allmählich immer höher. Als wir noch 20 Meter entfernt waren, schaltete ich auf Leerlauf, und wir glitten auf die Mauer zu. Kurz vor der Mauer packte ich die Ankerleine, und das Schiff machte keine Fahrt mehr. Ich brauchte die Leine nicht mal zu belegen.
Sonny stand nur da und schaute zu. Dann lief er nach vorn und zog eine Leine durch den eisernen Ring. Ich zerrte derweil die Ankerleine über die Klampe an Steuerbord. So lag unser Schiff nun säuberlich zwischen den Kajiken rechts und links mit einem knappen halben Meter Abstand, ohne gescheuert zu haben.
»Prima«, sagte Sonny, als er wieder nach achtern kam, »wirklich prima.«
Diesen Ausdruck schien er besonders zu schätzen.
»In meiner irregeleiteten Jugend war ich als Schnapsschmuggler vor der Küste von Florida aktiv«, sagte ich.
Er betrachtete mich nachdenklich und sagte dann endlich: »Na, hören Sie mal, so alt können Sie doch noch nicht sein!« Es dauert ja enorm lange, bis bei dir der Groschen fällt, dachte ich, oder willst du mich auf den Arm nehmen?
Er war höchstens fünf Jahre jünger als ich, und man sah es ihm an, wenn er sein Gesicht zu einem Grinsen verzog. Da half weder sein Hippieaufzug noch die Medaille, das lange Haar oder der Schnauzer. Wenn er grinste, bildeten sich unter den Augen und am Hals zahllose Runzeln.
»Ich wundere mich immer noch, daß Sie einem völlig Fremden Ihr Boot zu diesem Manöver überlassen haben«, sagte ich.
Er funkelte mich an, blieb aber stumm.
Plötzlich blökte eine Hupe los, die ein gut aussehender, schlanker, junger Grieche an Bord des geräumigen Kajik Polaris betätigte. Eine Gruppe Touristen wollte schon an Bord gehen, und beim Ertönen der Hupe kamen noch andere aus dem Schatten der Mauer heran. Über der Gangway hing ein Schild mit der lockenden Aufschrift »Picnic-Swimming-Luncheon Trips to Glauros, Petcos etc.«. Offenbar genoß der junge Mensch den Lärm, den er da verursachte. Nackt bis zum Gürtel, in Jeans und barfuß, wirkte er trotz der langen Koteletten im Gesicht sauber, gesund und geschmeidig. Bei seinem Anblick wurde mir klar, daß ich alt bin. Sonny brüllte etwas hinüber, der Grieche lachte und winkte, doch drückte er immer noch auf den Knopf dieser verdammten Hupe. Ihr Blöken zerschnitt förmlich die sonnige Luft über dem Hafen.
»Sehen Sie ihn? Das ist der hiesige Dealer«, sagte Sonny neben mir, als die Hupe endlich verstummte und man wieder ein Wort verstehen konnte. Und dabei machte er die Gebärde des Haschrauchens. »Girgis heißt er. Er ist hier der Größte, pimpert ausschließlich Blondinen aus England oder Amerika. Girgis ist nicht nur Eigner der Polaris, er betreibt auch noch andere Geschäfte.« Er wiederholte seine Geste, und allmählich begriff ich.
»Sieht er nicht aus wie das blühende Leben?« fuhr Sonny bitter fort. »Dabei ist er so gesund wie ein syphilitischer Spastiker.« Er nickte mehrmals. »Schauen Sie sich das an. Girgis drückt auf seine Hupe. Er versammelt seine Kunden, aber er fährt bestimmt erst in einer Stunde ab. Und so lange sitzen die Leute da rum. O ja, unser Girgis denkt an alles.« Er feixte.
Wir kletterten auf die Mole und wurden sogleich in den am Kai herrschenden Trubel hineingezogen. Hier tummelten sich die Touristen und Hippies, man kaufte Obst und Gemüse von kleinen Kajiks, nicht größer als der unsere. Ein Fährschiff lag im Hafen und übernahm Fracht, Kisten voller Melonen, Tomaten und Gemüse. Vor uns sah ich ein scheußliches Gebäude, das als Bank bezeichnet war.
»Ich muß da rein«, sagte ich, »ein Konto eröffnen. Wo finde ich Sie?«
Er deutete mit der Hand: »In dem Café dort. Ich treffe mich da mit Bekannten.«
Der Mann in der Bank hatte den gleichen kalten Hundeblick hinter ungefaßten Brillengläsern wie alle loyalen, pflichtbewußten Bankangestellten, die nichts lieber tun als mit Klauen und Zähnen das Geld ihrer Herren vor dem eingeschüchterten Arbeitnehmer zu verteidigen. Ich starrte ebenso impertinent zurück und schnitt ihm das Wort ab, als er mit seinen Regeln und Vorschriften anfangen wollte. Teufel auch, gehörte ihm denn das ganze Geld? Minuten später, als ich wieder an die frische Luft kam, fiel mir etwas Merkwürdiges auf. Ich trat in den Schatten zurück.
Unmittelbar vor mir bestieg Jane Duval samt Kleinkind ein Schiff, nämlich den Zubringer zu dem kleinen Flugplatz auf dem Festland, von dem aus täglich einmal eine Passagiermaschine nach Athen verkehrte. Der Winzling hatte Mühe mit den Stufen der Mole. Ich schaute aus dem Eingang der Bank zu, wie das Schiff ablegte und aufs Wasser hielt. Im Haus Taylor tat sich ja allerhand.
Ich trat hinaus in die Sonne; schließlich ging mich das nichts an. Der Hafen wimmelte von Hippies. Ich stieg die mit Kopfsteinen gepflasterte Gasse zu den Cafés auf der Mauer hinauf und fand nur mit Mühe einen freien Stuhl. Kaum saß ich, da sah ich auch schon Georgina Taylor. Sie war aufgestanden und winkte mich zu sich. Bei ihr waren Sonny Duval und ein ganzer Haufen junger Leute, von denen eigentlich nur drei beschreibenswert sind: ein hochaufgeschossener, magerer Junge mit dicken Brillengläsern und kurzgeschnittenem Haar; ein blonder Adonis mit schläfrigem, benommenem Gesichtsausdruck unter einer Löwenmähne sowie ein Mädchen in einem formlosen Hänger, das à la Jane Duval schmollte. Offenbar gehörten sie zusammen. Jedenfalls starrten sie allesamt zu mir herüber, als Georgina mich zu sich winkte. Ich schüttelte den Kopf.
Nach philosophischen Erörterungen mit Jugendlichen war mir ganz und gar nicht zumute. Ich fragte mich, ob Sonny schon wußte, daß seine Alte die Kurve kratzte; wahrscheinlich nicht.
Ich bestellte Kaffee und fragte den Kellner nach der Toilette. Diese befand sich an der Rückwand des Cafés, praktisch in der Gasse, und war eine Art Butze mit nicht schließender Brettertür. Es stank dort infernalisch. Als ich wieder zum Vorschein kam, hörte ich Stimmen, eine Frau weinte.
In der Gasse flehte ein amerikanisches Hippiemädchen den schönen Girgis verzweifelt um Hasch auf Kredit an. Das Mädchen schniefte. Girgis, der recht gut englisch sprach, war zu dem Mädchen gemein und grob. Ich hörte mir das mißfällig an. Als sie weinend davongegangen war, fiel sein Blick auf mich.
»Sind Sie nicht reichlich derb mit der Kleinen umgesprungen?« fragte ich. »Bloß wegen einer Prise Hasch?«
Er musterte mich ziemlich impertinent und plusterte sich auf wie ein Gockel. Am liebsten hätte ich ihm eine gescheuert. Schließlich sagte er: »Sie hat einen Freund. Der schickt sie zu mir, weil er selber zu feige ist, mich anzubetteln. Und im übrigen wollte sie kein Hasch von mir, wie der Herr zu denken scheinen, sondern sie wollte meine Polaris für ein sogenanntes Picnic chartern. Und diese Picnics enden meist als Orgie. Ich habe für die Hippies nichts übrig, das beruht übrigens auf Gegenseitigkeit.«
»Braucht man einen Gewerbeschein, um hier auf der Insel mit Hasch zu handeln? Oder kann jeder damit anfangen?«
»Der Handel mit Hasch ist ungesetzlich, und deshalb lasse ich die Finger davon.«
»Könnte ich Hasch verkaufen, wenn ich welches bei mir hätte?«
»Die Polizei ist hier ziemlich scharf – wenn sie einen nicht kennt.« Er feixte.
»Bestimmt hat man’s leichter, wenn man sie kennt«, bestätigte ich. Obwohl er feixte, wirkte er gefährlich. Also blies ich mich entsprechend auf und feixte ebenfalls. Nun kam er näher.
»Sie sind wohl erst seit kurzem hier? Jedenfalls bin ich Ihnen noch nicht begegnet.«
»Ganz recht. Ein Neuankömmling. Ein Feriengast, aber im übrigen kein Neuling, glauben Sie mir.«
Diesmal musterte er mich genauer. »Sie wohnen im Haus Taylor.«
»Ganz recht.«
Er war noch größer als Sonny Duval und überragte mich um ein beträchtliches Stück, doch hätte ich ihm, ohne mich von der Stelle rühren zu müssen, einen vorzüglichen linken Leberhaken verpassen können. Er bleckte die Zähne in meine Richtung – grinsen konnte man es kaum nennen.
»In Athen heißt es, ein amerikanischer Rauschgiftschnüffler sei auf dem Weg nach Tsatsos.«
»Was Sie nicht sagen.«
»Tsatsos ist eine kleine Insel, hier wohnen nur wenig Menschen, und die halten selbstverständlich zusammen. Fremde sind hier nicht gut gelitten – ausgenommen Touristen, die ihr Geld ausgeben. Hier sind schon Leute spurlos verschwunden. Das Meer ist stellenweise recht tief, und wenn ich Sie wäre, würde ich ganz rasch die Kurve kratzen, Mr. …?«
»Davies. Aber das klingt ja wie eine Drohung!«
»Ich drohe nicht, ich gebe Ihnen einen guten Rat.« Er machte einen Schritt zurück, bleckte nochmals die Zähne und stolzierte davon, anmutig wie immer. Er durchquerte eine Sandwüste, die man vermittels eines Schildes zum Park erklärt hatte.
Am Ende der Gasse stieß ich auf Sonny Duval, der hier offenbar den Lauf der Dinge abgewartet hatte. Bei einer Schlägerei hätte er mir wohl beigestanden. Schon gefiel er mir besser.
»Ein ziemlich übler Bursche«, bemerkte er.
»Klar. Die sind alle gleich.« Schon gefiel er mir wieder weniger. Wen nannten die Leute nicht alles üble Burschen! Und man mußte es glauben, denn meist hatten sie sogar recht. »Na, trinken wir einen, Sonny«, sagte ich.
»Kann ich jetzt nicht. Ich muß mich um Jane kümmern.«
Ich schaute ihn an, sagte aber nicht, daß ich Jane hatte abfahren sehen. Offenbar wußte er das nicht.
Ich bestellte mir einen Scotch. Sonny erklärte mir noch den Weg zum Haus der Baronin oben am Berg, dann ging er.
Ich drehte das kühle Glas in der Hand, stülpte die Lippen vor und schaute ihm nach. Das ist eine Angewohnheit von mir. Wenn ich nachdenke, stülpe ich die Lippen vor, besonders bei unergiebigen oder bedrückenden Gedanken. Ich tue es auch, wenn ich allein bin.
8
Ich schaute auf den in der Hitze glühenden Hafen. Hier, aus dem Schatten gesehen, wirkte das Licht hart und grell. Irgendwas an dieser Insel fand ich eigenartig, aber was? Es gefiel mir nicht. Ich zahlte dem übellaunigen Kellner und ging.
Das Städtchen erhob sich ziemlich steil über dem Hafen, und ich stieg durch enge, mit Kopfsteinen gepflasterte Straßen bergan. Sowie ich das Ladenviertel hinter mir hatte, traf ich kaum noch auf Hippies. Die Sonne brannte auf die weißen Fassaden und auch auf mich. Es war still. Aus manchen Gärten quoll es grün über die Mauern, doch wirkte alles ausgedörrt und versengt, bereit, in Flammen aufzugehen, sobald jemand eine Zigarettenkippe über die Mauer würfe.
Das ansehnliche Haus der Baronin lag fast ganz oben. Es schien ehemals die Trutzburg der Insel gewesen zu sein, ein Piratennest, von dem aus ein Seeräuberchef den Handel der umliegenden Inseln terrorisierte. Die Mauern waren sehr dick und die Decken gewölbt. Zwischen Haus und Garten erstreckte sich noch ein Mauerteil mit Schießscharten, der Garten war sehr gut gehalten. Also keineswegs die Hütte einer bettelarmen Jungfrau.
Eine ungewöhnlich fette, watschelnde Griechin von knapp 25 Jahren ließ mich ein. Der Griechische Chor war bereits auf der Terrasse versammelt und trank Bloody Mary unter einer weinumrankten Pergola. Ich dachte: Etwas Tomatensaft auf meinen Whisky kann nicht schaden. Im Wohnzimmer hing ein Porträt der Hausherrin aus ihrer Jugendzeit, und darunter brannte ein Ewiges Licht. Es war hier dank der tiefen, schmalen Fenster so düster, daß das Ewige Licht fast gerechtfertigt schien – aber nur fast. Als junge Frau hatte sie jedenfalls atemberaubend ausgesehen, und offenbar lag ihr daran, das nicht zu vergessen.
»Hoffentlich überstehen Sie das Essen«, murmelte sie mir zu, nachdem ich sie begrüßt hatte. Anscheinend hatte sie schon mehr als eine Bloody Mary getrunken, und das stand ihr gut.
Das Essen verlief schlimmer als befürchtet. Hauptthemen waren die Hippies und das Rauschgift. Die vier ältlichen Tucken waren schwer auseinanderzuhalten, und daß alle das gleiche dachten, erleichterte es mir keineswegs. Den alten Herrn konnte man sich an dem gestutzten Haar merken, allerdings trug eine der Damen das ihre ebenfalls kurz. Der Alte war amerikanischer Diplomat im Ruhestand, und man nannte ihn Herr Botschafter, weil er früher einen solchen Posten innegehabt hatte. Botschafter Pierson. Er war nervös und redete wenig. Wäre er kein Diplomat gewesen, ich hätte ihn glatt für einen Süchtigen gehalten.
»Man muß weniger die jungen Leute fürchten als vielmehr das von ihnen eingeschleppte Rauschgift«, sagte eine der alten Damen.
»Wie wahr«, bemerkte der Botschafter.
»Rauschgift«, warf ich ein, »oder Haschisch?«
»Haschisch!« sagte die Alte. »Ist das etwa kein Rauschgift?«