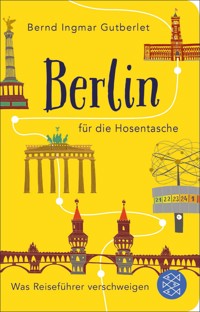Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Europa Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Bei aller Heimsuchung und allem Schrecken ist die Geschichte der Seuchen eine Erfolgs- und Fortschrittsgeschichte, und das nicht nur medizinisch. Unsere heutige Lebenserwartung verdanken wir nicht zuletzt den mit Pandemien gemachten Erfahrungen. Viele Seuchen schrieben sogar große Geschichte – im Guten wie im Schlechten. Während sich die Masern als unsichtbare Unterstützer bei der Eroberung der Neuen Welt einen unrühmlichen Namen machten, wurden gegen die Pocken zum ersten Mal Impfungen eingesetzt und wiederholte Cholera-Ausbrüche führten dazu, dass in den Städten verbesserte Hygienekonzepte Einzug hielten. Bei der Spanischen Grippe 1918 hingegen versagten die meisten Staaten beim Schutz der Menschen weitgehend. Viele Einzelaspekte aus der Seuchengeschichte kommen uns heute nur allzu bekannt vor: von Verschwörungstheorien und rabiaten Schutzmaßnahmen über Lockdown und Impfgegner bis hin zum mutigen und aufopferungsvollen Einsatz für Kranke und andere Leidtragende und der Fähigkeit, als Gesellschaft zusammenzustehen und der Herausforderung zu trotzen. Bei allem damit verbundenen Leid profitieren wir auch in der Corona-Pandemie von den Lehren aus der Seuchengeschichte. Durch die Rückschau auf vergangene, überstandene Pandemien bekommen wir einen Blick auf die Gegenwart, der nicht nur erhellend, abwechslungsreich und unterhaltsam, sondern auch bestärkend ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 460
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BERND INGMAR GUTBERLET
HEIMSUCHUNG
Seuchen und Pandemien –vom Schrecken zum Fortschritt
Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
© 2021 Europa Verlag in der Europa Verlage GmbH, München
Umschlaggestaltung und Motiv: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Bildnachweis: agefotostock / Alamy Stock Photo S. 118; Alamy Granger Historical Picture Archive / Alamy Stock Photo S. 197; Arndt, K.-H.: Die Pestepidemie von 1682/83 und ihre Auswirkungen auf Stadt und Universität Erfurt. Sonderdruck aus Beiträge zur Geschichte der Universität Erfurt (Bd. 18, S. 69) S. 50; Bundesarchiv, B 145 Bild-F025952-0024 / Gathmann, Jens / CC-BY-SA 3.0 S. 299; Bundesarchiv, Bild 183-09221-0003 / CC-BY-SA 3.0 S. 225; Bundesarchiv, Bild 183-1987-1112-016 / CC-BY-SA 3.0 S. 205; Eugen Holländer: Die Karikatur und Satire in der Medizin S. 43; Franklin Delano Roosevelt Library, Library ID 73113:61 S. 287; http://www.beloit.edu/~nurember/book/images/MiscellaneousS. 39; http://www.stampsx.com/auktion/artikel.php?artikel_id=20008811S. 121; https://unwritten-record.blogs.archives.gov/2018/03/13/the-1918-influenza-pandemic-photos/#jp-carousel-19868S. 264; https://www.reiss-sohn.de/en/lots/9454-A190-320/?sale_type=SOLD_AT_AUCTIONS. 125; Jochen Hick S. 328; Mesterb S. 46; Mill Valley Public Library, Lucretia Little History Room / Annual Dipsea Race S. 266; Pandemic Influenza: The Inside Story. Nicholls H, PLoS Biology Vol. 4/2/2006, e50 S. 247; Plakat DDR Bundesarchiv, Bild 183-84387-0001 / Schulz / CC-BY-SA 3.0 S. 296; Wikimedia Commons S. 69, 83, 104, 111, 148, 151, 188, 203, 209, 222, 224
Redaktion: Franz Leipold
Layout & Satz: Robert Gigler, München
Gesetzt aus der Crimson Text Regular und der DIN Next LT Condensed
Konvertierung: Bookwire
ePub-ISBN: 978-3-95890-427-9
Alle Rechte vorbehalten.
www.europa-verlag.com
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]
für Bodo
Inhalt
Vorwort
KAPITEL 1Die Pest – der Schwarze Tod kommt nach Europa
KAPITEL 2Seuchen begleiten Eroberer – mikrobielle Agenten in der Neuen Welt
KAPITEL 3»Vertilgt wäre unendliches Elend« – das Wirken der Pocken
KAPITEL 4Fleckfieber – aussichtsloser Kampf gegen einen winzigen Gegner
KAPITEL 5»Von den Sumpfregionen Asiens ist uns ein Feind zugeführt« – die Cholera
KAPITEL 6Tuberkulose – gehobenes Siechtum, verdienstvolle Leichen und fröhliche Mikrobenjagd
KAPITEL 7Die spanische Grippe – ein amerikanisches Virus?
KAPITEL 8Kinderlähmung – das Buch der Krankheit schließen
KAPITEL 9Aids – das Virus und die Moral
Nachwort
Literaturhinweise
Vorwort
O glückliche Nachgeborene, die ihr solches Leid nicht erfahren habt und unseren Bericht vielleicht zu den Fabeln zählen werdet!
Diese Worte richtete der italienische Dichter Francesco Petrarca vor beinahe 700 Jahren an die Nachwelt, in Trauer um seine an der Pest gestorbene Laura und angesichts der Schrecken des »Schwarzen Todes« im 14. Jahrhundert, deren Zeuge er wurde. Würden die zeitgenössischen Darstellungen dereinst nicht maßlos übertrieben wirken und der Schwarze Tod wie ein Schauermärchen? Petrarca konnte nicht absehen, dass die Pest zum Inbegriff einer Seuche werden würde, noch heute Gegenstand leidenschaftlicher Debatten der Fachwelt und bis in unsere Gegenwart stets Bezugspunkt für gesundheitliche Bedrohungen aller Art.
Geschichte mag sich aufs Vergangene beziehen, aber tot ist sie keineswegs. Noch vor ein paar Jahren konnte man Petrarcas Wehklage rhetorisch auffassen oder sich versuchen im Einfühlen in eine Zeit, die natürlich grausam war, aber doch sehr weit entfernt vom Erleben des verwöhnten spätmodernen Zeitgenossen. Doch im Lichte unserer gegenwärtigen Pandemie-Erfahrungen lesen wir diesen Satz Petrarcas ganz anders als noch vor ein paar Jahren, denn Seuchen sind nicht mehr ferne Fabeln längst vergangener Zeiten, sondern mit einem Mal gegenwärtig. Petrarca, Zeitgenosse des Schwarzen Todes, tritt uns, den Nachgeborenen, plötzlich wieder sehr nahe. Nicht nur seine schmerzerfüllte Klage berührt uns unmittelbarer, auch die Geschichte der Seuchen und Pandemien stellt sich aufgrund eigener Erfahrungen vollkommen anders dar als noch vor wenigen Jahren. Unser gegenwärtiges Erleben wirft Fragen auf: Kann der Blick zurück die Gegenwart erhellen? Finden sich im Schwarzen Tod vor fast 700 Jahren, im Ringen des vorletzten Jahrhunderts um die Pockenimpfung oder im Wüten der Spanische Grippe vor einem Jahrhundert Parallelen zu heute? Und von welchen Fortschritten aus der Vergangenheit profitiert das 21. Jahrhundert?
Im Coronajahr 2020 schien der gesamte Globus zunächst wie gelähmt angesichts des unerbittlich kreisenden Unheils, angetrieben von einem Virus, das plötzlich zuschlug und erst noch erforscht werden musste. Im Coronajahr 2021 sind zwar Impfstoffe verfügbar und hat eine gewisse Gewöhnung eingesetzt, doch je länger es dauert, desto ungeduldiger erwarten wir das Ende. Zudem hat uns, wenn wir ehrlich sind, diese erste Pandemie des 21. Jahrhunderts erkennbar zugesetzt, und das in einer Zeit ohnehin schwindender Gewissheiten und Zuversicht. In solcher Lage richtet sich der Blick auf Vergleichbares in der Vergangenheit und darauf, wie zu anderer Zeit die Menschheit mit Herausforderungen zurechtkam.
Wer heute ein Buch zur Pandemiegeschichte liest, tut das mit aktuellem Erfahrungshintergrund und ganz konkreten Erwartungen, die ältere Publikationen auch bei flüchtiger Überarbeitung nicht erfüllen können. Heimsuchung. Seuchen und Pandemien – Vom Schrecken zum Fortschritt wurde aus aktueller Perspektive geschrieben. Aus heutigem Blickwinkel ergeben sich neue Erkenntnisse, scheinen Parallelen und Muster auf, treten Ähnlichkeiten und Unterschiede hervor. Näher kommt uns die Vergangenheit außerdem, weil die Schauplätze des Buches (überwiegend) im deutschsprachigen Raum liegen und es erzählt, was (überwiegend) den Menschen hier widerfuhr. Grundlage dafür sind Lokal- und Einzelstudien zahlreicher Historiker.
Mit der Erfahrung einer weltweiten Pandemie erhält die Geschichte von Seuchen und Pandemien – zumal vor der eigenen Haustür – eine neue, lebensnahe Aktualität, und der Bezug zur Gegenwart ergibt sich ebenso von selbst, wie sich Tröstliches vermittelt. Denn so leidvoll Seuchen immer waren und trotz aller Rückschläge, ermöglichte das Bemühen, dem Schrecken etwas entgegenzusetzen, einen steten Fortschritt.
KAPITEL 1
Die Pest – der Schwarze Tod kommt nach Europa
Als die Seuche hereinbrach, war das 14. Jahrhundert knapp zur Hälfte vorbei. Mit einem glanzvollen kirchlichen Jubeljahr in Rom hatte es vielversprechend begonnen, doch dann folgte Unglück auf Kalamität. Man mag sich vorstellen, wie Anfang 1348 Zechbrüder in der Trinkstube nach einigen Schoppen einander aufzählten, was das 14. Jahrhundert schon alles über das christliche Europa gebracht hatte; mit genüsslichem Grausen, obwohl es sie in nüchternem Zustand zutiefst beängstigte: vom beispiellosen Mordversuch am Papst 1303, so zweifelhaft dieser Bonifaz VIII. auch gewesen sein mochte, von der bald folgenden »babylonischen Gefangenschaft« der Päpste in Avignon, wo sie nun schon seit Jahrzehnten unter Kuratel des französischen Königs standen, anstatt in Rom zu residieren, wohin sie gehörten. Außerdem der Skandalprozess gegen den Templerorden: War es da mit rechten Dingen zugegangen, oder hatte sich nur jemand am Ordensbesitz bereichern wollen? Was war mit all den Ketzern, die das katholische Dogma in Zweifel zogen? Die Ordnung der Kirche war dahin, ihre Einheit sowieso. Dazu kam das Wetter: Sintflutartige Regengüsse von den Alpen bis England den ganzen überaus kalten Sommer 1315 hindurch vereitelten nicht nur dem französischen König einen Feldzug und brachten Köln mitten im Sommer Schneefall. Allerorten wurde die Ernte zerstört, auch im Jahr darauf, weil Nässe bereits die Aussaat zunichtemachte. Die Weinlese erfolgte später und fiel knapper aus, in England wurden immer mehr Weinberge ganz aufgegeben. Und weil in Frankreich wegen des Wetters die Salzproduktion ins Stocken geraten war, fehlte andernorts das Mittel, um Lebensmittel haltbar zu machen. Die Preise nicht nur für Getreide stiegen immer weiter; in der Folge wurden weniger Tiere gehalten, was Fleisch zum raren Gut machte. Unausweichlich zog die größte Hungerkatastrophe des Spätmittelalters herauf und erfasste den größeren Teil Europas. Wer nicht Hungers starb, wurde krank: Ruhr, Antoniusfeuer (Ergotismus, Mutterkornvergiftung), Infektionen, vielleicht schon die Influenza. Es folgten beispiellos kalte und lange Winter, Hochwasser und Überschwemmungen. Die Lage entspannte sich zwar etwas nach der Ernte 1316, aber die Preise blieben hoch. In weiten Teilen Deutschlands litten die Menschen noch im übernächsten Jahr an Hunger und Krankheiten, und außergewöhnlich kalte Winter vermerkte man noch bis Ende der 1320er-Jahre – mit entsprechenden Folgen, wenn die Aussaat erst verzögert ausgebracht werden konnte, weil der Boden nicht auffror. In den Alpen waren Siedlungen in höheren Lagen gar nicht mehr zu halten. Und es ging weiter: Heuschreckenplagen waren in Mitteleuropa eher selten, doch im Sommer 1338 wurden weite Teile Süddeutschlands, von Bayern bis zum Rhein, von Heuschreckenschwärmen heimgesucht, die sich auf den Feldern an der Ernte gütlich taten. In den kommenden beiden Sommern wiederholte sich das Unglück, erneut wurde vielerorts gehungert. Schließlich wurde der Winter 1347 der kälteste seit vielen Jahrhunderten. (1348 sollte allerdings einen besonders warmen Sommer erleben, was die Trinkkumpane aber noch nicht wissen konnten.)
Politisch stand es um Europa kaum besser. Seit bereits zwei Jahrzehnten wütete der Hundertjährige Krieg zwischen England und Frankreich, und der war nur der größte zahlreicher Kriege und Feldzüge, die man unmöglich alle verfolgen konnte: Jedenfalls wollten die Kämpfe zwischen England und Schottland nicht enden, hatten die Hansestädte gegen dänische und norddeutsche Fürsten gekämpft, die Schweizer sich gegen die Habsburger gewehrt, zog im Baltikum der Deutsche Orden immer wieder gegen die neuerdings christlichen Litauer, und eben erst war der Grafenkrieg um die Vorherrschaft in Thüringen zu Ende gegangen. In der Mark Brandenburg herrschte Anarchie und das Raubrittertum grassierte, seit die Herrscherfamilie der Askanier ausgestorben und das Land führungslos war, ebenso wurden andere Gegenden von Aufständen, Revolten und Kämpfen erschüttert. Mochte es sich oft auch nur um innere Machtkämpfe einer kleinen Stadt oder den Aufruhr unwilliger Dorfbewohner handeln, so musste all dies in den Augen der Zeit doch höchst beunruhigend wirken. Denn dass die Ordnung derart wankte, konnte Gott nicht gefallen, zumal zur Sünde der Epoche die Sündhaftigkeit des Einzelnen hinzukam. Ob betrunken oder nüchtern, die vorgezogene Halbzeitbilanz des Jahrhunderts nährte die Furcht vor dem Kommenden, denn wenn Gott der Welt zürnte, war weiteres Unheil zu erwarten.
Und tatsächlich begann das Jahr 1348 mit einem schweren Erdbeben, das sich am Nachmittag des 25. Januar in Kärnten und im Friaul ereignete. Das Epizentrum lag bei Tolmezzo und Gemona, noch Hunderte Kilometer entfernt spürte man die nur zwei Minuten langen Erschütterungen von ungefähr Stufe 7 der Richterskala: bis Ravenna oder Prag, aber auch im süddeutschen Raum. Wochenlang kam es zu Nachbeben. Vorsichtigen Schätzungen zufolge starben rund 10 000 Menschen. Dass eine solche Naturkatastrophe, wie sie in der Alpenregion bis heute immer wieder vorkommt, die Europäer damals enorm beschäftigte, belegt die Fülle an zeitgenössischen Berichten, mehr als über andere Erdbeben zur Zeit des Mittelalters. Bis nach Krakau oder Lübeck schrieben Chronisten darüber, in Verona spürte Petrarca die Stöße, und im bayrischen Weihenstephan berichtete ein Benediktinermönch von einem Erdbeben, »wie man es seit dem Leiden Christi nie gehört oder gesehen hat«. Im Kärntner Kloster Friesach, nur 50 Kilometer vom Epizentrum entfernt, vermerkte ein Dominikanerbruder, neun von zehn Bewohnern des Städtchens Villach seien zu Tode gekommen. Die Stadt wurde zerstört, in der Umgebung traf es Burgen und Dörfer, Täler wurden von der Umgebung abgeschnitten. Ein Bergsturz am Dobratsch staute die Gail, Überschwemmungen verheerten die Gegend. Beobachtern schien es, als hätte die Naturgewalt eine vertraute Landschaft dauerhaft verändert; vielerorts hörte man Kirchenglocken von selbst läuten. Mindestens ebenso unheilvoll erschien den Zeitgenossen, dass selbst Gotteshäuser keine sichere Zuflucht boten, hatte doch in Villach die Pfarrkirche St. Jakob die betenden Gläubigen unter sich begraben. Ein solches Naturereignis betrachtete man als Vorzeichen für Schlimmeres, und tatsächlich: Während das Erdbeben noch die Menschen in Mitteleuropa beschäftigte, schickte sich ein weitaus verheerenderes Unheil an, Europa heimzusuchen: die Pest.
Handel und Bevölkerungswachstum – Voraussetzungen für die Pest
In heutige Begriffe gefasst, war der »Schwarze Tod« des 14. Jahrhunderts Auswirkung sowohl einer Vorstufe der Globalisierung (die nicht nur unsere Gegenwart prägt, sondern eine jahrhundertelange Vorgeschichte hat) als auch des Aufschwungs, den Europa in den Jahrhunderten zuvor genommen hatte. Globalisierung war damals natürlich noch kein Begriff, doch wie 2020 unsere vernetzte Welt von Handelswegen und Reiserouten die rasante Verbreitung des Coronavirus ermöglichte, war eine Voraussetzung für die Pestwelle Mitte des 14. Jahrhunderts, dass Europa regen Handel betrieb. Der Globalhistoriker Jürgen Osterhammel sprach von einem »eurasischen Kalamitätenzusammenhang« durch »Reiterkrieger und Mikroben«, der französische Mittelalterhistoriker Emmanuel Le Roy Ladurie von einer »globalen mikrobiellen Vereinigung« seit dem 14. Jahrhundert. Die Verbreitung der Pest seit dem Mittelalter zeigt, dass die Entwicklung zum »globalen Dorf« bereits eingesetzt hatte, wenn auch auf einem im Vergleich zu heute sehr bescheidenen Niveau, denn ohne den Handel zwischen Europa und Fernost hätte es der Erreger aus Asien nicht so weit bringen können. Es waren die Seehandelsrouten von der Krim nach Europa, entlang derer sich das Pestbakterium Yersinia pestis, das erst ein halbes Jahrtausend später entdeckt werden würde, ausbreiten konnte.
Die europäischen Handelsmächte dieser Zeit waren vor allem italienische Städte, allen voran die Rivalen Venedig und Genua. Ihre Handelsrouten verliefen zwischen Italien und dem Schwarzen Meer, von wo aus es nach Fernost weiterging durch das riesige Asien. Es wurde damals weitgehend von den Mongolen verschiedener Teilreiche beherrscht, die auf den verstorbenen Dschingis Khan zurückgingen. Der Kampf um politische Macht und Erträge aus dem profitablen Asienhandel – beides kaum voneinander zu trennen – lieferte dem Pesterreger einen zweiten Startvorteil: Kriege. Die Feldzüge der Mongolen, nicht zuletzt im Handelskrieg gegen Venedig und Genua, ermöglichten der Pest, sich aus Innerasien bis zur Krim im Schwarzen Meer zu verbreiten, über das seit mehr als einem Jahrhundert die wichtigsten Handelsrouten nach Innerasien verliefen. Im Südosten der Krim besaß Genua Niederlassungen, darunter den besonders wichtigen Handelsstützpunkt Kaffa, das heutige Feodossija, Umschlagplatz für den Handel nach Europa. Als im Herbst 1346 die Mongolen Kaffa wieder einmal belagerten, um der wenig zimperlichen Handelsmacht Genua direkt vor ihrer Haustür Einhalt zu gebieten, brach unter den Soldaten die Pest aus. Einer mindestens gut erfundenen Geschichte zufolge setzten die Mongolen Pestleichen als frühe biologische Waffen ein und beschossen damit die uneinnehmbare Festung. Die Seuche zwang sie allerdings bald zum Abzug. Auf welchem Weg auch immer, die Krankheit kam in die Stadt, und Schiffe der Genueser auf dem Weg in die Heimat hatten die Pest an Bord. 1347 infizierten sie Konstantinopel, das heutige Istanbul, dann im September Messina auf Sizilien, womit die Krankheit Europa erreichte, schließlich Marseille.
Neben der Vorstufe der Globalisierung ermöglichten weitere langfristige Veränderungen die Ausbreitung der Seuche: Die Blüte des christlichen Europa im Hochmittelalter beruhte nicht nur auf dem Aufschwung des Handels, sondern auch auf einer vorübergehenden Klimaschwankung mit mäßig höheren Temperaturen und einem rasanten Bevölkerungswachstum. Zwischen 1000 und 1300 n. Chr. verdoppelte sich die Zahl der Europäer auf 80, vielleicht 90 Millionen Menschen; in Deutschland lag die Zuwachsrate noch höher. Das hing mit der Gründung von Städten zusammen: Weiter entwickelte Regionen wie Flandern oder Frankreich gingen voran, weniger entwickelte wie Deutschland folgten. Leute vom Land und von weither strömten in die aufblühenden Städte, die Freiheit, Chancen und Wohlstand versprachen, und darüber hinaus mehr Abwechslung und Zerstreuung. Die Stadtbevölkerung Europas wuchs besonders rasch, obwohl die übergroße Mehrheit der Menschen weiterhin auf dem Land wohnte. Europa expandierte: nach innen durch die Erschließung von immer mehr Land sowie ostwärts über Elbe und Oder. Nicht nur war ein Mehr an Menschen mehr unterwegs, diese Epoche kam auch sonst zunehmend besser voran, immer häufiger auf Wasserwegen.
In den engen Städten ergaben sich jedoch auch Nachteile: Krankheiten konnten sich verbreiten, denn das Wachstum war stürmisch, der Platz innerhalb der Stadtmauern begrenzt, und Hygiene und Sauberkeit waren vollkommen unterentwickelt. In den Städten wohnte man damals sehr viel dichter aufeinander als heute: In der größten Stadt Deutschlands, Köln am Rhein, lebten damals geschätzte 40 000 Menschen auf nur vier Quadratkilometern, eine Bevölkerungsdichte doppelt so hoch wie die der heute dichtest besiedelten Stadt München. In anderen Städten des Spätmittelalters ging es noch enger zu. Längst nicht alle Städte verfügten bereits über gepflasterte Straßen, die sowieso nicht nur dem Verkehr und Alltagsleben, sondern ebenso der Abfallentsorgung dienten, ohne dass eine geordnete Müllabfuhr hin und wieder abgeholfen hätte. Häufige Klagen, Verbote und Verordnungen illustrieren die Missstände. Zwar ergriffen die Städte strengere Maßnahmen, wenn Krankheiten grassierten. Dann sollten Märkte sauberer werden und die Städter ihren Unrat nicht mehr unbekümmert auf die Gassen kippen. Wiederkehrende Klagen und Verordnungen zeigen aber, dass die Probleme bestenfalls punktuell und vorübergehend gelöst wurden. Ein weiteres Hygieneproblem war die Tierhaltung in den engen Städten, denn Mensch und Tier lebten dicht beieinander. Immer wieder gab es Beschwerden, weil Schweine frei herumliefen, manchmal gar auf den Friedhöfen. Nicht nur Kot verschmutzte die Gassen, oft genug lagen ganze Kadaver auf den Straßen. Kaum weniger abstoßend dürften die von bestimmten Gewerken geprägten Gassen gewesen sein, wenn deren Abfälle dort in größeren Mengen entsorgt wurden, man denke an Fleischer, Färber oder Kürschner. Zur Entsorgung in Privathaushalten dienten außer der Straße Abfall- und Fäkaliengruben auf dem eigenen Grundstück, notgedrungen in der Nähe der Brunnen. Und schließlich glichen Flüsse und Bäche oft Kloaken, weil sie den Unrat so bequem aus den Augen schafften.
Wieso waren Handel und Kriege, das Aufblühen der Städte und das Bevölkerungswachstum Voraussetzungen der Pandemie? Die genauen Übertragungswege der Pest des 14. Jahrhunderts sind bis heute nicht zweifelsfrei geklärt und noch immer Gegenstand leidenschaftlicher Debatten unter Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen, aber unbestritten geht die Pest von Nagetieren aus und trat wahrscheinlich in Zentralasien erstmals auf. Handel und Mobilität, Städteblüte und Bevölkerungswachstum ermöglichten die Verbreitung der Krankheit, weil damit die Hausratte sich verbreiten und infizierte Tiere den Erreger weitergeben konnten.
Pandemisch kann die Pest nur werden, wenn der Mensch dem Erreger assistiert, denn weder die Nagetiere noch ihre Flöhe haben einen ausreichend großen Aktionsradius. Ratten und Rattenflöhe bildeten die Brücke zum Menschen, weil die schwarze Hausratte in seiner Nähe lebte. Wenn infizierte Ratten massenhaft sterben, verfallen ihre Flöhe ersatzweise auf Menschen als Opfer – eine fatale Fügung. Dabei kommt dem Erreger zugute, dass er den Verdauungstrakt des (orientalischen wie europäischen) Rattenflohs blockiert, weswegen der Floh besonders viele Opfer sticht, da er nicht satt wird; zugleich gibt er besonders viel bakterielle Last weiter. Umstritten sind die Rolle des Menschenflohs und weiterer Floharten sowie die Frage, ob es in Europa überhaupt genügend Ratten gab, um den Pesterreger so effizient weiterzugeben. Inzwischen darf jedoch als gesichert gelten, dass das europäische Mittelalter über ein ausreichend großes Reservoir an Ratten verfügte, um dem Pesterreger zu assistieren. Die Hausratte stammt aus Südwestindien, woher die Römer ihren Pfeffer bezogen; und tatsächlich gab es seit der Antike überall da in Europa Ratten, wo die Römer waren. Zur weiteren Verbreitung dürften Seehandel (nicht ohne Grund firmiert die Haus- auch als Schiffsratte) und Getreidetransport beigetragen haben, ebenso Kriege. Parallel zum Aufschwung in Europa wuchsen ab dem 11. Jahrhundert die Rattenpopulationen vor allem in den Städten Europas. Allerdings waren sie Schwankungen unterworfen, und Historiker vermissten zeitgenössische Berichte über Rattensterben, die der Pest vorausgehen mussten, sowie entsprechende Skelettfunde bei Ausgrabungen. Doch die oft verdreckten Städte des Spätmittelalters, mit schmalen Gassen und eng bewohnt, sprechen ebenso für viele Ratten wie der Aspekt, dass die Kultivierung immer größerer Landflächen die natürlichen Feinde der Ratten dezimierte. Spärliche archäologische Befunde rührten wohl daher, dass winzige Rattenknochen leicht übersehen werden, zumal wenn man gar nicht danach sucht. Doch inzwischen hat die Archäologie nachgelegt. Dass von Ratten und Rattensterben wenig berichtet wurde, ist ohnehin kein Beweis, dass es keine gab. Man unterschied sie nämlich nicht von Mäusen oder Hamstern, und dass sie selten genannt werden, kann auch bedeuten, dass sie allgegenwärtig und daher nicht weiter erwähnenswert waren. Möglich auch, dass die Ratten eher unbemerkt verendeten, weil sie zum Sterben einsame Plätze wählten, um nicht von anderen Ratten aufgefressen zu werden. Dass Ungeziefer wie Flöhe und Läuse im Mittelalter zum Alltag gehören, ist belegt, auch archäologisch. Gesundheit und Sauberkeit hatten in den Augen der Zeit nichts miteinander zu tun, sauber hielt man eigentlich nur Körperteile wie Hände und Gesicht, weil sie sichtbar waren. Eine Verbindung zwischen dem Befall mit Flöhen und mangelnder Körperhygiene wurde aber nicht hergestellt, was ihre Verbreitung nur befördern konnte. Auch bei der Reinlichkeit der Kleidung kam es vorwiegend auf die sichtbaren Teile an; zwar setzte sich damals allmählich das Unterhemd durch, aber davon besaßen selbst reiche Leute nur eins oder zwei.
Der Schwarze Tod in Europa
1348 war nicht das erste Mal, dass die Pest Europa erreichte. Allerdings war die Justinianische Pest von Mitte des 6. bis Mitte des 8. Jahrhunderts längst kein Begriff mehr. Sie war nach dem oströmischen Kaiser Justinian I. benannt, der selbst daran erkrankte, aber wieder gesund wurde. Vor einigen Jahren konnte im bayerischen Aschheim der Pesterreger Yersinia pestis bei Seuchenopfern nachgewiesen werden. Das gelang im Fall einer anderen Seuche bislang nicht: der »Attischen Seuche« zu Beginn des Peloponnesischen Krieges 430 v. Chr., über die Thukydides, der Vater der Geschichtsschreibung, einen berühmten Bericht verfasste. Im überfüllten Athen, in das wegen der anstürmenden Feinde aus Sparta die Landbevölkerung evakuiert worden war, kam es zur Katastrophe. Thukydides war dabei nicht nur Zeitzeuge, sondern wurde selbst krank. Symptome, Verlauf und Folgen des loimos beschrieb er akribisch – so sehr, dass seine Schilderung bis ins 20. Jahrhundert stilbildend wirkte. Stets um größtmögliche Objektivität bemüht, aber nun mal kein Arzt, zumal nach modernen Standards, gab er den Medizinhistorikern Rätsel auf. Seine reichhaltig vermerkten Symptome lassen sich nämlich allen möglichen Infektionskrankheiten zuordnen, am wenigsten aber der eigentlichen Pest. Aufwendige retrodiagnostische Untersuchungen an Seuchentoten eines Athener Friedhofs haben vor einigen Jahren die Frage, woran die Athener damals in so großer Zahl starben, zwar nicht zweifelsfrei klären können; der Pesterreger aber konnte nicht nachgewiesen werden. Vermutlich wurden die Athener in ihrem Kriegsgeschäft von einer anderen Krankheit beeinträchtigt, vielleicht auch von mehreren zugleich.
Die eindrücklichsten Beschreibungen des Schwarzen Todes zwischen 1347 und 1353 stammen aus den italienischen Städten, die als Erste Opfer wurden. Weltberühmt (und wie Thukydides vorbildhaft für spätere Beschreibungen) ist die Schilderung der Ereignisse in Florenz von Giovanni Boccaccio. Sie bildet die Rahmenhandlung seiner Novellensammlung Dekameron: Zehn junge Florentiner fliehen vor der Pest aufs Land, wo sie einander Geschichten erzählen. Boccaccio berichtet von »gewissen Schwellungen« unter den Achseln oder in der Leistengegend, mit denen das Unheil begann und die »bis zur Größe eines Apfels oder eines Eies anwuchsen und vom Volk Pestbeulen genannt wurden«. Immer mehr Körperteile wurden erfasst. Ein anderes markantes Symptom waren schwarzfleckige Körperteile. »Die meisten starben innerhalb von drei Tagen nach den ersten Anzeichen, der eine früher, der andere später, und viele sogar ohne jegliches Fieber oder sonstige Krankheitserscheinungen.« Zum Schrecken trug bei, dass einerseits die Ärzte ratlos waren und kein Mittel dagegen kannten, andererseits die Krankheit aber hochinfektiös war und man sich kaum dagegen schützen konnte. In ihrer Verzweiflung reagierten die Menschen mit Isolation oder gesteigerter Genusssucht, sodass, wie Boccaccio beklagt, »die ehrwürdige Macht der göttlichen und menschlichen Gesetze in unserer Vaterstadt fast völlig gebrochen und aufgelöst« war. Andere brachten sich durch Flucht in Sicherheit, wenn sie die Möglichkeit dazu hatten. Die sozialen Verwerfungen waren brutal: »Doch der Schrecken dieser Heimsuchung hatte die Herzen der Menschen mit solcher Gewalt verstört, dass auch der Bruder den Bruder verließ, der Onkel den Neffen, die Schwester den Bruder und nicht selten auch die Frau ihren Mann. Das Schrecklichste, ganz und gar Unfassliche aber war, dass Väter und Mütter sich weigerten, ihre Kinder zu besuchen und zu pflegen, als wären es nicht die eigenen.« Das Sterben wurde einsam, und auch die Beisetzung geschah hastig und lieblos, oft ohne die Anwesenheit der Angehörigen. »Tag und Nacht verendeten Menschen auf offener Straße, und viele, die in ihren Häusern umkamen, taten, wenn nicht anders, erst mit dem Gestank ihrer verwesenden Körper ihren Nachbarn kund, dass sie tot waren. (…) Bei der Unzahl an Leichen, die Tag für Tag, ja Stunde für Stunde zu allen Kirchen gebracht wurden, reichte der geweihte Boden nicht aus für die Begräbnisse, und (…) hob man, als alles belegt war, rings um die Kirchhöfe große Gruben aus, in die man die unverhofft angekommenen Leichen wie Ware in den Schiffen, Schicht auf Schicht, nur mit wenig Sand bedeckt, zu Hunderten verstaute, bis schließlich die Gruben bis an den Rand gefüllt waren.« Der Horror der Zeitgenossen bestand nicht nur in der Angst, es mit einer Gottesstrafe zu tun zu haben. Kaum weniger verstörend war, wie die Seuche in eine Lebenswelt eingriff, die einen geradezu vertrauten Umgang mit dem Tod pflegte, die ihm am Lebensende nicht auswich, sondern ihn integrierte. Doch diesen menschlich milden und trostvollen Umgang mit dem Tod machte die Pest zunichte. Zu grausam wütete sie, zu schnell kam der Tod und in zu großer Zahl, als dass für die Rituale der Überlebenden noch Raum geblieben wäre. Als brutal und entmenschlichend musste die Pest daher auf die Zeitgenossen wirken. Wer in ungeweihter Erde massenbestattet wurde, keine letzte Beichte abgelegt und keine Sterbesakramente empfangen hatte, wen die Überlebenden nicht geordnet dem Tod übergeben konnten – wie würde es demjenigen im Jenseits ergehen?
Die Pest folgt den Handelswegen
So schnell wie heute verlief die Ausbreitung der Seuche nicht, weil die Reisegeschwindigkeit sehr viel geringer war, aber unerbittlich nahm das Unheil seinen Lauf. Da die Handelswege entscheidend waren, fächerte sich die Route der Pest auf: Während sie zum Beispiel Paris und London, aber auch Österreich und die Schweiz noch 1348 erfasste, war Deutschland ganz überwiegend erst 1349/50 an der Reihe. Nach Mitteleuropa drang die Pest zunächst von Süden über Österreich, die Schweiz und Bayern in nördlicher Richtung vor. In Österreich wurden selbst hoch gelegene ländliche Gebiete nicht verschont, in der Steiermark starben im Zisterzienserkloster Neuberg die meisten Ordensleute, und der Bau der Kirche des erst zwei Jahrzehnte alten Konvents musste wegen der Pest unterbrochen werden. Von Tirol aus erreichte die Pest im Herbst 1348 das Oberinntal, stoppte dann aber zunächst, vermutlich wegen des Winters. Eine der ersten deutschen Städte, die erfasst wurden, war im November 1348 über die Schweiz Konstanz am Bodensee, bevor die Seuche auch dort eine Winterpause einlegte. Im Frühjahr war mit Basel der Rhein erreicht, dann ging es, beschleunigt durch den Schiffsverkehr, nach Norden bis Frankfurt (Juli 1349), Mainz, Limburg und Köln (Ende 1349). Weiter östlich leistete die Donau der Verbreitung Vorschub: Wien, Passau und Regensburg wurden Mitte 1349 infiziert, ebenso Augsburg, München oder Mühldorf am Inn. Die weitere Ausbreitung in Deutschland erfolgte bald zusätzlich von den Küsten aus, in deren Häfen die Schiffe der gut vernetzten Hansestädte den Erreger befördert haben dürften, in Richtung Osten und Süden, wohl auch von östlichen Ostseehäfen westwärts. Der genaue Verbreitungsweg ist rätselhaft; möglicherweise kam es in Norddeutschland zur Kreuzung mehrerer Routen, darunter über die Seehäfen. England war bereits früh infiziert, und von dort fuhren Schiffe in Hafenstädte bis ins Baltikum und nach Russland. Der bei Hausratten offenbar sehr beliebte Stockfisch wurde über die nördlichen Häfen reichlich transportiert. Von Mitteleuropa zog die Seuche ostwärts, 1353 starben die letzten Opfer in Russland, bevor die Pest eine Pause einlegte.
In Straßburg wütete die Seuche im Sommer und Herbst, und der Chronist und Augenzeuge Fritsche Closener schrieb, in jeder Gemeinde seien Tag für Tag »sieben oder acht oder neun oder zehn oder noch mehr« Menschen gestorben, gar nicht eingerechnet die Toten der Klöster und der Hospitäler. So unzählig viele waren es laut Fritsche, dass die Grube am Hospital nicht mehr ausreichte und man weiter weg eine weitere graben musste. Innerhalb von wenigen Tagen nach Auftreten der Beulen starben die Menschen, manche gar schon am ersten Tag. Gegenseitig steckten sich die Leute an, und wenn die Pest ein Haus erfasst hatte, blieb es fast nie bei einem infizierten Bewohner. Um die Menschen nicht noch mehr zu ängstigen, wurde das Glockengeläut für die Toten verboten und untersagt, die Toten in die Kirchen zu tragen oder über Nacht zu Hause lassen. Entgegen der den Angehörigen teuren Bräuche mussten sie vielmehr umgehend begraben werden. Matthias von Neuenburg, Rechtsberater des Straßburger Bischofs und Chronist, schrieb von einem Sterben, wie man es seit der Zeit der Sintflut nicht gesehen habe. So ansteckend sei die Krankheit gewesen, dass man die Kranken ohne Sakramente sterben ließ, »Eltern sich nicht um ihre Kinder kümmerten und umgekehrt, die Gefährten nicht nach ihren Gefährten noch die Diener nach ihren Herren fragten« und infizierte Häuser leer standen, weil nach dem Tod aller Bewohner sich niemand mehr hineintraute.
Das Wüten des Schwarzen Todes ist für Deutschland weniger gut dokumentiert als etwa für Oberitalien. Die Vermerke der Stadtchronisten sind lückenhaft, mager und nicht allzu verlässlich; sie widersprechen auch mal zeitgenössischen Dokumenten über andere Vorgänge, die Rückschlüsse auf das Pestgeschehen erlauben, zum Beispiel Listen von neu aufgenommenen Stadtbürgern in den Jahren nach einer Pestwelle. Vielerorts ist umstritten, ob die Pest wirklich ausgebrochen ist, etwa im Fall von Würzburg und Nürnberg, ohne dass so recht erklärbar wäre, wieso bedeutende und daher gut vernetzte Handelsstädte verschont blieben. Dass Chronisten die Pest nicht erwähnen, muss aber noch nichts heißen. Obwohl es in der Rückschau merkwürdig erscheint, muss der Schwarze Tod nicht immer zu den Memorabilien gezählt worden sein. Als in späteren Zeiten die Pest zur ständigen Bedrohung geworden war, könnte mancher Chronist den Schwarzen Tod früherer Jahrhunderte gar nicht für eigens erwähnenswert gehalten haben. Auch abergläubische Furcht mag eine Rolle gespielt haben, als könne ihre Nennung die Seuche erneut heraufbeschwören.
Schon bevor die Pest Deutschland erreichte, waren die Nachrichten einer schrecklichen Krankheit mit Todeszahlen in monströser Höhe eingetroffen. Zwar war die Geschwindigkeit der Nachrichtenübermittlung damals geringer als heute, aber da dasselbe für die Ausbreitung von Seuchen gilt, war die Situation ähnlich: Die Kunde ging dem Leid voraus. Die Stadt Hamburg beispielsweise beklagte den Pesttod zweier ihrer Gesandten am päpstlichen Hof in Avignon, was dort laufende Verhandlungen unterbrach. Anfang 1350 erreichte die Pest Paderborn, Osnabrück und Minden, im Mai Bremen, Hamburg und Lübeck sowie zur gleichen Zeit Hannover, Halberstadt und Magdeburg. Als in Schleswig-Holstein vor allem 1350 die Pest Stadt und Land infizierte, kam als Infektionsroute sowohl der See- als auch der Landweg infrage. In Küstennähe erzählte man sich, die Pest habe das Festland übers Meer erreicht, auf einem führungslos treibenden Schiff, dessen Besatzung längst dahingerafft war – ein Topos, der sogar in die moderne Literatur und in aktuelle Filme Aufnahme fand. Noch im Frühjahr war Kiel an der Reihe, das Ende Juni 1350 beim Bremer Erzbischof Gottfried die Erlaubnis einholte, vor den Toren der Stadt beim Dorf Brunswik (heute ein Kieler Ortsteil) auf dem Grundstück eines Ritters einen Kirchhof mit Kapelle anzulegen. Aus Bremen berichtet in der Stadtchronik Herbort Schene als Augenzeuge, wie im Sommer 1350 pro Tag bis zu 200 Menschen der Seuche zum Opfer fielen. Ungeschützt lag die Stadt da, die Tore geöffnet, die Straßen verlassen, die Häuser menschenleer. Lübeck brauchte ebenfalls einen neuen Kirchhof vor den Stadttoren, denn wie in Hamburg explodierten dort im Sommer 1350 die Todeszahlen, wie sich an der Menge der Testamente ablesen lässt. Lübecker Bürger warfen Geld über die Mauer des Franziskanerklosters in der Hoffnung auf Fürbitten der Brüder. Daran erinnert noch heute eine Inschrift im Kreuzgang, denn mit den Spenden konnte der Konvent Reparaturen finanzieren. Auch andere Klöster und Hospitäler verzeichneten steigende Einnahmen, viele Bürger machten Stiftungen und schufen Stellen für Geistliche. In Lübeck starb offenbar rund ein Drittel der Ratsherren an der Pest, Schätzungen zufolge mehr als im Gesamtdurchschnitt der Stadt. Nachweisen lässt sich, dass unter den verstorbenen Hausbesitzern Vertreter solcher Gewerbe besonders betroffen waren, die Ratten anzogen, etwa Bäcker und Fleischer. Das deckt sich mit Befunden anderer Städte: Laut arbeitende Handwerker wie Schmiede hatten bessere Überlebenschancen, weil die Ratten den Lärm mieden. Ebenso lässt sich am Lübecker Beispiel verfolgen, wie die Städte nach dem Ende der Pestwelle Neubürger in hoher Zahl aufnahmen, um die Verluste möglichst schnell auszugleichen. Einbrüche im Handel verbuchten während der Pest insbesondere Kaufmannsstädte wie Bremen, Hamburg oder Lübeck, aber während sie danach meist einen raschen Aufschwung verzeichneten, waren die Folgen auf dem Land nachhaltiger. Vielerorts lagen Höfe und Dörfer wüst, sei es weil alle Bewohner an der Pest gestorben waren, weil Personalmangel die Weiterbewirtschaftung unmöglich machte oder weil die Überlebenden dem Werben der Städte folgten.
Wie groß die Bevölkerungsverluste im Einzelnen waren, ist so unklar wie umstritten. Durch die zeitgenössischen Schilderungen des Schwarzen Todes ziehen sich überall in Europa Todeszahlen in horrender Höhe. Sie sind mit Vorsicht zu genießen. Nicht nur bei der Pest neigten mittelalterliche Chronisten zum sorglosen Umgang mit Zahlen, vor allem wollten sie dramatische Verluste ausdrücken. Sowieso hielt sich ihr mathematisches Verständnis in Grenzen. Weder verfügte man über die Datenbasis, um mit Zahlenangaben verlässlich umzugehen, noch war man um korrekte Zahlen bemüht, wie wir es heute sind, sodass oft genug die Zahl der angeblich in einer Stadt an der Pest Gestorbenen die mutmaßliche Einwohnerzahl bei Weitem übersteigt. Doch abgesehen von übertriebenen Zahlen, stimmte der Eindruck der Chronisten wie des Straßburgers Fritsche, der vom »größten Sterben, das je gewesen« schrieb, andererseits betonte, die offenbar kursierende Zahl von 16 000 Toten sei übertrieben, überhaupt seien in Straßburg weniger Menschen an der Pest gestorben als in manch anderer Stadt. Die damalige Einwohnerzahl Straßburgs wird auf rund 20 000 geschätzt. In einer Bremer Quelle werden die Opfer der vier Pfarreien genau angegeben: 1816 Unser Lieben Frauen, 1415 St. Martin, 1922 St. Ansgar und 1813 St. Stephan, nicht eingeschlossen die Toten in den Straßen, außerhalb der Stadtmauer und auf den Kirchhöfen. Allerdings rätseln die Historiker über diese Zahlen, die weder zur Bevölkerungsstruktur noch zur weiteren politischen wie wirtschaftlichen Geschichte der Stadt so recht passen, denn bis zu 80 Prozent Todesrate hätte Bremen schwer getroffen. Die Bremer Neubürgerzahlen der Jahre nach dem Schwarzen Tod lassen eher vermuten, dass sehr viel weniger starben, denn in den Folgejahren blieb die Zahl der Zugezogenen meist unter 100 und lag selten doppelt höher als vor der Pest. Sowieso fehlte die Expertise, um so genaue Zahlen zu erheben, wie sie nach Pfarreien aufgeschlüsselt vorliegen. Kirchenbücher gab es damals noch nicht, Bremen besaß weder Arzt noch Apotheker, die in der Lage gewesen wären, Buch zu führen. Im konkreten Fall von Bremen waltete vermutlich eher operative Fantasie: Drastische Zahlen sollten bei späteren Finanzverhandlungen mit dem Erzbischof helfen, für die Stadt mehr herauszuholen.
Papst Clemens VI. ließ gar die verlockend exakt klingende Gesamtopferzahl von 42.836.486 Toten ermitteln, die jedoch genauso unrealistisch ist. Generell sind Bevölkerungszahlen für diese Zeit schlecht dokumentiert, noch am besten lassen sie sich für England ermitteln, wo wohl 40 Prozent der Menschen starben. Insgesamt dürften die Verluste je nach Land bei dramatischen 25 bis 40 Prozent gelegen haben. Eine damals häufig genannte Gesamtopferzahl entspricht heutigen Einschätzungen aber durchaus: Ein Drittel der Menschen seien an der Pest gestorben. Doch dürfte diese Angabe dem Neuen Testament entnommen sein, denn im achten und neunten Kapitel der Apokalypse des Johannes, geschrieben im 1. Jahrhundert, liefern sieben Engel Gottes mit sieben Posaunen die Begleitmusik dazu, dass jeweils »der dritte Teil« der Natur und der Schöpfung, der Geschöpfe und ihrer Werke vernichtet wird.
In jedem Fall war der Schwarze Tod der Jahre 1347–1353 der tödlichste Seuchenzug, den die Menschheit je erlebt hatte. Das stetige Bevölkerungswachstum, dessen Europa sich über die letzten 300 Jahre erfreut hatte, schwand dahin, und der Kontinent sollte sich davon für zwei Jahrhunderte nicht erholen – schon weil die Seuche immer wiederkam und zum ständigen Begleiter wurde.
Pest, Milzbrand oder Ebola?
Aber war der Schwarze Tod des Mittelalters überhaupt die Pest? Könnte es sich nicht um einen ähnlichen Irrtum handeln wie im Fall der »Attischen Seuche«, die Thukydides beschrieb? Tatsächlich gab es auch im Spätmittelalter keine so klaren Krankheitsdefinitionen, wie wir sie heute voraussetzen, noch waren die Begriffe eindeutig: Pest, lateinisch pestis, meinte wie schon der griechische Begriff loimos ganz allgemein eine Seuche und wurde erst allmählich spezifisch auf diese bezogen. (Gleichzeitig avancierte der Begriff zur Bezeichnung allen möglichen schlimmen Übels, was sich bis heute erhalten hat.) Bedeuten die mangelnde begriffliche Trennschärfe und weitere Ungereimtheiten wie die schon beschriebenen, dass wir einem Irrtum aufsitzen? Retrodiagnostik ist ein schwieriges Geschäft und der berüchtigte Schwarze Tod als medizinische Urkatastrophe durchaus attraktiv, um mit unerhörten Thesen zuverlässig Schlagzeilen zu provozieren. Nicht einfacher macht es die Tatsache, dass ganz unterschiedliche Wissenschaftsdisziplinen beteiligt und Forscher nicht notwendigerweise in allen Sachgebieten verlässlich trittsicher sind.
Die Forschung hat ja durchaus mit einigen Ungereimtheiten zu kämpfen: Dazu gehören Rattenpopulationen, klimatische Bedingungen für Flöhe, Seuchenintervalle, Symptombeschreibungen und anderes mehr. Dazu kommt noch, dass Seuchen ihr Gesicht verändern, weil die Erreger wandelfähig sind. Nimmt man zur Grundlage für die Einschätzungen des Schwarzen Todes die umfassend erforschte letzte Pestpandemie Ende des 19. Jahrhunderts, ergeben sich weitere Fragen. Vor einigen Jahren wurden deshalb fürs Mittelalter andere Seuchen ins Spiel gebracht, beispielsweise Milzbrand oder eine Ebolaähnliche Viruserkrankung, und der Beitrag von Ratte und Floh wurde grundsätzlich infrage gestellt. Die Debatte geht weiter, doch die Kenntnis einiger Fakten und Kontroversen erleichtert die Einordnung solcher und noch kommender Pestnachrichten: Wir wissen inzwischen aus Knochenanalysen von Pestkranken des 14. Jahrhunderts, dass damals tatsächlich der Erreger Yersinia pestis unterwegs war, und zwar in einer seither ausgestorbenen Variante. DNA-Untersuchungen lassen außerdem vermuten, dass die viel höhere Mortalität des Schwarzen Todes der besonderen Aggressivität dieses Pathogens zuzuschreiben ist. Seither wirken die andauernden Debatten eher wie Rückzugsgefechte der Pestskeptiker.
Boccaccio beschrieb im Dekameron die Symptome der Beulenpest, von der wir heute wissen, dass es nach dem Flohstich bis zu einer Woche dauern kann, bevor Symptome auftreten. Ohne Behandlung mit Antibiotika schnellt die Körpertemperatur des Kranken nach oben, sein Puls beschleunigt sich, und am Lymphknoten, der dem Biss am nächsten liegt, entsteht eine Beule, die faustgroß werden kann. Während sich der Erreger in Windeseile exponentiell vermehrt, kommen heftige Kopfschmerzen, Unwohlsein und quälender Durst hinzu. Vom Pestkranken und seinen Ausscheidungen geht jetzt ein extremer Gestank aus. Indem sie weiße Blutkörperchen abtöten, greifen die Bakterien das Immunsystem direkt an. Hält die Lymphbarriere des Körpers dem Bakterienangriff stand, besteht eine Überlebenschance, aber wenn der Erreger über die Lymphe ins Blut gelangt und die Pest septisch wird, besteht wenig Hoffnung. Es kommt zu Blutungen unter der Haut, die sich dunkel verfärben, was den Begriff Schwarzer Tod erklärt. Das multiple Organversagen zeigt sich im Gesicht des Kranken: Blässe, Muskelzuckungen, blutunterlaufene Augen, schwarz verfärbte Zunge. Das Fieber steigt weiter, Delirium setzt ein, dann folgen Koma und Tod. Die wenigen Überlebenden haben mit Langzeitfolgen zu kämpfen: Sprach- und Gedächtnisverlust, Teillähmungen, Taub- und Blindheit kommen vor. Nicht einmal eine dauerhafte Immunität bleibt ihnen.
Bei der reinen Beulenpest sterben 40 bis 70 Prozent der Infizierten innerhalb von fünf Tagen. Wenn die Lunge erfasst wird, tritt der Tod in weniger als drei Tagen ein. Die fast immer tödliche Lungenpest kann außerdem von Mensch zu Mensch per Tröpfcheninfektion übertragen werden, die Symptome sind dann die einer akuten Lungenentzündung mit blutigem Auswurf, heftigem Husten, hohem Fieber, Kopf- und Brustschmerzen. Eine dritte Form der Pest ist besonders selten, aber auch so gut wie immer tödlich: Die primäre septische Pest im Fall, dass der Erreger ohne Umweg über das Lymphsystem sofort in die Blutbahn gelangt. Welche Form der Pest im 14. Jahrhundert vorherrschte, ist ein weiterer Streitpunkt der Forschung.
Keineswegs ausgerottet, lässt sich die Krankheit längst mit Antibiotika gut behandeln, doch in drei langen Pandemien forderte sie weltweit viele Millionen Tote und schrieb Geschichte: Außer der Justinianischen Pest und der mit dem »Schwarzen Tod« beginnenden zweiten Pandemie von Mitte des 14. Jahrhunderts bis ins 18. Jahrhundert gab es eine dritte Welle Mitte des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts.
Den Schwarzen Tod des Spätmittelalters bezeichnen Historiker als »virgin soil«-Epidemie, weil die Menschen keinerlei Immunität besaßen und dem Erreger hilflos ausgeliefert waren – in einem anderen Sinne war er es auch, weil weder Maßnahmen entwickelt waren noch die Medizin in irgendeiner Weise helfen konnte. Über Erreger, Übertragungswege und Gegenmittel wusste man im 14. Jahrhundert nichts, entsprechend hilflos waren die Ärzte, als die Pest kam. Inzwischen kennen wir den Pesterreger Yersinia pestis, benannt nach dem Schweizer Arzt Alexandre Yersin, der ihn 1894 in Hongkong als Erster unter dem Mikroskop isolieren konnte. Das letzte Viertel des 19. Jahrhunderts war die Zeit der Mikrobenjagd, wobei ein hoher nationaler Konkurrenzdruck herrschte: Vor allem Louis Pasteur und Robert Koch und ihre jeweiligen Institute in Paris und Berlin lieferten sich Wettrennen, denn die Entdeckung wichtiger Erreger war damals eine Sache nationalen Wissenschaftsprestiges. Yersin arbeitete für Pasteur, zeitgleich suchte der Japaner Kitasato Shibasaburo, der zuvor bei Robert Koch in Berlin gearbeitet hatte, nach dem Pesterreger. Doch das 19. Jahrhundert lag noch in weiter Ferne, als der Schwarze Tod Europa infizierte.
Die mittelalterliche Medizin geht auf antike Vorbilder zurück, vor allem auf die Griechen Hippokrates von Kos (ca. 460 – ca. 370 v. Chr.), auch »Vater der Medizin« genannt, sowie seinen Jünger (oder Hohepriester) und kaiserlichen Leibarzt Galen (ca. 130 – ca. 216 n. Chr.), der Hippokrates nicht nur unsterblich machte, sondern die Unfehlbarkeit und Unveränderlichkeit seiner Erkenntnisse postulierte. Von moderner Wissenschaft kann dabei noch keine Rede sein, schon gar nicht von Bakteriologie, wohl aber von einem rationalen Ansatz im Verständnis von Krankheit. Das Mittelalter reicherte die antike Lehrmedizin mit christlichem Gehalt an. Krankheit konnte demnach durchaus eine Art Gottesstrafe sein, was Hippokrates allerdings als Ausrede Unfähiger bezeichnet hätte. Unsere Vorstellung von Krankheit als eine Art Programmierfehler und Abweichung von einer Norm von Gesundheit hätte Hippokrates ebenso abgelehnt, doch seine Bedeutung misst sich auch nicht an der modernen wissenschaftlichen Medizin, sondern sie liegt darin, dass er Magie und Aberglauben aus der Lehre von Krankheit und Gesundheit verbannte und stattdessen die aufmerksame Beobachtung des Körpers zur Erstellung einer Therapie vertrat. Das konnte weniger ausrichten als wissenschaftliche Medizin, aber eben mehr als die fatalistische passive Auffassung einer gottgegebenen Krankheit.
Grundlegend war die Viersäftelehre der Humoralpathologie, mit der auch die Pest erklärt wurde. Danach wirken im Universum vier Elemente mit den Eigenschaften trocken, nass, heiß, kalt. Ihnen entsprechen die vier Windrichtungen ebenso wie die vier Jahreszeiten – und eben vier Säfte, die im menschlichen Körper ausgewogen vorkommen müssen: Blut (heiß und feucht), Schleim (kalt und feucht), schwarze (trocken und kalt) und gelbe (trocken und heiß) Galle. Stimmt die Mischung nicht, ist der Mensch krank. Bei Hippokrates ist das ganzheitlich angelegt: Den vier Elementen entsprechen ebenso die vier menschlichen Grundtemperamente (melancholisch, sanguinisch, phlegmatisch, cholerisch) und die vier Lebensabschnitte. Als maßgebliche Ursache für Krankheit verstand er verdorbene Luft, die das Säftegleichgewicht des Körpers durcheinanderbrachte, und eine geeignete Therapie bestand darin, den Körper bei der Wiederherstellung dieses Gleichgewichts zu unterstützen. Das konnte von Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich ausfallen; es gab keine Standardtherapie für ein diagnostiziertes Leiden, zumal die Klassifizierung von Krankheit gar nicht im Vordergrund stand, sondern der individuelle Patient mit Körper und Seele und der Gesamtheit seiner Verfassung. Meist spielte die Ernährung für die Behandlung eine wichtige Rolle, ebenso Bewegung und Lebenswandel.
Wie aber erklärte man sich den plötzlichen Ausbruch einer unbekannten Krankheit, tödlicher als alles bekannte? Es war nicht so, dass der Mensch des Mittelalters ängstlich und gottergeben seinem Schicksal entgegensah. Wie wir es heute kennen, suchten die Mächtigen im Angesicht der verheerenden Seuche vielmehr den Rat von Experten. Berühmt wurde das Pariser Pestgutachten, das der französische König Philipp VI. noch im Herbst 1348 beim Ärztekollegium der Pariser Universität in Auftrag gab. So zweifelhaft es aus heutiger Perspektive erscheint: Damals entsprach es dem Kenntnisstand der Wissenschaft, die sich auf ehrwürdige Autoritäten von Aristoteles über Ptolemäus bis Avicenna und eben Hippokrates berief, deren Schriften sie zu Rate zogen. Die Fachleute befanden, eine Konjunktion von Saturn, Jupiter und Mars im Sternbild des Wassermanns im März 1345 sei der Ausgangspunkt des Übels gewesen. Diese astronomische Konstellation gab es wirklich, sie bewirkte laut Gutachten klimatische Veränderungen auf der Erde, die ein Übermaß an feuchten und warmen Südwinden hervorriefen, was wiederum der Atemluft eine krank machende Fäulnis einbrachte – den Pesthauch. Er wurde verstärkt durch die Aufnahme fauler und giftiger Dämpfe aus Sümpfen, Seen oder von Leichen, die nicht begraben wurden. Ein weiterer Faktor war der unübliche Verlauf der Jahreszeiten, namentlich ein warmer Winter, ein windiger Frühling und ein kühler Sommer. Rauchende Feuer färbten den Himmel gelb und die Luft rot; Blitze, Donner und Südwinde bewegten erdigen Staub und verbreiteten die krank machende Fäulnis. Jeder war gefährdet, da jeder die korrumpierte Luft einatmete. Weil sie auch von den Pestkranken selbst ausging, waren beim Umgang mit ihnen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Dass aber trotzdem nicht jeder an der Pest erkrankte, erklärten die Magister mit der individuellen Verfassung: Anfällig war, wessen körperliche Befindlichkeit ohnehin fatal zugunsten der warmen und feuchten Säfte verschoben oder generell gestört war.
Glieder der Kausalkette waren also aufeinanderfolgende Veränderungen von Planetenkonstellation, Klima, Wetter, Luftverhältnissen, Säfteverhältnis beim Menschen. Dem entsprachen die empfohlenen Maßnahmen, die sich sowohl auf die Luft als auch auf die Körpersäfte bezogen: Vor allem der richtige Lebenswandel diente der Vorsorge, ein Übermaß etwa an körperlicher Betätigung, Baden und Sex galt als schädlich. Ausgewogenheit und Mäßigung, lautete das Gebot, denn wer übertrieb, atmete notgedrungen zu viel der schädlichen Luft ein. Beim Baden sah man als Problem, dass es die Poren öffnete und damit ein Einfallstor für die vergiftete Luft entstand. Daneben empfahl sich eine Diät leicht verdaulicher, aromatisch gewürzter Speisen. Bedeutsam war zudem die seelische Verfassung, zu vermeiden waren negative Befindlichkeiten.
Als Therapie im Krankheitsfall empfahlen die Pariser doctores Aderlass zur Entgiftung sowie Medikamente gegen die schädlichen Säfte im Körper. Unter den empfohlenen Nahrungsmitteln waren Essig, Knoblauch, Sauermilch oder Sauerampfer, Gegengifte waren bestimmte Erden, Lärchenschwamm oder Smaragde sowie das Heilmittel der Zeit: Theriak. Positiv wirkten auch Kardamom, Safran, Zitronen, Kampfer oder Rosenwasser. Essig galt zwar als hilfreich, da der reichhaltige Genuss aber dem Magen nicht wohltut, empfahlen die Ärzte, mit anderen Stoffen entgegenzuwirken.
Zur Vorsorge empfahlen die Experten außerdem die Reinigung der Luft – oder gleich Luftveränderung, das heißt: Flucht, insbesondere aus Städten, vorzugsweise in Gegenden mit guter Luft, wenig Wind, ohne Sümpfe oder stehende Gewässer, nicht im Wald und nicht in tiefen Tälern. Während Südwind schädlich war, galt trockener und kalter Nordwind als besonders gesund. Ein weiterer Ratschlag betraf daher das Lüften: Bei geringem Luftzug sollte Nordluft eingelassen werden. Reinigen konnte man die Luft außerdem mit Feuer aus bestimmten Holzarten, trocken und duftend, am besten zur Mitternacht oder bei Sonnenauf- bzw. -untergang. Luftreinigend wirkten zudem alle möglichen Stoffe von Aloe über Muskat und Majoran bis zu Weihrauch.
Flieh früh, flieh weit, kehr spät zurück, fand als wirksamster Ratschlag weite Verbreitung, konnte allerdings nur befolgt werden, wenn Mittel und Gelegenheit dazu vorhanden waren – also folgten dem Rat insbesondere wohlhabende Patrizier, die neben ihren Stadthäusern auch Landsitze besaßen, auf die sie sich zurückziehen konnten wie die Eskapisten des Dekameron. Neben den fehlenden Mitteln konnten Verpflichtungen die rettende Flucht vereiteln. Von Stadtvätern, Ärzten und Geistlichen wurde erwartet, dass sie Maßnahmen trafen, Leiden linderten und Trost spendeten. Der Anteil der Geistlichen und der mittelalterlichen Pflegekräfte, die an der Pest starben, war in der Tat besonders hoch, aber es gab auch viele schwarze Schafe unter Pfarrern und Ärzten, die verschwanden und erst zurückkehrten, nachdem die Pestwelle überstanden war.
Ganz am Ende erst und geradezu pflichtschuldig eingefügt wie das Leninzitat in einer DDR-Dissertation verweisen die Gutachter der Pariser Universität noch darauf, dass Epidemien auch auf göttliches Wirken zurückgehen können, weshalb Demut angezeigt sei. Das Weltliche war dem Mittelalter nie genug, zur Deutung der Welt und der Ereignisse zog man stets den Glauben heran. Dieser religiösen Argumentation folgte 1350 auch der Regensburger Domherr Konrad von Megenberg und vertrat die Ansicht, es handele sich bei der Pest um Gottes Strafgericht über eine sündhafte Krisenzeit. Er konstatierte Sittenverfall und eine verfehlte Wissenschaft, die in ihrer Hybris mehr anstrebte als geboten und damit das Ketzertum begünstigte und die gottgefällige Ordnung der Welt durcheinanderbrachte. Es war gewissermaßen die gelehrte Version der Trinkbruderklage. Viele befanden, schon wegen der Sündhaftigkeit der Welt und ausweislich zahlreicher Bibelstellen, die Hunger und Seuchen ja schließlich als Strafen Gottes anführten, müsse der Allmächtige am Werk sein. Helfen konnte folglich der Versuch, Gott milde zu stimmen: durch Umkehr zum gottgefälligen Leben, durch Reue und Buße. Denn wenn hier Gott waltete, konnten Ärzte wenig ausrichten. Und so räsonierten medizinisch hilflose Ärzte in Traktaten, wie der Augsburger Stadtmedicus Ambrosius Jung, dass der Schöpfer die Menschen für ihre Sündhaftigkeit »strafen wollt mit pestilentz«. Dann war die beste Medizin, fromm zu sein, Reue und Buße für Sünden zu leisten. Es war auch die beste Möglichkeit, die Ratlosigkeit der Ärzte zu kaschieren.
Mit welchen Maßnahmen man aufs näher rückende Unheil reagierte, zeigt anschaulich das Beispiel des elsässischen Straßburg. Die bedeutende Handelsstadt verfügte über ein Botennetz und war stets gut informiert; erste Nachrichten einer unbekannten tödlichen Krankheit trafen wohl im Herbst 1348 aus Köln und der Schweiz ein. Nachdem die Pest mit Basel die unmittelbare Nachbarschaft des Elsass erreicht hatte, tauchte eine Gruppe auf, die im Vorfeld der Pest zu dieser Zeit häufiger in Erscheinung trat: die Geißler oder Flagellanten. Sie sind keine Erfindung der Pestzeit, aber die Seuche verschaffte ihnen Konjunktur. Geißlergruppen zogen von Stadt zu Stadt und büßten durch Selbstgeißelung ihrer nackten Oberkörper stellvertretend für die Sünden anderer – was dann gegen die drohende Pest zu helfen versprach, wenn ein den Sündigen zürnender Gott die Krankheit geschickt hatte. Und wenn es nicht half, verschaffte es den Reuigen wenigstens eine bessere Position im Jenseits. Der Kirche waren die Geißler nicht geheuer, weswegen sie auch recht bald gegen sie vorging, denn zu viel Selbstinitiative seitens der Gläubigen konnte dem Apparat gefährlich werden. Für Straßburg berichtet Matthias von Neuenburg, Mitte Juni 1349 seien 700 schwäbische Geißler in die Stadt gekommen. Mit Kreuzen vorn und hinten auf ihren Kleidern und dem Hut sowie angehängten Geißeln »bildeten sie unter Zulauf des Volkes einen weiten Kreis, in dessen Mitte sie sich entkleideten, Kleider und Schuhe ablegten und die Hemden hosenartig vom Schenkel bis zum Knöchel um sich schlagend herumgingen. Einer nach dem andern warf sich in diesem Kreise wie ein Gekreuzigter zu Boden und jeder von ihnen berührte im Vorübergehen den Hingestreckten mit der Geißel. Die letzten, welche sich zuerst niedergeworfen, standen zuerst wieder auf, schlugen sich mit Geißeln, welche Knoten mit vier eisernen Stacheln hatten, und zogen, in deutscher Sprache zum Herrn singend, unter vielen Anrufungen vorüber. In der Mitte des Kreises standen drei laut Vorsingende, welche sich dabei geißelten, ihnen sangen die anderen nach. Nachdem sie dies lange so getrieben, beugten auf ein gegebenes Zeichen alle die Knie und fielen wie Gekreuzigte unter Schluchzen und Beten auf das Antlitz. Darauf gingen die Meister im Kreise umher und mahnten sie, den Herrn anzuflehen um Barmherzigkeit für das Volk, für ihre Wohltäter, für ihre Feinde, für alle Sünder, für die im Fegefeuer Befindlichen und noch viele andere. Darauf erhoben sie sich und sangen kniend und mit zum Himmel erhobenen Händen. Endlich standen sie auf und geißelten sich lange im Herumgehen wie vorher (…)« Die Bürger Straßburgs nahmen die Geißler freudig auf, luden sie zu sich ein und versprachen, dem Aufruf entsprechend den Lebensjahren Jesu 33 ½ Tage lang Folge zu leisten.
Minderheiten als Sündenböcke – die Suche nach den Ursachen
Neben einer Ursachenforschung in Sachen eigener Sündhaftigkeit standen noch vor Ankunft der Seuche alle möglichen Schuldzuweisungen und die Suche nach Sündenböcken im Vordergrund. Vielerorts starben die ersten Opfer nicht an der Seuche, sondern wurden als ihre angeblichen Urheber umgebracht, noch vor Eintreffen der Geißler oder der Pest – wenn die überhaupt kam. Die vermeintlich Schuldigen konnten anfangs politische Gegner oder unliebsame Gruppen aller Art sein, doch rasch gerieten die Juden ins Zentrum der Beschuldigungen. So behaupteten die Nachrichten, die Straßburg vorab von der Pest erhielt, hier oder dort habe man den Juden unter Folter Geständnisse abgerungen oder bereits ganze jüdische Gemeinden ermordet oder vertrieben. Es lief hinaus auf die unselige Vorstellung einer jüdischen Weltverschwörung, durch Vergiftung der Brunnen (von der schon Thukydides aus Athen berichtete, wo angeblich die gegnerischen Peloponnesier die Brunnen der Stadt vergiftet hatten) die Christenheit auszurotten. Volkszorn gegen Juden ließ sich leicht entfachen, denn sie waren die größte und bedeutendste der Minderheiten, denen man die Rolle zum Nachteil auslegte, in die man sie gepresst hatte: die der allenfalls gelittenen Randgruppe. Religiöse Vorbehalte, niedriger Bildungsstand und wirtschaftliche Interessen taten ein Übriges. Die Informanten Straßburgs äußerten sich mal mehr, mal weniger skeptisch über den Wahrheitsgehalt der Beschuldigungen, aber die Rede war auch von angeblich beteiligten Straßburger Juden, und so entschied man im Januar 1349 in der elsässischen Metropole, gegen sie vorzugehen. Tatsächlich ging es dabei aber weniger um die Pest als vielmehr um die politischen Machtverhältnisse in der Stadt, was die Straßburger Juden auf sehr tragische Weise zweifach zum Spielball werden ließ. Die Nachrichten über ihre angebliche Verantwortung für die Pest nahm die Stadt zum Anlass, zunächst zwar einige Juden hinzurichten, aber die Gemeinde insgesamt zu verschonen. Im innerstädtischen Konflikt trug das jedoch dem Stadtrat den Vorwurf ein, für den bloßen Anschein gehandelt zu haben, tatsächlich aber von den Juden bestochen worden zu sein, damit nicht alle ermordet wurden. Zum Verhängnis wurde den Juden das folgende Bündnis zwischen Adel und Fleischerzunft, die nach mehr politischem Einfluss in der Stadt strebten. Sie entfachten den Volkszorn und erzwangen den Rücktritt mehrerer städtischer Würdenträger. Kurz darauf bauten die Straßburger Christen ein Haus, gaukelten den Juden vor, sie würden lediglich vertrieben, nur um sie dann bis auf wenige Ausnahmen in das Haus zu sperren und zu verbrennen. Während der so bewerkstelligte politische Umsturz erfolgreich war, das Vermögen der Juden aufgeteilt und alle Schulden bei ihnen gestrichen wurden, entging die Stadt der Pest aber keineswegs.
Verbrennung der Juden bei lebendigem Leib vor den Mauern der Stadt
Ende 1349 fielen auch die Nürnberger Juden den Verfolgungen zum Opfer. Schon Monate zuvor waren Stadtväter und Karl IV. über die Verteilung der Beute einig geworden: Ganz offensichtlich also war das Pogrom zum Zwecke der Bereicherung inszeniert worden, wie dies auch in anderen Städten geschah. Ausdrücklich gestatteten oder befahlen gar diverse Landesfürsten die Ermordung derer, die eigentlich unter Schutz standen. Der Papst hingegen verurteilte die Verfolgungen ebenso scharf wie zahlreiche zeitgenössische Beobachter, die auf die Unsinnigkeit der Anschuldigungen hinwiesen, da doch die Juden genauso an der Pest starben wie die Christen.
In geringerem Ausmaß traf es auch andere Ausgegrenzte, darunter Aussätzige, Ketzer, Muslime oder Slawen, später auch Bettler, fahrendes Volk und andere an den Rand der Gesellschaft Gedrängte. Für die Juden des 14. Jahrhunderts vor allem in Deutschland aber bedeutete die Verfolgung während des Schwarzen Todes den Untergang der meisten Gemeinden. Ungezählte starben, viele der Überlebenden wanderten aus, häufig nach Polen, wo sie damals willkommen waren. In der jüdischen Geschichte Europas war dies die größte Katastrophe vor der Shoah des 20. Jahrhunderts.
Die ersten Schutzmaßnahmen
Nach dem Schwarzen Tod zog sich die Pest für ein paar Jahre aus Europa zurück, kehrte anschließend aber wieder und wieder zurück, ungefähr einmal in jeder Generation, allerdings weniger tödlich als Mitte des 14. Jahrhunderts. Sie wurde zu einer ständigen Bedrohung, konnte jederzeit ausbrechen und forderte auch in abgeschwächter Form einen hohen Blutzoll. Doch bei allem Schrecken trat eine gewisse Gewöhnung ein, während sich gleichzeitig bestimmte Schutzmaßnahmen durchsetzten. Die bekannteste davon ist die Quarantäne, die Ende des 14. Jahrhunderts in Ragusa (heute Dubrovnik), einer venezianischen Hafenstadt, erstmals eingeführt wurde. Hoch im Kurs standen außerdem Maßnahmen der Luftreinhaltung oder -reinigung, indem man besonders wohlriechende – oder abstoßende – Substanzen verbrannte. Standard wurde auch, Städte abzuriegeln und die Kranken zu isolieren. Selten gelang die Umsetzung der Maßnahmen aber so rigoros wie geplant. Stadttore etwa waren keine hermetischen Gefängnistore, sondern in etwa so durchlässig wie das Nachtportal eines Teenager-Internats. Die Isolierung pestbefallener Häuser wurde von den Bewohnern häufig durchbrochen, weil sie Geld verdienen mussten.