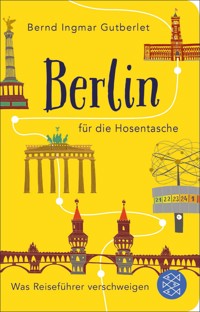Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Europa Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Gab es einmal eine Päpstin? Hat Nero die Stadt Rom angezündet? War die Mondlandung gestellt? Populäres historisches Wissen auf dem Prüfstand: Gefälscht und geschummelt wurde und wird immer, häufig liegt es gar nicht in der Absicht der Urheber, sondern ist mangelndem Wissen oder Vorurteilen geschuldet. Besonders schillernd und gefährlich wird das Fälschen bei Verschwörungstheorien, die sich gegenwärtig leider einer verstärkten Beliebtheit erfreuen. Sie zu entlarven, ist besonders wichtig, denn sie verzerren die Wahrheit ganz bewusst und mit der gezielten Absicht, andere zu manipulieren. Ansonsten entwickeln sie schnell ein Eigenleben – bis ihr Wahrheitsgehalt als selbstverständlich vorausgesetzt wird. Diesem Buch gelingt zweierlei: Es spürt vergnüglich durch die Jahrhunderte hindurch der unterhaltsamen Vielfalt des Falschen nach und dient gleichzeitig dazu, uns zu sensibilisieren und zu "immunisieren", um der Instrumentalisierung von Geschichte nicht auf den Leim zu gehen und stattdessen an den richtigen Stellen skeptisch zu werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 349
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
BERND INGMAR GUTBERLET
»Sollen sie doch Kuchen essen!«
Verleumdungen, Fälschungen und Verschwörungsmythen der Geschichte
Inhalt
Wenn unser Bild von der Vergangenheit trügt
Verleumdungen
Untergang auf Raten
Rufmord durch die Bibel
Cäsarenwahn und Perversion
Was nicht sein darf
Das verrufene Mittelalter
Vom Totalitären des Glaubens
Haudrauf, Haudegen, Hallodri
Von Geheimwissen und Gier
Verrat oder Verleumdung
Das Vorbild aller Vampire
Vom undankbaren Enkel schlechtgeredet
Der Marquis und die Jesuiten
Schöne Fassaden für die geliebte Zarin
Das schlechtgeredete Geschlecht
Ungeliebt und kühl verabschiedet?
Tropischer Samen, imperialistische Fänge
Märchenhafte Bauwut
Schuldzuweisungen unter Diktatoren
Von Hinfälligkeit und Weichenstellung
Staatsstreich im Kreuzfeuer
In heikler Mission
Fälschungen
Der erschlichene Kirchenstaat
Stammbaum-Lyrik fürs Ahnenrenommee
Die harte Währung heiliger Knochen
Erschwindelte Freiheit
Erzfälschung für den Ruhm
Herrscherliche Geschäfte mit Söldnern
Das Kriegskalkül des Diktators
Ein Medienskandal erster Güte
Fälschen statt Zahlungsunfähigkeit
Eine Revolution wird gekapert
Verschwörungsmythen
Ein Geheimbund mit Absichten
Hinterrücks und hinterhältig
Das stets wirksame Gift des Antisemitismus
Zeitenwende mit Erklärungsbedarf
Einzeltäterthese gegen Verschwörungsglaube
Hollywood auf dem Mond
Blutiges Herbstende
Literatur
Der Autor
Wenn unser Bild von der Vergangenheit trügt
Vergangenheit hat Zukunft. Was sich anhört wie ein zweifelhafter Wahlslogan, ist ein vielfach zu beobachtendes Phänomen: die Konjunktur von Geschichte außerhalb der rein akademischen Fachwelt. Die Vermittlung von Geschichte an eine breite Öffentlichkeit, von »E« bis »U«, also seriös bis unterhaltsam, hat viele, mitunter sogar kuriose Facetten: historische Filme, mal lehrreich, mal bloß spannend; anspruchsvolle oder reißerische Romane, die in näherer oder fernerer Vergangenheit spielen; Freizeittrends wie Mittelaltermärkte; die Nachstellung von Schlachten durch Reenactment-Fans; die Paläo-Diät, die Nahrung der Steinzeitmenschen als lifestylige Ernährungsweise empfiehlt. Sucht man nach Beispielen für den Einsatz der Geschichte in allen möglichen Spielarten, findet man immer mehr.
Doch die Vergangenheit hat ihre Tücken. Denn nicht alles, was Filme zeigen, Geschichtslehrer gelehrt haben oder auf andere Weise in unser historisches Allgemeinwissen eingegangen ist, entspricht den Tatsachen. Auf dem Schauplatz der Geschichte tummeln sich nämlich ungezählte zweifelhafte Berichte, Gestalten und Objekte. Da gibt es die mittelalterliche Chronik, die es mit der genauen Beschreibung der Verhältnisse ganz offensichtlich nicht allzu genau nimmt. Oder den zeitgenössischen Politiker, der mittels eigener Feder an dem Bild retuschiert, das die Nachwelt von ihm bewahren soll. Da findet sich die Legende, die über Jahrhunderte in der öffentlichen Meinung ihr (Un-)Wesen treibt. Oder die wichtige Urkunde, die Generation um Generation für echt hielt – bis sie sich eines Tages als Fälschung entpuppte. Schließlich gibt es Verleumdungen, an denen eisern festgehalten wird, sowie Verschwörungsmythen, die »alternative Fakten« propagieren, als könne man sich die Tatsachen aussuchen. Und dann wären da noch große Helden der Geschichte, die gar nicht existiert haben oder alles andere als heldenhaft waren; Lebenslügen, die ganze Nationen irreleiten; oder Anekdoten, die so hübsch sind, dass man sie für unbedingt wahr halten möchte. Und schließlich Forschungskontroversen, deren Verlauf mitunter spannender ist als das Thema, an dem sie sich entzündet haben. Die Liste ist lang.
Für manches Falsche ist die geschichtswissenschaftliche Zunft selbst verantwortlich. Warum sollte es der Geschichtsschreibung auch besser ergehen als anderen Wissenschaften? Fehler schleichen sich ein und setzen sich fest. Eitelkeiten, unsauberes Arbeiten, die Lust an gewagten Theorien oder politische Interessen führen zu Ergebnissen, die späterer Überprüfung nicht standhalten. Neue Beweismittel tauchen auf, die alles verändern. Und nicht zuletzt bewirkt in unserer spätmodernen Mediengesellschaft die Gier nach Sensationen und aufsehenerregenden Entdeckungen, dass bloße Hypothesen und Meinungen vorschnell als gesicherte Erkenntnisse gehandelt werden, und verleiht mediale Aufmerksamkeit zweifelhaften Theorien den Rang wissenschaftlicher Ergebnisse. Viele volkstümliche Legenden und zahllose Mythen bilden sich aber auch ohne Zutun der Historiker heraus, werden weitererzählt und sind alsbald nicht mehr totzukriegen. Harmlose, illustre Geschichten werden ebenso gerne zum Besten gegeben wie gefährliche Verschwörungstheorien. Beide entwickeln ein Eigenleben – bis ihr Wahrheitsgehalt als selbstverständlich vorausgesetzt wird.
Der Ahnherr der neueren deutschen Geschichtswissenschaft, Leopold von Ranke, hat vor zweihundert Jahren den Historikern ein Ideal vorgegeben: Sie sollten die Vergangenheit beschreiben, »wie es eigentlich gewesen«. Wer sich als Laie für Geschichte zu interessieren beginnt, stößt denn auch auf Schlagworte wie »Rekonstruktion der Vergangenheit« oder »historische Wahrheit« – Begriffe, die vorgeben, man könne per Geschichtsschreibung gewissermaßen die Kamera auf das halten, was von der Vergangenheit übrig ist, und erhielte so eine Art authentischen Film über den Hergang. Wir wissen natürlich, dass das unmöglich ist, denn die historische Wahrheit ist eine Schimäre. Geschichtsschreibung versucht vielmehr, der Vergangenheit nahezukommen, aber immer in der Gewissheit, eben nur eine Annäherung zu erreichen.
Geschichte sagt außerdem mindestens ebenso viel aus über die Zeit, die sie beschreibt, wie über die, aus deren Perspektive sie beschrieben wird. Der Preis für die Wiederbelebung der Vergangenheit ist ein gewisses Maß an Auslegung, Gewichtung und Einfärbung. Historiker arbeiten nicht nur mit Quellen, sie setzen überdies ihre Kreativität ein, ihr Vorstellungs- und Einfühlungsvermögen. Das ist stets eine Gratwanderung.
Irrtümer und Kontroversen, Lügen und Fälschungen, Legenden und Verschwörungsmythen in der Geschichte: Das ist das Thema dieser Buchreihe. Der vorliegende erste Band Sollen sie doch Kuchen essen! befasst sich mit Verleumdungen in der Geschichte, mit Fälschungen und Verschwörungsmythen. Das sind drei gewichtige Kategorien, die viel Unheil angerichtet haben und weiterhin anrichten. Gefälscht und geschummelt wird immer, aber die Urheber von Fälschungen, Verleumdungen und Verschwörungsmythen tun das nicht immer in voller Absicht, mitunter hat es auch mit mangelndem Wissen zu tun oder mit Vorurteilen – so bei den unzähligen Fällen von übler Nachrede gegenüber Frauen fast die gesamte Geschichte hindurch. Einem Zweck dient es in jedem Fall: was die Frauen angeht, so vor allem den Männern, die ihre Macht nicht teilen wollen. Besonders schillernd und gefährlich wird das Fälschen bei Verschwörungsmythen, die sich in unserer Gegenwart leider einer verstärkten Beliebtheit erfreuen. Sie zu entlarven ist besonders wichtig, denn Verschwörungsmythen treiben zu allen Zeiten Schindluder mit der Wahrheit, um ihr eben nicht zu dienen, sondern sie in böser bis teuflischer Absicht zu verfälschen. In vielen Fällen wurde Geschichte politisch missbraucht – und das geschieht bis heute ständig. Die Verfälschung von Geschichte für politische Zwecke hat gegenwärtig sogar Hochkonjunktur, wenn Regierungschefs überall in der Welt mit bemerkenswerter Dreistigkeit die Geschichte für ihre politischen Absichten und Pläne missbrauchen, als wäre die Vergangenheit ein Stück Knetmasse, das sich nach Belieben formen ließe. Daher möchte dieses Buch zweierlei: zum einen durch die Jahrhunderte hindurch der unterhaltsamen Vielfalt des Falschen vergnüglich nachspüren und zum anderen immunisieren, um der Instrumentalisierung von Geschichte nicht auf den Leim zu gehen, sondern an den richtigen Stellen skeptisch zu werden.
Verleumdungen
Untergang auf Raten
Man kann sich einen schlechteren Ausgangspunkt denken für einen Spaziergang durch zweieinhalb Jahrtausende voller Fälschungen, Verleumdungen und Verschwörungsmythen als die Mutter aller Universalbibliotheken, denn schließlich dienen Bibliotheken als Wissensspeicher, und die Menschheit verwahrt hier seit mehreren Tausend Jahren Wissen und Kultur. Man kann in ihnen der Vergangenheit nachgehen und natürlich auch dem, wo die Überlieferung der Geschichte fehlerhaft ist. Die Zahl der Bibliotheken ist riesig, ihr Bau und ihr Unterhalt sind nicht selten auch eine Frage des Prestiges.
Zu Anfang des 21. Jahrhunderts wurde in Ägypten mit großem Pomp und als PR-Aktion des Staates eine Bibliothek »wiedereröffnet«, die trotz ihres Untergangs vor vielen Jahrhunderten zu den bekanntesten der Welt gehört und als die wichtigste der Antike gilt: die Bibliothek von Alexandria. Über das traurige Schicksal der antiken Bibliothek gibt es verschiedene Versionen: Mal soll sie 48/47 v. Chr. im Alexandrinischen Krieg zerstört worden sein, als Julius Cäsar im Hafen der Stadt die Schiffe der ägyptischen Flotte in Brand setzen ließ und damit ein verheerendes Feuer auslöste. In anderen Erklärungen heißt es, die Bibliothek sei der Christianisierung Alexandrias Ende des 4. Jahrhunderts n. Chr. zum Opfer gefallen. Eine weitere Version macht den Islam für die Zerstörung der Bibliothek verantwortlich: Als der Feldherr Amr 642 n. Chr. Alexandria eroberte, soll Kalif Omar I. entschieden haben, den gesamten Bestand der Bibliotheken zu vernichten. Die Begründung war ebenso einfach wie folgenreich: Die Bücher, die dem Koran widersprachen, gehörten ohnehin vernichtet. Alle anderen aber waren überflüssig, weil der Koran ausreichte, und hatten ihr Existenzrecht mithin ebenfalls verwirkt. Ein halbes Jahr lang seien die 4000 Badestuben der Stadt mit den Rollen befeuert worden. All diese Erklärungen erscheinen mehr oder weniger glaubwürdig, und Altertumsforscher haben viel Energie und Leidenschaft darauf verwandt, aus dem Schicksal der ersten Universalbibliothek der Geschichte schlau zu werden. Wer aber ist wirklich verantwortlich für dieses Verbrechen am kulturellen Erbe der Antike? Es lässt ja zumindest aufhorchen, dass da Schuldige angeführt wurden, denen man sowieso alles Schlechte zutraute – jedenfalls aus der Perspektive ihrer Widersacher. Aber treffen die Verdächtigungen wirklich zu, oder handelt es sich um bloße Verleumdung?
Die hellenistische Welt verstand seit dem 4. Jahrhundert v. Chr. die Bibliothekskultur als Teil einer umfassenden Kulturpolitik. In Alexandria wurden unter den Ptolemäern gleich zwei bedeutende Buchsammlungen begründet: eine kleinere Bibliothek im Tempel des Serapis, die über 40 000 Buchrollen verwahrte, und die erheblich größere, bis heute legendäre Bibliothek im Museion, die mehr als eine halbe Million Rollen besaß. Das ist für die damalige Zeit eine bemerkenswerte Sammlung, zumal weitaus die meisten Buchrollen nicht nur ein Werk, sondern mehrere enthielten. Das Museion im Stadtteil Brucheion war eine Akademie nach dem Vorbild der aristotelischen Schule in Athen, die sich den Wissenschaften widmete, aber sie war gleichzeitig noch mehr: nämlich erstmals eine Universität nach unseren Maßstäben, mit Fachbereichen aller Art, darunter naturwissenschaftlichen. In der zugehörigen Büchersammlung konnten die Gelehrten der Akademie das gesammelte Wissen der damaligen Zeit studieren. So berühmt wurde die Bibliothek, dass der König für seine Akademie die Besten unter den Gelehrten anwerben konnte, denn sie waren begierig darauf, die Bücherschätze zu nutzen.
Das Museion und seine Bibliothek hatte Ptolemaios I. Soter um 300 v. Chr. gegründet; sie lag im Palastviertel und wurde von seinem Nachfolger noch erheblich erweitert. Ptolemaios I. war einer der Diadochen, die nach dem Tod Alexanders des Großen um dessen Weltreich kämpften und es schließlich aufteilten. Der Ehrgeiz der ptolemäischen Könige bestand darin, das gesamte Wissen der Menschheit zusammenzutragen: »Alle Bücher aller Völker der Erde« sollten es sein. Dies gehörte zum Programm der Hellenisierung des uralten ägyptischen Reiches und der übrigen Teile des Herrschaftsgebietes der Ptolemäer. Das Kalkül war einfach, aber klar: Um fremde Völker zu beherrschen, musste man ihre Kultur verstehen; dafür wiederum musste man ihre Bücher kennen, die daher ins Griechische übersetzt werden sollten. Ptolemaios I. schrieb an die Fürsten der Welt, ihm Bücher zu schicken.
Daneben durften es aber auch krumme Wege sein, um die Bücher nach Ägypten zu holen. Zur Erwerbspolitik der Bibliothek gehörte zum Beispiel, dass die Bücher von in Ägypten eintreffenden Schiffen beschlagnahmt wurden, um sie der Bibliothek zuzuschanzen. Die rechtmäßigen Besitzer wurden mit oft schlampig erstellten Abschriften abgespeist. Besonders dreist ging Ptolemaios III. vor, in einem Fall ein paar Jahrzehnte nach Gründung der Sammlung: Er lieh in Athen gegen ein Pfand die offiziellen Ausgaben Athens der Tragödien der klassischen Dramatiker Aischylos, Sophokles und Euripides aus und gab sie nicht mehr zurück. Selbst das stolze Athen musste sich mit einer Abschrift begnügen. Aber nicht alle Bücherrollen der Bibliothek waren solch zweifelhaften Ursprungs, sondern fanden auf akzeptablen Wegen ihren Platz in der legendären Alexandreia. Agenten im Dienste der Bibliotheken kauften im ganzen Reich Bücher, die sie nach Alexandria schickten. So oder so, die Sammlung wuchs, und die Alexandreia wurde zur größten und wichtigsten Bibliothek der Welt.
Die Bibliothek beschäftigte sich aber nicht nur mit dem Sammeln von Büchern. Bedeutende Gelehrte leiteten sie, und unter ihnen wurden Bibliografien, Kataloge, Kommentare und kritische Textausgaben erstellt. Wer in der Bibliothek arbeiten durfte, war privilegiert: steuerbefreit, gut bezahlt und in jeder Hinsicht bestens versorgt. Die gelehrten Mitarbeiter der Bibliothek dienten als Erzieher der königlichen Familie sowie als politische und kulturelle Ratgeber. Unter den Nutzern der Alexandreia waren viele wichtige Geschichtsschreiber wie Kallimachos, Plutarch und Strabo. In ihrer Arbeit wirkte die Alexandreia beispielgebend, und noch heute bekommen Bibliothekshistoriker feuchte Augen, wenn sie an die verlorenen Schätze von Alexandria denken.
Die Bedeutung der Bibliothek und ihr hervorragender Ruf dürften dazu beigetragen haben, dass für ihre Zerstörung unterschiedliche Erklärungen in Umlauf gebracht wurden. Auffällig ist aber schon, wie abwechselnd Heiden, Christen und Moslems für den Untergang dieses Symbols der antiken Kultur verantwortlich gemacht wurden.
Tatsächlich führten die Aktivitäten des Julius Cäsar 48/47 v. Chr. zu Zerstörungen in Alexandria, denen auch Bücherrollen zum Opfer fielen. Wie groß das Feuer im Hafen war und wie verheerend es wütete, ist allerdings umstritten. Und wie sehr die Bibliothek betroffen war, ist noch schwerer zu klären, da bis heute unklar ist, wo genau die Bibliothek stand – wie nah am Hafen und damit am Brandherd. Möglicherweise handelte es sich bei den damals zerstörten Büchern auch nur um jene rund 40 000 für den Export bestimmten Exemplare, die im Hafen der Stadt aufbewahrt wurden, denn die Bibliothek kaufte nicht nur, sondern handelte auch mit Büchern. Wahrscheinlich wurden das Museion selbst und die dort untergebrachte Bibliothek nicht allzu stark betroffen oder blieben gar unversehrt. Kleopatras römischer Ehemann Antonius, Widersacher Octavians, der als Augustus Roms erster Kaiser werden sollte, soll ihr später zum Trost für die verlorenen Kulturgüter mit 200 000 Rollen ausgeholfen haben: aus dem Besitz der Bibliothek von Pergamon, der schärfsten Konkurrentin der Alexandreia. Das allerdings ist vermutlich nur eine hübsche Geschichte ohne historischen Wahrheitsgehalt.
Zur eigentlichen Zerstörung der Bibliothek kam es Ende des 3. Jahrhunderts anlässlich der Kämpfe Kaiser Aurelians gegen Zenobia von Palmyra; ihnen fiel das Stadtviertel Brucheion zum Opfer, in dem der Königspalast und das Museion lagen. Ein gutes Jahrzehnt später schickte auch Diokletian Truppen nach Alexandria, um Aufstände niederzuschlagen. Die Gelehrten der Bibliothek mussten auf die kleinere Bibliothek im Serapistempel ausweichen, die rund 120 Jahre später ebenfalls zerstört wurde. Dieses Mal waren es Christen, vor Kurzem noch selbst wegen ihres Glaubens verfolgt, die nun ihrerseits über den Wert von Büchern richteten. Bischof Theophilos führte 391 eine erboste Menschenmenge an, die es auf die heidnischen Tempel abgesehen hatte. Der Serapis-Tempel ging dabei unter – vermutlich mitsamt seiner Büchersammlung.
Die Geschichte der islamischen Zerstörung der übrig gebliebenen Büchersammlung im 7. Jahrhundert ist unter den Fachleuten umstritten. Immerhin achtet der Islam die beiden anderen Buchreligionen Judentum und Christentum und verbietet die Vernichtung christlicher und jüdischer Schriften, die einen Teil der Bücher ausmachten. Auch hat ein erheblicher Teil der Schriften des Altertums das Mittelalter überhaupt nur dank des Islam überlebt, während das Christentum damals viel fundamentalistischer gesinnt war. Der islamische Feldherr Amr, der Ägypten im Jahr 640 im Namen der neuen Religion eroberte, war zudem ein überaus gebildeter Mann mit Respekt vor anderen Kulturen. Aufhorchen lässt aber, dass die Berichte darüber erst sechs Jahrhunderte nach der islamischen Eroberung Ägyptens entstanden, während frühere Autoren davon nichts schreiben, selbst wenn sie den Muslimen feindlich gesinnt waren. Das ist durchaus verdächtig und lässt vermuten, dass die Geschichte mit Absicht erfunden wurde. Bemerkenswerterweise handelt es sich aber nicht um eine antiislamische Verleumdung aus dem christlichen Europa, sondern um eine innerislamische Angelegenheit – entstanden zur Zeit des berühmten Sultans Saladin, der nicht nur gegen christliche Kreuzfahrer, sondern auch gegen Glaubensbrüder kämpfte: die Fatimiden in Kairo, die er als Spalter und Abweichler vom wahren Islam ansah. Nachdem er die Fatimiden besiegt hatte, ließ er eine große Bibliothek mit mutmaßlich ketzerischen Büchern verkaufen – wofür ihn seine Bewunderer mit dem Verweis auf die islamische Zerstörung der Bibliothek von Alexandria rechtfertigten, die auf höchster Ebene durch den Kalifen sanktioniert worden war. Als im 17. Jahrhundert die falschen Geschichten per Übersetzung die christliche Welt erreichten, wurden sie übrigens recht schnell angezweifelt.
Fraglich ist ohnehin, ob zur Zeit der angeblichen Zerstörungen auf Befehl Amrs überhaupt noch Nennenswertes von der gelehrten Pracht der Alexandreia übrig geblieben war. Über die Jahrhunderte seit dem Ende der Ptolemäer hatte die Stadt längst ihre kulturelle und politische Stellung eingebüßt – und wohl ebenso ihre berühmte Bibliothek verloren. Am Untergang der berühmten »Mutter aller Bibliotheken« tragen viele Seiten Mitschuld, und einseitige Schuldzuweisungen sind daher tatsächlich verleumderisch.
Rufmord durch die Bibel
Als vermutlich im 4. Jahrzehnt unserer Zeitrechnung – das Datum ist nicht mehr zweifelsfrei feststellbar – der Stifter des Christentums Jesus von Nazareth durch Kreuzigung hingerichtet wurde, geschah dies auf Befehl des römischen Statthalters der Provinz Judäa in Palästina, Pontius Pilatus. Kein anderes Ereignis der Antike ist so umfassend untersucht worden, und der Prozess Jesu ist der wohl berühmteste der Weltgeschichte. Pontius Pilatus aber wurde nur durch diese Geschehnisse, die für den weiteren Verlauf der Weltgeschichte von größter Bedeutung waren, bis heute zu einem Begriff. Noch immer führt das christliche Glaubensbekenntnis aller Konfessionen seinen Namen als Peiniger Jesu. Ihm wird im Allgemeinen die Verurteilung Jesu angekreidet, sie hat das historische Bild von ihm für immer geprägt.
Das Neue Testament charakterisiert den Römer als schwachen Machthaber, der Judäa miserabel regierte. Nach den Evangelisten verlief die Angelegenheit so: Um den gefährlichen Querkopf Jesus loszuwerden, schwärzten die jüdischen Hohepriester von Jerusalem ihn beim Vertreter des römischen Kaisers Tiberius als politischen Aufrührer an, weil er sich als »König der Juden« bezeichne und ein Umstürzler sei. Dies aber richte sich gegen die Herrschaft Roms, das seit fast einem Jahrhundert die Geschicke Palästinas bestimmte, und sei ein Majestätsverbrechen. Obwohl ihm klar war, dass es sich hier um ein durchsichtiges Manöver der Hohepriester handelte, so die Evangelisten, habe Pilatus dem Druck des jüdischen Volkes nachgegeben, das die Hinrichtung Jesu forderte. Der Evangelist Matthäus geht sogar so weit zu erzählen, der Römer Pilatus habe den jüdischen Brauch der Handwaschung vollzogen, um seine Unschuld zu dokumentieren.
Aber stimmt diese Beurteilung der Regierungszeit des Pontius Pilatus und seiner unrühmlichen Rolle im Prozess gegen Jesus von Nazareth mit der historischen Wahrheit überein? Und haben Prozess und Verurteilung Jesu so überhaupt stattgefunden? Oder haben die Evangelisten einen Rufmord in Gang gesetzt, der den römischen Statthalter seit nun schon fast zwei Jahrtausenden als einen wankelmütigen Opportunisten verleumdet?
In der Tat brauchten die jüdischen Gelehrten, um den unliebsamen, nach ihrer Auffassung blasphemischen, weil selbst ernannten Messias Jesus zu beseitigen, die Unterstützung der römischen Besatzungsmacht. Und um den Wirrkopf loszuwerden, der grundlegende jüdische Gebote infrage stellte, benötigten sie einen weltlichen Grund, denn in innerreligiöse Streitigkeiten mischte sich die Besatzungsmacht Rom nicht ein. Also schwärzten sie Jesus von Nazareth bei Pontius Pilatus als gefährlichen politischen Aufrührer an, mit dem es ein Ende haben musste, bevor er in der unruhigen Provinz einen weiteren Aufstand provozierte. Mit einer ähnlichen Taktik hatten sie schon vorher versucht, sich des charismatischen Wanderpredigers zu entledigen. Den Vorwurf des Majestätsverbrechens gegen Rom konnte Pilatus nicht auf sich beruhen lassen, und mit Rebellen verfuhr Rom wenig zimperlich, wobei die Kreuzigung eine gängige Hinrichtungsart darstellte. Die Evangelisten berichten, die Gelehrten hätten, als Pilatus die Schuld des Angeklagten anzweifelte, das Volk aufgewiegelt und Pilatus habe sich vom Zorn der Menge hinreißen lassen, Jesus zum Tode zu verurteilen, obwohl er von seiner Unschuld überzeugt war.
In der Regierungszeit von Pontius Pilatus (26–36 n. Chr.) gab es eine ganze Menge Volksaufstände, die der römische Statthalter blutig niederschlagen ließ. Damals standen im gesamten Römischen Reich diejenigen Provinzen, die an seinem Rand lagen, unter erheblichem römischem Integrationsdruck der pax romana. Die Juden Palästinas widersetzten sich dem besonders massiv, weil sie ihre jüdische Identität nicht aufgeben wollten. Dagegen ging Pontius Pilatus rücksichtslos vor. Diese Tatsachen passen jedoch nicht zum Bild des schwachen Provinzfürsten, das die Evangelisten gezeichnet haben. Andere Chronisten beschreiben Pilatus denn auch als taktisch klugen, gleichzeitig unerbittlichen und brutalen Machtmenschen, der jede Opposition gegen den Herrschaftsanspruch Roms erbarmungslos niederknüppelte.
Das Bild des schwachen, willenlosen Statthalters, dessen Schwäche das Kalkül der Schriftgelehrten aufgehen lässt, ist also nicht historisch. Es ist vielmehr von der Konkurrenz zwischen Juden und Anhängern Jesu bestimmt und zielt darauf ab, die Juden für den Tod Jesu verantwortlich zu machen. Je prekärer nach der Kreuzigung der Konflikt zwischen der alten Religion und ihrer Abspaltung wurde, desto mehr Anlass für Propaganda gab es, mit der jeweils eine Seite die gegnerische zu diskreditieren versuchte. Nach Darstellung der frühchristlichen Propaganda gehörte zur perfiden Taktik der Juden der schwache römische Statthalter, der zum Werkzeug der Schriftgelehrten wird.
Wenn sich aber Pontius Pilatus gar nicht einfach instrumentalisieren ließ – wieso hat er Jesus dann hinrichten lassen? Hat er vielmehr aus kühler Überlegung dem Druck von unten nachgegeben und den jüdischen Mob zufriedengestellt, der Jesus am Kreuz sehen wollte? Oder hat er Jesus zwar nicht für schuldig befunden, aber dennoch für einen potenziell gefährlichen Aufrührer gehalten, der seiner Politik von Modernisierung und römischem Druck zur kulturellen Integration entgegenstand? War das Grund genug, den merkwürdigen Sektierer vorsorglich unschädlich zu machen?
Tatsächlich führt nicht nur die landläufige Meinung über den Schwächling Pilatus in die Irre. Ebenso wenig spielte die jüdische Bevölkerung Jerusalems die entscheidende Rolle, die ihr das Neue Testament zuschreibt. Ein »Kreuziget ihn!« ist historisch unwahrscheinlich, weil der Prozess entgegen der neutestamentarischen Überlieferung ohne Öffentlichkeit stattfand – wenn es ihn überhaupt gab. Richtig ist, dass Pilatus Jesus jener Vergehen für unschuldig hielt, die ihm seitens der jüdischen Schriftgelehrten angehängt werden sollten. Immerhin besaß der Mann keine Waffen, zudem sah Pilatus keine Veranlassung, auch dessen Gefolgsleute verfolgen zu lassen. Was aber war Pilatus’ Motivation, die Kreuzigung anzuordnen?
Zunächst war die unerbittliche Verfolgung jüdischer Aufrührer römische Politik, dafür gibt es zahlreiche Beispiele. Das Interesse war ja durchaus beiderseitig, denn Unruhestifter wie dieser Jesus waren den römischen ebenso wie den jüdischen Autoritäten ein Dorn im Auge – mit dem Unterschied allerdings, dass Jesu Vergehen für die Juden ein todeswürdiges Verbrechen darstellte, während es aus römischer Sicht als religiöse Sache jedoch nicht justiziabel war. Also kostete es Pontius Pilatus wenig, dem Hohepriester Kaiphas einen Gefallen zu erweisen, zumal der römische Statthalter und der jüdische Einheimische offenbar generell einvernehmlich kooperierten. Das Bild des Neuen Testaments, dass da ein schwacher Römer den perfiden Juden ein willfähriges Instrument war, führt also in die Irre. Auch der Prozess selbst hat mit einiger Wahrscheinlichkeit gar nicht stattgefunden, den erlebten auch andere hingerichtete jüdische Unruhestifter nicht. Selbst das Messias-Bekenntnis, in dem Jesus vor Pilatus seinen göttlichen Auftrag bestätigte, lässt sich historisch weder belegen noch herleiten. Fürs katholische Dogma war es allerdings unverzichtbar.
Cäsarenwahn und Perversion
Pontius Pilatus ist beileibe nicht der einzige Römer, dem in der historischen Beurteilung Unrecht widerfuhr. Unser Bild vom alten Rom ist vermutlich weit mehr, als wir es uns eingestehen wollen, von Hollywoodfilmen, historischen Romanen und zweifelhaften Erzählungen launiger Reiseführer bestimmt. Das gilt in besonderem Maße für die Kaiserzeit, die sich als Steinbruch für schillernde Figuren und saftige Skandale regelrecht aufdrängt. Schon von Cäsar haben wir klare Vorstellungen: ein hagerer, asketischer Mann mit silbernem Haar und strengem Gesichtsausdruck. Majestätisch muss dagegen Augustus gewesen sein, Begründer des Prinzipats, weiser Landesvater und gütiger Friedenskaiser. Nach Augustus’ Tod in hohem Alter 14 n. Chr. aber rückten zweifelhafte Gesellen an die Spitze der Weltmacht Rom. Da sehen wir einen größenwahnsinnigen Nero ruhelos und Laute spielend durch seinen Palast irren. Da gibt es einen verdorbenen Alten namens Tiberius, der auf der Insel Capri seinen perversen Begierden nachgeht. Da ist der trottelige Claudius, der sich von zweifelhaften Frauen und Sklaven das Regiment abnehmen lässt, oder der sadistische Caligula, der auch mal ein Pferd zum Senator ernannte, oder im 2. Jahrhundert n. Chr. der brutale Commodus, der sich mit Gladiatoren gemeinmachte. Sie alle gelten als kaiserliche Ausfälle, als bestenfalls verantwortungslose und charakterlich verdorbene, wenn nicht wahnsinnige Gestalten, die dem Weltreich Rom nichts als Schande machten. Aber ist das so? Und wenn nicht, wo haben diese Bilder von den römischen Kaisern ihren Ursprung? Und wie lässt sich zum Beispiel im frühen Kaiserreich zusammenbringen, dass das Imperium gerade damals seinen Bürgern Wohlstand und Stabilität gewährleistete, wenn doch an der Spitze solche Satansbraten saßen?
Römischen Geschichtsschreibern ging es nicht um Objektivität; ihr Anspruch lag vielmehr darin, ihre Zeitgenossen zu unterhalten und zu belehren – und darin durchaus einen politischen oder moralischen Zweck zu verfolgen. Antike Geschichtsschreibung ist aus heutiger Sicht näher an Literatur als Kunstform als an wissenschaftlicher Darstellung, deshalb ist vorgeblich Echtes stets mit Vorsicht zu genießen. Der Historiker Tacitus betonte zwar, er wolle »ohne Zorn und Eifer« schreiben, also ohne Parteinahme und an den Tatsachen orientiert. Doch diesen Anspruch löste er nicht ein, sondern zeichnete ein übertrieben schlechtes Bild der Nachfolger des Augustus. Auch zwei weitere Historiker der frühen Kaiserzeit, Sueton und später Cassius Dio, nahmen es mit der Wahrheit nicht so genau, sehr zur Freude späterer Romanschriftsteller und Drehbuchautoren, die auf Sex, Skandale und Sensationen aus waren, um sie genüsslich auszuschlachten. Viele der Historiker waren Mitglieder des römischen Senats, der in der Monarchie an Bedeutung und Gestaltungsmöglichkeiten im Vergleich zur republikanischen Zeit eingebüßt hatte – Grund genug also, mittels Geschichtsschreibung den eigenen Machtverlust zu kompensieren, und zwar weniger durch grundlegende Systemopposition als in Gegnerschaft zu einzelnen Kaisern oder Kaiserfamilien. Darin drückten sie aus, wie tief Rom gesunken war seit den vermeintlichen goldenen Zeiten der Republik – und begründeten Verleumdungen, die die Jahrhunderte überdauerten.
Die eigenartige Konstruktion des römischen Prinzipats war Teil des Problems: Es gab da einen Mann, an dem die antiken Historiker ihre Kaiser maßen – und das war Augustus, der noch als Octavian nach der Ermordung Cäsars an die Spitze Roms rückte, nach fünfzehn Jahren Bürgerkrieg im Jahr 27 v. Chr. die Alleinherrschaft übernahm und das römische Kaiserreich begründete. Er tat das der Form nach, ohne dabei die Republik abzuschaffen, eigentlich eine Art Quadratur des Kreises. Das war von Anfang an gewagt, aber Augustus gelang der Drahtseilakt. Seither herrschten die Kaiser unumschränkt, und das Römische Reich war faktisch eine Monarchie. Offiziell jedoch wurde die Republik wiederhergestellt und der Senat in seine alten Rechte wiedereingesetzt, doch eigentlich gab man auf der Bühne der römischen Politik bloß eine Aufführung namens Republik: Es sollte sein wie in der glorreichen Vergangenheit, und doch war alles anders. Dieses heikle Konstrukt fortzuführen war die Aufgabe der Nachfolger des Augustus, die sich damit zunächst schwertaten – wenig verwunderlich, da stets der Schein gewahrt sein musste, aber nicht erprobt war, wie die Dinge vonstattengehen sollten. Unter anderem das hat das Urteil der antiken Geschichtsschreiber über die frühen Kaiser geprägt und damit über viele Jahrhunderte bis heute das Bild der römischen Kaiser bestimmt.
Die Herrschaftsverhältnisse im Römischen Reich waren also einigermaßen verworren. Doch mit viel Feingefühl und einiger Anstrengung inszenierte Augustus das Theater namens Rom überzeugend und zur allseitigen Zufriedenheit. Er hatte mit dieser paradoxen Konstruktion Rom befriedet und galt seither als gerechter, maßvoller und kluger Herrscher – und das umso mehr, je schwerer sich seine Nachfolger mit ihrer Aufgabe taten. Die Schwierigkeit bestand darin, trotz der tatsächlichen Machtverhältnisse das sogenannte Prinzipat so aussehen zu lassen, als habe nicht der Kaiser allein, sondern mit ihm der römische Senat die Geschicke des Reiches weiterhin in der Hand, als würde Rom einvernehmlich von den Senatoren regiert und der Kaiser in ihrer Runde eine Art Vorsitz einnehmen. Nur war der Senat praktisch machtlos, und der Kaiser herrschte unumschränkt. Prägend wurde außerdem, dass Rom kein Erbkaisertum geworden war, sodass ein Machtwechsel immer auf dünnem Eis vollzogen wurde. Den Biografen der nachfolgenden Kaiser diente Augustus sozusagen als Goldstandard, den seine Nachfolger in ihren Augen kaum erreichten. Dass die Forschung längst viel differenzierter urteilt, dringt ins allgemeine Bewusstsein nur schwer vor – zu hartnäckig und lieb gewonnen sind die Klischees der exaltierten und degenerierten Männer an der Spitze des Römischen Imperiums.
Höchst ungerecht verfährt die populäre Geschichtstradition bereits mit Augustus’ direktem Nachfolger Tiberius, der Rom von 14 bis 37 n. Chr. regierte. Wer die Insel Capri mit ihrer weltberühmten Blauen Grotte besucht, wird von diesem römischen Herrscher hören. Er hatte die malerische Insel fernab vom hauptstädtischen Getöse Roms zu seinem Alterssitz erkoren und sich dorthin zurückgezogen. Ein Dutzend prächtiger Villen besaß der römische Princeps auf Capri, heute Anziehungspunkte für Touristen, die sich wohlig gruseln, wenn ihnen der »Salto di Tiberio« gezeigt wird: Von dort, 300 Meter über dem Meer, ließ der böse alte Mann seine Opfer ins Meer stürzen, hört man. In Wahrheit war Tiberius jedoch eher menschenscheu, was aber nicht allzu viel hergibt für Geschichten, mit denen man Touristen unterhalten kann. Glücklicherweise jedoch können Reiseführer zitieren, was die römischen Geschichtsschreiber Tacitus und vor allem Sueton über Tiberius geschrieben haben: Nach dessen Bericht mussten »Scharen von überallher zusammengesuchten Mädchen und Lustknaben und Erfinder allerlei widernatürlicher Unzucht in Dreiergruppen miteinander Geschlechtsverkehr treiben. Er schaute dabei zu, um durch diesen Anblick seine erschlafften Kräfte aufzupeitschen.« Sueton zeichnete Tiberius als alten Lüstling, der Orgien inszenierte und seine hilflosen Gespielen hinterher gar brutal ermordete. Auch wenn er Sklaven loswerden wollte oder andere missliebige Untertanen und selbst hochgestellte Persönlichkeiten, ließ er sie grausam töten. Zum reinen Vergnügen veranlasste er die Hinrichtung Unschuldiger oder dachte sich Foltermethoden aus, um sich an den Qualen der Opfer zu weiden. Kurz gesagt, der alte Tiberius lebte nur für seine perversen Gelüste und überließ die römische Politik ihrem Schicksal.
Sueton schrieb seine bösen Worte einige Jahrzehnte nach dem Tod des römischen Kaisers. Seine Einordnung des Tiberius als dem Ersten der selbstsüchtigen, verderbten Despoten, die das stolze Erbe Cäsars und Augustus’ verrieten und Rom dem Niedergang preisgaben, ist bis heute populär. Auch Suetons Kollege Tacitus stimmte in die Verurteilung ein, ebenso wie bis ins 20. Jahrhundert hinein Schriftsteller das schlechte Image des Tiberius als heimtückischer Tyrann weitergaben. Dazu gehören auch der Schöpfer des Graf von Monte Christo Alexandre Dumas sowie Robert Graves, Autor des Longsellers Ich, Claudius, Kaiser und Gott.
Erst Mitte des 20. Jahrhunderts wurde Tiberius rehabilitiert – eigentlich erstaunlich, denn es fiel nicht weiter schwer, die Verleumdungen zu widerlegen. Doch eine kritische Geschichtswissenschaft, wie sie heute als selbstverständlich gilt, entwickelte sich erst im 19. Jahrhundert. Zum Beispiel ist auffällig, dass sich keine ernst zu nehmende zeitgenössische Kritik an Tiberius finden lässt, die die späteren Berichte bestätigt. Der Kaiser kümmerte sich während seiner Zeit auf Capri durchaus um seine Amtsgeschäfte. Auch die recht gut dokumentierte Rechtsgeschichte Roms legt nahe, dass die angeblichen Prozess- und Hinrichtungsorgien des Tiberius nie stattgefunden haben. Dagegen ist belegt, dass er den Opfern eines Großbrandes in Rom großzügige Hilfszahlungen zukommen ließ.
Nüchtern erforscht, ergibt das Leben des Tiberius ein ganz anderes Bild: Der Herrscher war gar nicht zügellos und selbstsüchtig, sondern im Gegenteil überaus bescheiden. Die Ehre, wie Cäsar und Augustus zum Namensgeber eines Monats zu werden, wies er zurück. Er war ein nüchterner Staatsmann, hochgebildet und mit einem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Damit aber und mit seiner zurückhaltenden, kontaktscheuen Art passte er nicht recht in die schillernde Politszene Roms. Trotzdem zeichnete er sich schon vor der Herrschaftsübernahme aus, glänzte als Oberbefehlshaber in Germanien, wirtschaftete als Princeps sparsam und kümmerte sich um die Verwaltung der römischen Provinzen. Andererseits brachte Tiberius in sein hohes Amt eine Hypothek ein. Er hatte, bevor er als Mittfünfziger an die Spitze des Imperiums rückte, über die Jahre mit vielen persönlichen Enttäuschungen und Demütigungen, mit nicht erfüllten Hoffnungen und hässlichen Intrigen fertigwerden müssen. Als Stiefsohn des Augustus und für die Thronfolge vorgesehen, viel herumgeschubst und im Volk nicht sonderlich beliebt, glich sein Leben über lange Strecken dem Bad in einem Haifischbecken. Das hatte ihn zu einem einsamen Menschen gemacht und mehr als einmal dazu bewogen, Rom verbittert den Rücken zu kehren. Anlass dazu bot wohl auch die ständige Einflussnahme seiner machtbewussten Mutter Livia, die als Witwe des Augustus einen enormen politischen Einfluss besaß. Ihr verdankte er die Thronfolge, weil sie in diesem Sinn auf Augustus eingewirkt hatte, aber dafür gängelte sie ihren Sohn gehörig. Sein Einstand als Kaiser ging ziemlich daneben, denn Tiberius vermochte nicht recht, im Anschein republikanischer Verhältnisse mit dem Senat sogleich ein gütliches Auskommen zu finden. Obwohl er alles richtig machen und die standesbewussten Senatoren einbinden wollte, verstand der Senat sein Bemühen falsch und reagierte aufgebracht. Das lag am noch unerprobten Ritual der Machtübernahme, aber wohl ebenso am mangelnden Gespür des neuen Kaisers und dem Unvermögen der überaus stolzen Senatorenschaft, mit ihrer Machtlosigkeit umzugehen – jedenfalls war die Atmosphäre fürs Erste vergiftet.
Die Verleumdungskampagne gegen den römischen Kaiser Tiberius begann vermutlich mit Vipsania Agrippina (die Ältere), die ihn des politischen Mordes an ihrem Mann Germanicus, dem Adoptivsohn des Tiberius, beschuldigte. Tiberius setzte sich zur Wehr, aber dem Erfolg stand sein Mangel an Popularität entgegen – heute würde man sagen, es fehlte ihm an medialer Ausstrahlung und einem fähigen PR-Team. Zahlreiche schmutzige Politaffären wurden mit seinem Namen in Verbindung gebracht, auch wenn er damit meist gar nichts zu tun hatte. Dass er sich im fortgeschrittenen Alter trotz seiner Verpflichtungen als Princeps nach Capri zurückzog, brachte ihm in Rom, wo die öffentliche Meinung nun einmal gemacht wurde, nur noch mehr Feinde ein. Denn nach allgemeiner Überzeugung gehörte ein Kaiser nach Rom, das schließlich Zentrum des Imperiums und Nabel der Welt war. Doch Tiberius verbrachte sein letztes Lebensjahrzehnt auf Capri, ohne noch einmal nach Rom zurückzukehren.
Vollends in Verruf geriet Tiberius aber nach seinem Tod. Die Zeit der Schreiber Tacitus und Sueton war geprägt vom verklärenden Blick auf die vergangene Blütezeit Roms und von Pessimismus unter dem Eindruck des Niedergangs ins Despotentum, den sie Tag für Tag erlebten. Diese beklagenswerte Entwicklung musste in den Augen der Nachgeborenen irgendwo greifbar ihren Anfang genommen haben, deshalb wurde Tiberius posthum zum Opfer politisch gefärbter Geschichtsschreibung. So wenig wie die Inkarnation des grausamen Despoten dürfte Tiberius das sanfte Unschuldslamm gewesen sein. An seinem Beispiel erweist sich jedoch, dass Politiker seit ehedem gut daran tun, sich zu Lebzeiten um ihr bleibendes Ansehen zu kümmern.
Zu Ostern 1894 erschien in Leipzig ein schmales Bändchen. Autor war der Historiker und spätere Friedensnobelpreisträger Ludwig Quidde, der damit einen handfesten Skandal auslöste. Gegenstand der Schrift Caligula war Tiberius’ Nachfolger, der dritte der römischen Kaiser, aber dem zeitgenössischen Leser konnte kaum entgehen, dass der Autor eigentlich auf den deutschen Kaiser höchstpersönlich zielte: Wilhelm II. Der Untertitel des Buches lautete Eine Studie über römischen Cäsarenwahnsinn, und der berüchtigte Caligula, seine allgemein bekannten pathologischen Charaktereigenschaften und die Monstrositäten seines Handelns dienten dazu, Wilhelm als modernes Beispiel des sogenannten Cäsarenwahnsinns vorzuführen. Das Kalkül der Publikation lag darin, Parallelen zwischen einem bekanntermaßen wahnsinnigen römischen Imperator und dem deutschen Kaiser aufzuzeigen, ohne sie direkt anzusprechen. Damit begab sich Ludwig Quidde mit einem Bein ins Gefängnis, denn Majestätsbeleidigung stand unter Strafe. Seine akademische Karriere fand ein jähes Ende.
Die Reihe von Herrschern quer durch die Weltgeschichte, die als wahnsinnig gelten, ist ziemlich lang, aber Caligula (37–41 n. Chr.) ist zweifellos einer der bekanntesten. Eifrig untermauern antike Autoren den vernichtenden Befund mit saftigen Details aus Caligulas Regierungszeit: Er wollte ein Pferd zum Konsul machen. Er aß in Essig aufgelöste Perlen und mit Gold überzogene Speisen. Er machte aus dem Kaiserpalast ein Bordell und zwang die Vornehmsten Roms, sich zu prostituieren. Er führte ein Schreckensregiment und ließ wahllos Menschen hinrichten. Er unterhielt inzestuöse Beziehungen zu seinen Schwestern. Er inszenierte irrsinnige Triumphspektakel. Er ließ sich als Gott anbeten. Die Sache scheint also klar – der Mann war ein brutaler, unzurechnungsfähiger und gefährlicher Psychopath.
Caligula regierte nur wenige Jahre, bereits 41 n. Chr. fiel er einer Verschwörung zum Opfer und wurde gerade einmal 28-jährig ermordet. Für die Geschichte Roms ist er gar nicht weiter von Belang, dafür ist er als historische Figur so populär wie langlebig: vor allem als Stoff für Dramen, Romane und Filme. Als schillerndster, berüchtigtster römischer Kaiser ist seine posthume Medienkarriere atemberaubend, sogar pornografische Werke, in denen ein hemmungsloser Kaiser seinen perversen Gelüsten nach Lust und Laune nachgeht, berufen sich auf Caligulas Lebensgeschichte. Und im öffentlichen Bewusstsein setzte sich dieser Befund hartnäckig fest – schließlich sind es die skandalösen, überdrehten und besonders illustren Gestalten, die im Gedächtnis haften bleiben. Nur blieb bei dieser posthumen Karriere Caligulas in Geschichtsbüchern und Dramen, TV-Serien und Pornofilmen die Wahrheit auf der Strecke, denn Caligula war nicht wahnsinnig.
Die üble Nachrede über Caligula begann unmittelbar nach seinem Tod. In einer Rede vor dem römischen Senat bezeichnete ihn der Konsul Gnaeus Sentius Saturninus zunächst als extremen Tyrannen – zum Befund der Geisteskrankheit war es da gleichwohl noch ein Stück Weges. Andere Zeitgenossen bemühten bereits den Begriff »Wahnsinn« oder »verwirrter Geist«, darunter der berühmte Philosoph Seneca, später auch der Historiker Tacitus. Diese Einschätzung bezog sich bei näherem Hinsehen aber nicht auf eine Geisteskrankheit, sondern diente – ähnlich wie heute – als Synonym für übersteigertes, verwerfliches Handeln, als politische Verurteilung also. Den Vorwurf des Wahnsinns im pathologischen Sinne hingegen erhob erstmals der Historiker Sueton fast 200 Jahre nach Caligulas Tod – der schon über Tiberius nicht verlässlich berichtete und stets auf Pointen und Anekdoten aus war, ohne sich allzu viel um deren Wahrheitsgehalt zu scheren. Jahrzehnte später taten es ihm die Geschichtsschreiber Cassius Dio und Flavius Josephus gleich. Und sie erreichten, dass noch viele Jahrhunderte später, zur Zeit des deutschen Kaiserreichs, Caligula als Inbegriff des »Cäsarenwahnsinns« galt.
Nicht alle modernen Historiker sind der schematischen Verteufelung Caligulas gefolgt, aber das Märchen vom unzurechnungsfähigen Psychopathen auf dem Thron ist noch immer lebendig. Dabei wurden all die Vorwürfe, die eine Geisteskrankheit belegen sollten, inzwischen akribisch widerlegt. Vor allem der Berliner Althistoriker Aloys Winterling hat in seiner Caligula-Biografie die fraglichen Punkte eingehend untersucht. Bei genauerer Betrachtung wird aus dem Wahnsinnskaiser zwar kein vorbildlicher Herrscher oder sympathischer Tugendbold – aber aus der Schwarz-Weiß-Skizze eines Sueton wird ein differenziertes Porträt mit vielen Schattierungen.
Caligulas eigentlicher Name lautet Gaius Julius Cäsar Germanicus, er war der Sohn des römischen Volkshelden Germanicus, der den Namen seinen (nach der Schmach im Jahre 9) siegreichen Feldzügen gegen die Germanen verdankte, und Agrippinas der Älteren, einer Enkelin des Augustus. Noch von Augustus als Tiberius’ Nachfolger vorgesehen, starb Germanicus jedoch bereits im Jahr 19 n. Chr. Da war sein Sohn Caligula sieben Jahre alt – und sollte der erste römische Herrscher werden, der zu einer Zeit zur Welt kam, als Rom bereits von Kaisern regiert wurde. Er kannte also weder die Zeit der römischen Republik noch den verheerenden Bürgerkrieg aus eigener Erinnerung. Für ihn war Kaiserherrschaft eine Selbstverständlichkeit, und seine Anwartschaft darauf bestand von Geburt an. Seine ersten Lebensjahre waren die unbeschwerten eines kleinen Jungen in einer glamourösen Familie, die noch dazu viel in der Welt herumkommt. Hätte es schon moderne Medien gegeben, der kleine Caligula wäre von Paparazzi umlagert worden, um ein gutes Motiv für das nächste Titelblatt abzugeben. Schon der Spitzname Caligula, Stiefelchen, verweist auf die Beliebtheit des Jungen, der im germanischen Feldlager, das sein Vater befehligte, die römischen Soldaten bespaßte. Das änderte sich schlagartig mit dem Tod des Vaters, denn damit wurde der kleine Junge allen Schutzes beraubt und mitten in die Intrigen und Gefahren der römischen politischen Klasse katapultiert.
Rom war ein überaus gefährliches Pflaster für ein Kind, das als künftiger Herrscher infrage kam. Eine geregelte Thronfolge gab es nicht, was das Leben Caligulas bedrohte, denn die kaiserliche Großfamilie war in zwei Lager gespalten und Caligulas Familie wurde Opfer einer Verschwörung. Seine ehrgeizige Mutter, die einst selbst hatte Kaiserin werden wollen und nun im Sinne ihrer Kinder tätig war, sowie seine beiden älteren Brüder Drusus und Nero wurden von Tiberius in die Verbannung geschickt bzw. eingekerkert und starben den Hungertod. Auch vorher dürfte Caligulas Mutter ihrem kleinen Sohn, auf den sie alle ihre enttäuschten Ambitionen projizieren musste, kaum eine nur fürsorgliche Mutter gewesen sein, die das Kindeswohl über alles andere stellt. Als nicht weniger dominant gilt die Urgroßmutter Livia, einflussreiche Witwe des Augustus und schon für Tiberius immer wieder ein Problem. Caligulas jugendliches Alter rettete ihm das Leben, aber bewahrte ihn nicht vor traumatischen Erlebnissen. Bei Tiberius in dessen Residenz auf Capri lebend, musste der junge Caligula vor allem überleben und bewies dabei beachtliches Geschick. Das hatte er auch bitter nötig, wollte er nicht wie seine Brüder enden. Zu seinen überlebenden Schwestern hatte Caligula ein sehr inniges Verhältnis: zur Lieblingsschwester Drusilla bis zu ihrem vorzeitigen Tod im Jahr 38, zu den beiden anderen, bis sie gegen ihn intrigierten.
Stark und hart aber musste ein Junge werden, der eine solche Kindheit und Jugend erlebte, und die notwendige Folge aus ständiger Bedrohung und dem Zwang zur Verstellung waren Misstrauen, Rücksichtslosigkeit, unbedingter Durchsetzungswille und kaum ein Hauch von Zimperlichkeit oder Nachsicht, dafür eine Anlage zur Bösartigkeit. Und offenbar eine Abscheu dem politischen System gegenüber, gepaart mit dem Vorsatz, sich darin um jeden Preis zu behaupten, sollte er Tiberius’ Nachfolge antreten.
Als schließlich im Jahr 37 Tiberius starb und Caligula an die Macht kam, galt er im Volk nach dem unbeliebten Tiberius als Hoffnungsträger, seiner Jugend und seines reichsweit bewunderten Vaters wegen. Zum ersten Mal trat an die Spitze des Staates kein gereifter, sondern ein junger Mann, der die Herzen des Volkes eroberte und große Hoffnungen weckte. Das gewohnte Spiel zwischen Alleinherrscher und Senat spielte er zwar zunächst mit, ja er versprach die Teilung der Macht und hofierte den Senat. Diese ersten Monate nach Regierungsantritt ließen vermuten, Caligula werde in die Fußstapfen des Augustus treten. Nicht einmal die Verantwortlichen für den Tod seiner Mutter und seiner Brüder ließ er zur Rechenschaft ziehen. Dann aber wurde der Kaiser ernstlich krank, was ihm vor Augen führte, dass er auch als Herrscher kaum weniger gefährdet war als zuvor am Hof des Tiberius – denn an seiner Nachfolge wurde bereits gebastelt. Machtbehauptung um jeden Preis bot die größtmögliche Sicherheit vor Bedrohung, nicht nur für Caligula selbst, sondern für seine gesamte Familie.
Seither verhielt er sich weniger konziliant und ausgleichend als Augustus und stieß die Senatoren, die mit ihrem Machtverlust ohnehin schwer zurechtkamen, immer wieder vor den Kopf. Das ging trotzdem noch einige Zeit gut, zumal Caligula sich als fähiger Herrscher erwies. Dann aber fanden sich höchste Kreise zu Intrigen gegen den Kaiser zusammen. Als diese fehlschlugen, ließ Caligula alle Rücksicht fahren und entblößte mit Ironie, Zynismus und Spottlust die Fassade einer Republik, die gar keine mehr war. Er demütigte den stolzen Senat, den er als Versammlung eitler, aber machtloser Heuchler vorführte. Er verhöhnte die Luxussucht, mit der die Oberschicht Roms ihren politischen Bedeutungsverlust kompensierte. Statt den Schein zu wahren, präsentierte er sich als der Alleinherrscher, der er faktisch ja auch war. Das aber widersprach dem stillschweigenden Abkommen aus Augustus’ Zeiten und schuf Caligula hasserfüllte Feinde in den Reihen der gedemütigten römischen Aristokratie. Weitere Verschwörungen gegen ihn folgten, von denen eine schließlich Erfolg hatte: Am 24. Januar 41 wurde Caligula bei einer Theateraufführung auf dem Palatinhügel in Rom von Prätorianern ermordet.
Die Vorwürfe gegen Caligula sind keineswegs allesamt frei erfunden. Der wahre Kern wurde jedoch von den Autoren mal