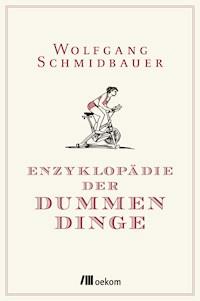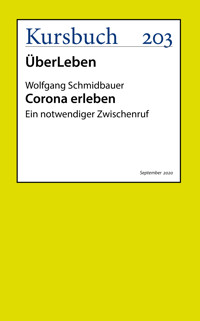9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Kann ein Mensch wirklich acht Stunden am Tag liebevolle Zuwendung geben? Darf sich eine Familientherapeutin scheiden lassen? Wie fühlt sich ein Helfer, der am Abend von seiner Partnerin die gleichen Klagen hört wie von seinen deprimierten Patientinnen tagsüber? Wolfgang Schmidbauer entwickelt eine fesselnd zu lesende Typologie der Wechselwirkung zwischen Berufsarbeit und Privatleben bei Helfern. Neben die Frage nach der Lebensgeschichte und den innerseelischen Schwierigkeiten von Helfern tritt darin auch die Betrachtung der äußeren Bedingungen, unter denen Menschen in den helfenden Berufen arbeiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Wolfgang Schmidbauer
Helfen als Beruf
Die Ware Nächstenliebe
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Kann ein Mensch wirklich acht Stunden am Tag liebevolle Zuwendung geben? Darf sich eine Familientherapeutin scheiden lassen? Wie fühlt sich ein Helfer, der am Abend von seiner Partnerin die gleichen Klagen hört wie von seinen deprimierten Patientinnen tagsüber?
Wolfgang Schmidbauer entwickelt eine fesselnd zu lesende Typologie der Wechselwirkung zwischen Berufsarbeit und Privatleben bei Helfern. Neben die Frage nach der Lebensgeschichte und den innerseelischen Schwierigkeiten von Helfern tritt darin auch die Betrachtung der äußeren Bedingungen, unter denen Menschen in den helfenden Berufen arbeiten.
Über Wolfgang Schmidbauer
Wolfgang Schmidbauer, geboren 1941 in München, studierte Psychologie und promovierte 1968 über «Mythos und Psychologie». Tätigkeit als freier Schriftsteller in Deutschland und Italien. Ausbildung zum Psychoanalytiker. Gründung eines Instituts für Analytische Gruppendynamik. Gegenwärtig arbeitet Schmidbauer als Psychotherapeut und (Lehr-)Analytiker in einer Praxisgemeinschaft in München.
Er ist als Autor zahlreicher Bücher, unter anderem «Die hilflosen Helfer», «Alles oder nichts», «Die Ohnmacht des Helden», «Die Angst vor Nähe», «Du verstehst mich nicht!», bekannt geworden.
Inhaltsübersicht
Vorwort
Ein Autor mag erwarten, daß seine Bücher bis zum Ende gelesen und so verstanden werden, wie er sie gemeint hat. Unter diesem Aspekt hat mir das Buch über die «hilflosen Helfer» neben der Freude an dem oft intensiven Interesse auch Kränkungen eingetragen. Nicht viel anders als orientalische Despoten, die erst einmal die Überbringer schlechter Nachrichten köpfen ließen, haben einige Rezensenten überlegt, was denn aus den jungen Sozialarbeitern werden solle, denen man schon im Erstsemester durch ein Buch über das Helfer-Syndrom jede Freude am Beruf und jedes unbefangene Engagement verderbe. Ein Monsignore und leitender Caritas-Angestellter in einer süddeutschen Diözese erhielt rauschenden Beifall, als er auf einer Tagung für Klinikpersonal sagte, er besitze das Buch, habe es aber nicht gelesen. Besonders beeindruckte mich jener Verwaltungsdirektor einer großen Klinik in Österreich, der mir nach einem Vortrag in Salzburg zum «Tag der Krankenschwester» zwischen Mozarts Dissonanz-Quartett und dem kalten Büfett entgegenhielt, er sei selbst kürzlich als Patient in seiner eigenen Klinik gelegen und habe keine Spur von einem Helfer-Syndrom bei seinen Pflegerinnen entdeckt. Irgendwo spricht mich ein stämmiger Sozialarbeiter an und sagt finster, ihm habe sein Beruf immer Spaß gemacht – ob ich das für nicht normal halte?
Man kann über ein Thema falsche Gedanken äußern; das ist in der Regel nicht schlimm. Man kann überhaupt keine Gedanken dazu äußern und damit sogar Professor werden, weil man es auf wissenschaftlich untadelige Weise getan hat. Aber einen Fehler sollte man nicht machen: über ein Thema nachdenken, über das man gar nicht nachdenken darf. Dann wird jeder Gedanke als zerstörerisch ausgelegt. Mir scheint, daß die Nächstenliebe ein solches Thema ist. Der Monsignore, der das Buch zwar erwirbt, es jedoch ungelesen wegstellt, drückt die Abwehr solcher Gedanken besonders anschaulich aus.
Die Beschäftigung mit den unbewußten Hintergründen menschlicher Hilfsbereitschaft ist nicht nur für die Konservativen ein Ärgernis. Auch manche «fortschrittlichen» Autoren gehen mit dieser Fragestellung um wie die von ihnen angegriffenen Psychiater mit ihren Patienten. Sie wird mit einem Etikett versehen («Psychologisierung» oder «Therapeutisierung») und abgeschoben.[*] Es scheint die abstrakten Linien großräumig geplanter gesellschaftlicher Veränderungen zu stören, daß es so etwas wie eine subjektive Problematik der Helfer tatsächlich gibt.
Nach wie vor glaube ich, daß die Unterscheidung zwischen «Helfen aus Abwehr»[*] und spontaner Hilfsbereitschaft sinnvoll ist. Unsere Altruismus-Verwalter sehen diese Unterscheidung nicht gerne, weil sie dazu neigen, ihre bürokratische Macht mit dem Wohl der Kranken und Klienten zu rechtfertigen. Diesem gegenüber muß das Wohl der beruflichen Helfer zurückstehen. Der zwanghaft an die Helfer-Position gebundene Berufstätige wird zum willigen Opfer einer Sozialbürokratie, die Machtinteressen durch das «von oben» definierte Kranken- und Klientenwohl rechtfertigt. Der Helfer, der in einem umfassenden Sinn selbst-bewußter wird, ist auch weniger bereit, sich in solche Zusammenhänge einzuordnen. Er läßt sich sein Engagement nicht mehr von seinen Vorgesetzten vorschreiben. Wenn diese deshalb mein Buch für ihre Interessen unangenehm finden, habe ich nichts dagegen.
Ärgerlich finde ich freilich, wenn sich ein durch solche Interessen bestimmtes Zerrbild meiner Absichten auch in den Köpfen der Betroffenen festsetzt. Diese nehmen dann an, daß das Nachdenken über die Motive der eigenen Hilfsbereitschaft und Nächstenliebe unweigerlich zu einer zerstörerischen Entlarvung führt. In den «hilflosen Helfern» habe ich mehrmals ausdrücklich gesagt, daß es gerade um die Wiederherstellung und Befreiung der spontanen, kreativen Hilfsbereitschaft geht, um die Trennung von einem zerstörerischen Ideal. Aber eine solche Trennung macht auch Angst – die Angst, alles zu verlieren, weil man alles behalten möchte. Immer wieder höre ich Fragen: Wie sieht denn das richtige Helfen, das Helfen ohne Helfer-Syndrom aus? Ich werde verlegen, wenn ich diese Frage beantworten soll. Denn ich bin überzeugt, daß sie besser offen bleibt, wie eine jener Wunden, die dann verhängnisvoll werden, wenn ein unkundiger Arzt es darauf anlegt, sie möglichst rasch mit scheinbar gesunder Haut zu bedecken.
Der Konflikt zwischen zweckrationaler Leistungsfähigkeit und spontaner Gefühlsreaktion, zwischen Technik und Natur bestimmt das Leben in den Industriegesellschaften. Wie er sich in den helfenden Berufen darstellt, versuche ich in diesem Buch zu zeigen. Obwohl ich meine Gedanken anhand der Arbeit über die hilflosen Helfer entwickle, ist es keine Fortsetzung davon, sondern untersucht einen neuen Aspekt: die Wechselwirkungen zwischen dem von der Gesellschaft angebotenen «sozialen» Beruf und den persönlichen Eigenschaften der Helfer. Der lebensgeschichtliche Gesichtspunkt wird so durch einen sozialpsychologischen ergänzt.
Mitbedingt durch die Produktionsweise eines Psychoanalytikers, der seine Freizeit zum Schreiben verwendet, vielleicht sogar Ausdruck meiner persönlichen Deformation durch die «freien Assoziationen», ist «Helfen als Beruf» eher assoziativ als systematisch verfaßt. Ich hoffe, daß sich auf diese Weise erreichen läßt, woran mir liegt: der subjektive Nachvollzug, der Anstoß, sich selbst Gedanken «gegen den Strich» der Schulweisheiten zu machen.
Einen solchen Gedanken «gegen den Strich» stellt auch der Untertitel dar. Die wahre und die Ware Nächstenliebe – das ist mehr als ein Wortspiel. Es geht um jene Grundsätze der bürgerlichen Gesellschaft, die etwas anderes sind als das Über-Ich des einzelnen. Therapeuten, die selbst Beobachtungen über die konkrete Ausprägung des christlichen Altruismus anstellen konnten, werden mir zustimmen, daß in der praktizierten «christlichen» Erziehung häufig Nächstenliebe auf dem Weg über den Selbsthaß erzeugt wird. Woran liegt das? Weshalb erinnern sich so wenige christliche Eltern in ihrer Erziehungspraxis an den Satz: «Liebe deinen Nächsten wie dich selbst»? Sie haben verlernt, sich selbst zu lieben. Sie wissen gar nicht, wie sie selber sind. Die Leistungsideale der Gesellschaft haben ihre Persönlichkeit kolonisiert. Nächstenliebe als Beruf, als bezahlte Dienstleistung, als Ware: hier droht stets die Gefahr, daß die Leistung – «Liebe deinen Nächsten» – die Erholung – «Liebe dich selbst» – auffrißt, bis endlich der Helfer nur noch eine funktionierende Dienstleistungsfassade aufrechterhält und alles ablehnt, was an kindlichen Gefühlen und Wünschen dahintersteckt. Wenn der Helfer nicht mehr schwach sein kann, braucht er die Schwachen draußen, braucht er Abhängige, Unmündige. Der Vollzug seiner eigentlichen, vornehmsten Aufgabe, sich selbst überflüssig zu machen, wird dann zur tödlichen Gefahr für sein Selbstgefühl, zu etwas, an das nicht einmal gedacht werden darf.
Das Gleichgewicht, welches in dem Satz: «Liebe deinen Nächsten wie dich selbst» angedeutet ist, geht durch die Professionalisierung der Nächstenliebe verloren. Gleichzeitig ist dieser Verlust eine Voraussetzung der Professionalisierung. Sie kann erst stattfinden, wenn die Menschen verlernt haben, Schwäche, Regression, Kindlichkeit, Emotionalität in ihrer tiefen und umfassenden Bedeutung für ihr Leben zu sehen und zu akzeptieren. Dann werden die Gesellschaften erfolgreicher nach außen, im Kampf gegen die Natur und gegen andere Gesellschaften. Aber sie werden unglücklicher nach innen und müssen Helfer erfinden, die dieses Unglück verwalten. Beheben können sie es nicht, weil sie ein Teil seiner Bedingungen und Folgen sind.
Es ist an der Zeit, den Kolonialismus der Experten in der Gesundheits- und Erziehungswissenschaft zu beenden. Der Arzt, der die Fragen des Patienten überhört, tut das auch, weil er nicht gewohnt ist, sich selbst in Frage zu stellen. Der Therapeut, der vorgibt zu wissen, was das Dunkel des Unbewußten seiner Patienten birgt, gleicht dem Kind, das im Keller singt, weil es dann weniger Angst hat. Die Komplexe und Archetypen, die wir entdecken, entlarven unser eigenes Bedürfnis nach Ordnung und Struktur. Wenn ich einige Helfer anregen kann, ihre Arbeit zu entkolonisieren – und einige Klienten, ihnen dabei zu helfen, dann hat das Buch seinen Zweck erreicht. Es ist nicht nur ein Machtgewinn, sondern auch eine schwer erträgliche Last, Kolonisator zu sein, immer überlegen und stark sein zu müssen. Schwäche und Angst wieder zuzulassen, heißt auch die Kluft zu den unterworfenen «Wilden» verkleinern. Der Mächtige muß nicht mehr so viel Angst haben, seine Überlegenheit zu verlieren. Der Ohnmächtige muß nicht so viel Angst vor dem Mächtigen haben.
Ich habe vielen Menschen zu danken, ohne deren Hilfe dieses Buch nicht zustande gekommen wäre, obwohl ich mich während der eigentlichen Schreibarbeit wie ein Einsiedlerkrebs hinter meine Schreibmaschine zu verkriechen pflege. Es sind vor allem die vielen Helfer, die mir in Gesprächen zu zweit oder in Selbsterfahrungsgruppen von sich erzählt haben, deren privates und professionelles Schicksal ich oft über Jahre hin verfolgen konnte. Es sind die Kliniken, Praxisgemeinschaften und Verbände, die mich für kürzere, oft aber auch jahrelange Beratungen, Supervisionen und selbsterfahrungsorientierte Gruppenarbeit eingeladen haben. Der Gesellschaft für analytische Gruppendynamik, dem Moreno-Institut in Stuttgart und seiner Geschäftsführerin Sarah Kirchknopf, WILL-Europa und der Münchner Arbeitsgemeinschaft für Psychoanalyse danke ich für die organisatorische Hilfe, ohne die ich keine so reichen Beobachtungsmöglichkeiten gehabt hätte. Seit ich die «hilflosen Helfer» schrieb, sind viele Menschen zu mir in Gruppen gekommen, um den Autor kennenzulernen. Nicht wenige waren enttäuscht, weil sie (wie es einer von ihnen formulierte) «nur einen Psychoanalytiker» fanden.
Vor allem aber möchte ich Gudrun Brockhaus danken. Ursprünglich wollten wir das Buch zusammen schreiben, haben diesen Plan aber aufgegeben. So ist der Text zwar meiner; die Gedanken aber sind oft unsere. In diesen Gesprächen habe ich nicht nur viel gelernt, sondern mich auch oft auf jene liebevolle Weise in Frage gestellt gefühlt, die ich brauche, um mich weiterzuentwickeln.
Vorwort zur Taschenbuchausgabe
Die Revision eines fast zehn Jahre alten Textes regt an, über die eigene Situation und die gesellschaftlichen Veränderungen nachzudenken. Zwei der Themen von «Helfen als Beruf» haben sich inzwischen zu eigenen Büchern weiterentwickelt: «Die Angst vor Nähe», zwei Seiten und eine Zwischenüberschrift in Teil V, und «Die subjektive Krankheit – Kritik der Psychosomatik», worin Gedanken über «das objektive und das subjektive Wissen», ebenfalls in Teil V, weitergesponnen werden. Nachdem die deutsche Wiedervereinigung unsere Möglichkeiten so erweitert hat, zu erfahren, was jenseits der Mauer vorging, habe ich überrascht gehört, daß «Die hilflosen Helfer» in der früheren DDR viel gelesen und diskutiert wurden. Vielleicht gibt die Taschenbuchausgabe des zweiten «Helfer»-Bandes diesen Lesern, die auf die wenigen Exemplare in den Bibliotheken angewiesen waren, nun eine Möglichkeit, das Thema in aller Ruhe weiter zu verfolgen.
Ich habe in der Revision den Text gestrafft und die veraltete «Dokumentation» fortgelassen, dafür aber zwei längere Abschnitte eingearbeitet, die sich auf jenen gesellschaftlichen Bereich beziehen, in dem die Krise der helfenden Berufe derzeit besonders bedrohlich wird: auf die Kranken- und Altenpflege. Hier sind die ‹burnout›-Phänomene am deutlichsten. Hinter ihnen werden die Strukturprobleme unserer veralteten medizinischen und sozialen Einrichtungen sichtbar. In dem Gegensatz zwischen der bedrückenden Situation im Pflegebereich und den expansiven Geltungsansprüchen höher bezahlter und geräuschvoller auftretender Berufsgruppen spiegelt sich nicht nur der unbefriedigende Zustand der Gleichberechtigung von Mann und Frau, sondern auch die Verdrängung von Hinfälligkeit und Tod, die Verleugnung der Grenzen menschlicher Belastbarkeit, welche an vielen Orten vernünftige Lösungen unserer Umweltprobleme unmöglich machen. Die Spaltung in der hochtechnisierten «Risikogesellschaft» (U. Beck), die qualifizierte, durchsetzungsfähige, gutverdienende und arbeitssüchtige Individuen von ihrem Gegenbild trennt (vgl. Teil III), wirkt auch auf die helfenden Berufe. Sie teilt diese in zwei Lager, von denen das eine die technischen Hilfsmöglichkeiten im Scheinwerferlicht entwickelt, während das andere im Dunkeln jene pflegen (oder ruhigstellen) soll, die sich für solche Maßnahmen nicht mehr eignen. In Lainz bei Wien und in Wuppertal, wo die schlimmsten Symptome dieser Situation auftraten (die Tötung schwerkranker, alter Patienten durch das Pflegepersonal), konnten sich in den folgenden Prozessen die Beteiligten im erleuchteten Lager retten, während die Opfer-Täterinnen im dunklen Bereich nur solange ins öffentliche Scheinwerferlicht gerieten, bis sie überführt und verurteilt waren. Die Chefärzte, denen – mit ihren Privatpatienten beschäftigt – nichts aufgefallen war, die Gerontochirurgen, die ohne jedes Bedenken den nächsten achtzigjährigen Patienten operierten, obwohl der letzte in der Intensivstation aus unklaren Gründen so plötzlich verstorben war, wurden geschont. Vielleicht ist auch Kriminalität eine Frage des Chiaroscuro, des Helldunkel. Wer im Licht steht, ist allein schon deshalb unschuldig; wer im Dunkel seine Pflicht tut, macht sich in dem Augenblick schuldig, in dem er sichtbar werden läßt, was er doch im Verborgenen erledigen soll. In der Welt der modernen Medizin, in der sogar der Tod eine Lobby braucht («Gesellschaft für humanes Sterben»), muß man sich auf manches gefaßt machen, was einst nur als Gruselgeschichte am Kamin erzählt wurde.
Einer meiner Freunde, Universitätslehrer von Beruf und wegen seiner Herzlichkeit von den Studenten ebenso geschätzt wie wegen seines Wissens, hat mir einmal erzählt, eine seiner Diplomandinnen habe wegen «Helfen als Beruf» ihr Studium aufgeben wollen. Er sagte es etwas vorwurfsvoll, aber auch amüsiert, und schien drauf und dran, mich zu einer Art Noteinsatz in dieser Angelegenheit zu verpflichten. Die Vorbereitung der Taschenbuchausgabe hat diese Szene wieder heraufbeschworen. Liebe Unbekannte, möchte ich sagen, laß dich nicht verwirren: Wir sind doch nicht verantwortlich für die Struktur der Welt, in der wir leben, sondern nur für unsere Bewegungen darin, denen sich unweigerlich etwas von dieser Struktur mitteilt («es gibt kein richtiges Leben im falschen», sagte doch Adorno so schön plakativ). Unser Spielraum ist begrenzt, aber wir können ihn besser ausschöpfen, wenn wir uns genauer orientieren. Daß der Helfer-Beruf ein frag-würdiger Beruf ist, scheint mir weder Schande noch Auszeichnung («Schriftsteller» ist schließlich nicht weniger fragwürdig). Ob die Aussage der Ermutigung dient, daß ich selbst nach zwanzig Jahren immer noch in diesem Beruf bin?
München, im Mai 1991
W.S.
Teil I Die «neuen» Helfer
In diesem Teil verdeutliche ich an meiner Arbeit als Psychoanalytiker den Widerspruch zwischen Dienstleistung und Gefühlsbeziehung. Die psychotherapeutische Situation, Beispiel einer relativ neuartigen Helfer-Schützling-Beziehung, setzt beim Helfer wie beim Klienten Lernprozesse in Gang, die mehr emotionale Freiheit ermöglichen, aber auch eine stärkere Kontrolle bisher der Privat- und Intimsphäre überlassener Bereiche bedingen. Die Hilflosigkeit der Experten beginnt da, wo an sie Teile einer Selbstverantwortung abgetreten werden, die sie gerade aufbauen sollen. Andrerseits ist zu beachten, wo die Experten durch ihre Lebensgeschichte und ihre Tätigkeit so geformt werden, daß sie ihre Schützlinge von sich abhängig machen müssen. Ein erster Schritt zu einem genaueren Verständnis dieser Situation ist die Unterscheidung zwischen «alten» und «neuen» Helfern. Die berufliche Entwicklung der klassischen Helfer – etwa der Ärzte und Geistlichen – hat dazu geführt, daß die gefühlsbestimmten Kontakte zu ihren Schützlingen immer dürftiger wurden. Parallel dazu entstanden neue soziale Berufe, die gerade diese emotionale Beziehung zum Gegenstand einer insgesamt rational bestimmten Dienstleistung machen.
Helfer-Syndrom und Professionalisierung
Machen wir einen Augenblick halt, um den Analytiker unserer aufrichtigen Anteilnahme zu versichern, daß er bei der Ausübung seiner Tätigkeit so schwere Anforderungen erfüllen soll. Es hat doch beinahe den Anschein, als wäre das Analysieren der dritte jener «unmöglichen» Berufe, in denen man des ungenügenden Erfolgs von vornherein sicher sein kann. Die beiden anderen, weit länger bekannten, sind das Erziehen und das Regieren.
S. Freud[*]
Zu den wenigen Dingen, die Sigmund Freud über den Beruf des Psychotherapeuten gesagt hat, gehört die Feststellung, daß es ein «unmöglicher» Beruf sei. Das heißt, daß in diesem Beruf Widersprüche eingeschlossen sind, die sich nicht auflösen lassen. Ich glaube, daß diese Widersprüche in anderen pädagogischen und medizinischen Berufen ebenso nachweisbar sind, doch sind sie für mich in der Psychotherapie am besten faßbar. Ich möchte ihnen von zwei Seiten nachgehen: der subjektiven (wie ich mich selbst und meine Kollegen in diesem Widerspruch erlebe) – und der objektiven (welche gesellschaftlichen Bedingungen diesen Widerspruch ausmachen).
Ich selbst bin erst spät zum professionellen Helfer geworden. Meine Tätigkeit nach dem Studium hatte einen anderen, handwerklichen Charakter. So nahm ich die Faszination des Helfens aus kritischer Distanz wahr. Ich erlag ihr endlich und sehne mich heute, nach fünfzehn Jahren vorwiegend psychotherapeutischer Tätigkeit, oft wieder zurück zu der größeren Freiheit, die ein «Handwerk» wie das des Schriftstellers mit sich bringt. So geht es vielen meiner Kollegen. Töpferkurse, ein Haus mit großem Garten auf dem Land, ein Reitpferd, ein eigenes Fotolabor oder eine Bienenzucht stehen hoch im Kurs. Fast alle sagen ständig, daß sie «weniger Therapie machen wollen».
Die Freiheit des Handwerks liegt darin, daß die Arbeit nicht unmittelbar eine Beziehung betrifft, in der beide – Helfer und Klient – voneinander abhängig sind. Die Schreibmaschine ist mir nicht böse, wenn ich sie in die Ecke stelle, weil mir heute nichts mehr einfällt. Der Klient läßt sich das nicht gefallen. Die Schulen der Psychotherapie sind sich weitgehend einig, daß gleichmäßige, freundliche Behandlung des Klienten durch den Therapeuten wünschenswert sei. Daneben gibt es eine ausgedehnte Diskussion darüber, in welcher Form und ob überhaupt der Therapeut auch «negative Gefühle» oder eine «feindselige Gegenübertragung» äußern dürfe. Daß er es unbegrenzt tun sollte, empfiehlt keines der professionellen Glaubensbekenntnisse. Ich fühle mich verpflichtet, für meine Klienten «da» zu sein, Müdigkeit und schlechte Laune möglichst zu unterdrücken, mich auf sie einzustellen. Wenn ich das nicht tue, muß ich es mir überlegen, d.h., ich muß meine Verweigerung der Therapeutenrolle zu einem Instrument einer letztlich doch therapeutischen Strategie machen.
Von dem französischen Analytiker Lacan wird erzählt, daß er es sich vorbehielt, Analysestunden bereits nach fünf Minuten abzubrechen und den Patienten nach Hause zu schicken, wenn er überzeugt war, daß heute nichts Wesentliches zustande käme. Ich habe mir diese Geschichte gemerkt, weil ich Lacan um sein Selbstbewußtsein beneide. Gleichzeitig finde ich seine Sicherheit sehr angreifbar, daß der Therapeut entscheiden kann, ob sich seine Anwesenheit für den Klienten lohnt oder nicht. Viele Therapeuten sind heute von der Notwendigkeit emotionaler Erfahrungen in der Therapie überzeugt, welche frühkindliche Versagungserlebnisse wiedergutmachen. Dabei wird zugestanden, daß diese korrigierenden Erlebnisse das Verlorene nicht wirklich ersetzen. In den Behandlungsberichten steht aber immer wieder zu lesen, daß bisher noch niemand dem Klienten ermöglicht hatte, seine wirklichen Gefühle zu erleben und zu äußern.
Diese familiäre Rolle setzt den Therapeuten einerseits größeren Anforderungen aus, andrerseits scheint sie ihm auch so viel zu bieten, daß die therapeutischen Theorien sich deutlich in Richtung auf mehr korrigierende emotionale Erfahrungen verändern (wenn man zum Beispiel die Positionen von Freud, Ferenzci, Janov und Miller vergleicht). Therapie kann im Rahmen einer ärztlichen oder psychologischen Praxis nur dann stattfinden, wenn sich die Beteiligten auf ein professionelles Verhältnis (einen Verkauf von Dienstleistungs-Zeit gegen bar oder gegen Leistungen der Krankenkasse) einigen. Sie soll andrerseits nur dann wirksam werden, wenn der Klient ein persönliches, intimes Vertrauensverhältnis zum Therapeuten findet. Fehlt diese persönliche Beziehung, so wird die Therapie wirkungslos bleiben. Was wir über positive Veränderungen wissen, läuft darauf hinaus, daß sich der Klient um so eher verändert, je mehr er sich gemocht fühlt und seinerseits den Therapeuten mag. Doch kann diese persönliche Beziehung nicht zustande kommen, wenn der Patient die Warenbeziehung verweigert, wenn er zum Beispiel seine Rechnungen nicht bezahlt oder seinen Krankenschein nicht abliefert, Termine nicht einhält oder zum Ende seiner Stunde nicht gehen will.
Mit dieser Situation umzugehen, erfordert für beide Beteiligten Lernprozesse und setzt Vermeidungsstrategien in Gang. So kenne ich Kollegen, die einem Patienten die bereitliegende Rechnung nicht in die Hand geben, sondern sie ihm per Brief ins Haus schicken. Ich selbst habe schon oft «vergessen», einem Patienten die Rechnung zu geben, wenn es ihm nach einer Stunde schlecht ging. Es hat mich Mühe gekostet, meine anfänglichen Schwierigkeiten zu überwinden, für eine so persönliche Beziehung Geld anzunehmen und Rechnungen auszuteilen. Andere Therapeuten bestehen darauf, daß jede Stunde zu Beginn bar bezahlt wird[*] – angeblich, um klare, analysierbare Verhältnisse zu schaffen.
Psychotherapeuten und Klienten sind sich heute vielfach in einer «Bauch nicht Kopf»-Ideologie einig. Diese Ideologie drückt deutlich aus, daß die Rationalisierungsfortschritte der Industriegesellschaft die Menschen schädigen. Es gibt Überanpassungen an die zweckmäßigtechnische Welt, die bei dem Betroffenen Genußfähigkeit, Beziehungsmöglichkeiten und Lebensfreude ruinieren. Er muß zu seinen Gefühlen zurückfinden, oder er wird in Depression und psychosomatischen Leiden zugrunde gehen. Aber in der Therapie lernt er keineswegs, nach seinen Gefühlen zu leben, sondern eher, die Gefühle so zweckrational und instrumentell einzusetzen, wie es ihm der Therapeut vormacht. In den Therapie- und Selbsterfahrungsgruppen ist der häufigste Vorwurf, daß einer seine Emotionen nicht herausläßt, daß er so «kopfig» daherredet. Aber wenn ein Gruppenmitglied einmal wirklich selbstvergessen emotional reagiert, sind Angst und Schrecken groß.
Auf mich wirkt sich das so aus, daß ich erleichtert bin, wenn der Patient zu Beginn der Stunde oder der Gruppensitzung betroffen ist und heftige Emotionen ausdrückt. Tut er das nicht, so versuche ich diesen Widerstand zu bearbeiten. Gegen Ende der Sitzung hingegen bremse ich eher eine tiefere Regression. Dann fesseln mich Gefühlsausbrüche nicht mehr, sondern sie machen mich ärgerlich. Ich beherrsche diesen Ärger mit der Überlegung, daß der Klient eine Szene aus seiner Kindheit wiederholt, in der er für seine Gefühlsäußerungen bestraft wurde – eben weil er sie am falschen Ort oder zur falschen Zeit zeigte. (Vielleicht gab es gar keinen «richtigen» Ort.) Ich versuche dann, diese Szene nicht zu wiederholen, aber ich weiß nicht, ob mir das immer gelingt. Schließlich bin ich am Ende eines Arbeitstages ruhebedürftig (wie es die Eltern dieses Klienten möglicherweise ebenfalls waren), oder der nächste Klient steht schon im Flur. Dieser «nächste Klient» erlaubt eine subjektiv angenehmere Helfer-Abgrenzung als das Bedürfnis nach Freizeit. Ich habe mich gelegentlich dabei ertappt, daß ich ihn vorschützte, um einen zögernden Klienten zum Gehen zu bewegen.
Ich hoffe, daß ein Stück weit deutlich geworden ist, weshalb professionelle Helfer die Gefühlsfeindlichkeit der Industriegesellschaft nicht wirklich überschreiten. In der Therapie gibt es den «richtigen» und den «falschen» Ort für das gefühlsbestimmte Leben, genau wie in der technokratischen Arbeitswelt. In ihr sind ja ebenfalls der Emotionalität Nischen reserviert, zum Beispiel beim Verkauf, in den Ritualen der Angestellten und vor allem beim Konsumieren. Wir kaufen nicht Zigaretten und Kosmetika, sondern Lebensgefühle, heile Welten oder sogar Charakter («Players Profile»).
In der üblichen therapeutischen Sozialisation lernen Klient und Therapeut, es als «Widerstand» anzusehen, wenn ein Konflikt nicht in die therapeutische Situation eingebracht wird, weil sie zeitlich begrenzt ist. Weniger abhängige Klienten (beispielsweise Studenten in einem Selbsterfahrungs-Seminar) halten an diesem Widerstand fest. «Ich denke gar nicht daran, jetzt was zu erzählen, was mich wirklich trifft, und dann ist es zwölf Uhr, und wir hören einfach auf, und ich weiß nicht, wohin ich soll mit meinen Gefühlen.» In einer längeren Therapie entwickeln Klienten ein sicheres Zeitgefühl, und es wird immer einfacher, die Stunden pünktlich zu beenden.
Die Hilflosigkeit der Experten
«Ich leide an einem Helfer-Syndrom – ich weiß nicht, ob Sie wissen, was ich da meine, Herr Schmidbauer?» Ich glaube, ich kann darauf warten, bis der erste Patient mit dieser Selbstdiagnose in meiner Praxis erscheint. Der Urheber eines solchen Begriffs reagiert darauf mit gemischten Gefühlen. Es schmeichelt ihm, daß er etwas ausgedrückt hat, was anscheinend vielen plausibel erscheint. Gleichzeitig fragt er sich, ob er wirklich das aussagen wollte, was jetzt so populär geworden ist. Helfer-Syndrom heißt gewiß nicht, daß die Helfer «auch nur aus egoistischen Motiven» handeln, wie es oft verstanden wird. Es heißt auch nicht, daß Schwierigkeiten und Widersprüche in der psychosozialen und pädagogischen Versorgung durch eine Art Berufsneurose bedingt sind.
Wichtigster Inhalt des Helfer-Syndroms ist das Helfen als Abwehr anderer Beziehungsformen und Gefühle. Aus unbewußten Motiven ist für den «hilflosen Helfer» die Kontaktaufnahme mit einem bedürftigen Schützling zu einer Art Droge geworden. Daß ihn andere brauchen, wird zum Suchtmittel, auf das er nicht mehr verzichten kann.[*] Der Helfer-Beruf bietet die Möglichkeit, dieses Suchtmittel auf legale Weise zu erwerben. Die hohen Dosen, die sich der Helfer auf diese Weise verschaffen kann, führen zu einer Abstumpfung, die in der amerikanischen Sozialforschung als Ausbrennen (burnout) anschaulich beschrieben wird.[*] Der «ausgebrannte» Süchtige hat keinen Lustgewinn mehr, wenn er seine Droge nimmt. Aber der Entzug ist noch unerträglicher, noch unangenehmer. Diesem Konflikt gleicht die Situation des hilflosen Helfers, der für andere dasein muß, aber gerade deswegen selbst verarmt und innerlich, hinter seiner Dienstleistungsfassade, immer bedürftiger und kümmerlicher wird.
Das Bild des hilflosen Helfers gewinnt ein Stück seiner Faszination aus der Entlarvung, dem exhibitionistischen Schock, welcher der Entblößung des sonst Verdeckten folgt. Der Psychotherapeut ist selber neurotisch, der Pfarrer gottlos, der Arzt krank. Hinter den Fassaden ist etwas ganz anderes – ein verwahrlostes Baby, ein Vampir, ein Süchtiger. Ziel meiner ersten Darstellung war es, auszudrücken, was mir in der Arbeit mit Angehörigen helfender Berufe als Gründe für ihre Depressionen, ihre Trauer, ihr Unglück und ihren Schmerz erschienen waren. Ich wollte die Betroffenen entlasten, sie dazu bewegen, sich dem Widerspruch zwischen omnipotenter Fassade und innerem, verwahrlostem Baby zu stellen. Ich wollte sie nicht in ihrer Selbstverleugnung bestätigen; ich wollte dem Kind hinter der Fassade etwas geben, aber die Fassade kritisieren. (Daher haben mir konservative Kritiker wie Christa Meves auch vorgeworfen, ich würde den Helfern Steine statt Brot geben.) Aber meine Analyse des Helfer-Syndroms ist sicher auch ein Ausdruck meiner eigenen gesellschaftlichen Position, die ich erst allmählich genauer wahrnahm. Psychotherapeuten sind hochspezialisierte und -reflektierte Helfer. Ihre Lösungsvorschläge gehen in diese Richtung: mehr Qualifizierung, mehr Professionalisierung – mehr Abhängigkeit von ihren beruflichen Kompetenzen. Wesentlich für den hilflosen Helfer ist häufig, daß er die Rolle des Gebenden, Mächtigen, Verstehenden überall spielen muß, in der Arbeit wie im Privatleben. In manchen Fällen gibt es gar kein Privatleben. Das Ideal der Selbstlosigkeit bestimmt das ganze Leben, wie in dem von manchen Gesundheitspolitikern immer noch beschworenen Bild der Ordenskrankenschwester, oder in dem von der Erbauungsliteratur sozialistischer Staaten angestimmten hohen Lied des Revolutionärs und Parteifunktionärs. Eine klare Formulierung der Trennung von Beruf und Privatleben ist sicherlich für die seelische Gesundheit vieler von ihren Institutionen ausgebeuteter Helfer wichtig.
Gleichzeitig ist aber die Entwicklung eines Arbeitnehmerbewußtseins in den Bereichen der medizinischen, psychologischen und pädagogischen Versorgung eine sehr zweischneidige Angelegenheit. Es gibt nämlich in vielen Bereichen keine Teilung der Bedürfnisse von Klienten, die der professionellen Arbeitsteilung entspricht. Immer da, wo die Helfer primär emotionale Bedürfnisse befriedigen sollen, ist die Versachlichung und Arbeitsteilung professioneller Hilfe in Gefahr, mit zunehmender Perfektionierung destruktiv zu werden. Der Klient gerät in die Rolle des Hasen zwischen den Igeln: Er hat keine Chance, zu finden, was er sucht, weil immer jemand anderer zuständig ist. In einem Krankenhaus führt zum Beispiel die Funktionspflege dazu, daß für jede einzelne Verrichtung eine andere Pflegekraft zuständig ist. Eine vertrauensvolle emotionale Beziehung kann unter diesen Umständen kaum zustande kommen. In einem «modernen» Kinderheim mit heilpädagogischer und psychologischer Fachabteilung, Schichtdienst und hoher Fluktuation der Erzieher kann es dazu kommen, daß ein elternloses Kind jährlich von zwanzig und mehr wechselnden Fachkräften betreut wird. Zu kaum einer kann es dann eine tiefere emotionale Bindung aufbauen.
Die Professionalisierung jener Dienstleistungen, die lange Zeit in den Familien autonom und ohne Verwissenschaftlichung geleistet wurden, bringt die Gefahr mit sich, daß sich die Betroffenen nichts mehr zutrauen und damit Selbstheilungskräfte verlieren, die durch die Hilfe der Spezialisten nicht ersetzt werden können. Ivan Illich hat darauf hingewiesen, daß das Martinshorn eines Ambulanzwagens die Bereitschaft zu gegenseitiger Hilfe in einem ganzen Stadtviertel zerstören kann. Seine Aussage über das Medizinsystem läßt sich durchaus auch auf die psychosoziale Versorgung übertragen. Ein professionelles, auf die Person des akademisch geschulten Fachmannes abgestelltes Vorgehen, das sich über bestimmte Grenzen hinaus entwickelt, macht aus drei Gründen die Übel schlimmer, die es zu bekämpfen vorgibt. Es erzeugt technische Schäden, die seine Wohltaten überwiegen; es begünstigt zerstörerische gesellschaftliche Verhältnisse und verschleiert ihre Bedeutung für das individuelle Leid; es behindert und entfernt die Betroffenen von ihren Möglichkeiten, ihr Leben zu gestalten, selbst zu gesunden und die krankmachenden Umweltfaktoren anzugehen.
Die gesellschaftliche Dimension des hilflosen Helfers, um die es mir hier geht, liegt darin, daß die Industriegesellschaft dazu neigt, Probleme, die durch ihre technische, profitbestimmte und zweckrationale Vorgehensweise entstehen, mit eben diesen Mitteln zu «lösen». Jede solche «Lösung» verschleiert das tiefere Problem und erschwert eine Veränderung. Im Bereich der psychosozialen Versorgung sieht das vor allem so aus, daß Experten produziert werden, die für systembedingte Störungen zuständig sind. Sie gewinnen ihre berufliche Rolle durch diese Störungen und schaffen so einen zusätzlichen, an Grundsätzen von Angebot und Nachfrage, Profit und Konkurrenz orientierten Wirtschafts-Bereich. In ihm werden mit der Hilfe bezahlter Dienstleistungen die Schäden verwaltet, welche Umweltzerstörung, Profitdenken und Wettbewerbszwänge anrichten.
Die Strategie der Professionalisierung beruht auf der Annahme, daß alle durch die Industrialisierung angerichteten emotionalen Probleme rational durch geeignete Experten gelöst werden können. Das ist ein Irrtum, der ständig dadurch verschleiert wird, daß es diesen Experten sehr gut möglich ist, immer neue Erklärungen dieser Probleme zu finden und immer neue Techniken des Umgangs mit ihnen zu propagieren. Weil diese Neuerungen den Experten wichtig sind, werden sie oft irrtümlich für hilfreich gehalten. So machen Pädagogik, Sozialarbeit und Psychotherapie ständig «Fortschritte». Diese gleichen oft den neuen Kleidern des Kaisers, haben mehr mit Mode zu tun als mit dem wissenschaftlichen Modell des Fortschritts.[*]
Da die seelische Gesundheit und damit das soziale Funktionieren des einzelnen nicht rational, sondern emotional bestimmt ist, enthält die Produktion von pädagogischen, psychotherapeutischen und medizinischen Spezialisten nach dem Modell der technisch so erfolgreichen Naturwissenschaft einen tiefen Widerspruch. Er ist so lange unlösbar, wie der Umgang mit dem spezialisierten Wissen von den Grundprinzipien bestimmt ist, die der Kapitalismus geboren und bisher nicht bewältigt hat: Verwertung der Natur, um den größtmöglichen Profit zu erzielen.
In den «hilflosen Helfern» ging es darum, zu zeigen, daß es neben der materiellen Ausbeutung auch eine psychologische gibt, die gerade in den helfenden Berufen eine große Rolle spielt. Eine narzißtische Ausbeutung der sozialen Umwelt durch die anerkannte Rolle des Helfers, die sicheren Abstand von den verletztenden, zerstörerischen Umgangsformen der profitgeprägten Wirtschaft verspricht, scheint heute an Anziehungskraft zu gewinnen. Nicht mehr der Ingenieur oder der Anwalt, sondern der Arzt und Psychologe sind die begehrtesten Berufe.
Doch bietet ein Beruf allenfalls eine begrenzte narzißtische Befriedigung. Er wird keinesfalls ein narzißtisches Defizit, einen Mangel ausgleichen. Der angehende Psychologe oder Sozialarbeiter sucht einen Kompromiß. Er möchte aus dem konkurrenzbestimmten, rücksichtslosen Arbeitsleben aussteigen[*], aber nicht auf die Vorteile eines qualifizierten, angesehenen Berufs verzichten. Das heißt auch, daß er in einer beruflichen Krise rasch daran denkt, ganz auszusteigen. Berufstätige im Wirtschaftsleben können in solchen Krisen immer noch daran denken, «partiell» auszusteigen, indem sie auf einen sozialen Beruf umschalten. Der Industriemanager, welcher Heilpraktiker wird (und in seiner Praxis alsbald wieder Spitzenumsätze erzielt) ist ein populärer Vertreter dieser Gruppe.
Ein Mediziner, der es zu einer hohen Position in der pharmazeutischen Industrie gebracht hatte, erzählte mir einmal, er habe immer davon geträumt, auszusteigen und sich als Landarzt niederzulassen. Ich habe aber noch nie beobachtet, daß ein Therapeut in einer persönlichen Krise daran denkt, seine Privatpraxis aufzugeben und sich einen Job in der Industrie zu suchen.
In unserer ethischen Überlieferung ist Nächstenliebe als Gefühlsausdruck gegenwärtig, nicht als Berufsbild. Ihre Professionalisierung bringt die Gefahr mit sich, daß wenige erledigen sollen, was den anderen abgenommen ist. Ein Stück Gefühlsausdruck mehr wird reglementiert und kontrolliert. Nächstenliebe als Beruf zieht jene Menschen an, die das Gefühl haben, zuwenig Liebe erhalten zu haben. Dieser Mangel macht empfindlich für den Mangel an liebevollen Beziehungen in der Industriegesellschaft selbst. Wenn aus diesen Motiven ein helfender Beruf gewählt wird, öffnet der Betroffene gerade jenen von den Zwängen der Warenproduktion bestimmten Vorgängen die Tür, welche er verwerfen und vermeiden will.
Als Psychotherapeut begegne ich diesen Widersprüchen immer wieder. Meine Arbeit hat mich zu einem deutlicheren Bewußtsein über die gesellschaftlichen Bedingungen jener Helfer-Nischen gezwungen, in denen ich anfänglich selbstbewußt und selbstvergessen zugleich gearbeitet habe. Heute konkurriere ich nicht mehr mit den «schlechten» Eltern meiner Klienten, sondern sehe sie ebenso als Opfer gesellschaftlicher Entwicklungen wie mich und meine eigene Arbeit. Ich unterwerfe mich keiner therapeutischen Theorie mehr, seit mir klarer wird, wie sehr sie alle von den Bedürfnissen der Helfer geprägt sind und ihre beruflichen Auffassungen rechtfertigen. Ich bin überzeugt, daß eine wirkliche Veränderung der zerstörerischen Vorgänge in den Industriegesellschaften Experten und Klienten gleichermaßen betreffen muß. Es gibt keine professionellen Helfer, welche die ganze Gesellschaft verbessern können, aber sehr viele, die sie weitertreiben auf ihrem unheilvollen Weg.
Solche Überlegungen sind sicher ein Privileg des Psychotherapeuten, der durch die Einfachheit seiner Mittel eher dazu in der Lage ist, Technik und Naturwissenschaft aus kritischer Distanz zu sehen. Viele nachdenkliche Menschen haben schon die Geschichte vom chinesischen Weisen nacherzählt, der es ablehnte, seinen Garten mit einer Maschine zu bewässern. Er fürchtete, die vervollkommnete technische Leistung würde ihn selbst, seine ganze Person anstecken, ihn maschinenmäßig funktionieren lassen. Ich bin überzeugt, daß diese Gefahr besteht. Wir drohen ihr heute zu erliegen. Das Anwachsen des Protests unter den Jugendlichen und des Protests der seelischen und «körperlichen» Krankheiten ist ein Ausdruck dieser Situation. Diese Gefahr, «maschinenmäßig» und damit innerlich tot zu werden, liegt nicht nur in der Anwendung äußerer Maschinen, sondern auch in der Verbindung des menschlichen Selbstgefühls mit einer rational definierten, abgegrenzten Berufstätigkeit. Der Helfer sucht dieser Gefahr zu entrinnen, indem er Mitmenschlichkeit zu seinem Beruf macht – aber damit gerät er in Gefahr, sein innerstes Wesen selbst zu instrumentalisieren.
Um diese Gefahren und den Umgang mit ihnen geht es in diesem Buch. Ich sehe es als Fortentwicklung meiner Arbeit über das Helfer-Syndrom an und möchte vor allem klarer zeigen, wie die verschiedenen Formen der Professionalisierung des Helfens die innere und äußere Situation der Helfer prägen. Ich will möglichst anschaulich bleiben und immer wieder versuchen, durch konkrete Beispiele die Wechselwirkung des persönlichen und des Berufs-Feldes so darzustellen, daß die einzelnen Einflüsse in ihrem Zusammenspiel durchschaubar werden.
Die «neuen» Helfer
Der Ausgangspunkt der Arbeiten zum Helfer-Syndrom war die persönliche Situation von Menschen aus den sozialen Berufen, die als Klienten von Selbsterfahrungsgruppen oder als Patienten in analytischer Psychotherapie mit sich selbst und ihrer Arbeit nicht zurechtkamen. Als grundlegende Charakterproblematik ergab sich der Konflikt zwischen einer starken, progressiven Fassade und unterdrückten «kindlichen» Bedürfnissen dahinter. Angst vor Offenheit und vor gegenseitigen Beziehungen, in denen jeder der Beteiligten einmal stark, einmal schwach sein kann, wurde deutlich. Indirekte Aggressionsäußerungen, Mißtrauen, und starre Orientierung an Regeln trugen zu diesen persönlichen Schwierigkeiten der «hilflosen Helfer» bei.
Mein ursprüngliches Ziel war, diesen Menschen Einsichten in die emotionale Dynamik ihrer persönlichen Situation und Schritte zu einer verbesserten Psychohygiene in den helfenden Berufen anzubieten. Wo ich damit als Therapeut nicht weiterkam, dachte ich eher gewerkschaftlich: klare Trennung von Beruf und Privatleben, Organisationsformen wie Betriebs- und Personalräte, welche verhindern, daß mit der Über-Orientierung an Pflicht und Dienst der Helfer Schindluder getrieben wird. Ich zitiere als Erfolgsbericht eine Sozialarbeiterin, die sich früher ständig überfordern und von allen ihren Klienten bis tief in die Nacht hinein emotional ausbeuten ließ. Sobald sie in einer analytischen Selbsterfahrungsgruppe gelernt hatte, rechtzeitig nein zu sagen und sich abzugrenzen, fand sie wieder mehr Freude und Initiative für ihre Arbeit.
Aber ich erlebe auch Reaktionen auf das Buch, die mich unsicher machen. Meine Analyse des Helfer-Syndroms war gegen die Unklarheit gerichtet, die eine so «familiäre» Tätigkeit mit sich bringt. Im Haushalt ist jeder für jeden anderen mitverantwortlich. Es gibt einem kranken Kind gegenüber keine Möglichkeit, sich nach Dienstschluß von jeder Fürsorgepflicht zurückzuziehen. Die strenge Trennung von Arbeitszeit und Freizeit, die sich gewissermaßen als Konsequenz aus einer Auseinandersetzung mit dem eigenen Helfer-Syndrom ergeben könnte, wies in eine Richtung, die mir nicht so gut gefällt. Die psychosoziale Arbeit wird am Ende auch taylorisiert, durch Aufteilung in einzelne Maßnahmen scheinbar wirksamer gemacht, tatsächlich aber ihres emotionalen Gehalts mehr und mehr entleert.
Natürlich kann ich mich darauf zurückziehen, daß jene Helfer, die mit dem Argument: «Ich habe schließlich kein Helfer-Syndrom» um jeden Preis pünktlich nach Hause gehen wollen, mich eben nicht verstanden haben. Ich halte mehr von den Versuchen, die Trennung von Beruf und Privatleben, zum Beispiel in therapeutischen Wohngemeinschaften wieder durchlässiger zu machen. Das scheint mir im psychosozialen Bereich sinnvoller, als ihn immer mehr zu rationalisieren und Kinderheime oder Kliniken wie Industriebetriebe aufzuziehen. Einige meiner Überlegungen dazu habe ich 1980 in ein Nachwort zu den «hilflosen Helfern» aufgenommen, aber das Thema hat nicht aufgehört, mich zu beschäftigen.
Der Aspekt der Selbsterfahrung, von dem ich ausgegangen bin, enthält ja die Sorge um den «ganzen Menschen». Im sozialen Beruf ist die «Droge Arzt» (Lehrer, Sozialarbeiter, Psychotherapeut) vermutlich das wirksamste Instrument. Gleichzeitig ist es am wenigsten erforscht, eben weil dieser «ganze Mensch» auch das Gefühlsleben einbezieht. Er läßt sich nicht auf rationales Wissen und technische Fertigkeiten reduzieren. Untersuchungen, die sich wirklich auf diese Ebene begeben und sie nicht nur hilflos quantifizieren, fehlen bitter. Aber sie sind auch verdächtig, weil wir leicht Emotionalität und Irrationalität gleichsetzen. Wir müssen das wohl auch tun, solange die zweckmäßige Verwertung der Gefühle obenan steht. Eine Vernunft, die dem Leben mehr verpflichtet ist als dem Profit, wird auch offen sein für die Lebensäußerung der Gefühle und damit für diesen konkreten «ganzen Menschen».
Der «ganze Mensch» hängt sozialgeschichtlich mit dem «ganzen Haus» zusammen, also mit einer Lebenssituation, in der die produktivreproduktiven Einheiten überschaubar waren. In dieser Zeit brauchte man keine differenzierten sozialen Berufe. Die Großfamilie, die dörfliche Gemeinde, das Stadtviertel waren in Jahrzehnten zusammengewachsene Gemeinschaften. Die Gruppen reglementierten das Leben ihrer Mitglieder in einem für unser heutiges Bewußtsein wohl schwer erträglichen Ausmaß, aber sie boten auch Schutz und Hilfe in vielen jener Situationen, in denen sich heute ein leidendes, von fremden Nachbarn angefeindetes Individuum zu einem psychosozialen Fachmann begibt, um ihn um Hilfe zu bitten, oder aber von einer Ordnungsmacht (Polizei, Gesundheitsamt, Sozialamt) diesem Fachmann zugeführt wird.
Diese Entwicklungen sind als «Individualisierungsprozesse» in der Soziologie, in Gemeindepsychiatrie und Gemeindepsychologie bereits differenziert dargestellt. Was bedeuten sie für den Helfer? Der «soziale Beruf» war schon immer ein normativer Beruf. Der Zugang zu ihm setzte den Nachweis einer überdurchschnittlichen Fähigkeit voraus, Normen zu verstehen, sie zu erfüllen und sie weiterzugeben. Das gilt für die klassischen drei «großen» Professionen, den Arzt, den Pfarrer und den Rechtsanwalt, ebenso wie für ihre Institutionen: die Krankenhäuser, die Schulen und die Justizbehörden. Bis heute regeln die Angehörigen dieser drei Berufsgruppen das Zusammenleben in den entwickelten Gesellschaften. Wenn man die Umweltzerstörung und das zwischenmenschliche Chaos allenthalben betrachtet, kann man sie auch alle miteinander als hilflose Helfer ansprechen. Aber solche Rundumschläge bringen uns nicht viel weiter.
Die bürgerliche Gesellschaft hat in ihrer Entwicklung dieser Professionen auf die Rationalität gesetzt. Solange ihre Legitimation noch eine intakte Fassade hatte, die Naturausbeutung und der Kolonialismus noch nicht zum Himmel stanken, funktionierte dieses System leidlich. Es reichte aus, daß die Professionellen an die Fiktion ihres rationalen Expertentums glaubten und ihre Urteile über sich und die Welt danach ausrichteten. Der Arzt war für die Behandlung der körperlichen Krankheiten zuständig, der Pfarrer und Lehrer für moralische und intellektuelle Erziehung der Kinder, der Jurist für die sogenannte rechtsstaatliche Regelung des Zusammenlebens. Es gab Menschen, die durch die Löcher dieses Systems hindurchfielen und die Normen nicht erfüllten. Sie wurden erkannt, abgestempelt und entweder (falls es sich um Angehörige der Oberschicht handelte) der Pflege ihrer Familien bzw. bezahlter Diener überlassen oder in den Irrenanstalten und Zuchthäusern aus dem Verkehr gezogen. Ärzte, Pfarrer und Juristen lösten diese Probleme gemeinsam auf die vertraute, normativ- rationale Weise.
Diese allgemeinen Überlegungen sind notwendig, um die Veränderungen zu verstehen, die sich heute in den sozialen Berufen abspielen. Der Arzt, der einen Patienten mit Wahnvorstellungen als «Dementia praecox» bis an sein Lebensende in die Heilanstalt einweist, der Lehrer, welcher alle Schüler, die nicht aufmerksam zuhören, verprügelt oder aus dem Klassenzimmer schickt, der Pfarrer, welcher zerstrittene Eheleute mit Zitaten aus den Paulus-Briefen abfertigt – sie alle gehören heute der Vergangenheit an. Sie mögen sich als lebendige Fossilien noch gelegentlich in der Gegenwart finden, haben jedoch keinen wirklichen Rückhalt in der Gesellschaft für ihr schlicht normatives Vorgehen.
Warum muß denn der Arzt heute in eine Balintgruppe gehen, um zu erfahren, wie er als «ganzer Mensch» auf seine Patienten wirkt, nicht als medizinischer Techniker? Warum hat es der Lehrer nötig, seine Schüler zu motivieren? Warum soll der Pfarrer eine Ausbildung als Eheberater machen oder zumindest wissen, welche seiner Gemeindeangehörigen er in eine Beratungsstelle schicken muß? Warum gibt es eine ganze Palette von Berufen wie die Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Beschäftigungstherapeuten, Psychologen, Psychotherapeuten, Erziehungsberater, Familientherapeuten, die allesamt mehr oder weniger ausdrücklich zugestehen, daß die Beziehung zu ihren Klienten ein wichtiges, wenn nicht das wichtigste Instrument ihrer Arbeit sei?
Es gibt sicher mehr als nur einen Grund dafür. Ich will hier einige Gesichtspunkte zusammenstellen, sicher eine unvollständige Liste, die man auch systematischer fassen könnte:
1. Es wurden schlechthin zu viele «Unangepaßte», «Unaufmerksame», «Neurotiker», «Nervöse»; die Arbeits- und Lebensbedingungen (über)forderten das menschliche Nervensystem mehr und mehr (→ Punkt 4).
2. Mit steigendem Lebensstandard und wachsender industrieller Produktion konnte mehr Arbeitskraft abgestellt werden, um sich mit jenen Menschen zu beschäftigen, die einerseits die Normen nicht erfüllen konnten, andrerseits aber unter besonderer Hilfe vielleicht einmal doch nützliche, produktive Mitglieder der Gesellschaft zu werden versprachen.
3. Daß sich menschliches Leiden normativ so wenig vermindern ließ, störte in einer fortschrittsgläubigen «Macher»-Gesellschaft und erzwang neue Hilfsmaßnahmen.
4. Die dörflichen und städtischen Gemeinschaften wurden immer funktionsuntüchtiger, desgleichen die Kleinfamilien, welche durch die Forderungen der industriellen Produktionsweise gebildet worden waren. Störungen wogen schwerer und fielen in der Kleinfamilie mehr auf als in den Großfamilien.
5. Durch die wachsende Bedeutung der inländischen Nachfrage verwandelten sich die sittlichen Normen der kapitalistischen Gesellschaft von der Mischung Sparsamkeit/Leistungserfüllung zu der Mischung Leistungssteigerung/sofortiger Konsum. Arbeiter und Angestellte wurden als Konsumenten aufgebaut. Damit steigerte sich auch die potentielle Nachfrage nach sozialen Dienstleistungen. Im Gegensatz zur zweckrationalen Arbeits- und Leistungswelt spielen in der Konsumwelt Gefühle und persönliche Beziehungen eine wichtige Rolle. Dieser bisher vernachlässigte menschliche Bereich mußte also entdeckt und erschlossen werden. (Daher auch die gegenseitige «Befruchtung» von klinischer und Werbe-Psychologie.)
Welchen Einfluß hatten diese Veränderungen auf die sozialen Berufe? Das maßlose Wachstum der wirtschaftlichen Produktion hatte dazu geführt, daß die Europäer große Erfolge in der Eroberung und Ausbeutung des Planeten hatten. Dahinter stand ein durch tönende nationalistische und kolonialistische Phrasen («Bürde des weißen Mannes») verdecktes schlechtes Gewissen. Der soziale Beruf stellt einen Kompromiß her. Er erlaubt es, an dem zweckrationalen Grundkonzept festzuhalten – schließlich ist es eine abgegrenzte, anerkannte Arbeit, die man leistet. – Zugleich wird das schlechte Gewissen beschwichtigt, das durch den Widerspruch der bürgerlichen Ideale (Glück, Freiheit und Gleichheit für alle Individuen) zur bürgerlichen Wirklichkeit entstehen mußte. Der soziale Beruf bietet eine sofortige alltagsnahe Lösung dieser Widersprüche an, ohne Gewalt und Umsturz, im Einklang mit der bürgerlich-christlichen Moral, ja selbst mit nationalem Empfinden.
Aber auch diese Formulierung ist sehr allgemein. Sie muß ergänzt werden. Der Helfer-Beruf hatte früher durchaus auch emotionale Bedürfnisse wahrgenommen und erfüllt. Durch die Entwicklung von Hierarchien[*] und später durch die bürgerliche Aufklärung verlor er diese Qualität weitgehend. Erst in den letzten Jahrzehnten gewinnt er sie zurück, wenn auch nur partiell, wie die ganze Zulassung von Emotionalität in der konsum-kapitalistischen Gesellschaft von Anfang an begrenzt und reglementiert ist.
Der «Sinn» des menschlichen Lebens liegt in den emotionalen Beziehungen. Er liegt, wie uns die trivialsten Dichter und die erhabensten Theoretiker des Bürgertums versichern, nicht im Gelderwerb, im Gewinn von Macht und Ansehen, in genialen Leistungen. Die Bestätigung durch Leistung, durch Geld, durch Macht befriedigt uns nicht wirklich, wird gesagt. Das gelingt nur in der wechselseitigen Bestätigung von Freundschaft und Liebe. Ich glaube, daß diese Beobachtung richtig ist, aber auch, daß die Situation, in der sie angestellt wird, bereits die Konflikte einer individualisierten Gesellschaft ausdrückt. Es ist wie in der Liebe, wo Schwüre und Geständnisse oft auch