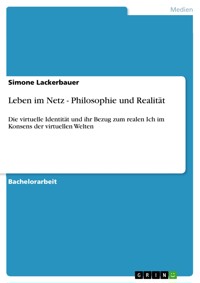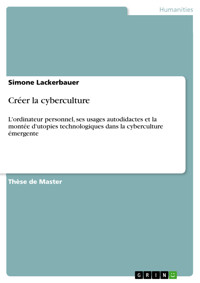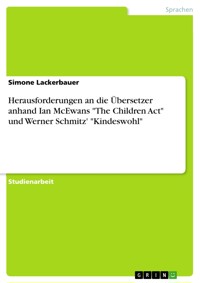
Herausforderungen an die Übersetzer anhand Ian McEwans "The Children Act" und Werner Schmitz' "Kindeswohl" E-Book
Simone Lackerbauer
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich Dolmetschen / Übersetzen, Note: Unbenotet, Ludwig-Maximilians-Universität München (Anglistik), Veranstaltung: Übersetzungskritik, Sprache: Deutsch, Abstract: Den Einstieg zu finden, ist meist der schwierigste Schritt im Erstellungsprozess eines schriftlichen Werkes. Wie gut, möchte man meinen, haben wir es da als ÜbersetzerInnen, die das fertige Werk bereits vorliegen haben, es sich zu Gemüte führen dürfen und es danach lediglich in die eigene Muttersprache übertragen. Doch sowohl Theorie als auch Praxis belehren uns eines Besseren: Es gibt keine einheitliche Lehre der Translation, anhand derer wir unsere Entscheidungen für die Übersetzung treffen und rechtfertigen können. Zudem begegnet uns bisweilen die Meinung, das Übersetzen sei einfach: Mangels des Wissens um die Komplexität der Aufgabe und aufgrund der Tatsache, dass in einem druckreif übersetzten Manuskript die zugrunde liegende Arbeit nicht sichtbar wird. Anders verhält es sich bei der Übersetzungskritik. Ausgehend vom Ausgangstext (AT) und vom Zieltext (ZT), versucht die dritte Person in Form des Kritikers, den Dialog mit dem Text wieder zu erweitern und aus dem Ergebnis die Vorgehensweise abzuleiten – sozusagen eine Form des reverse engineering. Dass dabei ein guter Text noch lange kein Garant für eine solide Übersetzung ist, dass ein mangelhafter AT durch einen gehaltvollen ZT überstrahlt werden kann, oder dass eine fehlerhafte ZT auch negativ auf den AT rückwirkt, gehört zu den ersten Lektionen, die angehende ÜbersetzerInnen lernen. So ist es umso erfreulicher, dass im Rahmen dieses Portfolios sowohl AT als auch ZT von hervorzuhebender Qualität sind. Das macht es einerseits zum Vergnügen, sich mit den Texten auseinanderzusetzen. Andererseits wirft es die Frage auf: Welche Perspektive muss die Kritik einnehmen, um sowohl gerecht gegenüber dem ZT aufzutreten, aber dennoch Alternativen sinnhaft begründet anzubringen? Anders ausgedrückt: Wie kritisiert man einen Text, an dem es aus Leser- und Verlagsperspektive nichts Wesentliches auszuset
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
I. Zum Autor: Ian McEwan
Kurzbiographie
Ian McEwan und die Medien
Ressourcen zu Ian McEwan
II. Zum Übersetzer: Werner Schmitz
Kurzbiographie
III. Inhaltliche Vorstellung des AT
Ian McEwan, The Children Act
Inspiration für The Children Act
Forschung zu The Children Act
IV. Rezensionsrecherche
Eingangsüberlegungen zur Rezensionsrecherche
Beispiele für inhaltliche Fragen
Beispiele für textbezogene Fragen
Beispiele aus Rezensionen zu Ian McEwans Kindeswohl
V. Herausforderungen an den / die ÜbersetzerIn
Problem 1: Kontraste und Konfrontationen
Problem 2: Juristisches, religiöses und medizinisches Fachwissen
Problem 3: Dialogszenen vor Gericht, im Krankenhaus
Problem 4: Watching the English
Problem 5: der Jugendliche Adam Henry
Problem 6: die Frau Fiona Maye
VI. Übersetzungsfragen an den ZT
Wie (gut) funktioniert der Text als deutscher Text?
Was kann als gelungen hervorgehoben werden?
Was kann als weniger gelungen bezeichnet werden?
VII. Beispiele im Vergleich: AT und ZT
Titel und Eingangszitat (AT S. I, Z. 1-5; ZT S. VII, Z. 1-5)
(AT.1 / ZT.1) Gerichtsverhandlung: Der Fall Adam Henry
(AT.2 / ZT.2) Die Urteilsverkündung
(AT.3 / ZT.3) Die Ballade von Adam Henry
VIII. Fazit und Ausblick
IX. Referenzen
X. Textstellen
Einleitung
Den Einstieg zu finden ist meist der schwierigste Schritt im Erstellungsprozess eines schriftlichen Werkes. Wie gut, möchte man meinen, haben wir es da als ÜbersetzerInnen, die das fertige Werk bereits vorliegen haben, es sich zu Gemüte führen dürfen und es danach lediglich in die eigene Muttersprache übertragen. Doch sowohl Theorie als auch Praxis belehren uns eines Besseren: Es gibt keine einheitliche Lehre der Translation, anhand derer wir unsere Entscheidungen für die Übersetzung treffen und rechtfertigen können. Zudem begegnet uns bisweilen die Meinung, das Übersetzen sei einfach: Mangels des Wissens um die Komplexität der Aufgabe und aufgrund der Tatsache, dass in einem druckreif übersetzten Manuskript die zugrunde liegende Arbeit nicht sichtbar wird.
Anders verhält es sich bei der Übersetzungskritik. Ausgehend vom Ausgangstext (AT) und vom Zieltext (ZT), versucht die dritte Person in Form des Kritikers, den Dialog mit dem Text wieder zu erweitern und aus dem Ergebnis die Vorgehensweise abzuleiten – sozusagen eine Form des reverse engineering. Dass dabei ein guter Text noch lange kein Garant für eine solide Übersetzung ist, dass ein mangelhafter AT durch einen gehaltvollen ZT überstrahlt werden kann, oder dass eine fehlerhafte ZT auch negativ auf den AT rückwirkt, gehört zu den ersten Lektionen, die angehende ÜbersetzerInnen lernen:
“[T]he text in the other language has become almost materially thinner, the light seems to pass unhindered through its loosened fibres. For a spell the density of hostile or seductive ‘otherness’ is dissipated. […] The translator invades, extracts, and brings home. […] Certain texts or genres have been exhausted by translation. Far more interestingly, others have been negated by transfiguration, by an act of appropriate penetration and transfer in excess of the original, more ordered, more aesthetically pleasing. There are originals we no longer turn to because the translation is of a higher magnitude.”[1]
So ist es umso erfreulicher, dass im Rahmen dieses Portfolios sowohl AT als auch ZT von hervorzuhebender Qualität sind. Das macht es einerseits zum Vergnügen, sich mit den Texten auseinanderzusetzen. Andererseits wirft es die Frage auf: Welche Perspektive muss die Kritik einnehmen, um sowohl gerecht gegenüber dem ZT aufzutreten, aber dennoch Alternativen sinnhaft begründet anzubringen? Anders ausgedrückt: Wie kritisiert man einen Text, an dem es aus Leser- und Verlagsperspektive nichts Wesentliches auszusetzen gibt? Denn letztendlich ist dies der Kompromiss, den eine Übersetzung herstellen muss: Die Brücke zu schlagen zwischen dem Autor, dem Verlag, dem Leser und der übersetzenden Person selbst; sie muss allen gerecht werden, insbesondere aber dem Markt, damit sie sich gut verkaufen lässt. Kritik muss also auf eine andere Stelle abzielen als auf die kommerzialisierbare Lesbarkeit. In reduzierter Form wird dies im vorliegenden Portfolio angestrebt; wenngleich gesagt werden muss, dass es einer intensiveren Auseinandersetzung mit den Texten bedarf, um die angedeuteten Ansätze entsprechend auszuarbeiten.
Zunächst sollen kurz Autor und Übersetzer, sowie der AT und seine Rezensionen vorgestellt werden; sodann folgt eine Skizze der Herausforderungen an den oder die ÜbersetzerIn. Generelle Fragen zur Übersetzung werden im nächsten Abschnitt beantwortet und anhand von Beispielen im Vergleich von AT und ZT belegt. Schlussendlich rundet ein kurzes Fazit mit Ausblick die Übersetzungskritik ab.
I. Zum Autor: Ian McEwan
Kurzbiographie
Ian Russell McEwan wird am 21. Juni 1948 im englischen Aldershot (Hampshire) im Süden Englands geboren. Die 62.000 Einwohner umfassende Stadt ist als Home of the British Army vor allem aufgrund seines Militärstützpunktes bekannt. Als Sohn eines Majors verbringt McEwan seine Kindheit unter anderem in Singapur und in Libyen; nach dem Internat studiert er englische Literatur in Brighton und an der Universität von East Anglia. Seit 1974 lebt und arbeitet er als freier Schriftsteller, der zunächst durch Kurzgeschichten Bekanntheit erlangt: 1975 erscheint die erste Sammlung unter dem Titel First Love, Last Rites; 1978 In Between the Sheets. 1978 erscheint mit The Cement Garden sein erster Roman, der 1993 auch verfilmt wird. Der endgültige Durchbruch gelingt McEwan 1998 mit dem Roman Amsterdam, für den er den Booker Prize erhält. Insgesamt verfasste er bisher 13 Romane, zwei Kurzgeschichtensammlungen, zwei Kinderbücher, drei Theaterstücke und zwei Libretti[2].Über sein Schreiben sagt der Autor selbst:
"I think of novels in architectural terms. You have to enter at the gate, and this gate must be constructed in such a way that the reader has immediate confidence in the strength of the building.“[3]
Er konstruiert seine Geschichten und seine Charaktere um zentrale Themen; genau recherchiert er, wenn Fachwissen vonnöten ist. In einem Interview beschreibt er, dass er gegensätzliche Fantasien und Ziele in seinem Schreiben sieht: Einerseits schätzt McEwan Präzision und Klarheit in seinen Sätzen. Andererseits schätzt er die implizierte Bedeutung in ihren Zwischenräumen. Gegensätze wie der private und der öffentliche Raum, oder das Verhältnis zwischen Mann und Frau, faszinieren ihn:
"I have contradictory fantasies and aspirations about my work. I like precision and clarity in sentences, and I value the implied meaning, the spring, in the space between them. Certain observed details I revel in and consider ends in themselves. I prefer a work of fiction to be self-contained, supported by its own internal struts and beams, resembling the world, but somehow immune from it. I like stories, and I am always looking for the one which I imagine to be irresistible. Against all this, I value a documentary quality, and an engagement with a society and its values; I like to think about the tension between the private worlds of individuals and the public sphere by which they are contained. Another polarity that fascinates me is of men and women, their mutual dependency, fear and love, and the play of power between them. Perhaps I can reconcile, or at least summarise, these contradictory impulses in this way: the process of writing a novel is educative in two senses; as the work unfolds, it teaches you its own rules, it tells how it should be written; at the same time it is an act of discovery, in a harsh world, of the precise extent of human worth.“[4]
Es ist an dieser Stelle tatsächlich wichtig, dieses Author Statement von der Webseite des British Council Literature ungekürzt einzufügen. Denn es erlaubt Rückschlüsse darauf, worauf der Übersetzer auf der übergeordneten Metaebene zu achten hat, wenn er einen McEwan ins Deutsche überträgt. Die genannten Kontradiktionen stellen zugleich eines der Probleme dar, die in Kapitel V beschrieben werden.
Ian McEwan und die Medien