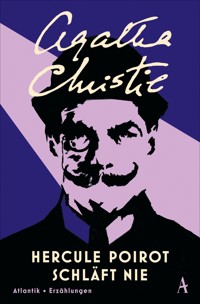
9,99 €
Mehr erfahren.
Eine Tote, die sich mit der rechten Hand in die linke Schläfe geschossen hat? Ein Geist, der just auftaucht, als geheimste Militärpläne verschwinden? Eine Kugel, die erst Sir Gervase umbringt und dann einen weit entfernten Spiegel trifft? Verwickelte Fälle und damit: Treibstoff für Meisterdetektiv Hercule Poirots nimmermüde kleine graue Zellen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 317
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Agatha Christie
Hercule Poirot schläft nie
Erzählungen
Erzählungen
Aus dem Englischen von Michael Mundhenk
Atlantik
Für meine alte Freundin
Sybil Heeley,
voller Zuneigung
Mord in der Bardsley Gardens Mews
Kapitel 1
I
Haben Sie mal ’n Penny für Guy, Sir?«
Ein kleiner Junge mit rußigem Gesicht lächelte zuckersüß.
»Garantiert nicht!«, sagte Chief Inspector Japp. »Und jetzt hör mir mal zu, Bürschchen …«
Es folgte eine kurze Gardinenpredigt. Der verblüffte Gassenjunge machte sich fluchtartig aus dem Staub und rief seinen Freunden kurz und knapp zu:
»Mensch, der feine Pinkel ist ’n Bulle!«
Die Bande nahm die Beine in die Hand und sang dabei das Guy-Fawkes-Lied:
Vergesst niemals, niemals die Tat
vom fünften Novembertag –
Pulver, Verschwörung und Verrat.
Es wäre vermessen,
die Pulververschwörung
jemals zu vergessen.
Der Begleiter des Chief Inspector, ein kleiner älterer Herr mit einem eiförmigen Kopf und einem großen, militärisch anmutenden Schnurrbart, lächelte in sich hinein.
»Très bien, Japp«, bemerkte er. »Sie halten eine vortreffliche Predigt! Ich gratuliere.«
»Nichts weiter als eine faule Ausrede fürs Betteln, dieser Guy-Fawkes-Tag!«, erwiderte Japp.
»Ein interessantes Überbleibsel«, sagte Hercule Poirot sinnierend. »Das Feuerwerk schießt – krach, peng – in die Luft, obwohl der Mann, dessen man gedenkt, und seine Tat längst vergessen sind.«
Der Mann von Scotland Yard pflichtete ihm bei.
»Glaube nicht, dass viele dieser Lümmel überhaupt wissen, wer dieser Guy Fawkes eigentlich war.«
»Und schon bald kommt es zu einer allgemeinen Desorientierung. Wird das feu d’artifice am 5. November in den Himmel geschossen, um ihn zu ehren oder um ihn zu verwünschen? Ein englisches Parlament in die Luft zu jagen, wäre das eine Schandtat oder eine Heldentat gewesen?«
Japp kicherte.
»Manch einer würde zweifellos Letzteres behaupten.«
Die beiden Männer bogen von der Hauptstraße in die Bardsley Gardens Mews ein, eine vergleichsweise ruhige Wohngegend mit umgebauten alten Remisen. Sie hatten zusammen zu Abend gegessen und nahmen jetzt eine Abkürzung zu Hercule Poirots Wohnung.
Noch immer konnte man vereinzelte Knallfrösche hören. Gelegentlich erleuchtete ein goldener Funkenregen den Himmel.
»Guter Abend für einen Mord«, bemerkte Japp mit kriminalistischem Interesse. »Einen Schuss zum Beispiel würde in so einer Nacht kein Mensch hören.«
»Ich fand es schon immer komisch, dass das nicht öfter von Verbrechern ausgenutzt wird«, stimmte ihm Hercule Poirot zu.
»Wissen Sie, Poirot, manchmal wünsche ich mir fast, Sie würden einen Mord begehen.«
»Mon cher!«
»Doch, ich würde wirklich gerne sehen, wie Sie es anstellen würden.«
»Mein lieber Japp, wenn ich tatsächlich einen Mord begehen würde, hätten Sie nicht die geringste Chance, zu sehen, wie ich es anstelle! Sie würden wahrscheinlich nicht einmal merken, dass überhaupt ein Mord begangen wurde.«
Japp lachte herzlich und gutmütig auf.
»Sie blasierter kleiner Satansbraten, Sie«, sagte er nachsichtig.
II
Am nächsten Vormittag um halb zwölf klingelte Hercule Poirots Telefon.
»Allô? Allô?«
»Hallo, sind Sie’s, Poirot?«
»Oui, c’est moi.«
»Japp am Apparat. Wissen Sie noch, wie wir gestern Abend auf dem Nachhauseweg durch die Bardsley Gardens Mews gegangen sind?«
»Ja?«
»Und wie wir darüber sprachen, wie leicht es wäre, bei dem ganzen Geknalle und Geböller jemanden zu erschießen?«
»Sicher.«
»Nun, genau dort gab es einen Selbstmord. In der Nr. 14. Eine junge Witwe, Mrs Allen. Ich fahre jetzt dorthin. Hätten Sie Lust, mich zu begleiten?«
»Entschuldigung, aber wird normalerweise jemand von Ihrem Kaliber, mon ami, zu einem Selbstmord gerufen?«
»Schlaues Bürschchen. Nein, das wird er nicht. Aber unser Arzt scheint der Meinung zu sein, dass an der Sache etwas faul ist. Kommen Sie? Irgendwie habe ich das Gefühl, Sie sollten mit dabei sein.«
»Sicher komme ich. Nr. 14, sagten Sie?«
»Genau.«
III
Poirot traf fast genau im gleichen Augenblick an der Bardsley Gardens Mews Nr. 14 ein, als dort ein Wagen mit Japp und drei weiteren Männern vorfuhr.
Das Haus Nr. 14 stand ganz eindeutig im Blickpunkt des allgemeinen Interesses. Eine Menschenmenge – die Chauffeure aus der Nachbarschaft mit ihren Frauen, Laufburschen, Tagediebe, elegant gekleidete Passanten und unzählige Kinder – hatte einen Halbkreis gebildet, und alle starrten das Gebäude mit offenem Mund wie gebannt an.
Ein uniformierter Constable war auf der Treppe postiert und hielt die Neugierigen, so gut es ging, fern. Junge Männer mit Fotoapparaten rannten geschäftig umher und stürzten sofort herbei, als Japp aus dem Wagen stieg.
»Gibt noch nichts«, sagte Japp und wimmelte sie ab. Er nickte Poirot zu. »Da sind Sie ja. Gehen wir rein.«
Schnell traten sie ins Haus. Als die Tür hinter ihnen ins Schloss fiel, standen sie, auf engstem Raum zusammengedrängt, am Fuß einer leiterähnlich steil ansteigenden Treppe.
Ein Mann erschien auf dem oberen Treppenabsatz, erkannte Japp und meinte: »Hier oben, Sir.«
Japp und Poirot stiegen hinauf.
Der Mann am Kopf der Treppe öffnete eine Tür zu ihrer Linken, und sie traten in ein kleines Zimmer.
»Dachte, ich sollte Ihnen kurz die wichtigsten Eckpunkte darlegen, Sir.«
»Ganz recht, Jameson«, sagte Japp. »Also?«
»Die Tote ist eine gewisse Mrs Allen, Sir«, begann Divisional Inspector Jameson mit seinem Bericht. »Lebte hier zusammen mit einer Freundin, einer Miss Plenderleith. Miss Plenderleith war aufs Land gefahren und kehrte heute Vormittag zurück. Sie schloss die Tür auf, doch zu ihrer Überraschung war niemand zu Hause. Normalerweise kommt jeden Morgen um neun Uhr die Putzfrau vorbei. Zuerst ging sie hinauf in ihr Zimmer – das wäre dieses hier – und dann zu dem ihrer Freundin auf der anderen Seite der Treppe. Die Tür war von innen abgeschlossen. Sie rüttelte am Knauf, klopfte und rief, bekam jedoch keine Antwort. Schließlich kriegte sie es mit der Angst zu tun und rief die Polizei. Das war um Viertel vor elf. Wir kamen sofort und brachen die Tür auf. Mrs Allen lag, mit einer Schusswunde im Kopf, zusammengesunken am Boden. In ihrer Hand befand sich ein Revolver, ein .25er Webley – sah nach einem klaren Fall von Selbstmord aus.«
»Wo ist Miss Plenderleith jetzt?«
»Unten im Wohnzimmer, Sir. Eine sehr besonnene, tüchtige junge Dame, würde ich sagen. Ein helles Köpfchen.«
»Ich gehe gleich runter. Aber erst mal sollte ich mit Brett reden.«
Von Poirot begleitet, ging er ins gegenüberliegende Zimmer. Ein großer älterer Herr blickte auf und nickte.
»Tag, Japp, gut, dass Sie da sind. Komische Sache, das Ganze.«
Japp trat zu ihm. Hercule Poirot ließ seinen Blick prüfend durch das Zimmer wandern.
Es war entschieden größer als das, aus dem sie gerade gekommen waren. Es gab ein Erkerfenster, und während der andere Raum ein reines Schlafzimmer war, handelte es sich hier ganz eindeutig um ein Schlafzimmer, das gleichzeitig als Wohnzimmer fungierte.
Die Wände waren silberfarben, die Decke smaragdgrün. Die Vorhänge hatten ein modernes silbergrünes Muster. Auf einem Diwan lagen ein gesteppter, smaragdgrün schimmernder Seidenüberwurf sowie eine Reihe von golden und silbern gemusterten Kissen. Es gab einen hohen antiken Nussbaumsekretär, eine Nussbaumkommode und mehrere moderne chromblitzende Sessel. Auf einem niedrigen Glastisch stand ein großer Aschenbecher voller Zigarettenkippen.
Diskret schnupperte Hercule Poirot. Dann trat er zu Japp, der den Blick nach unten gerichtet hatte.
Vor ihnen lag der zusammengesackte Leichnam einer jungen, vielleicht siebenundzwanzigjährigen Frau, und zwar exakt so, wie sie aus einem der Chromsessel auf den Boden gesunken war. Sie hatte blonde Haare und feine Züge, trug kaum Make-up. Ihr Gesicht war hübsch, melancholisch und vielleicht ein klein wenig dümmlich. Die linke Schläfe war voller geronnenem Blut. Die Finger der rechten Hand hielten einen kleinen Revolver umklammert. Die Frau trug ein einfaches, hochgeschlossenes dunkelgrünes Kleid.
»Also, Brett, wo liegt das Problem?«
Japp blickte noch immer auf die zusammengesunkene Gestalt.
»Die Position stimmt«, erwiderte der Arzt. »Wenn sie sich selbst erschossen hätte, wäre sie wahrscheinlich aus dem Sessel genau in diese Position gerutscht. Die Tür war abgeschlossen und das Fenster von innen verriegelt.«
»Das stimmt also alles, sagen Sie. Was ist dann faul?«
»Sehen Sie sich mal den Revolver an. Ich habe ihn nicht angerührt – warte noch auf die Spurensicherung, wegen der Fingerabdrücke. Aber es ist ziemlich leicht zu erkennen, was ich meine.«
Poirot und Japp knieten sich hin und betrachteten den Revolver eingehend.
»Ich weiß, was Sie meinen«, sagte Japp und erhob sich wieder. »Die Wölbung ihrer Hand. Es sieht aus, als würde sie ihn halten, aber in Wirklichkeit hält sie ihn gar nicht. Noch etwas?«
»Eine Menge. Sie hat den Revolver in der rechten Hand. Jetzt sehen Sie sich einmal die Wunde an. Der Revolver wurde dicht an die Schläfe gehalten, direkt über dem linken Ohr – dem linken Ohr, wohlgemerkt!«
»Hm«, sagte Japp. »Damit wäre der Fall wohl klar. Mit der rechten Hand kann sie den Revolver niemals so gehalten und abgedrückt haben, richtig?«
»Schlicht unmöglich, würde ich sagen. Vielleicht bekommt man den Arm so weit herum, aber ich bezweifle, dass man dann noch abdrücken kann.«
»Die Sache scheint also ziemlich eindeutig. Sie wurde von jemandem erschossen, der dann einen Selbstmord vortäuschen wollte. Aber was ist mit der abgeschlossenen Tür und dem Fenster?«
Diesmal antwortete Inspector Jameson: »Das Fenster war verriegelt, Sir, und die Tür war abgeschlossen, aber den Schlüssel konnten wir nirgends finden.«
Japp nickte.
»Ja, das ist natürlich Pech. Als der Täter ging, hat er die Tür abgeschlossen und gehofft, das Fehlen des Schlüssels würde unbemerkt bleiben.«
»C’est bête, ça!«, murmelte Poirot.
»Ach, kommen Sie, Poirot, Sie können doch nicht alle Menschen im Lichte Ihres strahlenden Intellekts betrachten! In Wirklichkeit ist das doch genau eins von diesen kleinen Details, die ziemlich leicht übersehen werden. Die Tür ist abgeschlossen. Sie wird aufgebrochen. Eine Tote auf dem Boden, in der Hand einen Revolver – ein klarer Fall von Selbstmord, nachdem sie sich selbst eingeschlossen hat. Da sucht man nicht lange nach irgendwelchen Schlüsseln. Im Prinzip war es sogar ein glücklicher Zufall, dass Miss Plenderleith die Polizei gerufen hat. Wenn sie ein oder zwei von den Chauffeuren aus der Nachbarschaft geholt hätte, damit sie die Tür aufbrechen, wäre die Sache mit dem Schlüssel vollkommen übersehen worden.«
»Das ist allerdings durchaus möglich«, sagte Hercule Poirot. »Viele Leute hätten erst einmal so reagiert. Die Polizei ist wirklich immer der letzte Strohhalm, nicht?«
Er starrte immer noch auf den Leichnam hinab.
»Fällt Ihnen irgendetwas auf?«, fragte Japp.
Die Frage klang beiläufig, doch seine wachsamen Augen waren gespannt auf Poirot gerichtet.
Hercule Poirot schüttelte langsam den Kopf.
»Ich habe nur auf ihre Armbanduhr geguckt.«
Er beugte sich hinab und berührte sie mit der Fingerspitze. Es war eine elegante, brillantenbesetzte Uhr mit einem schwarzen Moiréband am Gelenk der Hand, die den Revolver hielt.
»Spitzenqualität«, bemerkte Japp. »Muss teuer gewesen sein!« Er neigte den Kopf zur Seite und sah Poirot fragend an. »Kann uns die irgendwie weiterhelfen?«
»Möglicherweise schon.«
Poirot wanderte zum Sekretär hinüber. Er hatte einen wunderschön gearbeiteten ausklappbaren Pultdeckel mit einer auf das allgemeine Farbschema des Zimmers abgestimmten Schreibtischgarnitur.
In der Mitte der Schreibplatte stand ein recht massives silbernes Tintenfass, davor lag eine Löschpapiermappe mit einem hübschen grünen Lackdeckel. Links daneben eine Stiftschale aus smaragdgrünem Glas mit einem silbernen Federhalter, einer Stange grünem Siegellack, einem Bleistift und zwei Briefmarken. Rechts daneben ein Kalender, der den Wochentag, das Datum und den Monat anzeigte, sowie ein kleines, zur Hälfte mit Bleikugeln gefülltes Glasgefäß, in dem ein prachtvoller grüner Federkiel stand. Dieser Federkiel schien Poirots Interesse zu wecken. Er nahm ihn heraus und besah ihn sich genau, konnte jedoch keine Tintenspuren entdecken. Der Federkiel war ganz eindeutig nur ein Dekorationsstück, mehr nicht. Benutzt wurde allein der silberne Federhalter mit der tintenbefleckten Schreibfeder. Sein Blick wanderte zum Kalender.
»Dienstag, der 5. November«, sagte Japp. »Gestern. Das stimmt so weit.«
Er wandte sich an Brett.
»Wie lange ist sie schon tot?«
»Sie wurde gestern Abend um 23.33 Uhr umgebracht«, kam Bretts prompte Antwort.
Als er Japps überraschtes Gesicht sah, grinste er.
»Tut mir leid, altes Haus«, sagte er. »Musste einfach mal den Superarzt geben, wie man ihn aus Detektivgeschichten kennt! Tatsächlich schätze ich den Todeszeitpunkt auf 23 Uhr – mit einem Spielraum von plus/minus einer Stunde.«
»Ach so, ich dachte, die Armbanduhr sei stehen geblieben oder so etwas.«
»Die ist auch stehen geblieben, allerdings um 16.15 Uhr.«
»Und 16.15 Uhr kommt, nehme ich mal an, als Todeszeitpunkt nicht infrage.«
»Das können Sie völlig vergessen.«
Poirot hatte den Deckel der Löschpapiermappe aufgeschlagen.
»Gute Idee«, meinte Japp. »Aber leider Pech gehabt.«
Das oberste Blatt war vollkommen unbenutzt. Poirot sah sich die Blätter darunter an, aber auch sie wiesen keinerlei Spuren auf.
Er richtete sein Augenmerk auf den Papierkorb.
Dieser enthielt zwei oder drei zerrissene Briefe sowie Reklame. Alles war nur einmal durchgerissen und ließ sich leicht wieder zusammensetzen: ein Spendenaufruf von einer Gesellschaft zur Unterstützung von Kriegsveteranen, eine Einladung zu einer Cocktailparty am 3. November, ein Termin bei einer Schneiderei. Dazu die Ankündigung eines Pelzausverkaufs und ein Kaufhauskatalog.
»Nichts«, sagte Japp.
»Nein, komisch …«, erwiderte Poirot.
»Sie meinen, normalerweise hinterlassen Selbstmörder einen Abschiedsbrief?«
»Genau.«
»Also noch ein Beweis dafür, dass es kein Selbstmord war.«
Japp ging in Richtung Tür.
»Ich sage meinen Männern jetzt, dass sie anfangen können. Wir sollten inzwischen nach unten gehen und diese Miss Plenderleith befragen. Kommen Sie, Poirot?«
Poirot schien noch immer fasziniert vom Sekretär und seinen Accessoires.
Er verließ das Zimmer, doch als er in der Tür stand, wanderte sein Blick abermals zurück zu dem prächtigen smaragdgrünen Federkiel.
Kapitel 2
Am Fuß der schmalen Treppe führte eine Tür in ein großes Wohnzimmer – in Wirklichkeit der ehemalige Pferdestall. In diesem Raum, an dessen grob verputzten Wänden Radierungen und Holzschnitte hingen, saßen zwei Frauen.
Die eine, eine dunkelhaarige, tüchtig wirkende Sieben- oder Achtundzwanzigjährige, saß in einem Sessel in der Nähe des Kamins und hatte die Hände zum Feuer ausgestreckt. Die andere, eine ältere, vollschlanke Frau, hielt ein Einkaufsnetz in der Hand und schwadronierte atemlos vor sich hin, als die beiden Männer den Raum betraten.
»… wie gesagt, Miss, ich bekam so einen Schreck, dass ich fast auf der Stelle umgekippt wäre. Und wenn man sich vorstellt, dass ausgerechnet heute Morgen …«
Die andere schnitt ihr das Wort ab.
»Das genügt, Mrs Pierce. Diese Herren sind von der Polizei, glaube ich.«
»Miss Plenderleith?«, fragte Japp und trat vor.
Die junge Frau nickte.
»Ja, das bin ich. Und das hier ist Mrs Pierce, die jeden Tag bei uns sauber macht.«
Mrs Pierce ließ sich nicht unterkriegen und legte sofort wieder los.
»Wie ich gerade zu Miss Plenderleith sagte, wenn man sich vorstellt, dass ausgerechnet heute Morgen die kleine Louisa Maud, die Tochter von meiner Schwester, einen Anfall bekommen musste und außer mir keiner da war und, wie ich immer sage, das eigene Fleisch und Blut eben doch das eigene Fleisch und Blut ist, und ich dachte, dass Mrs Allen sicher nichts dagegen hätte, obwohl ich die gnädigen Frauen um keinen Preis hängen lassen möchte …«
Japp unterbrach sie geschickt.
»Ganz recht, Mrs Pierce. Wenn Sie jetzt mit Inspector Jameson in die Küche gehen würden, damit er Ihre Aussage aufnehmen kann.«
Als er die redselige Mrs Pierce, die jetzt Jameson die Ohren vollposaunte, losgeworden war, wandte Japp seine Aufmerksamkeit erneut der jungen Frau zu.
»Ich bin Chief Inspector Japp. Also, Miss Plenderleith, ich würde gern alles wissen, was Sie mir über diese Angelegenheit erzählen können.«
»Sicher. Wo soll ich anfangen?«
Ihre Selbstbeherrschung war bewundernswert. Bis auf ihre fast schon unnatürlich steifen Umgangsformen zeigte sie keinerlei Anzeichen von Trauer oder Schock.
»Um wie viel Uhr trafen Sie heute Morgen hier ein?«
»Ich glaube, kurz vor halb elf. Mrs Pierce, diese Heuchlerin, war, wie ich feststellen musste, nicht hier …«
»Kommt das oft vor?«
Jane Plenderleith zuckte mit den Schultern.
»Etwa zweimal die Woche erscheint sie um zwölf – oder gar nicht. Eigentlich sollte sie jeden Morgen um neun hier sein. In Wirklichkeit fühlt sie sich, wie gesagt, zweimal die Woche ›komisch‹, oder jemand in ihrer Familie ist plötzlich krank. Aber so sind sie, die Putzfrauen – ab und zu lassen sie einen eben im Stich. Vergleichsweise ist sie gar nicht übel.«
»Sie arbeitet schon lange hier?«
»Gut einen Monat. Die Letzte hat lange Finger gemacht.«
»Bitte fahren Sie fort, Miss Plenderleith.«
»Ich habe das Taxi bezahlt, meinen Koffer ins Haus getragen, Mrs P. gesucht, konnte sie aber nirgends finden und bin hoch in mein Zimmer. Ich habe ein bisschen aufgeräumt, und dann bin ich zu Barbara – Mrs Allen – hinübergegangen und habe bemerkt, dass die Tür abgeschlossen war. Ich habe am Türknauf gerüttelt und geklopft, aber keine Antwort bekommen. Also bin ich wieder nach unten und habe die Polizei gerufen.«
»Pardon!« Beherzt warf Poirot eine Frage dazwischen: »Sie kamen nicht auf den Gedanken, zu versuchen, die Tür aufzubrechen – zum Beispiel mit Hilfe eines der Chauffeure, die hier in der Nachbarschaft wohnen?«
Ihre Augen – kühle, graugrüne Augen – richteten sich auf Poirot. Abschätzend ließ sie ihren Blick über ihn gleiten.
»Nein, ich glaube, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Wenn da irgendetwas nicht stimmte, dann, so schien es mir, wäre die Polizei der richtige Ansprechpartner.«
»Dann haben Sie also – Pardon, Mademoiselle – vermutet, dass tatsächlich irgendetwas nicht stimmte?«
»Natürlich.«
»Weil Sie auf Ihr Klopfen keine Antwort bekamen? Aber hätte es nicht sein können, dass Ihre Freundin ein Schlafmittel oder so etwas eingenommen hatte …«
»Sie nahm keine Schlafmittel«, kam die scharfe Antwort.
»Oder dass sie irgendwo hingegangen war und die Tür abgeschlossen hatte?«
»Warum hätte sie sie abschließen sollen? Auf jeden Fall hätte sie mir dann eine Nachricht hinterlassen.«
»Und sie hat Ihnen keine Nachricht hinterlassen? Da sind Sie sich völlig sicher?«
»Natürlich bin ich mir da sicher. Ich hätte sie doch sofort gesehen.«
Ihr Ton wurde schärfer.
»Sie haben nicht versucht, durchs Schlüsselloch zu gucken, Miss Plenderleith?«, fragte Japp.
»Nein«, erwiderte Jane Plenderleith nachdenklich. »Daran habe ich gar nicht gedacht. Aber ich hätte doch sowieso nichts sehen können, oder? Der Schlüssel hat doch wohl im Schloss gesteckt?«
Ihr fragender Blick, ihre unschuldigen großen Augen richteten sich auf Japp. Poirot lächelte in sich hinein.
»Sie haben natürlich genau richtig gehandelt, Miss Plenderleith«, sagte Japp. »Ich nehme an, Sie hatten keinen Grund zu der Vermutung, dass Ihre Freundin Selbstmord begehen würde?«
»Woher denn!«
»Sie wirkte nicht besorgt – oder irgendwie beunruhigt?«
Es entstand eine Pause, eine deutliche Pause, ehe die junge Frau antwortete.
»Nein.«
»Wussten Sie, dass sie einen Revolver besaß?«
Jane Plenderleith nickte.
»Ja, er war noch aus Indien. Sie bewahrte ihn in einem Schubfach in ihrem Zimmer auf.«
»Hm. Hatte sie einen Waffenschein?«
»Ich denke schon. Das weiß ich aber nicht genau.«
»Gut, Miss Plenderleith, würden Sie mir jetzt bitte alles erzählen, was Sie über Mrs Allen wissen, wie lange Sie sie schon kennen, wo ihre Verwandten leben – alles eben.«
»Ich kenne Barbara seit circa fünf Jahren«, begann sie. »Ich lernte sie auf einer Reise kennen – genauer gesagt, in Ägypten. Sie befand sich auf der Heimreise von Indien. Ich war ein Weilchen an der British School in Athen gewesen und verbrachte vor meiner Rückkehr nach England noch ein paar Wochen in Ägypten. Wir nahmen beide an einer Nilkreuzfahrt teil. Wir fanden einander sympathisch und freundeten uns an. Ich suchte damals jemanden, mit dem ich eine Wohnung oder ein kleines Haus teilen könnte. Barbara war ganz allein auf der Welt. Wir dachten, wir würden gut miteinander auskommen.«
»Und Sie kamen dann auch gut miteinander aus?«, fragte Poirot.
»Sehr gut sogar. Wir hatten beide unseren eigenen Freundeskreis: Barbaras Freunde stammten eher aus der High Society, meine aus dem Künstlermilieu. Das war wahrscheinlich gut so.«
Poirot nickte.
»Was wissen Sie über Mrs Allens Familie und ihr Leben, ehe Sie beide sich kennenlernten?«, fuhr Japp fort.
Jane Plenderleith zuckte mit den Achseln.
»Eigentlich nicht sehr viel. Ihr Mädchenname war Armitage, glaube ich.«
»Und ihr Mann?«
»Mit dem war wohl nicht viel Staat zu machen. Soweit ich weiß, trank er. Ich glaube, er starb ein oder zwei Jahre nach ihrer Hochzeit. Es gab ein Kind, ein kleines Mädchen, das mit drei Jahren starb. Barbara hat nicht viel über ihren Mann gesprochen. Ich glaube, sie hat ihn in Indien geheiratet, als sie ungefähr siebzehn war. Dann ging es nach Borneo oder in irgendeine andere gottverlassene Gegend, wo man Nichtsnutze halt hinschickt, aber da das offensichtlich ein schmerzhaftes Thema für sie war, habe ich es nie angesprochen.«
»Wissen Sie, ob Mrs Allen in finanziellen Schwierigkeiten steckte?«
»Nein, ganz bestimmt nicht.«
»Keine Schulden, nichts dergleichen?«
»O nein! In solch einer Bredouille saß sie sicher nicht.«
»Ich muss Ihnen jetzt noch eine weitere Frage stellen, von der ich hoffe, dass Sie sie mir nicht übelnehmen, Miss Plenderleith. Hat Mrs Allen eine Männerbekanntschaft oder auch mehrere gehabt?«
»Nun«, erwiderte Jane Plenderleith kühl, »sie war verlobt und wollte heiraten, falls das Ihre Frage beantwortet.«
»Wie heißt ihr Verlobter?«
»Charles Laverton-West. Er ist Parlamentsabgeordneter für irgendeinen Wahlkreis in Hampshire.«
»Kannte sie ihn schon lange?«
»Ein gutes Jahr.«
»Und seit wann war sie mit ihm verlobt?«
»Seit zwei, nein, eher seit drei Monaten.«
»Und soweit Sie wissen, gab es keinen Streit?«
Miss Plenderleith schüttelte den Kopf.
»Nein. Das hätte mich auch wirklich gewundert. Barbara war nicht der streitsüchtige Typ.«
»Wann haben Sie Mrs Allen das letzte Mal gesehen?«
»Letzten Freitag, bevor ich fürs Wochenende wegfuhr.«
»Mrs Allen blieb in der Stadt?«
»Ja. Ich glaube, sie wollte am Sonntag mit ihrem Verlobten ausgehen.«
»Und Sie, wo verbrachten Sie das Wochenende?«
»Auf Laidells Hall in Laidells, Essex.«
»Der Name Ihrer Gastgeber?«
»Mr und Mrs Bentinck.«
»Und Sie fuhren dort erst heute Morgen wieder ab?«
»Ja.«
»Dann müssen Sie ja äußerst früh abgereist sein?«
»Mr Bentinck nahm mich mit dem Wagen mit. Er bricht immer sehr zeitig auf, weil er um zehn in der Stadt sein muss.«
»Verstehe.«
Japp nickte wohlwollend. Miss Plenderleiths Antworten waren allesamt knapp und überzeugend gewesen.
Poirot hatte noch eine Frage für sie: »Was halten Sie von Mr Laverton-West?«
Die junge Frau zuckte mit den Schultern.
»Spielt das eine Rolle?«
»Nein, es spielt vielleicht keine Rolle, aber ich würde es trotzdem gern wissen.«
»Ich glaube, ich habe mir gar nicht groß Gedanken über ihn gemacht. Er ist jung – höchstens ein- oder zweiunddreißig –, ehrgeizig, ein guter Redner, will es im Leben zu etwas bringen.«
»Das wäre die Habenseite – und die Sollseite?«
»Nun«, Miss Plenderleith überlegte einen Augenblick. »Meiner Meinung nach ist er nichts Besonderes – seine Vorstellungen sind nicht unbedingt originell, und er ist etwas aufgeblasen.«
»Das sind aber keine besonders gravierenden Charakterfehler, Mademoiselle«, sagte Poirot lächelnd.
»Finden Sie nicht?«
Ihre Stimme klang ironisch.
»Für Sie vielleicht schon.«
Er beobachtete sie, sah ihre etwas befremdete Miene und nutzte die Gelegenheit.
»Aber für Mrs Allen – nein, sie hat sie sicher gar nicht bemerkt.«
»Da haben Sie vollkommen recht. Barbara fand ihn phantastisch – sah ihn so, wie er sich selbst gern sah.«
»Sie hatten Ihre Freundin gern?«, fragte Poirot sanft.
Er sah, wie sich ihre Hand auf dem Knie verkrampfte, wie sich ihre Kinnpartie verspannte, und dennoch antwortete sie in einem nüchternen, emotionslosen Tonfall.
»Da haben Sie völlig recht. Ich hatte sie gern.«
»Nur eins noch, Miss Plenderleith«, sagte Japp. »Sie beide hatten nicht zufällig Streit? Es gab keine Unstimmigkeiten zwischen Ihnen?«
»Absolut nicht.«
»Auch nicht wegen dieser Verlobung?«
»Nicht die Spur. Ich habe mich gefreut, dass sie so glücklich war.«
Nach einem kurzen Schweigen fragte Japp: »Hatte Mrs Allen Ihres Wissens irgendwelche Feinde?«
Jetzt entstand eine deutliche Pause, ehe Jane Plenderleith antwortete. Als sie sprach, hatte sich ihr Tonfall ein wenig verändert.
»Mir ist nicht ganz klar, was Sie unter ›Feinde‹ verstehen.«
»Zum Beispiel all jene, die von ihrem Tod profitieren würden.«
»Nicht doch, das wäre geradezu lächerlich. Sie hatte ohnehin nur sehr geringe Einkünfte.«
»Und wer erbt dieses Geld?«
»Wissen Sie, das weiß ich gar nicht genau.« Jetzt klang Miss Plenderleiths Stimme erstaunt. »Es würde mich nicht wundern, wenn ich die Erbin wäre. Falls sie überhaupt ein Testament aufgesetzt hat.«
»Und auch in anderer Hinsicht hatte sie keine Feinde?«, wechselte Japp schnell zu einem anderen Aspekt über. »Irgendwelche Leute, die einen Groll gegen sie hegten?«
»Ich glaube nicht, dass irgendjemand einen Groll gegen sie hegte. Sie war ein sehr sanfter Mensch, der immer allen alles recht machen wollte. Sie hatte ein wirklich nettes, zuvorkommendes Wesen.«
Zum ersten Mal zitterte ihre harte, nüchterne Stimme ein wenig. Poirot nickte freundlich.
»Dann läuft es also auf Folgendes hinaus«, sagte Japp. »Mrs Allen war in letzter Zeit guter Dinge, sie steckte in keinen finanziellen Schwierigkeiten, sie wollte heiraten und war glücklich verlobt. Es gab überhaupt keinen Grund, weshalb sie hätte Selbstmord verüben sollen. Stimmt das so weit?«
Nach einem kurzen Schweigen antwortete die junge Frau mit Ja.
Japp erhob sich.
»Entschuldigen Sie mich, aber ich muss kurz mit Inspector Jameson sprechen.«
Er verließ das Zimmer.
Hercule Poirot blieb zu einem Gespräch unter vier Augen allein mit Jane Plenderleith zurück.
Kapitel 3
Ein paar Minuten herrschte Stille.
Jane Plenderleith warf abermals einen schnellen, abschätzenden Blick auf den kleinen Mann, dann starrte sie vor sich hin und schwieg. Eine gewisse Nervosität verriet jedoch, dass sie sich seiner Anwesenheit sehr wohl bewusst war. Ihre Körperhaltung war ruhig, aber nicht entspannt.
Als Poirot das Schweigen endlich brach, schien ihr schon allein der Klang seiner Stimme eine gewisse Erleichterung zu verschaffen. In einem freundlichen, beiläufigen Ton stellte er ihr eine Frage: »Wann haben Sie das Feuer angezündet, Mademoiselle?«
»Das Feuer?«, fragte sie geistesabwesend zurück. »Oh, gleich heute Morgen, als ich zurückkam.«
»Ehe Sie nach oben gegangen sind oder danach?«
»Davor.«
»Verstehe. Ja, natürlich … Und es war schon alles vorbereitet, oder mussten Sie das noch tun?«
»Es war bereits vorbereitet, ich musste nur noch ein Streichholz daranhalten.«
Es lag ein Hauch von Ungeduld in ihrer Stimme. Sie hatte ihn ganz eindeutig im Verdacht, lediglich Smalltalk zu betreiben. Vielleicht war es das ja auch. Auf jeden Fall fuhr er im selben ruhigen Plauderton fort: »Aber Ihre Freundin – in ihrem Zimmer sah ich nur eine Gasheizung?«
»Das hier ist unser einziger Kamin«, antwortete Jane Plenderleith rein mechanisch, »die anderen Räume haben Gasheizung.«
»Und Sie kochen auch mit Gas?«
»Ich glaube, das tut heutzutage jeder.«
»Stimmt. Es erspart einem eine Menge Arbeit.«
Das kleine Gespräch kam zum Erliegen. Jane Plenderleith klopfte mit dem Fuß auf den Boden. Dann sagte sie abrupt: »Dieser Mann, dieser Chief Inspector Japp, gilt der eigentlich als clever?«
»Er ist sehr tüchtig. Ja, er hat einen guten Ruf. Er ist fleißig und gründlich, und es entgeht ihm nur sehr wenig.«
»Ich möchte wissen …«, murmelte die junge Frau.
Poirot beobachtete sie. Im Schein des Feuers schimmerten seine Augen sehr grün.
»Der Tod Ihrer Freundin war ein großer Schock für Sie, ja?«, fragte er leise.
»Schrecklich.«
Plötzlich klang sie sehr offenherzig.
»Sie haben nicht damit gerechnet, nein?«
»Natürlich nicht.«
»Sodass es Ihnen zuerst vielleicht so vorkam, als wäre es unmöglich – als könnte es einfach nicht wahr sein?«
Das diskrete Mitgefühl in seiner Stimme schien Miss Plenderleiths Abwehrhaltung zu durchbrechen. Ihre Antwort war energisch, natürlich, alles andere als steif: »Genauso ist es. Und selbst wenn Barbara sich umgebracht hat, ist es für mich unbegreiflich, dass sie es auf diese Weise getan hat.«
»Aber sie besaß doch einen Revolver?«
Jane Plenderleith machte eine ungeduldige Handbewegung.
»Ja, aber dieser Revolver war ein – ach, ein Relikt aus alten Zeiten. Sie war früher oft in abgelegenen Gegenden unterwegs. Sie hat ihn einfach behalten, aus reiner Gewohnheit – nicht aus irgendeinem besonderen Grund. Da bin ich mir ganz sicher.«
»Aha! Und warum sind Sie sich da sicher?«
»Ach, wegen verschiedener Dinge, die sie gesagt hat.«
»Wie zum Beispiel?«
Seine Stimme war sanft und freundlich, lockte sie behutsam aus der Reserve.
»Nun, zum Beispiel haben wir einmal über Selbstmord gesprochen, und sie meinte, die bei weitem einfachste Methode wäre es, den Gashahn aufzudrehen, alle Ritzen zuzustopfen und ins Bett zu gehen. Ich hielt das für ein Ding der Unmöglichkeit – einfach dazuliegen und auf das Ende zu warten. Ich sagte, dann würde ich mich lieber erschießen. Aber sie meinte, nein, sich zu erschießen, das würde sie nie fertigbringen. Sie hätte viel zu viel Angst, dass der Schuss nicht losgehen würde, und außerdem würde sie den Knall unerträglich finden.«
»Verstehe«, sagte Poirot. »Sie haben recht, es ist wirklich seltsam … Denn, wie Sie vorhin sagten, ihr Zimmer hat ja Gasheizung.«
Jane Plenderleith sah ihn etwas verdattert an.
»Ja, das stimmt … Ich verstehe nicht – nein, ich verstehe wirklich nicht, warum sie dann nicht diesen Weg gewählt hat.«
Poirot schüttelte den Kopf.
»Ja, es mutet seltsam an, irgendwie unlogisch.«
»Die ganze Sache scheint unlogisch. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass sie sich umgebracht hat. Aber es muss wohl Selbstmord gewesen sein, oder?«
»Nun ja, es gibt auch noch eine andere Möglichkeit.«
»Wie meinen Sie das?«
Poirot sah ihr direkt in die Augen.
»Es könnte auch – Mord gewesen sein.«
»Nein.« Jane Plenderleith fuhr zurück. »O nein! Was für eine entsetzliche Vorstellung.«
»Ja, es hört sich vielleicht entsetzlich an, aber halten Sie es für völlig abwegig?«
»Aber die Tür war doch von innen abgeschlossen. Und das Fenster war auch verriegelt.«
»Ja, die Tür war abgeschlossen. Aber es ist unklar, ob von innen oder von außen. Der Schlüssel ist nämlich verschwunden.«
»Aber wenn er verschwunden ist …« Sie überlegte einen Augenblick. »Dann muss die Tür von außen zugeschlossen worden sein. Sonst wäre er doch irgendwo im Zimmer.«
»Ja, das ist er vielleicht auch. Vergessen Sie nicht, das Zimmer wurde noch nicht gründlich durchsucht. Oder er wurde aus dem Fenster geworfen, und jemand hat ihn gefunden und mitgenommen.«
»Mord!«, sagte Jane Plenderleith. Noch während sie diese Möglichkeit erwog, ließ sich an ihrem finsteren, klugen Gesicht ablesen, dass sie die Fährte bereits aufgenommen hatte. »Ich glaube, Sie haben recht.«
»Aber wenn es Mord war, muss es ein Motiv gegeben haben. Wüssten Sie ein Motiv, Mademoiselle?«
Langsam schüttelte sie den Kopf. Doch Poirot hatte erneut den Eindruck, dass die junge Frau irgendetwas verschwieg. Die Tür ging auf, und Japp trat ein.
Poirot erhob sich.
»Ich habe Miss Plenderleith gerade zu verstehen gegeben«, sagte er, »dass der Tod ihrer Freundin kein Selbstmord war.«
Japp wirkte für einen Moment verstimmt. Er warf Poirot einen vorwurfsvollen Blick zu.
»Es ist noch zu früh für ein endgültiges Urteil. Verstehen Sie, wir müssen immer sämtliche Möglichkeiten in Betracht ziehen. Mehr ist dazu im Moment nicht zu sagen.«
»Ich verstehe«, antwortete Jane Plenderleith ruhig.
Japp trat auf sie zu.
»Sagen Sie, Miss Plenderleith, haben Sie das hier schon einmal gesehen?«
In seiner ausgestreckten Hand lag ein kleines, ovales Stück dunkelblaue Emaille.
Jane Plenderleith schüttelte den Kopf.
»Nein, noch nie.«
»Es gehört weder Ihnen noch Mrs Allen?«
»Nein. So etwas tragen Menschen unseres Geschlechts normalerweise nicht, oder?«
»Oh! Sie wissen also, was es ist.«
»Nun, das ist ja wohl ziemlich eindeutig, oder etwa nicht? Das ist ein halber Manschettenknopf.«
Kapitel 4
Diese junge Dame bildet sich ein, sie wäre sonst was«, klagte Japp.
Die beiden waren noch einmal in Mrs Allens Zimmer. Der Leichnam war fotografiert und abtransportiert worden, und der Mann von der Spurensicherung hatte die Fingerabdrücke gesichert und war ebenfalls gegangen.
»Es wäre nicht ratsam, sie wie einen Einfaltspinsel zu behandeln«, stimmte Poirot ihm zu. »Sie ist ganz eindeutig kein Einfaltspinsel. Im Grunde ist sie eine ausgesprochen kluge und fähige junge Frau.«
»Glauben Sie, sie war’s?«, fragte Japp, und ein flüchtiger Hoffnungsschimmer huschte über seine Miene. »Sie könnte es nämlich durchaus gewesen sein. Wir müssen ihr Alibi überprüfen. Vielleicht irgendein Streit wegen dieses jungen Mannes, dieses Nachwuchsparlamentariers. Ihre Bemerkungen über ihn sind viel zu bissig, finde ich. Da ist irgendetwas faul! Als wäre sie selbst in ihn vernarrt, und er hätte sie abblitzen lassen. Diese Art von Frau würde doch jeden abmurksen, wenn ihr danach ist, und dabei auch noch einen kühlen Kopf bewahren! Ja, wir werden ihr Alibi überprüfen müssen. Sie hatte auf alles eine Antwort parat, und so weit weg ist Essex auch wieder nicht. Eine Menge Zugverbindungen. Oder ein schnelles Auto. Es wäre zum Beispiel gut herauszubekommen, ob sie gestern Abend früh schlafen ging.«
»Da haben Sie recht«, pflichtete ihm Poirot bei.
»Jedenfalls«, fuhr Japp fort, »verheimlicht sie uns etwas. Eh? Hatten Sie nicht auch das Gefühl? Diese junge Dame weiß etwas.«
Poirot nickte nachdenklich.
»Ja, das war deutlich zu erkennen.«
»Das ist in solchen Fällen immer schwierig«, beschwerte sich Japp. »Die Leute hüten einfach ihre Zunge – manchmal aus den ehrenwertesten Motiven.«
»Woraus man ihnen kaum einen Vorwurf machen kann, mon ami.«
»Nein, aber es macht unsere Arbeit natürlich umso schwerer«, brummte Japp.
»Es gibt Ihnen allerdings die Möglichkeit, Ihre Genialität in vollem Umfang unter Beweis zu stellen«, tröstete ihn Poirot. »Was ist übrigens mit den Fingerabdrücken?«
»Also, es war auf jeden Fall Mord. Keinerlei Abdrücke auf dem Revolver. Abgewischt, ehe er ihr in die Hand gelegt wurde. Selbst wenn es ihr gelungen sein sollte, sich den Arm mit irgendwelchen phantastischen akrobatischen Verrenkungen um den Kopf zu schlingen, hätte sie kaum abdrücken können, ohne den Revolver festzuhalten, und abwischen hätte sie ihn nach ihrem Tod natürlich auch nicht mehr können.«
»Nein, nein, das deutet ganz eindeutig auf Fremdeinwirkung hin.«
»Im Übrigen ist die Ausbeute an Fingerabdrücken enttäuschend. Auf dem Türknauf nichts. Am Fenster nichts. Aufschlussreich, eh? Ansonsten finden sich von Mrs Allen überall welche.«
»Hat Jameson irgendetwas herausbekommen?«
»Aus der Putzfrau? Nein. Sie hat zwar eine Menge geredet, wusste aber nicht wirklich viel. Hat bestätigt, dass Allen und Plenderleith gut miteinander auskamen. Habe Jameson losgeschickt, damit er in der Nachbarschaft Erkundigungen einzieht. Mit Mr Laverton-West müssen wir auch noch reden. Wir müssen herausfinden, wo er gestern Abend war und was er getan hat. In der Zwischenzeit sollten wir ihre Papiere durchgehen.«
Er machte sich sofort an die Arbeit. Gelegentlich knurrte er und schob Poirot etwas zu. Die Durchsicht dauerte nicht lange. Es befanden sich nicht viele Papiere im Sekretär, und die wenigen, die dort lagen, waren fein säuberlich geordnet und abgeheftet.
Schließlich lehnte sich Japp zurück und stieß einen Seufzer aus.
»Nicht gerade viel, was?«
»Sie sagen es.«
»Im Prinzip ganz normale Sachen: quittierte Rechnungen, einige unbezahlte Rechnungen, nichts besonders Auffälliges. Gesellschaftliche Verpflichtungen: Einladungen. Briefe von Bekannten. Die hier« – er legte die Hand auf einen Stapel von sieben oder acht Briefen – »sowie ihr Scheckheft und ihr Sparbuch. Fällt Ihnen da irgendetwas auf?«
»Ja, sie hatte ihr Konto überzogen.«
»Sonst noch etwas?«
Poirot lächelte.
»Unterziehen Sie mich hier einer Prüfung? Aber, ja, ich habe gesehen, was Sie meinen. Vor drei Monaten eine Barabhebung von zweihundert Pfund – und gestern noch einmal zweihundert Pfund …«
»Und nichts auf den Kontrollabschnitten im Scheckheft. Bis auf kleine Summen – im Höchstfall fünfzehn Pfund – keine anderen Barabhebungen. Und ich sage Ihnen noch etwas: Ein derartiger Betrag wurde nirgendwo im Haus gefunden. In einer Handtasche steckten vier Pfund zehn und in einer anderen Tasche noch mal ein, zwei Shilling. Die Sache ist ziemlich klar, finde ich.«
»Mit anderen Worten, sie hat diesen Betrag gestern ausgegeben.«
»Ja. An wen hat sie ihn also gezahlt?«
Die Tür ging auf, und Inspector Jameson trat ein.
»Nun, Jameson, haben Sie etwas?«
»Ja, Sir, Verschiedenes. Zunächst einmal hat niemand den Schuss wirklich gehört. Zwei oder drei Frauen behaupten, sie hätten ihn gehört, weil sie sich wünschen, sie hätten ihn gehört, aber das ist auch schon alles. Bei dem ganzen Feuerwerk gestern – nicht die Spur einer Chance!«
»Wahrscheinlich nicht«, brummte Japp. »Und weiter?«
»Mrs Allen war fast den ganzen Nachmittag und Abend zu Hause. Kam gegen fünf. Ging rund eine Stunde später noch einmal aus dem Haus, aber nur bis zum Briefkasten am Ende der Straße. Gegen halb zehn fuhr ein Wagen vor – eine Standard-Swallow-Limousine –, und ein Mann stieg aus. Personenbeschreibung: circa fünfundvierzig, gut aussehender Gentleman, militärische Erscheinung, dunkelblauer Mantel, Melone, Zweifingerbart. James Hogg, der Chauffeur von Nr. 18, meint, dieser Herr habe Mrs Allen schon des Öfteren besucht.«
»Fünfundvierzig«, sagte Japp. »Kann eigentlich nicht Laverton-West gewesen sein.«
»Der Mann, wer auch immer es war, blieb knapp eine Stunde hier. Verließ das Haus gegen zwanzig nach zehn. Blieb noch einmal in der Tür stehen und sprach mit Mrs Allen. Der kleine Frederick Hogg trieb sich ganz in der Nähe herum und konnte hören, was er sagte.«
»Und was hat er gesagt?«
»‹Also, überlegen Sie es sich und geben Sie mir Bescheid.› Dann hat sie etwas gesagt, und er meinte: ‹In Ordnung. Bis dann.› Daraufhin stieg er in seinen Wagen und fuhr weg.«
»Das war um zwanzig nach zehn«, sagte Poirot nachdenklich.
Japp rieb sich die Nase.
»Demzufolge war Mrs Allen gegen zwanzig nach zehn also noch am Leben«, sagte er. »Was weiter?«
»Nichts weiter, soweit ich weiß, Sir. Der Chauffeur von Nr. 22 kam um halb elf nach Hause und hatte seinen Kindern versprochen, mit ihnen ein Feuerwerk abzubrennen. Sie hatten auf ihn gewartet, und die anderen Kinder in der Nachbarschaft auch. Er schoss es ab, und Groß und Klein sah begeistert zu. Danach gingen alle schlafen.«
»Und niemand hat gesehen, ob noch jemand Nr. 14 betrat?«
»Nein, aber das will nichts heißen. Es hätte kein Mensch bemerkt.«
»Hm«, sagte Japp. »Stimmt. Tja, dann müssen wir wohl den Gentleman vom Militär mit dem Zweifingerbart ausfindig machen. Es ist einigermaßen klar, dass er der Letzte war, der sie lebend gesehen hat. Wer könnte das gewesen sein?«
»Vielleicht sagt Miss Plenderleith es uns?«, schlug Poirot vor.
»Vielleicht«, sagte Japp finster. »Vielleicht auch nicht. Ich habe das Gefühl, sie könnte uns eine ganze Menge sagen – wenn sie nur wollte. Und Sie, Poirot, altes Haus? Sie waren doch ein Weilchen allein mit ihr. Haben Sie denn nicht wieder Ihre mitunter so erfolgreiche Beichtvater-Masche abgezogen?«
Poirot breitete entschuldigend die Hände aus.
»Wir haben uns leider nur über die Gasheizung unterhalten.«
»Die Gasheizung, die Gasheizung!« Japp klang entrüstet. »Was ist eigentlich los mit Ihnen, Sie altes Schlitzohr? Seit Sie hier sind, interessieren Sie sich einzig und allein für Federkiele und Papierkörbe. O ja, ich habe Sie beobachtet, wie Sie unten still und leise einen inspiziert haben. Irgendetwas gefunden?«
Poirot seufzte.
»Einen Katalog für Tulpenzwiebeln und eine alte Zeitschrift.«
»Was soll das eigentlich? Wenn man ein belastendes Dokument oder worauf immer Sie spekulieren loswerden will, wirft man es doch wohl kaum einfach in einen Papierkorb.«
»Das ist sehr richtig, was Sie da sagen. Man würde sicher nur etwas ziemlich Unwichtiges in einen Papierkorb werfen.«
Poirots Stimme klang lammfromm. Trotzdem sah Japp ihn argwöhnisch an.
»Also«, sagte er. »Ich weiß, was ich als Nächstes tue. Und Sie?«
»Eh bien«, sagte Poirot. »Ich werde meine Suche nach dem Unwichtigen zu Ende führen. Da wäre nämlich noch der Mülleimer.«
Behände schlüpfte er aus dem Zimmer. Japp blickte ihm mit einer Spur von Empörung hinterher.
»Übergeschnappt«, sagte er. »Völlig übergeschnappt.«
Inspector Jameson schwieg respektvoll. In seinem Gesicht stand, mit typisch britischer Überheblichkeit, nur ein einziges Wort geschrieben: Ausländer!
Aus seinem Mund kamen die Worte: »Das ist also Mr Hercule Poirot! Ich habe von ihm gehört.«
»Ein alter Freund von mir«, erklärte Japp. »Ist übrigens längst nicht so unterbelichtet, wie es den Anschein hat. Kommt allerdings in die Jahre.«





























