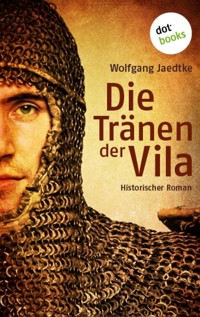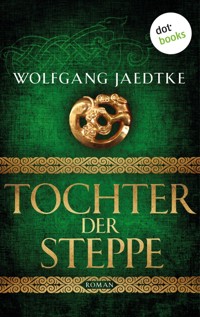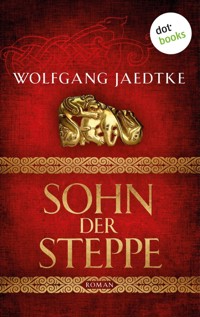Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Steppenwind-Saga
- Sprache: Deutsch
Niemand kann vor seiner Bestimmung fliehen: "Herrin der Steppe", der dritte Roman der Steppenwind-Saga von Wolfgang Jaedtke, als eBook bei dotbooks. Sie ist der Stolz ihres Stammes: Manja ist die stärkste Kämpferin der Sarmaten und gilt vielen als beste Nachfolgerin der Königin. Doch dann erschüttert ein schrecklicher Schicksalsschlag das Leben der jungen Frau. Manja sieht keinen anderen Ausweg, als ihr Volk zu verlassen. Jahre vergehen, bevor sie auf den Einsiedler Artan stößt, der einst zu den gefürchtetsten Anführern der Skythen gehörte, jenem Reitervolk, das die Sarmaten hasst. Diese Begegnung ändert alles. Aber kann Manja den schweren Mantel der Vergangenheit abwerfen, der auf ihr lastet, und wieder zu der Kriegerin werden, die ihr Volk dringender braucht als jemals zuvor? In Wolfgang Jaedtkes großer Trilogie erwachen das siebte Jahrhundert vor Christus und die antiken Völker zu neuem Leben, die als Amazonen und Zentauren in die Geschichte eingehen sollten – ein fesselndes Lesevergnügen über das Zusammenprallen von Matriarchat und Patriarchat voller Abenteuer, Sitten und Bräuche, die uns heute ebenso schaudern lassen wie faszinieren. Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Herrin der Steppe", der dritte Band der Steppenwind-Saga von Wolfgang Jaedtke – ein kraftvoller historischer Roman für alle Fans der Uhtred-Serie von Bernard Cornwell. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 479
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Sie ist der Stolz ihres Stammes: Manja ist die stärkste Kämpferin der Sarmaten und gilt vielen als beste Nachfolgerin der Königin. Doch dann erschüttert ein schrecklicher Schicksalsschlag das Leben der jungen Frau. Manja sieht keinen anderen Ausweg, als ihr Volk zu verlassen. Jahre vergehen, bevor sie auf den Einsiedler Artan stößt, der einst zu den gefürchtetsten Anführern der Skythen gehörte, jenem Reitervolk, das die Sarmaten hasst. Diese Begegnung ändert alles. Aber kann Manja den schweren Mantel der Vergangenheit abwerfen, der auf ihr lastet, und wieder zu der Kriegerin werden, die ihr Volk dringender braucht als jemals zuvor?
In Wolfgang Jaedtkes großer Trilogie erwachen das siebte Jahrhundert vor Christus und die antiken Völker zu neuem Leben, die als Amazonen und Zentauren in die Geschichte eingehen sollten – ein fesselndes Lesevergnügen über das Zusammenprallen von Matriarchat und Patriarchat voller Abenteuer, Sitten und Bräuche, die uns heute ebenso schaudern lassen wie faszinieren.
Über den Autor:
Wolfgang Jaedtke, geboren 1967 in Lüneburg, studierte Historische Musikwissenschaft und promovierte mit einer Arbeit über Beethoven. Danach arbeitete er für ein Theater, bevor er sich als Schriftsteller selbstständig machte und seitdem unter seinem eigenen Namen und einem Pseudonym historische Romane und Thriller veröffentlicht.
Bei dotbooks veröffentliche Wolfgang Jaedtke bereits den historischen Roman »Die Tränen der Vila« und die »Steppenwind«-Trilogie mit den Einzelbänden »Sohn der Steppe«, »Tochter der Steppe« und »Herrin der Steppe«.
***
Originalausgabe August 2018
Copyright © der Originalausgabe 2017 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design, München
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)
ISBN 978-3-95520-702-1
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Herrin der Steppe« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Wolfgang Jaedtke
Herrin der Steppe
Die Steppenwind-Saga – Dritter Roman
dotbooks.
Erster Teil DIE MUTTER
Der Leopard
Leise rauschend strich der Wind über das Steppengras. Er kam von den nahen Bergen und fuhr über die weite Ebene, von keinem Busch oder Baum gebrochen. Die hohen Halme rauschten in Wellen wie aufgewühltes Wasser.
Niemand bemerkte die große Raubkatze, die geduckt durch das Gras schlich. Auch sie war vom östlichen Gebirge herabgekommen, und das Tappen ihrer Pfoten ging im Rauschen des Windes unter. Die Spitzen des Grases verdeckten ihre gedrungene Gestalt vollständig, von den runden Pelzohren bis zum lauernd gesenkten Schwanz.
Der Schneeleopard war ein erfahrener Jäger. Gewöhnlich lebte er auf den Almwiesen der Berge, wo er einen Unterschlupf in einer Felshöhle bewohnte und Hasen, Erdhörnchen oder Steinböcke fing. Heute jedoch hatte ihn die Ankunft einer großen Wanderherde in die Ebene herabgelockt. Mit seinen scharfen Augen hatte er die Rauchsäulen von Lagerfeuern entdeckt und erkannt, dass es jene seltsamen Wesen waren, die aufgerichtet auf den Hinterbeinen gingen.
Der Leopard kannte die Menschen vom Sehen. Sie waren Nomaden und kamen nur gelegentlich ins Vorland des Gebirges, um ihr Winterlager aufzuschlagen. In ihrem Gefolge zogen Herden von zahmen Ziegen und Schafen einher. Als sie das letzte Mal gekommen waren, war der Leopard noch jung gewesen und hatte es nicht gewagt, sich ihnen zu nähern. Nun jedoch, da er größer und erfahrener war, schreckten ihn die Zelte, Fuhrwerke und Lagerfeuer nicht mehr, und es schien ihm ein Leichtes, eines der jungen Lämmer oder Zicklein zu schlagen, die im Umkreis des Lagers weideten. Seine einzige Sorge galt den Hirtenhunden; daher achtete er darauf, sich gegen den Wind anzupirschen.
Ursprünglich hatte der Leopard eine Schafherde zum Ziel erkoren, die am Ufer eines Flusses weidete. Als er sich jedoch der Böschung näherte, schlug ihm ein unbekannter Geruch in die Nase, der aus einer Senke seitlich des Flusstals herüberdrang. Wie Schafe und Ziegen rochen, wusste der Leopard; dieser neue Geruch jedoch war vermutlich derjenige eines Menschen, den er noch nie aus der Nähe wahrgenommen hatte. Die Witterung verriet eindeutig, dass das Wesen jung sein musste, denn es war noch nicht in der Lage, die Ausscheidungen seines Körpers zu halten. Womöglich handelte es sich um ein Neugeborenes.
Neugierig schwenkte der Leopard um, pirschte einige Ellen weit durch das Gras und hielt inne, um in die Senke hinabzublicken. Dort standen einige verkrüppelte Bäume, denen es gelungen war, im Windschatten der Böschungen zu überleben. Am Boden zwischen ihnen war ein Tuch aus Schafwolle ausgebreitet, und darauf lag – der Leopard sah es mit freudiger Erregung – ein kleines Menschenwesen. Es war gänzlich nackt und lag auf dem Rücken, die kleinen Ärmchen und Beinchen in der Luft rudernd, ganz ähnlich einem Käfer, der sich nicht aus eigener Kraft umzudrehen vermochte. Offensichtlich war es schwach und hilflos.
Dennoch zögerte der Leopard. Das Menschenkind war nämlich nicht allein: Unmittelbar neben ihm saß ein ausgewachsenes Menschenweibchen mit untergeschlagenen Beinen, den Rücken an den Stamm eines Baumes gelehnt, und schickte sich eben an, das kleine Wesen in ein sauberes Tuch zu wickeln. Dabei ging sie sehr zart und behutsam mit ihm um, streichelte die rosige Haut, spielte mit den kleinen Fingerchen, die sich ihr entgegenreckten, und stieß leise, gurrende Laute aus. Instinktsicher erkannte der Leopard, dass das Menschenweibchen die Mutter des Kindes sein musste. Es war möglich, dass sie ihr Kind beschützen würde, doch schien sie dem Leoparden nicht gefährlich: Wie alle Menschen besaß sie stumpfe Krallen und Zähne, hatte nackte, schutzlose Haut und nicht einmal Hufe, mit denen sie sich zur Wehr setzen konnte. Ein rascher Sprung würde genügen, um die beiden voneinander zu trennen, das Weibchen in die Flucht zu schlagen, das Junge zu packen und wieder im hohen Gras zu verschwinden.
Der Leopard duckte sich zum Angriff. Er streckte die Vorderpfoten, ließ die langen, gebogenen Krallen aus den Hautfalten fahren, senkte den Kopf und fixierte das Ziel. Seine Augen mit den schlitzförmigen Pupillen verengten sich, stellten sich auf das hilflose Bündel am Boden ein und schätzten sorgfältig die Entfernung. Die kräftigen Hinterbeine stemmten sich gegen den Boden, um die nötige Kraft für den Sprung bereitzustellen, und der buschige Schwanz zuckte hin und her, um den richtigen Winkel zu finden.
Plötzlich ruckte der Kopf der Menschenfrau in die Höhe. Unter der schwarzen Mähne, die ihren Kopf bedeckte, kam das Gesicht zum Vorschein und wandte sich der Böschung zu, mit blitzenden Augen unter misstrauisch gerunzelten Brauen. Was hatte sie wahrgenommen – ein Geräusch? Einen Geruch?
Urplötzlich schnellte sie aus ihrer sitzenden Haltung hoch, so rasch, dass der Leopard zusammenzuckte. Mit einem entschlossenen Satz sprang sie auf ihn zu, ergriff einen am Boden liegenden Ast, schwenkte ihn wie einen Prügel und schrie aus Leibeskräften. Sie war hochgewachsen und bewegte ihren Körper, dessen weiche Umrisse zuvor so verletzlich gewirkt hatten, mit einer ebenso anmutigen wie Furcht einflößenden Kraft. Ihre Faust schloss sich so fest um den Stock, dass die Knöchel weiß hervortraten. Ihre hellen Augen funkelten, und ihre schwarz gelockte Mähne tanzte wie ein Haufen zischelnder Schlangen.
Mehr als alles andere jedoch war es ihre Stimme, die den Leoparden erschreckte. Instinktiv erkannte er alle Rufe der Angst, die seine Beutetiere ausstießen, vom schrillen Wiehern der Wildpferde bis zum panischen Meckern der Gämsen. Diese Stimme jedoch – das spürte er deutlich – schrie nicht vor Angst, sondern vor Wut. Es war ein Kampfgeschrei, eine Herausforderung, ein Signal, dass die Menschenfrau kämpfen würde, notfalls bis zum Tod. Die Ohren des Leoparden zuckten; die schrille Stimme peinigte sein empfindliches Gehör. Atemluft wehte mit dem Schrei zu ihm herüber – und sosehr er sich auch bemühte; er konnte keinen jener Duftstoffe wittern, die gewöhnlich von Angst kündeten.
Der Leopard gab auf, rettete sich mit einem raschen Sprung zurück ins hohe Gras und ergriff die Flucht. Er hielt nicht einmal inne, um zurückzublicken, sondern rannte, bis der Geruch der Menschen sich vollständig verloren hatte und die Rauchsäulen der Lagerfeuer zu fernen Wolken über der Steppe verblassten. Erst als er die Hänge des nahen Gebirges erreichte, hielt er schwer atmend inne, ließ sich ins Gras sinken und verschnaufte. Er hatte seine Lektion gelernt. Vorläufig würde er dem Menschenlager fernbleiben und auf den Almwiesen Hasen und Rehe jagen, wie er es gewöhnlich tat. Und wenn er doch noch einmal versuchen würde, ein Menschenkind zu schlagen – vielleicht in einigen Tagen oder Wochen, falls die Menschen blieben und er sich von seinem Schrecken erholt hätte –, musste er sichergehen, dass dessen Mutter nicht in der Nähe war.
Schwer atmend hielt Manja inne, ließ den Stock sinken und überzeugte sich, dass der Leopard verschwunden war. Erst als sie keine Bewegung mehr im Gras ausmachen konnte, kehrte sie um und barg die kleine Ariane in ihren Armen. Das Kind, das ihre Erregung spürte, weinte vor sich hin und barg den Kopf an ihrer Brust.
Wenig später näherte sich das Geräusch von Hufen. Ein Reiter tauchte am Rand der Senke auf, Pfeil und Bogen in der Hand. Manja kannte ihn vom Sehen; er war einer der Hirten, die am Fluss die Herden des Stammes bewachten.
»Was war es, Herrin?«, rief er besorgt zu ihr hinab.
»Ein Leopard«, antwortete Manja. »Er schlich sich im hohen Gras heran, ist aber geflohen.«
»Bist du wohlauf?«
»Ja. Aber du solltest auf die Schafe achtgeben.«
Der junge Mann nickte, wendete sein Pferd und trabte zurück zum Fluss.
Manja setzte Ariane in ihr Tragetuch, schulterte das Kind und machte sich auf den Weg zurück zum Lager. Solange ein Raubtier sich in der Nähe aufhielt, würde es sicherer sein, beim Wagen zu bleiben. Vor einigen Jahren noch, dachte Manja mit einer gewissen Wehmut, hätte sie die Jagd auf den Leoparden nicht den Männern überlassen, sondern selber Bogen und Speer ergriffen und ihr Pferd bestiegen. Inzwischen jedoch war es schon lange her, dass Manja, bei ihrem Volk Manjane genannt, eine Kriegerin gewesen war und ein Schwert am Gürtel getragen hatte. Gemäß den Sitten der Sarmaten hatte sie sich seit Arianes Geburt vor nunmehr einem Jahr vom Kriegshandwerk zurückgezogen, um sich der Pflege des Kindes zu widmen.
Manja erreichte die Zeltstadt, die sich über mehrere Meilen vom Flussufer bis zu den Hängen des nahen Gebirges erstreckte, und hielt auf einen weithin sichtbaren Hügel zu, wo die Wohnwagen der Königsfamilie standen. Die vier mächtigen Fahrzeuge, die so abgestellt waren, dass sie die Form eines Hufeisens bildeten, standen auf mannshohen hölzernen Speichenrädern. Die Deichseln, an denen jeweils sechs Zugochsen angeschirrt wurden, wenn der Stamm sich auf Wanderschaft befand, waren ausgehängt und ruhten im Gras. Jeder der Wagen trug einen hölzernen Aufbau mit Wänden aus Weidengeflecht, die mit Wandmatten aus Filz verkleidet waren. Bunte Aufsätze aus farbigem Stoff überzogen diese Matten. Sie stellten Tiere dar: rennende Pferde, fliegende Adler, Steinböcke mit gewundenen Hörnern, jagende Wölfe, Raubkatzen im Sprung. Der größte der Wagen thronte auf sechs Rädern und trug eine Standarte, bekrönt von der Bronzefigur eines Wolfes. Ihn bewohnte Tamage, die alleinstehende Königin der Sarmaten, Manjas Ziehmutter. Gleich hinter ihm war ein Zelt zu ebener Erde aufgebaut, in dem die Dienerschaft der Familie lebte, bestehend aus zumeist halbwüchsigen Köchen, Mundschenken, Schneiderinnen und Ammen. Rechts neben dem Wagen der Königin stand das vierrädrige Gefährt, das Tamages leiblicher Tochter Gwendike und ihrer Familie als Wohnstätte diente. Ein dritter Wagen war etwas abseits am Rand des Hügels abgestellt. Er gehörte Byke, einer entfernteren Verwandten der Königin.
Der vierte Wagen, in dem Manja mit ihrem Ehemann Sajan lebte, erhob sich zur Linken. Im Augenblick allerdings würde Manja ihn leer vorfinden, denn Sajan war am Morgen, gemeinsam mit der Königin und den übrigen Kriegern des Stammes, zur Schlacht gegen die Skythen ausgeritten.
Manja blieb stehen, als sie an Gwendikes Wagen vorbeiging und eine helle Kinderstimme sie anrief.
»Tante Manjane!« Aspan, Gwendikes vierjähriger Sohn, lief lachend auf sie zu. »Schau, was ich gefertigt habe!«
Strahlend hielt er ihr ein Holzstück entgegen, das kaum so lang wie sein Unterarm war, jedoch die grobe Form eines Bogens besaß und mit einer Sehne aus Pferdehaar bespannt war.
»Oh!«, staunte Manja und ließ sich auf die Knie nieder, um das Spielzeug zu betrachten. Auch die kleine Ariane, die eben noch mit Manjas Haaren gespielt hatte, lugte neugierig über ihre Schulter.
»A-pan!«, rief sie freudig, als sie den Jungen erkannte. Die Aussprache seines Namens bereitete ihr noch Schwierigkeiten.
Aspan grinste. »Weißt du, was das ist, Ariane?«, fragte er und hielt den winzigen Bogen hoch.
Ariane machte große Augen, und ihre kleinen Lippen formten einen Laut, der annähernd wie »Bom« klang.
Aspan lachte. »Bo-gen!«, wiederholte er mit übertriebener Betonung.
Manja nahm die Spielzeugwaffe entgegen und musterte sie genau. Sie bestand aus Kiefernholz und war erstaunlich sorgfältig geschnitzt.
»Du hast ihn selbst gebaut?«, fragte sie.
»Nicht ganz – mein Vater hat mir geholfen«, gab Aspan zu. »Aber die Sehne habe ich selber geflochten!«
»Wirklich bemerkenswert«, sagte Manja ehrlich.
»Aspan?« Die Matte aus Hirschfell, die den seitlichen Eingang des Wagens verdeckte, wurde beiseitegeschoben, und Gwendike erschien in der Tür. Ihre schlanke, zierliche Gestalt wurde von einem himmelblauen Kleid mit Pelzborten umflossen. Ein goldener Stirnreif fasste den Ansatz ihres glatten, beinahe hüftlangen Haares ein.
»Ich bin hier, Ama!«, rief der Junge seiner Mutter zu.
Gwendike erblickte ihn, erkannte Manja und stieg das Trittbrett herab, um sich zu ihnen zu gesellen.
»Ich habe Tante Manjane meinen neuen Bogen gezeigt!«, empfing Aspan sie stolz.
»Wie schön.« Gwendike strich ihm über das dunkle Haar, wirkte jedoch abwesend. Manja ahnte, dass sie besorgt war, und konnte sie nur zu gut verstehen: Auch ihr Ehemann war zur Schlacht ausgeritten, und beide Frauen bangten um das Schicksal der Krieger.
»Man kann sogar richtig damit schießen!«, rief Aspan aufgeregt. »Ich zeige es euch! Ich habe einen Pfeil geschnitzt …«
Er blickte sich suchend um, konnte den Pfeil jedoch nirgends entdecken und lief schließlich zur Rückseite des Wagens, wo er ihn im Gras liegen gelassen hatte.
Manja nutzte seine Abwesenheit.
»Lass ihn nicht allein zum Fluss gehen!«, sagte sie leise zu Gwendike. »Dort streift ein Leopard herum. Er schlich sich an, als ich am Ufer saß und Ariane wickelte.«
Gwendike zog erschrocken die Augenbrauen hoch. »Hast du es den Männern gesagt?«
»Natürlich. Die Hirten werden sich darum kümmern. Trotzdem sollten wir einstweilen gut auf unsere Kinder aufpassen.«
Gwendike nickte ernst, während die kleine Ariane einen Arm nach ihrer Tante ausstreckte.
»Dike!«, plärrte sie fröhlich.
Gwendike lächelte, ergriff ihre kleine Hand und drückte sie. Ariane gluckste.
»Wie fühlst du dich?«, fragte Manja.
Gwendike seufzte. »Das Warten ist furchtbar … ich glaube, ich werde mich nie daran gewöhnen.« Sie blickte zu ihrem Sohn hinüber, der hinter dem Wagen nach seinem Spielzeugpfeil suchte. »Aspan kann es gar nicht erwarten, ein Krieger zu werden und seinen Vater in die Schlacht zu begleiten. Wenn es nach mir ginge, würde er nie älter werden – es schaudert mich bei dem Gedanken, auch noch um ihn fürchten zu müssen.«
»Das ist ja noch lange hin«, tröstete Manja sie.
»Glaubst du?« Gwendike lachte freudlos. »Sein Vater redet schon jetzt davon, ihn auf ein Pferd zu setzen. Er sagt, ein Sarmate müsse Reiten lernen, sobald er laufen kann.«
»Ich habe den Pfeil!«, rief Aspan, bog um die Rückseite des Wagens und hielt triumphierend einen stumpfen Eschenstock in die Höhe. »Ihr müsst zusehen!«
Beide Frauen wandten sich dem Jungen zu, der sich mühte, den Pfeil aufzulegen und die Sehne zu spannen. Zweimal fiel er ihm herunter, und erst beim dritten Versuch gelang es ihm, den Stock einige Ellen weit ins hohe Gras zu schießen. Sogleich lief er los, um ihn wiederzuholen, was Gwendike die Gelegenheit gab, das Gespräch fortzusetzen.
»Und du?«, fragte sie. »Machst du dir keine Sorgen?«
»Ich versuche, nicht darüber nachzudenken«, antwortete Manja wahrheitsgemäß. »Natürlich wäre es mir lieber, wenn Sajan daheim wäre und friedlich mit mir am Feuer sitzen würde … aber noch lieber würde ich bei ihm sein und an seiner Seite kämpfen.«
Gwendike senkte den Blick. »Das werde ich wohl nie verstehen«, sagte sie etwas beschämt. »Ich bin eben keine Kriegerin wie du.«
Das war die Wahrheit, dachte Manja. Wie alle sarmatischen Frauen waren sie beide von ihrem 13. Lebensjahr an im Umgang mit Waffen ausgebildet worden. Manja erinnerte sich noch gut an die Lehrstunden bei Skudane, einer grimmigen alten Kriegerin, die aufgrund einer Beinverletzung nicht mehr reiten konnte und stattdessen den Nachwuchs schulte. Nahezu täglich hatten sie sich im Bogenschießen und im Umgang mit Axt und Speer geübt. Gwendike jedoch hatte große Angst vor der Bewährung im Kampf gehabt und dafür gesorgt, dass sie frühzeitig schwanger wurde – ein Umstand, der es einer Frau erlaubte, sich nur noch ihren häuslichen Pflichten zu widmen. Manja verachtete sie nicht im Geringsten dafür. Gwendike war ein herzensgutes Geschöpf und, wie sie selbst stets betont hatte, besser an der Wiege aufgehoben als auf dem Schlachtfeld. Inzwischen hatte sie zwei Kinder, und Manja wusste, dass sie seit Kurzem ein drittes erwartete.
»Du bist, was du bist«, sagte Manja ernst. »Eine liebevolle Mutter, eine treue Ehefrau − und die beste Freundin der Welt.«
Gwendike lächelte dankbar, während Aspan, der endlich seinen Pfeil wiedergefunden hatte, auf sie zugelaufen kam.
»Spielst du mit mir, Ama?«, bettelte er und griff nach ihrem Arm.
Im selben Moment jedoch erhob sich hinter ihnen im Innern des Wagens die Stimme eines Kleinkindes, das vor sich hin weinte. Offenbar war Gwendikes zweijährige Tochter erwacht und hatte die Abwesenheit ihrer Mutter bemerkt.
»Du musst alleine spielen. Budine hat Hunger«, sagte Gwendike seufzend zu ihrem Sohn. Dann warf sie Manja einen entschuldigenden Blick zu. »Ich muss hinein.«
Manja nickte verständnisvoll, und während Aspan sich enttäuscht davonmachte, wandte Gwendike sich um und erstieg den Wagen.
Manja ging weiter, um ihren eigenen Wagen aufzusuchen, wobei Ariane auf ihrer Schulter freudig vor sich hin brabbelte.
»Unner!«, verlangte sie, als Manja das Trittbrett erstieg und die Matte am Eingang hob – was »hinunter« bedeutete und ihren Wunsch ausdrückte, auf den Holzboden abgesetzt zu werden.
Manja tat ihr den Gefallen und stützte sie einen Moment, bis sie das Gleichgewicht gefunden hatte. Zielstrebig lief sie auf ihr Lieblingsspielzeug zu, das am Boden unter der Wiege lag: ein kleines Holzpferdchen auf Rädern, das Sajan für sie geschnitzt hatte.
Während sie spielte, ließ Manja sich auf das Lager aus Schaffellen beim Herdfeuer nieder und beobachtete ihre Tochter. Der Angriff des Leoparden schien sie nicht im Mindesten aus dem Gleichgewicht gebracht zu haben. Wahrscheinlich – so hoffte Manja – hatte sie das Tier gar nicht gesehen und nicht begriffen, warum ihre Mutter plötzlich aufgesprungen war und schreiend einen Stock geschwenkt hatte.
Stumm dankte Manja den Göttern, dass sie ihre schützende Hand über Ariane gehalten hatten. Es blieb nur zu hoffen, dass das Auftauchen der Raubkatze kein schlechtes Omen für den Ausgang der Schlacht war. Gerade in diesem Moment, während Ariane mit ihrem Holzpferdchen spielte, war ihr Vater vermutlich irgendwo draußen in der Steppe und ritt mit gezücktem Schwert gegen eine feindliche Streitmacht an. Im Geist glaubte Manja das Schnauben der Rosse zu hören, klirrende Klingen, splitternde Speere, die Schreie der Sterbenden. Gegenüber Gwendike hatte sie ihre Furcht nicht gezeigt; insgeheim jedoch bebte sie vor banger Erwartung. Die Krieger waren früh am Morgen ausgeritten und bereits seit vielen Stunden fort. Wenn das Signalhorn ertönte, das ihre Rückkehr ankündigte, mochte es sein, dass Sajan nicht mehr bei ihnen war – oder dass er verwundet zurückkehrte, vielleicht bewusstlos, mit gebrochenen oder gar fehlenden Gliedmaßen. Manja zwang sich, nicht daran zu denken. Stattdessen betete sie leise zu allen Göttern der Sarmaten, zu Tabiti, der Herrin des Weltfeuers, zu Api, der Erdmutter, zu Papai, dem Himmelsvater und Gott des Krieges.
»Herrin?«
Manja schreckte auf und sah Bilai, ihre junge Leibdienerin, in der Tür stehen. Sie war ein hübsches Mädchen, 16-jährig, aber frühzeitig voll erblüht und von reizender Gestalt.
»Ich sah dich zurückkommen«, sagte Bilai. »Brauchst du mich?«
Manja zwang sich zu einem Lächeln.
»Eigentlich nicht«, erwiderte sie. »Was bleibt mir anderes zu tun, als dazusitzen und zu warten?«
Bilai trat dennoch ein, bemerkte Ariane, die soeben über ihrem Spiel eingeschlafen war, hob das Kind sanft vom Boden auf und bettete es in seine Wiege, die an einem der Deckenbalken hing. Der längliche Korb bestand aus geflochtenen Weidenzweigen, war mit weichem Filz ausgelegt und mit Amuletten behängt, die vor Krankheiten und bösen Geistern schützten.
»Du könntest dich schön machen für Sajans Rückkehr«, schlug Bilai vor. »Möchtest du?«
Manja nickte ergeben. Eigentlich hatte sie keine rechte Lust dazu, doch fiel ihr ein, dass sie schon am vergangenen Abend auf ihre Körperpflege verzichtet hatte.
Ich vernachlässige mich, dachte sie. So geht es wohl den meisten Frauen, wenn sie erst einmal Kinder haben.
Bilai griff nach einem goldverzierten Ölgefäß, das auf dem Holztisch neben dem Schlaflager stand, und entkorkte es. Manja streifte ihren Leibrock ab, setzte sich mit untergeschlagenen Beinen ans Feuer und ließ sich Schultern, Arme und Brüste einreiben. Ihre Unlust verging. Das Öl, eine besondere Tinktur aus Wacholder und Zypresse, roch angenehm wie stets, und Bilais zarte Hände taten ihr gut. Sie spürte ihren Körper deutlicher als zuvor, und zugleich wurde ihr Kopf klarer.
»Danke, Bilai«, seufzte Manja und rollte sich auf den Rücken.
»Du sollst doch schön sein, wenn dein Mann nach Hause kommt«, wiederholte Bilai lächelnd. »Wir sollten eine zweite Schicht auf deine Brüste legen. Das lässt die blauen Flecken verschwinden.«
Manja sah an sich herab und begriff, was sie meinte: Ariane hatte beim letzten Stillen wieder einmal sehr fest zugebissen. Stumm ließ sie die Dienerin gewähren, ärgerte sich jedoch im Stillen über ihren mitleidigen Ton.
Bin ich schon so alt, fragte sie sich, dass das Mitgefühl einer Halbwüchsigen mich kränkt?
Eigentlich war kein Grund dafür vorhanden. Manja war 24, und die Schwangerschaft hatte ihren Körper kaum gezeichnet. Nur wenn sie sehr genau hinsah, fiel ihr eine leichte Erschlaffung auf, vor allem beim Anblick der Bilderzeichnungen, die sie wie jede erwachsene Kriegerin auf der Haut trug. Der Adler unterhalb ihrer Brüste hatte sich nicht verändert; die Kette fliehender Steinböcke jedoch, die ihren Bauch bedeckte, war ein wenig zerdehnt, und das stilisierte Bild der Raubkatze auf ihrem linken Oberschenkel war von Geweberissen durchbrochen. Wahrhaftig; es war schon lange her, dass sie täglich im Sattel gesessen und sich in den Kampfübungen bei Skudane ertüchtigt hatte.
»Bist du in Sorge, Herrin?«, fragte Bilai, die ihren abwesenden Blick missdeutete. »Hab keine Angst! Dein Mann ist ein starker Krieger, und die Götter werden ihn beschützen.«
Manja nickte seufzend und drehte sich auf den Bauch, damit die Dienerin mit der Bearbeitung ihres Rückens fortfahren konnte. Bilais Worte, wenngleich tröstend gemeint, hatten ihre Gedanken wieder auf Sajan gelenkt, der womöglich in Todesgefahr schwebte. Manja ertappte sich dabei, dass sie die Dienerin beneidete – um ihre Jugend, ihre Einfalt und ihre Zuversicht.
Die Heimkehr der Krieger
Endlich, am frühen Abend, erklang von Westen das hohle Dröhnen des Signalhorns. Manja hatte Bilai längst fortgeschickt und schürte gerade das Herdfeuer, als sie es hörte. Der Schürhaken fiel ihr aus der Hand, als sie in die Höhe fuhr, und polterte auf die Holzdielen des Wagenbodens. Schuldbewusst wandte sie sich nach Ariane um, die in ihrer Wiege lag – doch das Kind schlief tief und fest.
»Dein Vater kommt heim!«, flüsterte Manja ihr zu, während ihr das Herz vor Erregung in der Kehle pochte. Die Götter mochten geben, dass sie die Wahrheit sprach.
»Manjane?«, rief jemand von draußen.
Das war Gwendikes Stimme. Hastig schnürte Manja ihren Leibrock, hob die Ledermatte am Eingang des Wagens und kletterte ins Freie. Gwendike erwartete sie, das Gesicht vor Aufregung gerötet.
»Sie kommen!«, rief sie und fasste Manja bei der Hand. »Ich bete schon seit Stunden … glaubst du, es ist alles in Ordnung?«
Statt zu antworten, schloss Manja sie fest in die Arme. Es tat gut, die Freundin zu beschwichtigen, denn es lenkte sie von ihrer eigenen Unruhe ab.
»Komm!«, sagte sie schließlich und zog Gwendike mit sich.
Hand in Hand liefen sie über den freien Platz, dann durch eine Allee von Zelten und quer über die Pferdeweide zum westlichen Rand des Lagers. Sie waren nicht die Einzigen, die ungeduldig die Rückkehr der Krieger erwarteten: Das ganze Lager war auf den Beinen; überall hoben sich die Matten an den Eingängen der Zelte und Wagen, und die Menschen strömten ins Freie. Als die beiden Freundinnen den Rand der Weide erreichten, hatte sich bereits eine große Menschenmenge eingefunden.
Manja beschattete die Augen mit der freien Hand und blinzelte in die tief stehende Sonne. Am Horizont, undeutlich vor der roten Glut, war eine dunkle Schlange von Menschen und Pferden auszumachen, die sich rasch näherte. Speerspitzen blinkten, und es dauerte nicht lange, bis das Getrappel von Hufen herüberdrang. Dann ertönte zum zweiten Mal der Ruf des Horns, näher und lauter.
»Tabiti, Herrin des großen Feuers …«, betete Gwendike leise. Manja spürte, wie die Hand der Freundin zwischen ihren Fingern zitterte.
Neben ihnen drängte sich Bazukan, der greise Priester, durch die Menge. Er stützte sich auf seinen Stab, der mit einer bronzenen Steinbocksfigur bekrönt war, und blickte wie alle anderen zum Horizont. Die Umstehenden hatten ihm erwartungsvoll Platz gemacht, denn jeder wusste, dass er trotz seines Alters scharfe Augen besaß, besonders für Dinge in großer Ferne. Jetzt starrte er angestrengt in die Ebene hinaus − und reckte schließlich die dürre Faust zum Himmel.
»Sieg!«, rief er mit seiner krächzenden, doch kräftigen Stimme. »Sieg!«
Manjas Herz tat einen fast schmerzhaften Satz, während die Menge den Ruf aufnahm und in begeistertes Geschrei ausbrach. Niemand zweifelte daran, dass der weitsichtige Alte den Ausgang der Schlacht zutreffend erraten hatte. Auch Manjas Angst verflog, als die Vorhut des Heeres sich näherte: Mehrere Reiter galoppierten voraus und schwenkten ihre Bogen.
»Xorsa!«, schrie Gwendike, ließ Manja los und stürmte ihnen entgegen. Der junge Mann, der in der vordersten Linie ritt, erblickte sie, sprang aus dem Sattel und schloss sie in die Arme. Unmittelbar neben ihm zügelte Tamage, die Königin der Sarmaten, ihren Schimmel. Ebenso wie Xorsa schien sie vollständig unverletzt, reckte die Streitaxt und stieß ein triumphierendes Geheul aus.
»Sieg!«, rief Bazukan erneut, und nun löste sich jede Ordnung auf: Die Menge stürmte drauflos, flutete auf die Heimkehrer zu und schloss sie ein, sodass manches Pferd erschrocken wieherte. Krieger und Kriegerinnen sprangen aus den Sätteln, um Verwandten und Freunden in die Arme zu fallen. Hier und da mischten sich Klagerufe in das allgemeine Begeisterungsgeschrei, denn einige der Streiter – wenngleich wenige – hingen leblos auf dem Rücken ihrer Pferde.
Manjas Herz klopfte heftig. Sie war von der Menge eingeschlossen worden und hatte Mühe, zu den Pferden durchzudringen; auch konnte sie über die wimmelnden Köpfe hinweg niemanden erkennen außer Tamage, die noch immer im Sattel saß. Als sie sich endlich in Rufweite gedrängt hatte, bemerkte die Königin sie und zeigte ein grimmiges Lächeln.
»Die Götter waren mit uns!«, rief sie und stieß eine Faust in die Luft, dass ihr rotes Haar flog. »Schade, dass du nicht dabei sein konntest!«
»Wo ist Sajan?«, schrie Manja zurück.
Tamages Lächeln wurde noch breiter. »Mein kleiner Bruder ist der Held des Tages!«, rief sie zurück und deutete ins Gewühl zur Linken, wo mehrere Männer einen Kreis gebildet hatten und Hochrufe ausstießen.
Manja, nun alle Rücksichten vergessend, boxte sich den Weg frei, bis sie endlich zu der Gruppe durchgedrungen war.
»Sajan?« Ihre Stimme brach vor Erregung.
Und da endlich war er! Ungeduldig schob er die Männer beiseite, die ihn umringten, und rannte ihr entgegen. Sein Gesicht strahlte.
Manja prallte so heftig gegen ihn, dass sie ihn fast umwarf, schlang beide Arme um seine Schultern und atmete glücklich den Geruch seines erhitzten Körpers.
»Manjane …« Seine Stimme, nahe an ihrem Ohr, klang erschöpft, doch warm und voller Zärtlichkeit. Er strich über ihre schwarzen Locken, während sie das Gesicht in seine Halsbeuge presste und Tränen der Erleichterung in sich aufsteigen spürte. Ihre Hände fuhren ruhelos über seinen Rücken, als müsse sie ihn nach der Trennung erneut in Besitz nehmen und sich vergewissern, dass er unverletzt war. Es dauerte lange, bis sie sich von ihm lösen konnte, um ihm ins Gesicht zu sehen.
»Ein leichter Sieg«, sagte er und strich ihr eine Haarsträhne aus der Stirn. »Dennoch bin ich froh, wieder bei dir zu sein. Hätten wir nicht das Überraschungsmoment auf unserer Seite …«
»Still!«, flüsterte sie, packte mit beiden Händen seinen Kopf und küsste ihn gierig. Seine Lippen schmeckten nach Wildheit und Weite und der Hitze der Schlacht.
Sie gingen zu fünft zu ihren Wagen zurück: Manja und Sajan, Gwendike, Xorsa und schließlich auch Tamage, nachdem sie ihr Pferd einer Dienerin übergeben hatte.
»Vor den Skythen werden wir erst einmal Ruhe haben«, sagte die Königin zufrieden, während sie im Gehen Staub von ihrer Reithose klopfte.
»Was ist geschehen?«, fragte Manja.
»Sie stellten sich jenseits des Flusses zur Schlacht«, berichtete Sajan, der den Arm um Manjas Hüfte gelegt hatte. »Es waren rund zweitausend Reiter – mehr als wir. Ich war dafür, sie zu umgehen und in der Flanke zu nehmen, um ihre Schlachtlinie aufzubrechen.« Er lächelte Tamage zu. »Aber meine Schwester meinte, tollkühn wie stets, wir sollten keine Furcht zeigen und geradenwegs auf sie zuhalten. Ich gebe zu: Das war letztlich eine gute Idee, auch wenn mir zuerst nicht ganz wohl dabei war.«
»Dabei warst du einer der Vordersten und hast gekämpft wie ein Gott!«, sagte Tamage mit einem grimmigen Lachen. »Überlass also nicht mir den ganzen Ruhm.«
»Seid ihr durchgebrochen?«, fragte Manja.
»Wir fegten durch ihre Reihen und trieben sie auseinander wie flüchtende Hasen«, nahm Tamage den Bericht wieder auf, da Sajan bescheiden schwieg. »Asma, der skythische Häuptling, sammelte mit Mühe seine Leute für einen Gegenangriff, aber dann traf Zartir mit unserer Verstärkung ein und überschüttete sie von hinten mit Pfeilen. Es dauerte kaum eine Stunde, bis sie aufgaben und nach Westen flohen.«
»Habt ihr sie verfolgt?«, wollte Manja wissen.
»Das hätte ich gerne getan«, sagte Tamage, »aber diesmal hörte ich auf den Rat meines kleinen Bruders.«
»Wir hatten kaum Verluste, und ich wollte, dass es dabei bleibt«, erklärte Sajan. »Wären wir ihnen bis zu ihrem Lager gefolgt, dann hätten wir nicht mehr so leichtes Spiel gehabt.«
»Sicher hattest du recht«, sagte Tamage seufzend. »Auch wenn es mich in den Fingern juckte, ihren Häuptling zu stellen – er machte sich nämlich als Erster davon.«
»Sind viele Krieger gefallen?«, fragte Gwendike. »Ist jemand dabei, den ich kenne?«
Tamage schüttelte den Kopf. »Nicht dass ich wüsste.«
»Etwa dreißig Männer und Frauen haben wir verloren«, sagte Xorsa, »und Zartir noch einmal so viele. Aufseiten der Skythen aber lagen mehrere Hundert am Boden. Das ist ein großer Sieg – die Skythen werden sich vermutlich nicht so schnell wieder diesseits des Schwarzen Flusses blicken lassen.«
»Das mögen die Götter geben«, seufzte Gwendike und hakte sich fest bei ihrem Ehemann ein.
»Von mir aus dürfen sie ruhig wiederkommen!«, meinte Xorsa übermütig. »Ich habe heute sechs Männer erschlagen, doch ich hätte nichts dagegen, diese Zahl bei nächster Gelegenheit zu verdoppeln.«
»Aber ich!«, sagte Gwendike und blickte ihn beinahe vorwurfsvoll von der Seite an. »Schließlich will ich nicht ständig Angst um dich haben müssen.«
Xorsa lachte und streichelte ihre Schulter. Dann wandte er sich Sajan zu. »Wie viele hast du getötet? Zwanzig? Dreißig?«
Sajan schwieg verlegen.
»Ich habe aufgehört mitzuzählen, als Zartirs Leute eintrafen«, sagte Tamage und schenkte ihrem jüngeren Bruder ein verschmitztes Lächeln.
»Ist Zartir mitgekommen, um mit uns zu feiern?«, fragte Manja.
»Nein, er wollte zu seinem Stamm zurück«, sagte Tamage. »Sie lagern etwa zwei Tagesritte entfernt am Unterlauf des Flusses.«
Inzwischen hatte die Gruppe ihre Wagen erreicht, und sogleich liefen Diener auf sie zu, um die Heimkehrer willkommen zu heißen und ihnen Becher mit Stutenschnaps zu reichen. Bilai, Manjas hübsche Leibdienerin, umarmte Sajan. Manja warf den beiden einen strengen Blick zu, und Sajan schob das Mädchen schuldbewusst ein wenig von sich. Xorsa leerte den Becher, den Gwendikes Dienerin ihm reichte, mit einem Zug. Tamage dagegen lehnte ab.
»Mir ist nicht nach Essen und Trinken«, sagte sie, »nicht einmal nach Ausruhen. Der Sieg war zu leicht … Ich habe einfach noch zu viel Kraft übrig.«
»Dann solltest du vielleicht einen deiner Krieger zu dir rufen«, schlug Sajan grinsend vor.
Tamages Blick ruhte auf ihrem Diener, einem Jungen von vielleicht 16 Jahren, der erst seit Kurzem ihren Haushalt führte.
»Hast du schon einmal bei einer Frau gelegen, Malai?«
Der Junge erbleichte und trat unwillkürlich einen Schritt zurück.
»Keine Angst!«, sagte Tamage, hob eine Hand und strich über die noch bartlose Wange des Jungen. »Ich bin vielleicht eine Königin und viele Jahre älter als du … aber ich bin auch eine Frau. Folge mir!«
Sie erstieg das Trittbrett ihres Wagens, hielt die Eingangsmatte auf und winkte dem Jungen, der ihr schüchtern folgte. Beide verschwanden im Innern der Wohnstätte.
»Sieh mal an!« Sajan pfiff anerkennend durch die Zähne. »Es ist schon lange her, dass meine Schwester zum letzten Mal einen Mann in ihren Wagen geführt hat.«
»Sie schläft mit ihrem Diener?« Xorsa runzelte die Stirn.
»Es ist das Vorrecht der Frauen, ihre Gefährten für die Nacht zu wählen«, sagte Sajan achselzuckend. »Gegen Malai ist nichts einzuwenden; er ist gebürtiger Sarmate und alt genug.«
»Aber wenn sie von ihm schwanger wird?«
Sajan schüttelte den Kopf. »Tamage ist 48 – ihre fruchtbaren Tage sind vorbei.«
Xorsa zuckte die Achseln. »Jedem das Seine.« Er wandte sich Gwendike zu. »Wie fühlst du dich, Liebste? Hast du wieder unter Übelkeit zu leiden?«
Gwendike lächelte verschämt und schüttelte den Kopf. »Ich bin bereit.«
Xorsa legte ihr einen Arm um die Schulter, nickte Sajan und Manja zu und führte seine Ehefrau zum Wagen.
»Willst du dich waschen, Herr?«, fragte Bilai, die Sajan ein Filztuch und eine Schale mit Wasser hinhielt.
»Nicht jetzt, Bilai!«, sagte Manja mit einer Spur von Ungeduld – was ihr sofort leidtat, denn die Dienerin machte ein beleidigtes Gesicht, stellte die Schale auf den Boden und verschwand ohne weitere Worte.
»Du hast sie gekränkt«, stellte Sajan fest.
»Tut mir leid«, sagte Manja schuldbewusst. »Ich habe sie wirklich gern, aber ich will nicht, dass sie zusieht, wie du dich ausziehst. Wahrscheinlich würde sie dir anbieten, dich eigenhändig zu waschen.«
Er grinste. »Eifersüchtig?«
Manja stieß ihn ärgerlich in die Rippen.
»Au!«, rief er, konnte sich jedoch das Lachen nicht verbeißen. »Gnade! Für einen Tag habe ich schon mehr als genug Schläge eingesteckt.«
Sie bestiegen den Wagen, und Sajan beugte sich als Erstes über die Wiege, in der Ariane schlummerte. Sie erwachte nur kurz und begrüßte ihn mit einem halblauten Gurren, um fast sofort wieder einzuschlafen.
»Bist du hungrig?«, fragte Manja, die bemerkte, dass Bilai einen Holzteller mit Hammelfleisch und einen Milchkrug neben dem Feuer abgestellt hatte.
Sajan winkte ab. »Später.« Er legte den Waffengurt ab und blickte an seiner beschmutzten Kleidung herab. In seiner Reithose klaffte ein Riss, womöglich von einem Schwerthieb, und die Ärmel seines Leibrocks waren mit Blut bespritzt. »Bilai hat recht. Ich sollte mich waschen.«
Er ging hinaus, um die Wasserschale zu holen. Als er zurückkehrte, hängte er seinen Bogen an einen Haken über dem Eingang − ein allgemein übliches Zeichen, dass die Bewohner des Wagens nicht gestört zu werden wünschten. Dann legte er seine Kleider ab und wusch sich ausgiebig.
Manja saß beim Feuer und beobachtete ihn. Ihr Herz klopfte spürbar. Es war erregend, ihm zuzusehen, gerade weil er sich ihrer Aufmerksamkeit nicht bewusst war. Sajan war zehn Jahre älter als sie, doch der schönste Mann, den sie kannte. Während er ihr den Rücken zukehrte und sich Wasser über Kopf und Schultern goss, verlor sich Manja in der Betrachtung seiner schlanken Gestalt, rötlich beleuchtet vom Feuerschein. Als er mit Schwung das Haar in den Nacken warf, folgte ihr Blick dem rinnenden Wasser, das sich den Weg zwischen seinen Schulterblättern hinab bahnte, Wirbel für Wirbel abwärts bis in die schattige Schlucht zwischen den kräftigen Schenkeln. Abwesend stellte sie fest, dass er bis auf einige Prellungen, die sich als blaue Hautflecken zeigten, völlig unverletzt schien. Als er sich umwandte, glaubte Manja Spritzer von geronnenem Blut auf seiner Brust zu erkennen, an ebender Stelle, wo sich der Ausschnitt seines Leibrocks geöffnet hatte. Es war nicht sein Blut, sondern stammte von den Männern, die er im Kampf erschlagen hatte. Seltsamerweise erregte der Anblick keinen Abscheu in ihr, sondern überwältigendes Verlangen. Stumm sah sie zu, wie er die Flecken fortwusch, wie rötliches Wasser über seinen Bauch lief, sich einen Moment lang im Nabel sammelte und schließlich über die Lenden hinabperlte.
»Komm zu mir!«, raunte sie, und der Klang ihrer eigenen Stimme erschreckte sie fast, denn sie war rau und zittrig vor Ungeduld.
Sajan ließ die leere Wasserschale sinken und wandte sich ihr zu. Seine braunen Augen glühten im Feuerschein; ihr Ausdruck jedoch war zweifelnd, fast beschämt.
»Ich brauche mehr Wasser«, brachte er zaghaft vor und blickte an sich hinab. »Vielleicht sollte ich zum Fluss gehen und …«
»Das wirst du nicht«, bestimmte Manja, erhob sich und trat auf ihn zu. Entschlossen packte sie ihn bei den Schultern und drückte ihn hinab, sodass er sich im Schneidersitz niederließ. Manja brauchte kaum länger als drei Herzschläge, um ihren Gürtel zu lösen, ihren Leibrock abzustreifen und sich auf seinen Schoß sinken zu lassen. Er keuchte erschrocken; ihre Ungeduld schien ihn zu verstören.
»Ich habe immer noch Blut an mir«, flüsterte er entschuldigend.
Manja verschloss ihm den Mund mit einem Kuss, bevor er weitersprechen konnte, ergriff seine Hände und legte sie auf ihre Hüften.
»Was an mir ist grau?«, fragte sie lächelnd.
Schon seit ihrer Hochzeit neckte sie ihn beständig mit dieser Frage, die er nicht beantworten konnte. Es war eine Art Spiel. Bislang hatte er nie erraten, was sie meinte, sondern stets geglaubt, sie befürchte – wie einst ihre Mutter –, frühzeitig graue Haare zu bekommen.
»Ich weiß nicht, was du meinst«, gab er kopfschüttelnd zu, ergriff eine Strähne ihres pechschwarzen Haars und rieb es zwischen den Fingern. »Du hast kein einziges graues Haar; das versichere ich dir. Wovon sprichst du?«
»Ich verrate es dir nicht«, sagte Manja ernsthaft. »Du musst schon selbst darauf kommen.«
Sie küsste ihn erneut, so lange, bis er seine Zurückhaltung aufgab. Als sie endlich spürte, dass er sich entspannte, löste sie sich von seinen Lippen, umschlang ihn fest mit beiden Armen, blickte zum Rauchloch in der Decke hinauf und überließ sich seiner Führung.
»Ich hatte fast vergessen, wie wundervoll du dich anfühlst«, flüsterte er nah an ihrem Ohr, und sie spürte einen wohligen Schauder. Erstaunt nahm sie wahr, dass er sich ungewöhnlich langsam bewegte, die linke Wange fest gegen ihre rechte geschmiegt, tief atmend wie jemand, der einen berauschenden Geruch in sich aufnimmt.
»Meine wundervolle Geliebte …«
Sie spürte, wie seine Worte ihren Körper durchrieselten und ihre angespannten Schenkel seltsam schwach und weich wurden. Seufzend ergab sie sich dieser Schwäche und ließ sich wiegen. Der Gedanke, dass er eben erst vom Schlachtfeld zurückgekehrt war, würzte jede ihrer Empfindungen mit prickelnder Schärfe. Sein Haar war verklebt, seine Haut von Schweiß bedeckt, und sie glaubte einen schwachen Geruch von Blut wahrzunehmen, eine Witterung des Todes und der Gefahr. Heiß und schwer fühlte sie seine Hände auf ihren Hüften – dieselben Hände, mit denen er noch vor wenigen Stunden eine Klinge geführt, einen Speer geschleudert, Menschen getötet hatte. Als sie spürte, dass sie sich nicht mehr beherrschen konnte, biss sie keuchend die Zähne zusammen, um einen Schrei zu unterdrücken. Ariane, nur wenige Schritte entfernt in ihrer Wiege ruhend, gluckste leise im Schlaf.
Die Beratung
Am folgenden Morgen traf sich die Familie zur Siegesfeier auf dem freien Platz, der von den Wohnwagen umgrenzt wurde. Auch Zartir und Amazuk waren gekommen, die Häuptlinge der verbündeten Stämme, die am Vortag zum siegreichen Ausgang der Schlacht beigetragen hatten. Diener hatten mehrere Teppiche auf dem Gras ausgebreitet, trugen Fleisch von Rind und Hammel in hölzernen Schalen auf und versorgten die Gäste reichlich mit Schnaps aus vergorener Stutenmilch.
Manja war innerlich abwesend, schmiegte sich an Sajans Seite und genoss seine Nähe. An der ausgelassenen Stimmung der Gesellschaft nahm sie kaum Anteil und nippte nur aus Höflichkeit an dem Schnaps, den Bilai ihr reichte. Den Gesprächen lauschte sie nur mit halbem Ohr und beobachtete stattdessen Ariane, die fröhlich zwischen den Gästen umhertollte und mit ihren ungelenken Gehversuchen selbst den greisen Amazuk zum Lachen brachte. Auch Gwendike, die Manja gegenübersaß, beteiligte sich kaum am Gespräch, denn sie hatte alle Hände voll damit zu tun, sich um ihre Kinder zu kümmern. Die zweijährige Budine langweilte sich und weinte, während der vierjährige Aspan immer wieder die Gespräche unterbrach, indem er von einem zum anderen ging und stolz seinen Spielzeugbogen vorzeigte. Zartir, Häuptling der Siraken und zugleich Aspans Großvater, brachte ihn schließlich zur Ruhe, indem er ihn auf seinen Schoß setzte.
»Unser Sieg war leicht«, sagte er, indem er sich der Königin zuwandte, »doch sollten wir uns nicht in Sicherheit wiegen oder in unserer Wachsamkeit nachlassen. Die Skythen könnten die Atempause nutzen, um Pläne zur Vergeltung zu schmieden. Wir sollten beraten.«
»Ja, das sollten wir«, bestätigte Tamage. »Ich will lediglich warten, bis wir vollzählig versammelt sind.«
»Fehlt denn noch jemand?«, fragte Zartir und blickte in die Runde.
Tamage nickte und wies zu dem Wagen, der etwas abseits von den anderen am Rand des Hügels abgestellt war. Eine Dienerin hatte soeben die Matte am Eingang geöffnet, und heraus trat eine Frau, die ein Kleinkind im Arm hielt und mit gemessenen Schritten das Trittbrett hinabstieg. Am Boden angekommen, machte sie eine herrische Kopfbewegung, woraufhin die Dienerin herbeieilte, um ihr das Kind abzunehmen. Ein Mann folgte ihr ins Freie.
»Du hast Byke eingeladen?«, fragte Sajan überrascht, wobei er unwillkürlich seine Stimme dämpfte. Auch die übrigen Anwesenden waren still geworden und warfen einander betretene Blicke zu.
Tamage seufzte. »Natürlich habe ich sie eingeladen. Ihre Mutter und meine waren Halbschwestern. Sie gehört ebenso zur Familie wie du, Sajan, und sie hat ein Recht darauf, an unserer Beratung teilzunehmen.«
Auch Manja hatte sich aufgesetzt und beobachtete, wie Byke sich der Versammlung näherte, in einigen Schritten Abstand von ihrem Ehemann gefolgt. Wie immer spürte sie beim Anblick der hochgewachsenen, blonden Frau mit den leicht verengten blauen Augen eine gewisse Beklemmung. Byke ließ sich nur selten im Freien blicken, und dies nicht nur, weil sie seit Kurzem verheiratet war und im fortgeschrittenen Alter von 40 Jahren noch ein Kind zur Welt gebracht hatte. Es war allgemein bekannt, dass Byke sich in der Erbfolge übergangen fühlte, seit ihre Großmutter einst der Mutter Tamages – einer unehelichen Tochter – die Herrschaft übertragen hatte. Gewöhnlich behandelte Byke nicht nur Tamage, sondern alle Mitglieder der königlichen Familie mit kühler Missachtung, weigerte sich, gemeinsam mit ihnen zu essen, und ließ ihren Wagen stets in einiger Entfernung zu den anderen abstellen.
»Ich heiße dich willkommen, Cousine«, sagte Tamage freundlich, als Byke den Versammlungsplatz erreicht hatte, »und auch dich, Boya.«
Letzterer Gruß galt Bykes Ehemann. Sein Anblick verstörte Manja wie stets, wenn sie ihm begegnete. Boya hatte auffallende Ähnlichkeit mit Sajan: das gleiche rotbraune Haar, der gleichfarbige Bart, sogar ähnliche Gesichtszüge. Während jedoch Sajan der jüngere Bruder der Königin war, handelte es sich bei Boya um einen Mann aus dem einfachen Volk, der noch dazu von schwachem Geist war.
Byke kam der Aufforderung ihrer Cousine nicht sofort nach, sondern blieb stehen und ließ den Blick in die Runde schweifen. Ihre kalten blauen Augen verweilten kurz auf Sajan, dann – wie Manja bereits geahnt hatte – auf ihr.
»Wenn ich mich nicht irre, ist die Beratung von Stammesangelegenheiten den Edlen vorbehalten«, sagte Byke mit klarer Stimme, die trotz scheinbarer Ruhe einen drohenden Unterton verriet.
Die Versammelten tauschten ratlose Blicke.
»Stört dich jemand in unserer Runde, liebe Cousine?«, fragte Tamage.
Byke fasste erneut Manja ins Auge, die ahnte, worauf ihre Feindin hinauswollte.
»Die Ehefrau deines Bruders ist anwesend«, stellte Byke fest. »Willst du mir das erklären, Tamage?«
»Ich bitte dich«, erwiderte Tamage, die sich noch immer um Höflichkeit bemühte. »Sajan ist mein Bruder, und selbstverständlich habe ich auch Manjane zu unserer Beratung geladen.«
Manja senkte den Blick, während sie zugleich fühlte, dass Sajan ihr beruhigend über den Rücken strich. Es war offenkundig, worauf Byke anspielte: Manja war keine gebürtige Sarmatin, sondern ein Findelkind und Tamages Ziehtochter. Schon immer war dies ein Streitpunkt gewesen, da Byke sich als Blutsverwandte der Königin zurückgesetzt fühlte, während Manja, die Fremde, bereitwillig in die Familie aufgenommen worden war.
»Willst du dich nicht setzen?«, bat Tamage.
Byke musterte ihre Cousine kühl, während Boya einfältig grinste – vermutlich hatte er gar nicht begriffen, worüber die Frauen stritten. Endlich folgte Byke der Aufforderung und ließ sich nieder, in einigem Abstand zu den Übrigen. Für den Augenblick schien der Streit beendet, doch Manja ermaß an der wachsamen Stille der Versammlung, dass jeder ein erneutes Aufflammen der Feindseligkeiten fürchtete. Als schließlich Zartir den Faden wieder aufnahm, wirkten alle erleichtert.
»Wir wollten darüber sprechen, wie wir einem erneuten Angriff der Skythen begegnen können«, sagte der Häuptling an Tamage gewandt. »Wenn ich dich richtig verstanden habe, stimmen wir darin überein, dass unser Sieg uns nicht blind für die Gefahr machen darf. Die Skythen werden Vergeltung suchen.«
Tamage nickte ernst. »Der Krieg dauert nun schon viele Jahre an, und ich bin überzeugt, dass es den Skythen nicht allein um Weideplätze für ihre Herden geht. Sie wollen uns vernichten. Ihr Reich im Westen erstreckt sich inzwischen bis zum Schwarzen Meer, und im Süden bedrängen sie die Assyrer und Meder. Sie sind das mächtigste Volk der Steppe – allein uns fürchten sie als eine Gefahr an ihrer Ostgrenze. Vermutlich sind wir das einzige Volk, das ihnen dauerhaft Widerstand leisten kann, weil wir nicht in festen Häusern und Siedlungen leben, die man niederbrennen könnte. Stattdessen ziehen wir, wie die Skythen selbst, mit unseren Herden von einem Ort zum anderen und kämpfen zu Pferd.«
»Ich habe nie verstanden, warum die Skythen eigentlich unsere Feinde geworden sind«, meldete sich einer der Krieger aus Zartirs Gefolge zu Wort, »da doch ihre Lebensweise der unseren so ähnlich ist. Es heißt, dass sie sogar die gleichen Götter anbeten wie wir.«
»Das ist richtig«, antwortete Xorsa, Gwendikes Ehemann. »Dennoch gibt es einen wesentlichen Unterschied: Die Skythen glauben, dass der Himmelsgott Papai allein den Männern gestattet, zu kämpfen, zu herrschen und die Geschicke ihres Volkes zu lenken. Ihre Frauen betrachten sie als persönliches Eigentum, ganz wie das Vieh, und verbannen sie zur Pflege der Kinder in ihre Wagen. Keine Frau darf ein Pferd besteigen, nicht einmal zur Jagd. Auch ihre Tracht ist nicht dieselbe wie die der Männer, denn sie tragen keine Hosen. Die Häuptlinge der Skythen nennen sogar mehrere Frauen ihr Eigen, und wenn ein Häuptling stirbt, müssen sie ihm ins Grab folgen.«
»Ist das wirklich wahr?«, fragte der Gefolgsmann Zartirs ungläubig.
»Es ist wahr«, bestätigte Tamage. »Wir dagegen haben seit jeher unsere jungen Frauen zu Kriegerinnen ausgebildet und im Kampf mit Bogen und Axt geschult. Die Skythen halten dies für eine Lästerung der Götter. Sie nennen unsere Kriegerinnen Oiorpata, was Männertöter bedeutet.«
»Jedenfalls«, kam Zartir auf sein Anliegen zurück, »dürfen wir nicht damit rechnen, dass die Skythen sich nach der gestrigen Niederlage geschlagen geben. Sie werden frische Kräfte sammeln und Pläne schmieden. Was sollen wir tun, um einem erneuten Angriff begegnen zu können?«
Tamage nahm einen langen Zug aus ihrem Kelch.
»Ich habe darüber nachgedacht«, sagte sie. »Zunächst einmal sollten wir möglichst bald unseren Lagerplatz räumen. Der Herbst naht, und es ist ohnehin an der Zeit, dass wir uns auf den Weg ins Winterlager machen. Zuvor jedoch werde ich Gesandtschaften ausschicken und versuchen, benachbarte Völker für ein Bündnis zu gewinnen.«
»An welche Völker hast du dabei gedacht?«, fragte Zartir.
»Vor allem an die Massageten, die in den Oasen südlich des Achsensees leben. Ich habe gehört, dass sie unsere Lebensweise teilen und ebenfalls von einer Königin angeführt werden. Gewiss haben auch sie bereits unter den Übergriffen der Skythen zu leiden gehabt, und vielleicht sind sie bereit, uns zu unterstützen. Auch zu den Orgimpaiern, die im Osten am Fuß der Himmelsberge wohnen, werde ich Boten senden.«
Zartir nickte anerkennend. »Das ist ein guter Plan. Mit der Unterstützung der Massageten sollte es uns leichtfallen, die Skythen abzuwehren.«
»Die Orgimpaier allerdings«, gab der greise Häuptling Amazuk zu bedenken, »wirst du nicht für ein Bündnis gewinnen können. Sie sind ein friedliebendes Volk, besitzen keinerlei Waffen und glauben, dass Krieg dem Heil der Seele schadet.«
Tamage seufzte. »Das wusste ich nicht. Dennoch werde ich es versuchen; schließlich betrifft die Bedrohung durch die Skythen alle Völker.«
»Ich könnte einen Boten zu den Orgimpaiern senden«, erbot sich Zartir. »Das Lager meines Stammes liegt derzeit am weitesten im Osten, und ich verfüge über Männer, die den Weg kennen.«
»Ich danke dir, Zartir«, sagte Tamage befriedigt.
»Und wen schicken wir zu den Massageten?«, meldete sich Xorsa zu Wort. »Es heißt, sie seien wandernde Rinderhirten, und der Weg zur Südseite des Achensees ist lang. Es wird nicht einfach sein, sie zu finden. Ein Bote müsste eine wochenlange Reise durch unbekanntes Gebiet auf sich nehmen.«
»Darüber habe ich mir bereits Gedanken gemacht«, sagte Tamage. Sie suchte Bykes Blick. »Liebe Cousine, dein Großvater entstammte dem Volk der Iyrker, die einst durch freundschaftliche Beziehungen mit den Massageten verbunden waren.« Sie machte eine Pause, und es war deutlich zu erkennen, dass sie ihre Worte vorsichtig wählte. »Glaubst du, du wärest in der Lage, in den Süden zu reisen, die Massageten zu finden und ihrer Königin meine Bitte anzutragen?«
Aller Augen richteten sich auf Byke, die keine Regung erkennen ließ. Es schien, als wöge sie sorgfältig ab, ob sie ihrer Verwandten diesen Gefallen tun sollte.
»Gut«, sagte sie schließlich zum allgemeinen Erstaunen. »Ich werde gehen.«
Tamage, die offenbar nicht mit ihrer Bereitschaft gerechnet hatte, hob erfreut die Augenbrauen. »Ich werde dir fünfzig Reiter als Geleitschutz mitgeben«, beeilte sie sich zu versichern, »und Vorräte für mehrere Wochen.«
Byke winkte ab. »Eine Reitertruppe dieser Größe erregt zu viel Aufsehen. Ich nehme nur zwei meiner treuesten Krieger und einige Packpferde mit. Wir werden geradenwegs nach Südwesten reiten, den Achsensee umrunden und den Karawanenstraßen von einer Oase zur nächsten folgen, bis wir die Massageten gefunden haben.«
»Wärst du denn bereit«, setzte Tamage vorsichtig an, »schon in Kürze aufzubrechen?«
Byke zuckte die Achseln. »Gleich morgen, wenn du willst.«
Tamage schien gerührt. »Du erweist mir damit einen großen Dienst, liebe Cousine!«, sagte sie ernsthaft. »Sei meiner Dankbarkeit und der unseres gesamten Volkes versichert. Ich werde es dir nicht vergessen.«
Byke erwiderte die Freundlichkeit lediglich mit einem knappen Kopfnicken.
»Bestens!«, rief Zartir und erhob seinen Kelch. »Und nun wollen wir feiern! Bei aller Sorge um die Zukunft wollen wir nicht vergessen, dass wir einen bedeutenden Sieg errungen haben.«
»So sei es!«, bestätigte Tamage, und die gesamte Runde erhob ihre Trinkgefäße.
Die Feier dauerte bis weit in den Nachmittag. Erst als die Sonne sich rötete, brachen Zartir und Amazuk auf, um ins Lager ihrer Stämme zurückzukehren. Tamage verabschiedete sie mit Wärme und dankte ihnen für ihr Kommen. Dann zog sich auch Byke zurück, um Vorbereitungen für ihren Aufbruch am nächsten Morgen zu treffen. So blieben am Ende nur die engsten Angehörigen der Familie auf dem Festplatz zurück: Tamage, Gwendike und Xorsa, Sajan und Manja.
Während Manja ihren Leibrock aufschlug, um Ariane an die Brust zu legen, wandte sich Sajan an die Königin.
»Ist es wirklich eine gute Idee, ausgerechnet Byke zu den Massageten zu schicken?«, fragte er. »Du weißt sehr wohl, dass sie dir die Königswürde missgönnt. Glaubst du nicht, sie könnte diesen Auftrag nutzen, um Ränke in eigener Sache zu spinnen?«
Tamage schürzte die Lippen. »Was könnte sie denn tun?«
»Nun ja …« Sajan blickte nachdenklich vor sich hin. »Angenommen, sie erzählt den Massageten eine ganz andere Geschichte: zum Beispiel, dass sie die rechtmäßige Königin sei, und dass du sie vertrieben hast. Statt um ein Bündnis zu ersuchen, stachelt sie die Massageten womöglich zum Krieg gegen uns auf.«
»Du bist nicht bei Sinnen, Sajan!«, beschied ihm Tamage mit einer Spur von Ärger. »Ich weiß, Byke liebt mich nicht, doch würde sie niemals ihr Volk verraten und wissentlich ins Unglück stürzen.«
»Aber sie hat ihren Auftrag erstaunlich bereitwillig angenommen«, bemerkte Xorsa, der Sajan gegenübersaß. »Ich muss gestehen: Auch mir kam der Gedanke, dass diese Reise zu irgendwelchen geheimen Absichten passen könnte, die sie hegt.«
»Ich gebe zu: Gewiss wollte sie mir nicht nur einen Gefallen tun«, lenkte Tamage ein. »Wahrscheinlich hofft sie, dass es ihren Einfluss im Rat der Stämme vergrößert, wenn durch ihre Vermittlung ein Bündnis mit den Massageten zustande kommt. Außerdem versichert sie sich auf diese Weise meiner Dankbarkeit. Vermutlich genießt sie die Vorstellung, dass ich ihr etwas schuldig bin.«
»Ich nehme an, sie hofft immer noch, dass du sie eines Tages als deine Nachfolgerin benennst«, sagte Sajan.
Tamage schüttelte den Kopf. »Das kann sie nicht ernsthaft erwarten. Byke ist kaum zehn Jahre jünger als ich, und meine Nachfolgerin muss eine junge Frau sein, die in der Blüte ihres Lebens steht.«
Bei diesen Worten merkte Gwendike auf, die es Manja gleichgetan hatte und ihre Jüngste stillte.
»Mutter«, sagte sie mit einem flehentlichen Ausdruck in der Stimme, »du weißt doch, dass ich …«
»Beruhige dich«, sagte Tamage ernst. »Ich weiß, dass du für diese Aufgabe nicht infrage kommst. Zwar habe ich mich nur schwer damit abfinden können, dass meine einzige leibliche Tochter mir die Nachfolge verweigert …«
Gwendike zuckte zusammen, als hätte man ihr einen Schlag versetzt. Ihre Augen füllten sich mit Tränen.
»Nichts würde ich dir verweigern, liebe Mutter!«, beteuerte sie mit bebender Stimme. »Doch sieh selbst: Bin ich dafür geschaffen, zu reiten, zu kämpfen und die Geschicke unseres Volkes zu lenken?« Sie schluchzte, biss sich auf die Unterlippe und bemühte sich um Fassung. »Ich bin ein schwaches Geschöpf, und ich schäme mich dafür … ich weiß, dass du eine bessere Tochter verdient hättest.«
Xorsa legte tröstend einen Arm um sie. Budine, die an Gwendikes Brust lag, spürte die Erregung ihrer Mutter und begann, leise vor sich hin zu wimmern.
»Was redest du für einen Unsinn!«, wehrte Tamage unwirsch ab. Vermutlich sollte es ärgerlich klingen, doch auch ihr war die Rührung anzumerken. Als Gwendike nicht aufhören konnte zu weinen, stand Tamage auf, setzte sich ihrer Tochter zur Seite und zog sie an sich.
»Gwendike«, sagte sie mit ungewohnter Zärtlichkeit, »bitte verzeih meine harten Worte.«
»Ich bin, wie ich bin«, flüsterte Gwendike. »Und ich habe es mir nicht ausgesucht, Mutter!«
»Das weiß ich«, sagte Tamage. »Du erinnerst mich oft an deinen Vater. Von ihm hast du nicht nur deine Schönheit und dein dunkles Haar, sondern auch deine Empfindsamkeit. Umso mehr liebe ich dich.«
Gwendike schluckte und brachte vor Bewegung kein Wort hervor.
»Du sagtest einmal, dein einziger Wunsch sei, in Frieden mit deinem Ehemann zu leben und deine Kinder aufwachsen zu sehen.«
Gwendike nickte. »Ich bin keine Kriegerin, Mutter − weder mit Worten noch mit Waffen, weder im Rat noch auf dem Schlachtfeld.«
»Mach dir keine Sorgen«, sagte Tamage. »Ich habe bereits eine andere Regelung für meine Nachfolge getroffen.«
Gwendike hob den Kopf, und auch Xorsa und Sajan blickten die Königin erstaunt an.
»Was für eine Regelung?«, fragte Sajan.
Doch Tamage winkte ab. »Die Sitte verlangt, dass ich meine Entscheidung nur dem Hohepriester anvertraue. Bis zu meinem Tod wird Bazukan dieses Geheimnis bewahren. Und im Übrigen muss auch der Rat der Stämme zustimmen; es ist also keineswegs sicher, dass meinem Wunsch entsprochen wird.«
Manja fühlte bei diesen Worten einen leichten Stich in der Herzgegend, während eine ungebetene Stimme in ihrem Geist fragte: Spricht sie etwa von mir?
Sie wusste seit Langem, dass Tamage sie wie eine zweite Tochter liebte, wenngleich sie es nie offen gezeigt oder gar ausgesprochen hatte. Gewöhnlich verlor die stolze alte Kriegerin nicht viele Worte − schon gar nicht über ihre Gefühle −, doch Manja hatte gelernt, in ihrem Gesicht zu lesen. Zudem hatte Sajan schon häufig angedeutet, dass die Königin ihre Ziehtochter höher schätzte als viele ihrer treuesten Gefolgsleute.
Doch Manja war eine Fremde, keine gebürtige Sarmatin, sondern eine Bauerntochter aus den nördlichen Wäldern. Es schien ihr undenkbar, dass die Versammlung der Häuptlinge zustimmen würde, falls Tamage sie zu ihrer Nachfolgerin erwählte. Die Königin musste dies wissen − und dieser Gedanke beruhigte Manja, denn bei der Vorstellung, Tamages Platz einzunehmen und das Volk führen zu müssen, kam sie sich klein und verloren vor wie ein ausgesetztes Kind. Sie hoffte inbrünstig, dass ihr Verdacht unzutreffend war. Vielleicht hatte Tamage gar nicht sie gemeint, sondern Sajan oder Xorsa. Zwar wurden die Sarmaten nach altem Herkommen stets von einer Frau angeführt, doch womöglich plante Tamage, mit dieser Tradition zu brechen.
»Reden wir nicht mehr davon!«, entschied die Königin unvermittelt. »All dies ist erst von Bedeutung, wenn ich sterbe – und ich hoffe, dass ich noch einige Jahre auf dieser Welt zubringen darf.«
»Das hoffe ich auch, liebe Mutter«, sagte Gwendike und küsste sie auf die Wange.
»Deine Tochter schläft bereits«, bemerkte Tamage und wies auf die kleine Budine, die an Gwendikes Brust eingeschlummert war. »Und auch du siehst müde aus. Vielleicht solltest du dich zurückziehen.«
Sie tauschte einen Blick mit Xorsa, der nickte und Gwendike sanft beim Arm ergriff.
Beide verabschiedeten sich und gingen zu ihrem Wagen, wobei Xorsa kurz anhielt, um Aspan herbeizurufen, der am Rand des Hügels mit seinem Bogen spielte. Auch Tamage erhob sich.
»Eine gute Nacht euch beiden!«, wünschte sie Sajan und Manja. »Bleibt nicht mehr zu lange hier draußen; die Nächte sind bereits herbstlich, und Ariane könnte sich erkälten.«