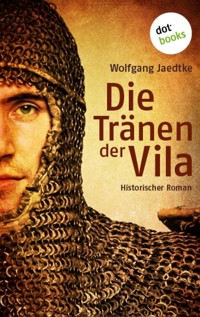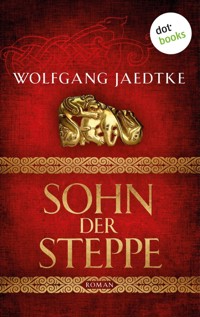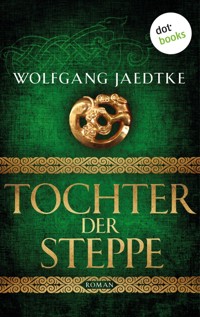
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Steppenwind-Saga
- Sprache: Deutsch
In Schande geboren – zu Großem bestimmt: "Tochter der Steppe", der zweite Roman der Steppenwind-Saga von Wolfgang Jaedtke, als eBook bei dotbooks. Der Schock sitzt tief: Die bei friedlichen Bauern aufgewachsene Manja ist noch ein Kind, als sie erfährt, wer ihr Vater war – ein Anführer der Skythen, der erklärten Feinde aller sesshaften Menschen! Wenig später entkommt Manja nur knapp einem Angriff des mörderischen Reitervolks und wird von Kämpfern der Sarmaten gerettet. Bei ihnen herrschen nicht die Männer, sondern die Frauen; bei ihnen ist es möglich, dass das mutige Mädchen zu einer Kriegerin heranwächst, wie es vor ihr keine andere gegeben hat. Aber ist Manja auch gewappnet gegen eine Intrige, die sich wie eine unsichtbare Schlinge um ihre Kehle legt? In Wolfgang Jaedtkes großer Trilogie erwachen das siebte Jahrhundert vor Christus und die antiken Völker zu neuem Leben, die als Amazonen und Zentauren in die Geschichte eingehen sollten – ein fesselndes Lesevergnügen über das Zusammenprallen von Matriarchat und Patriarchat voller Abenteuer, Sitten und Bräuche, die uns heute ebenso schaudern lassen wie faszinieren. Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Tochter der Steppe", der zweite Band der Steppenwind-Saga von Wolfgang Jaedtke – ein kraftvoller historischer Roman für alle Fans der Uhtred-Serie von Bernard Cornwell. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 558
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Der Schock sitzt tief: Die bei friedlichen Bauern aufgewachsene Manja ist noch ein Kind, als sie erfährt, wer ihr Vater war – ein Anführer der Skythen, der erklärten Feinde aller sesshaften Menschen! Wenig später entkommt Manja nur knapp einem Angriff des mörderischen Reitervolks und wird von Kämpfern der Sarmaten gerettet. Bei ihnen herrschen nicht die Männer, sondern die Frauen; bei ihnen ist es möglich, dass das mutige Mädchen zu einer Kriegerin heranwächst, wie es vor ihr keine andere gegeben hat. Aber ist Manja auch gewappnet gegen eine Intrige, die sich wie eine unsichtbare Schlinge um ihre Kehle legt?
In Wolfgang Jaedtkes großer Trilogie erwachen das siebte Jahrhundert vor Christus und die antiken Völker zu neuem Leben, die als Amazonen und Zentauren in die Geschichte eingehen sollten – ein fesselndes Lesevergnügen über das Zusammenprallen von Matriarchat und Patriarchat voller Abenteuer, Sitten und Bräuche, die uns heute ebenso schaudern lassen wie faszinieren.
Über den Autor:
Wolfgang Jaedtke, geboren 1967 in Lüneburg, studierte Historische Musikwissenschaft und promovierte mit einer Arbeit über Beethoven. Danach arbeitete er für ein Theater, bevor er sich als Schriftsteller selbstständig machte und seitdem unter seinem eigenen Namen und einem Pseudonym historische Romane und Thriller veröffentlicht.
Bei dotbooks veröffentliche Wolfgang Jaedtke bereits den historischen Roman »Die Tränen der Vila« und die »Steppenwind«-Trilogie mit den Einzelbänden »Sohn der Steppe«, »Tochter der Steppe« und »Herrin der Steppe«.
***
eBook-Neuausgabe Februar 2018
Copyright © der Originalausgabe 2009 Piper Verlag GmbH, München
Copyright © der Neuausgabe 2017 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design, München
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)
ISBN 978-3-95824-519-8
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »NN« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Wolfgang Jaedtke
Tochter der Steppe
Die Steppenwind-Saga – Zweiter Roman
dotbooks.
Erster Teil DIE WÖLFIN
Russland, um 700 vor Christus
Auf der Weide
»Sei artig, sonst holt dich der Wolfsmann!«, sagte Tante Durka.
Diese Drohung hörte Manja nur selten, und sie erlaubte Rückschlüsse auf die Schwere ihres Vergehens. Gewöhnlich drohte Tante Durka, die in Wahrheit gar nicht ihre Tante war, nur mit den Dorfältesten. Vor den Ältesten hatte Manja keine Angst, denn sie wusste, dass ihre Mutter sie beschützen würde. Außerdem hatte Durka diese Drohung noch nie wahr gemacht. Dass ein zwölfjähriges Mädchen beim Ziegenhüten auf der Weide eingeschlafen war oder einen Tonkrug zerbrochen hatte, war nicht wichtig genug, um die weisen Männer zu behelligen.
Der Wolfsmann war erst an der Reihe, wenn Manja ungehorsam war – zum Beispiel, wenn sie im Garten stand und den Himmel betrachtete, statt sich im Haus nützlich zu machen. Diese Drohung empfand Manja als besonders schlimm, auch wenn sie nicht recht glauben wollte, dass sich ein behaartes Untier aus den Wäldern, halb Mensch, halb Wolf, um die Sünden von Kindern kümmerte.
»Zieh deinen Kittel an!«, wiederholte Tante Durka, die Manja soeben auf dem Weg zur Weide angehalten hatte, wo sie die Ziege melken wollte. »Sonst holt dich der Wolfsmann.«
Manja zögerte und forschte in Durkas strengem Gesicht, denn sie verstand den Sinn dieser Anordnung nicht. Wenn sie Milch verschüttete oder das Feuer ausgehen ließ, konnte sie verstehen, dass sie getadelt wurde, denn die Milch wollten sie trinken, und das Feuer hielt warm. Warum aber sollte ein zwölfjähriges Mädchen nicht mit nacktem Oberkörper vor die Tür gehen, wenn draußen die Sonne schien? Schließlich war es ein schöner Frühlingsnachmittag und warm für die Jahreszeit.
»Mir ist nicht kalt«, sagte sie trotzig.
Tante Durka starrte mit unbewegtem Gesicht auf sie herab. Dann, so plötzlich, dass Manja nicht zurückweichen konnte, holte sie blitzschnell aus und versetzte ihr eine schallende Ohrfeige.
Manja weinte nicht. Gegenüber Tante Durka zeigte man besser keine Schwäche. So biss sie nur die Zähne zusammen, während ihr das Blut ins Gesicht schoss.
»Du bist kein Kind mehr«, sagte Tante Durka scharf. »Also los jetzt!«
Manja gehorchte, innerlich zornbebend, doch ruhig. Langsam zog sie den leinenen Leibrock an, den sie wie einen Schurz um ihre Hüften geknotet hatte. Folgsam steckte sie die Hände in die Ärmel, zog den Kragen über die Schultern und schloss den dreieckigen Ausschnitt. Als der Stoff sie vom Hals bis zu den Knöcheln bedeckte, drehte sie sich um, nahm den tönernen Melkkübel wieder auf und ging in Richtung der Ziegenweide davon.
Der Weg führte über eine kleine Anhöhe, von der aus man das gesamte Dorf überblicken konnte. Es lag auf einer weiten Lichtung inmitten der umgebenden Wälder und bestand aus niedrigen, fensterlosen Häusern, deren schwere Binsendächer fast bis zum Boden reichten. Die aus Bruchsteinen und Lehm getürmten Kamine sandten schmale Rauchsäulen in den wolkenlosen Himmel. Jedes Haus war von einem Gemüsegarten mit hüfthohen Weidenzäunen umgeben. Rund um die bebaute Fläche verlief ein Erdwall, der das kleine Dorf vollständig umschloss. Draußen vor dem Wall lagen die Ackerfelder, gerodete Flächen, auf denen Gerste, Hirse und Weizen wuchsen. Dahinter begann der Wald, eine dunkle Wand aus Tannen und Fichten, die sich bis zum Horizont erstreckte.
Manja ahnte, dass Tante Durka ihr nachblickte, und hielt sich bewusst aufrecht. Sie war froh, als sie die Anhöhe überquert hatte und die sandige Terrasse zu den Weiden hinabstieg, denn nun war sie sicher, aus Durkas Gesichtsfeld verschwunden zu sein.
Sie ist eine Plage, dachte Manja, während sie verdrossen weiterstapfte. Eine Heimsuchung. Eine Strafe der Götter.
Natürlich hätte sie nie gewagt, eine derartige Lästerung laut auszusprechen. »Tante« Durka war die Ehefrau ihres Nachbarn Korzak, der Manjas Mutter oft bei schweren Arbeiten zur Hand ging: Er hackte Holz für sie, hielt die Zäune instand und nahm, wenn es notwendig war, Ausbesserungen am Haus vor. Korzak war ruhig und freundlich, sowohl zu Manja als auch zu ihrer Mutter. Durka allerdings beäugte die vielen Hilfsdienste ihres Gatten für die verwitwete Nachbarin mit Argwohn. Vielleicht hatte sie nicht einmal ganz unrecht, wenn sie sich selbst – eine schwergewichtige, von Pockennarben entstellte Bäuerin in vorgerücktem Alter – mit Manjas Mutter verglich, die trotz ihrer achtunddreißig Jahre eine schöne Frau war.
Es gab noch einen anderen Grund, warum Durka Manjas Mutter nicht mochte: Sie war vor Jahren als Fremde ins Dorf gekommen, und niemand wusste genau, wo sie vorher gelebt hatte. Die Ältesten hatten der jungen Mutter ein Haus ganz am Rand des Dorfes zur Verfügung gestellt, das früher einmal ein Stall gewesen war. Korzak hatte tatkräftig mitgeholfen, es bewohnbar zu machen, die Wände auszubessern, das Dach zu decken und sogar einen Verschlag für die Gänse zu zimmern.
Für Manja lagen diese Dinge in einer so weit entfernten Vergangenheit, dass sie nur selten daran dachte. Sie lebte hier, solange sie denken konnte, und nur, wenn sie zum Dorfplatz ging, um Wasser vom Brunnen zu holen, erinnerten sie die Blicke der anderen Kinder zuweilen daran, dass ihre Familie nicht alteingesessen war. Doch die anderen Kinder waren ihr gleichgültig – solange nur Vilufar zu ihr hielt, Durkas jüngster Sohn, mit dem sie schon vor Jahren Freundschaft geschlossen hatte.
Vilufar erwartete sie am Rand der kleinen Weide, die sich Manjas Mutter mit ihren Nachbarn teilte. Er saß wie üblich auf dem Zaun, eine Gerte in der Hand, und winkte schon von Weitem. Manja vergaß Tante Durka, als sie sah, wie er sich ins Gras herabgleiten ließ und auf sie zu kam.
»Gruß, Schwester.« Er küsste sie auf die Wange.
Manja lächelte und stellte ihren Melkkübel ab. Sie liebte es, wenn er sie »Schwester« nannte – ebenso sehr wie sie es verabscheute, seine Mutter mit »Tante« anzureden.
»Was hast du denn eben so grimmig geschaut?«
Manja verzog den Mund.
»Deine Mutter«, sagte sie. »Sie hat mich getadelt, weil ich meinen Kittel nicht angezogen hatte.«
Vilufar grinste. Ihm gegenüber konnte Manja ehrlich sein; das wusste sie. Auch er stand mit seiner Mutter nicht auf bestem Fuße und mied sie, so oft seine Pflichten es ihm erlaubten.
»Wo es doch so warm ist …« Manja ging hinüber zu der Ziege, die ihrer Mutter gehörte, und klopfte ihr den Hals. Das Tier meckerte leise und erwiderte die Zärtlichkeit mit einem Stubser seines bärtigen Mauls.
»Hier sieht sie dich ja nicht«, sagte Vilufar, der ihr gefolgt war und müßig die Gerte über das Gras fahren ließ.
Manja blickte ihn an und bemerkte sein schelmisches Lächeln.
»Stimmt«, sagte sie, fasste ihren Leibrock beim Kragen, zog ihn von den Schultern und warf ihn ins Gras. Dann schob sie den Kübel unter die Zitzen der Ziege und begann sie mit sparsamen, geübten Bewegungen zu melken. Vilufar sah ihr zu – und wenn Manja sich nicht sehr irrte, lagen seine Augen eher auf ihrem nackten Rücken als auf dem Tier.
Vilufar war dreizehn Jahre alt und ein Ebenbild seines Vaters, kräftig und groß für sein Alter. Für Manja, die ein Jahr jünger war, hatte er immer ein wenig die Rolle des großen Bruders verkörpert. Schon als kleine Kinder hatten sie zusammen gespielt und fast jede freie Stunde gemeinsam verbracht. Seit beide alt genug waren, um ihren Eltern zur Hand zu gehen, richteten sie es gewöhnlich so ein, dass sie sich auf der Weide oder beim Brunnen trafen. Zur Zeit hatte Vilufar nicht viel mehr zu tun, als die fünf Ziegen seines Vaters zu beaufsichtigen, denn das Korn war noch nicht reif zum Ernten, und um die Gemüsebeete kümmerte sich Durka selbst, da sie der Meinung war, ihr Junge habe kein Gefühl für den Umgang mit Schwarzwurzeln, Rüben und Feldsalat. Manja war dies nur recht, denn es bedeutete, dass sie sich täglich trafen.
»So. Das genügt.«
Sie stellte den gefüllten Milchkübel beiseite und sah, dass Vilufar es sich auf ihrem Leibrock bequem gemacht hatte, der ausgebreitet wie eine Decke im Gras lag.
»Komm, Schwester! Leg dich zu mir.«
Sie zögerte. Früher hatte sie oft an seiner Seite im Gras gelegen und in den Himmel geschaut, doch seit sich beide dem Erwachsenenalter näherten, war diese kindliche Unbefangenheit in eine gewisse Scheu umgeschlagen.
»Na gut«, sagte Vilufar grinsend. »Dann bekommst du eben ein eigenes Lager.«
Umstandslos zog er seinen eigenen Leibrock über den Kopf, breitete ihn im Gras neben sich aus und klopfte mit der flachen Hand darauf.
Manja musste lächeln, und angesichts seiner Offenherzigkeit nahm sie das Angebot an und ließ sich rücklings an seiner Seite nieder.
»Was gibt es Neues im Dorf?«, fragte sie wie üblich. Da sie ganz am Rand der Siedlung wohnte und ihre Mutter außer den nächsten Nachbarn keine Freunde hatte, bezog sie ihre Neuigkeiten zumeist von ihm: Seine Familie war alteingesessen, und er kannte viele gleichaltrige Jungen, darunter auch Söhne der Dorfältesten.
»Ach, nicht viel Neues«, sagte Vilufar, der gleich ihr in den wolkenlosen Himmel hinaufblickte. »Das Korn gedeiht, und die Ältesten sind zufrieden. Das Wetter ist gut, und weit und breit hat niemand Pferdemenschen gesehen.«
Manja schauderte. Die wilden Pferdemenschen waren eine Bedrohung, die sie mehr ängstigte als der Wolfsmann. Jenes Ungeheuer aus den Wäldern hatte noch kein lebender Mensch zu Gesicht bekommen; dass jedoch grausame Menschen die Länder im Westen verheerten, war allgemein bekannt. Es hieß, dass sie Verstoßene seien, die einst in die Weiten der Steppe hinausgezogen waren, um sich mit wilden Pferden zu paaren. Manja wusste, dass ihre eigene Mutter auf der Flucht vor den Pferdemenschen hierhergelangt war, auch wenn sie nie darüber sprach und Manja klug genug war, nicht zu fragen. Lediglich Gerüchte waren ihr zu Ohren gekommen, manchmal von Vilufar, manchmal aus Bemerkungen seiner Eltern.
»Stimmt es, dass sie mit ihren Pferden zusammengewachsen sind?«, fragte sie beklommen.
»Mein Onkel Balba sagt Nein«, meinte Vilufar. »Er hat Verwandte in einem Dorf im Westen, und die haben einmal von Weitem Pferdemenschen gesehen, wie sie durch die Steppe zogen. Sie reiten auf ihren Pferden und steigen niemals von ihnen ab, nur um zu schlafen und zu essen.«
Dies beruhigte Manja ein wenig, denn sie hatte bereits begonnen, sich die Fremden in derselben Art vorzustellen wie den Wolfsmann: als schaurige Halbwesen, aus deren menschlichen Körpern Pferdehufe wuchsen. Freilich war die Vorstellung, dass diese Menschen auf Pferden ritten, kaum weniger erschreckend. Im Dorf gab es nur kleine, gedrungene Tarpane, die zum Ziehen von Wagen und als Milchtiere dienten, und niemand hatte je den Rücken eines Pferdes erstiegen, um sich von ihm tragen zu lassen.
»Aber es stimmt, dass sie Bauerndörfer überfallen«, fuhr Vilufar fort. »Das sagt jedenfalls Balba. Sie töten alle Menschen, auch die Frauen und sogar das Vieh, und die Häuser und Kornfelder stecken sie in Brand. Es heißt auch, dass sie ihren Feinden die Kopfhäute samt dem Haar abschneiden und sie an ihren Pferden aufhängen. Die Kinder nehmen sie als Sklaven. Einige opfern sie ihren Göttern; andere lassen sie leben, damit sie ihnen das Essen zubereiten und ihre Kleider nähen.«
Erneut schauderte Manja – falls er es darauf anlegte, sie zu gruseln, hatte er gute Arbeit geleistet.
»Sich selbst nennen sie Skythen. Unsere Ältesten sagen, dass sie eine Plage sind, die von den Göttern gesandt wurde«, erzählte Vilufar. »Wie die Heuschrecken oder die Stechmücken im Herbst.«
Er wandte sich Manja zu und bemerkte ihren unbehaglichen Gesichtsausdruck.
»Aber unser Dorf liegt gut geschützt im Wald«, sagte er schließlich, offenbar in dem Bedürfnis, etwas Tröstliches zu äußern. »Und wenn sie doch einmal kommen …« – er hieb mit seiner Gerte in die Luft – »dann bringe ich sie alle um!«
Manja lachte, dankbar für die Auflockerung.
»Im Moment reden die Ältesten von ganz anderen Dingen«, wechselte Vilufar das Thema. »Sie sagen, dass in vier Wochen der Ritus stattfinden soll, wenn der Mond wieder voll ist.«
Er sprach leichthin, doch Manja wusste, dass das Thema ihn sehr beschäftigte. Vilufar würde in diesem Sommer an den Initiationsriten teilnehmen, bei denen die jungen Männer des Dorfes in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen wurden. Worin der Ritus bestand, war ein Geheimnis, und kein Eingeweihter durfte darüber sprechen. Gewiss war Vilufar viel aufgeregter, als er zugab, denn dieses einmalige Ereignis in seinem Leben würde von einem Tag zum nächsten einen vollwertigen Mann aus ihm machen.
Manja verstand ihn gut, denn sie verband auch mit ihrer eigenen Initiation gemischte Gefühle – mit dem Unterschied, dass sie keine gleichaltrigen Mädchen kannte, mit denen sie ihre Hoffnungen und Ängste hätte teilen können. Sie wusste nicht, wann man das geheime Ritual an ihr vollziehen würde, denn es oblag den Dorfältesten, über die Reife der Anwärter zu entscheiden. Immerhin hatte sie gehört, dass bei der Einweihung eines Mädchens nur Frauen anwesend sein durften, ebenso wie die Initiation der Jungen von den Männern durchgeführt wurde.
»Du bist sicher auch bald an der Reihe«, sagte Vilufar, drehte sich auf die Seite und sah sie an.
»Woher willst du das wissen?«, fragte sie, während sie mit einer unvertrauten Scheu seine Blicke auf ihrem Körper spürte.
»Du bekommst schon Brüste«, sagte er lächelnd.
Manja blickte an sich hinab. Es stimmte; ihre Brustwarzen waren in den letzten Monaten größer und voller geworden, und das Fleisch im Umkreis begann sich leicht zu wölben. Ihr war ein wenig unbehaglich bei dem Gedanken, wie genau er sie betrachtete.
»Und du bekommst Haare!«, sagte sie in dem Bedürfnis, von sich abzulenken, und deutete in Richtung jenes Gliedes, das die Männer Balboi nannten. Nun war es Vilufar, der an sich herabsah – mit einem so verdutzten Ausdruck, dass Manja lachen musste. Offenbar war ihm der zarte Flaum, der seit Kurzem an seinen Lenden spross, noch gar nicht aufgefallen.
»Du wirst sicher ein großer, starker Mann«, sagte Manja scherzhaft und drehte sich wieder auf den Rücken.
»Und ob ich das werde!« Vilufar lehnte sich seinerseits zurück und blickte wieder zum Himmel. »Ich werde der reichste Bauer meiner Sippe. Ich werde vier Dutzend Ziegen und zwei Dutzend Schweine haben und doppelt …«
»… doppelt so viel Land wie dein Vater«, beendete Manja grinsend den Satz, den sie schon oft von ihm gehört hatte.
Sie schwiegen eine Weile.
»Und ich …«, sagte Manja mehr zu sich selbst. »Was werde ich sein?«
»Die Frau eines Bauern«, sagte Vilufar leichthin. Dann warf er ihr einen raschen Seitenblick zu. »Die Frau eines reichen Bauern, wenn du willst.«
Manja schwieg. Sie war sich nicht sicher, ob sie den Hintersinn seiner Worte zutreffend erfasst hatte.
»Wie könnte ich einen der hiesigen Bauern heiraten«, sagte sie ablenkend. »Ich bin doch eine Fremde.«
»Bist du nicht«, widersprach Vilufar. »Die Ältesten werden einer Heirat zustimmen, wenn die Eltern nichts einzuwenden haben. Und deine Mutter wäre glücklich, wenn du einen guten Mann bekommst.«
Manja nickte still. Ja, vermutlich wäre ihre Mutter glücklich. Ob sie selbst zufrieden wäre, ihr Leben lang die Ziegen zu melken, das Essen zu bereiten und das Korn auszulesen, bezweifelte sie. Sie hatte nie mit jemandem darüber gesprochen – nicht einmal mit Vilufar –, doch der Gedanke, ein Leben wie Tante Durka zu führen und am Ende vielleicht eine ebenso grässliche Alte zu werden wie sie, erfüllte Manja mit Abscheu. Seit jeher war sie ein stilles, nachdenkliches Kind gewesen, das mehr Augen für die Wunder seiner Umwelt als für die tägliche Arbeit hatte. Sie konnte stundenlang dasitzen und dem Kreisen eines Raubvogels am Himmel zusehen, das Strömen des Wassers im Bach beobachten oder dem Wind lauschen. Selbstverständlich ging sie ihrer Mutter zur Hand und half ausdauernd beim Reinigen des Geschirrs, beim Schüren des Feuers, bei der Versorgung der Tiere und selbst beim Holzhacken, doch vieles davon tat sie innerlich abwesend, denn ihre Gedanken weilten bei anderen Dingen. Sie fragte sich, warum die Sonne immer über der gleichen Bergkette im Osten aufging, warum ein Frosch sowohl im Wasser als auch an Land atmen konnte, warum ein Kalb nicht mit Hörnern geboren wurde – und warum es der Wille der Götter war, dass die Menschen von Getreidekörnern lebten, die sie unter größten Mühen säten, ernteten und horteten.
Schon oft war ihr der Gedanke gekommen, dass sie sich insgeheim nach etwas anderem sehnte – doch was es war, wusste sie nicht. Irgendwo tief in ihrer Seele schien es einen verborgenen Ort zu geben, an dem fremdartige Bilder lebten, die sie zuweilen im Traum zu sehen glaubte: Bilder von fernen Ländern, von hohen Bergen und weiten Ebenen, vom Flug der Falken über unbekannter Erde. Manchmal, wenn sie nachts wach gelegen hatte und der Ostwind über dem Rauchloch des Hauses hinwegpfiff, war es ihr vorgekommen, als flüsterten Stimmen in der Dunkelheit – Stimmen, die sie fürchtete, und die sie dennoch magisch anzogen, wie Geister aus einer Vergangenheit, die weit länger zurücklag als das erste Erwachen ihres Bewusstseins.
»Dein Vater wäre sicher auch glücklich«, nahm Vilufar den Faden wieder auf. »Jeder Bauer wünscht sich, dass seine Tochter eine Bäuerin wird.«
Manja schwieg betreten.
»Oder war er vielleicht kein Bauer?«, fragte Vilufar. »Was dann? Korbmacher? Gerber? Schmied?«
»Ich weiß es nicht«, sagte Manja leise.
»Hat deine Mutter denn nie etwas über ihn erzählt?« »Nein.«
Das war die Wahrheit: Sie wusste nichts von ihrem Vater. Ihre Mutter hatte lediglich gesagt, er sei vor ihrer Geburt gestorben.
»Was hast du, Schwester?« Vilufar wandte sich ihr zu und strich ihr flüchtig über die Wange.
»Nichts«, sagte sie betont forsch. »Es ist nur … es ist wohl doch noch ein bisschen zu kühl ohne Rock.«
Sie setzte sich auf und sah ihn bittend an.
Vilufar zuckte die Achseln, wälzte sich von ihrem Leibrock und sah mit einem gewissen Bedauern zu, wie sie ihn anzog.
Manjas Mutter stand in den Beeten hinter ihrem Haus und sammelte Kohlköpfe in einem Korb, als sie ihre Tochter von fern den Weg heraufkommen sah. Mit schmerzendem Rücken richtete sie sich auf, legte eine Hand auf den niedrigen Zaun und beobachtete die schlaksige Gestalt, die, den vollen Melkkübel in der Hand, mit nachdenklich gesenktem Blick dahinschritt.
Mein kleines Mädchen, dachte sie mit einer Mischung aus Rührung und jener leisen Unsicherheit, die sie gelegentlich befiel, seit ihre Tochter das zwölfte Lebensjahr erreicht hatte.
Manjas Mutter war eine Fremde unter den ansässigen Bauern. Als sie mit dem gerade geborenen Säugling ins Dorf gekommen war und um Aufnahme gebeten hatte, war sie sechsundzwanzig Jahre alt gewesen. Die Dorfherrin, wie die älteste und weiseste Frau der Sippe genannt wurde, hatte ihr viele Fragen gestellt, und sie hatte ruhig und knapp geantwortet. Der Vater des Kindes, so gab sie an, sei bei einem Überfall der Skythen auf ihr Heimatdorf getötet worden; sie selbst sei seitdem auf der Flucht. Das hatte den Ausschlag gegeben: Alle Menschen, die in den nördlichen Wäldern lebten, fürchteten die grausamen Pferdereiter, und so hatte die Dorfherrin Mitleid mit der jungen Mutter gezeigt und ihr ein Haus zur Verfügung gestellt.
Seitdem kümmerte sich Korzak, ihr nächster Nachbar, um die Alleinstehende, sorgte für grobe Arbeiten im Haus und überließ ihr bei jeder Ernte einige Körbe voll Getreide, da sie ohne Ehemann und Söhne nicht in der Lage war, selbst ein Feld zu bewirtschaften. Darüber hinaus lebte sie von selbstgezogenem Gemüse, einigen zahmen Gänsen und dem Flechten von Bastkörben, die sie auf dem Markt eines Nachbardorfes gegen Lebensmittel tauschte. Den Marktplatz ihres eigenen Dorfes suchte sie nur ungern auf.
Obwohl Arinai – denn so lautete ihr Name – die Sprache der Einheimischen teilte und zu einem verwandten Stamm gehört hatte, war sie stets eine Außenseiterin geblieben. Dafür hatte nicht zuletzt Durka gesorgt, die keine Gelegenheit ausließ, sie bei den Alteingesessenen anzuschwärzen. Arinai wusste dies sehr wohl, da sie über einen scharfen Verstand und wache Sinne verfügte. Dass sie die Ehemänner anderer Frauen verführte, war jedoch zum Glück eine derart plumpe Lüge, dass Durkas Beteuerungen keinen ernsthaften Glauben fanden. Vermutlich durchschauten selbst die einfältigsten Dorfgenossen, dass Durka lediglich um ihren Gatten besorgt war, der sich allzu willig um die Belange der Nachbarin bemühte – und was Arinais Lebenswandel betraf, so konnte jeder leicht erkennen, dass sie ihre Tage mit harter Arbeit verbrachte und weder Lust noch Muße hatte, sich mit Männern einzulassen. Das galt auch für Korzak, dem sie wohl Freundschaft entgegenbrachte, aber zugleich bei jeder Gelegenheit zu verstehen gab, dass die Götter sie unwiderruflich zum Witwenstand bestimmt hatten.
Ein Umstand allerdings sorgte dafür, dass die Gerüchte nicht verstummten: Arinai war schön. Sie näherte sich dem vierzigsten Lebensjahr und hatte damit ein Alter erreicht, in dem andere Frauen – falls sie nicht vorher im Kindbett starben – bucklig und runzlig waren. Arinai hatte nur ein einziges Kind zur Welt gebracht, und obwohl die Schwangerschaft schwer und die Geburt von kritischen Momenten begleitet gewesen war, hatte sie ihren Körper kaum gezeichnet. Lediglich ihr dichtes schwarzes Lockenhaar zeigte ergraute Strähnen, die ihr jedoch eher Würde verliehen, als sie alt wirken zu lassen. Insofern war es kein Wunder, dass Frauen wie Durka – die neun Kinder geboren und bis zum Auszug aus dem elterlichen Haus erzogen hatte – mit einer gewissen Missgunst auf Arinai blickten.
Würde auch ihre Tochter zeitlebens eine Außenseiterin bleiben? Dies fragte sich Arinai, als sie Manja beobachtete, die eben auf den Fußweg zum Haus einbog und das aus Zweigen geflochtene Gatter öffnete. Auch sie unterschied sich deutlich von den übrigen Mädchen im Dorf, schon durch ihren hohen Wuchs und ihr üppiges, pechschwarzes Haar. Außerdem, so schien es Arinai, teilten sie einen gemeinsamen Wesenszug: Beide sprachen nicht viel und hingen oft, jede für sich, ihren Gedanken nach.
»Gruß, Mutter«, sagte Manja, stellte den Kübel ab und küsste ihre Mutter auf die Wange.
Arinai blickte auf die Milch, deren Oberfläche bereits stockig war.
»Aber Kind«, sagte sie mit mildem Bedauern. »Hast du sie etwa in der Sonne stehen lassen?«
Manja folgte ihrem Blick, sah die Bescherung und biss sich auf die Unterlippe.
Sie ist keine Bäuerin, dachte Arinai. Nachsichtig strich sie ihrer Tochter durchs Haar.
»Komm. Dann mache ich uns stattdessen einen Hirsebrei.«
Als sie wenig später am Boden vor dem Herdfeuer saßen und ihren Brei verzehrten, waren beide schweigsam. Manja hatte die Augen gesenkt und starrte in ihre Schüssel. Sie kaute abwesend; ihre blassen Lippen bewegten sich kaum. Das pechschwarze Haar hing über ihr Gesicht herab wie ein Vorhang.
Sie hat mein Haar, dachte Arinai, die ihre Tochter nachdenklich beobachtete. Aber sie hat seine Augen.
Es war unabweisbar. Arinai hatte große, hellbraune Augen; die ihrer Tochter dagegen waren schmal und von einem kühlen Grau wie ein stürmischer Himmel. Nichts an ihr erinnerte Arinai so sehr an jenen Mann, den sie seit zwölf Jahren zu vergessen versuchte. In manchen Momenten war es fast, als wäre er noch immer da: Er blickte sie aus den Augen ihrer Tochter an, manchmal vertraut, manchmal fragend, manchmal – und diese Blicke weckten eine bange Beklemmung in ihr – mit einem Ausdruck der Fremdheit.
»Mutter?«, fragte Manja, schob ihre Schüssel von sich und blickte zu ihr auf. »Warum schimpft Tante Durka mit mir, wenn ich meinen Kittel um den Bauch knote?«
»Ach – tut sie das?«, fragte Arinai, die angesichts des finsteren Ausdrucks ihrer Tochter schon etwas Ernsteres erwartet hatte.
»Ja«, sagte Manja ärgerlich. »Dabei ist es doch so warm draußen. Was ist denn schlimm daran?«
Arinai betrachtete ihre Tochter. Wie immer, wenn sie zornig war, tanzte eine einzelne Haarsträhne zitternd über ihrer Stirn, und die zarte Nase krauste sich. Jäh wurde ihr bewusst, wie sehr sie dieses Kind liebte, und sie musste sich einen Moment besinnen, um auf Manjas Frage zurückzukommen.
»Nun … du wirst langsam eine junge Frau«, sagte sie sanft. »Ich nehme an, du weißt, was das bedeutet.«
Manja dachte nach. Es stimmte: Nur Kinder liefen im Dorf ohne Kleider umher; Erwachsene dagegen verhüllten ihren Körper. Sie erinnerte sich des seltsamen Gefühls, als Vilufar auf der Weide neben ihr gelegen und auf ihre knospenden Brüste gedeutet hatte.
»Es bedeutet, dass du in absehbarer Zeit alt genug sein wirst, um Kinder zu bekommen«, fuhr Arinai fort.
Manja starrte ihre Mutter befremdet an, und Arinai glaubte ihre Gedanken erraten zu können: Sie, selbst noch ein Kind, würde schwanger werden können?
»Wann?«, fragte sie beklommen.
»So schnell, wie du wächst, kann es nicht mehr lange dauern«, sagte Arinai lächelnd. »Du wirst es an der Blutung merken, von der ich dir erzählt habe. Mach dir keine Sorgen, wenn das geschieht; die Götter haben es so eingerichtet. – Weißt du, wie man schwanger wird?«
Manja nickte. Die meisten Kinder kannten die Tatsachen aus eigener Anschauung, denn in den Häusern des Dorfes wohnten vielköpfige Familien Tag und Nacht im selben Raum. Manja lebte nur mit ihrer verwitweten Mutter zusammen, doch ging sie mit wachen Sinnen durch die Welt und war eine aufmerksame Beobachterin. Darüber hinaus gaben die Tiere ihr ein Beispiel, denn sie hatte oft gesehen, wie der Bock auf der Weide die Ziegen besprang.
»Ich weiß, dass die Männer das Glied dafür benutzen, dass man Balboi nennt«, sagte sie, nicht ohne Scham über ihre Altklugheit. »Aber ich weiß nicht, wie sie damit ein Kind machen.«
»Dann will ich dir ein Geheimnis verraten«, sagte Arinai. »Du weißt sicher, warum wir die Große Hochzeit feiern.«
»Natürlich«, sagte Manja. »Das Fest ist immer beim ersten Sommerregen. Der Regen fällt auf die Erde, lässt die Saat keimen und das Getreide wachsen. Es heißt, dass der Himmel sich dabei mit der Erde vermählt.«
»So ist es«, sagte Arinai ernst. »Die Große Mutter Erde, die unsere höchste Gottheit ist, gebiert das Getreide. Doch sie kann nicht schwanger werden, wenn der Himmel sie nicht zuvor durch den Regen befruchtet hat. Das nennen wir die Große Hochzeit – und die kleine Hochzeit, die zwischen Mann und Frau, ist ihr Abbild. Auch der Mann bewässert eine Saat, wenn er in den Leib der Frau eindringt.«
»Mit seinem Balboi?«
»Ja.«
»Ist es das Wasser, das er lässt?«
»Nein, kein Wasser. Wir nennen es den Samen. Und daraus entsteht ein Kind.«
Manja schwieg eine Weile, und wie immer, wenn sie angestrengt nachdachte, strich sie sich die vorwitzige Haarsträhne aus der Stirn.
»Wenn ich einmal heirate und Kinder bekomme …«, sagte sie langsam, »… werde ich dann so wie Tante Durka?« Arinai lachte herzlich.
»Wie kommst du denn darauf?«
»Ich weiß nicht«, sagte Manja, die todernst geblieben war. »Durka hat neun Kinder, und sie sieht immer so … so missmutig aus. Sie lächelt niemals – so wie du.«
»Du hast recht«, sagte Arinai nachdenklich. »Durka hat schon ein langes Leben gelebt und viele Sorgen und Mühen gehabt. Das ist schwer zu verstehen, wenn man so jung ist wie du. Es ist nicht leicht, neun Kinder zur Welt zu bringen, die Felder zu bewirtschaften, um die vielen Mäuler zu stopfen, und sie alle großzuziehen.«
»Aber du hast nur ein Kind«, sagte Manja. »Und du bist immer noch glücklich – und schön.«
Gerührt blickte Arinai ihre Tochter an. Es war das erste Mal, dass sie ihr etwas Derartiges sagte.
»Ich bin nicht so glücklich, wie es vielleicht den Anschein hat«, erwiderte sie ernst. »Ich habe schlimme Dinge erlebt, über die ich nicht sprechen möchte – nicht einmal mit dir. Und dass ich nur ein Kind habe, ist eine Fügung der Götter, deren Sinn mir verborgen geblieben ist. Ich hätte gern eine große Familie und so viele Kinder gehabt wie Durka.«
»Wirklich?«, fragte Manja mit echtem Erstaunen. »Obwohl man bei der Geburt sterben kann?«
»Ja, wirklich«, nickte Arinai. »Kinder zu haben, ist etwas Wundervolles. Auch du solltest keine Angst davor haben.«
Manja biss sich auf die Lippen. Eine Weile schwiegen beide, und Arinai vermochte nicht zu erraten, woran ihre Tochter dachte.
»Vilufar hat gefragt, wer mein Vater war«, sagte Manja schließlich scheinbar beiläufig.
Arinai senkte den Blick. Sie hatte stets gewusst, dass ihre Tochter ihr diese Frage einmal stellen würde, hatte Pläne entworfen, was sie antworten würde – und am Ende alles wieder verworfen. Nun war er da, der gefürchtete Moment. Es hätte sie erleichtert, dem Schmerz Ausdruck zu verleihen, der in ihr emporstieg, doch stattdessen verschlossen sich ihre Züge zu einer Maske der Erstarrung.
»Iss deinen Brei auf«, sagte sie kalt und bemerkte, dass ihre Stimme bebte.
Enthüllungen
Für den Rest des Tages blieb die Stimmung angespannt und unbehaglich. Manja hatte keine weiteren Fragen gestellt und ihrer Mutter wortlos geholfen, das Geschirr zu säubern, das Feuer zu schüren und sogar das Gemüse für den folgenden Tag vorzubereiten. Anschließend verbrachte sie eine unruhige Nacht auf ihrer strohgedeckten Wandbank, lauschte auf den Wind, der leise über dem Rauchloch in der Decke pfiff, und wälzte sich von einer Seite auf die andere. Einmal glaubte sie, in weiter Ferne, irgendwo draußen in den Wäldern, einen Wolf heulen zu hören.
Als sie am Ende doch einschlief, hatte sie einen merkwürdigen, um nicht zu sagen beängstigenden Traum. Sie sah sich am Waldrand stehen und in das weite Grasland der Steppe hinausblicken, das sie in Wahrheit noch nie gesehen hatte – es begann etwa eine Wegstunde südlich des Dorfes, und ihre Mutter hatte ihr verboten, jemals in diese Richtung zu gehen. In ihrem Traum jedoch verließ sie den Schatten der Bäume und trat in ein Meer von hüfthohem Gras hinaus, über das der Wind in Wellen hinwegstrich. Der Mond stand hoch über dem Land, und die Köpfe der Disteln, die hier und dort aus dem Gras emporschossen, glänzten silbrig.
In einiger Entfernung erkannte Manja den dunklen Umriss eines Hügels, der sich in der endlosen Weite erhob. Auf dem Gipfel dieses Hügels stand eine hohe Gestalt, regungslos wie ein Steinblock. Es mochte ein Mensch sein, doch sein Gesicht lag im Schatten. Erst als Manja genauer hinschaute, nahm sie eine Bewegung wahr: Ganz langsam hob die Gestalt einen Arm, streckte eine schwarze Hand aus und krümmte die langgliedrigen Finger.
Der Fremde winkte ihr zu.
Manja erwachte spät am nächsten Morgen und fand ihre Mutter bereits damit beschäftigt, die Gänse zu füttern, die sie in einem Verschlag an der Rückwand des Hauses hielt. Arinai schickte sie sogleich mit dem Melkkübel zur Weide, und Manja war froh, Haus und Garten verlassen zu können und der frostigen Stimmung zu entfliehen, die sich seit dem Vorabend zwischen Mutter und Tochter ausgebreitet hatte.
Auf dem Weg zur Weide kam sie am Nachbarhaus vorbei und bemerkte Korzak, der eben eine Leiter an den Apfelbaum in seinem Garten stellte. Er nickte ihr freundlich zu, wie er es stets tat, und Manja blieb vor dem Gartenzaun stehen – nachdem sie sich vergewissert hatte, dass Tante Durka nirgends zu sehen war.
»Gruß, Korzak!«, rief sie. »Ist Vilufar auf der Weide?«
Korzak, der soeben die Leiter erstieg und einen Weidenkorb an einen der Äste hängte, drehte sich mühsam zu ihr um.
»Nein. Er ist bei den Ältesten.«
»Oh.« Manja machte große Augen. »Weißt du, wann er zurückkommt?«
Korzak pflückte einige Äpfel und ließ sie in seinen Korb fallen, wobei seine Beine auf der Leiter zitterten – er war nicht mehr der Jüngste, und Manja wusste, dass er unter Gelenkschmerzen litt.
»Nein«, brummte er einsilbig, streckte die Finger nach einem weiteren Apfel aus und schwankte.
»Soll ich helfen?«, erbot sich Manja, deren erster Impuls war, über den Zaun zu springen und die Leiter festzuhalten, damit der alte Mann nicht stürzte.
»Nein«, brummte Korzak abermals, zog den Apfel vom Zweig und schaffte es, das Gleichgewicht wiederzufinden.
»Geh du nur zur Weide, Kind.« Er wies auf einen Tonkrug, der vor dem Zaun stand. »Wenn du helfen willst, kannst du unsere Finka melken.«
»Gern«, rief Manja, nahm den zweiten Melkkübel auf und setzte ihren Weg fort.
Es war einsam auf der Weide ohne Vilufar. Sie war es gewohnt, ihn schon von Weitem mit seiner Gerte auf dem Zaun sitzen zu sehen. Heute begrüßten sie nur die Ziegen, die sie sofort klagend umringten und ihre übervollen Euter schüttelten.
Geduldig molk sie zuerst Finka, Korzaks beste Ziege, dann zwei ihrer Schwestern und schließlich das Tier, das ihrer Mutter gehörte. Es dauerte lange, denn Korzaks Ziegen waren ihre Hände nicht gewohnt, und sie musste ihnen gut zureden und mehrmals von neuem beginnen, da sie ständig nervös umhersprangen.
Als Manja fertig war, sah sie endlich Vilufar den Weg zur Weide herabkommen. Er winkte bereits von Weitem und ließ seine Gerte lässig in der Hand hängen, sodass die Spitze über den Boden streifte.
»Gruß, Schwester!«, sagte er strahlend, als er das Gatter erreichte.
Sie neigte ihm die Wange zu, empfing den gewohnten Kuss und spürte, dass er aufgeregt und erhitzt war.
»Was hast du denn bei den Ältesten getan?«, fragte sie. Vilufar zog eine Augenbraue hoch.
»Woher weißt du …?«
»Dein Vater hat es mir gesagt.«
»Oh …« Vilufar schwang sich wie üblich auf den Zaun und ließ die Beine baumeln. »Es ging um den Ritus. Alle Jungen, die in diesem Jahr an der Reihe sind, mussten zu den Ältesten gehen.«
»Und was habt ihr dort getan?«, fragte Manja und setzte sich neben ihn. Sie war einigermaßen neugierig, denn sie kannte die sieben alten Männer, die zur Zeit den Rat bildeten, nur vom Sehen. Die Hütte der Dorfherrin, in der sie stets zusammentrafen, stand unweit des Brunnens in der Mitte des Dorfes, doch war es normalerweise verboten, sie zu betreten.
»Das darf ich dir nicht sagen«, sagte Vilufar. Vielleicht sollte es bedauernd klingen, doch Manja vernahm deutlich einen Ausdruck von Stolz in seiner Stimme. »Du weißt doch; die Riten sind geheim.«
»Oh«, machte Manja ihrerseits und verbarg ihre Enttäuschung. »Und … du willst es nicht einmal deiner Schwester sagen?«
Er schüttelte würdevoll den Kopf. »Kein Wort.«
»Sicher nicht?«
»Nein.«
»Ganz sicher nicht?«, neckte sie ihn.
Er grinste, sprang vom Zaun herab und warf ihr einen schelmischen Blick zu.
»Fang mich, dann sag ich es dir!«
Und er rannte los.
»Du Schuft!«, schrie Manja, hin- und hergerissen zwischen Ärger und Belustigung. »Warte nur!«
Sie wusste, dass er schneller laufen konnte als sie; dennoch schwang auch sie sich vom Zaun und setzte ihm nach.
»Fang mich doch, fang mich doch!«, rief Vilufar und rannte immer im Kreis um die Weide herum. Manja jedoch schnitt ihm den Weg ab, indem sie sich zwischen den erschrockenen Ziegen hindurchdrängte, und trieb ihn derart in die Enge, dass er sich schließlich mit einem Hechtsprung über den Zaun retten musste.
»Fang mich doch! Fang –«
Doch er hatte nicht mit Manjas Wagemut gerechnet: Sie rannte direkt auf den Zaun zu, tat es ihm gleich und flankte hinüber, die Hände auf einen der Pfosten gestützt. Vilufar war zu überrascht, um zurückzuweichen – mit der Folge, dass Manja geradewegs in seine Arme stürzte und ihn zu Boden riss.
»Hab ich dich!«, schrie Manja triumphierend, wälzte sich über ihn und blickte aus nächster Nähe in sein Gesicht. Vilufar wehrte sich fahrig, doch er musste so sehr lachen, dass es ihm nicht gelang, sie abzuschütteln.
Endlich verebbte sein Lachen; sein Gesicht glättete sich, und er blickte ihr in die Augen. Manja, die der Länge nach auf ihm lag, spürte seine Wärme und die regelmäßigen Hebungen seiner Brust. Sie fühlte sich plötzlich schwindlig und benommen.
»Vilufar!«, zerschnitt eine entfernte Stimme die Stille.
Manja fuhr hoch, und auch Vilufars Kopf fiel zur Seite. Drüben am Gatter stand Durka, eine Heugabel in der Hand, und blickte zu ihnen herüber.
Erschrocken kam Manja auf die Füße. Auch Vilufar erhob sich, klopfte Erde von seinem Überwurf und blickte zu seiner Mutter hinüber. Sein Gesicht glühte scharlachrot.
Durka stand reglos da, in der einen Hand die Heugabel, die andere in die Seite gestemmt. Ihr Gesicht war wie versteinert. Sie gab keinen weiteren Laut von sich, sondern wartete mit fest zusammengepressten Lippen.
»Ach ja«, raunte Vilufar so leise, dass nur Manja es hören konnte. »Ich soll noch beim Heuwenden helfen …«
Sie tauschten einen raschen Seitenblick, und Manja sah Beschämung und Bedauern in seinem Gesicht. Sie nickte.
Mit hängenden Schultern setzte sich Vilufar in Bewegung und ging zu seiner Mutter hinüber, die ihm wortlos bedeutete, ihr zu folgen. Bevor sie sich abwandte, schoss sie Manja noch einen Blick zu, so vernichtend wie nie.
Trotzig warf Manja das Haar in den Nacken und ging zu den beiden Melkkübeln hinüber. Schuldbewusst bemerkte sie, dass die oberste Schicht bereits stockig geworden war – sie hatte die Milch also schon wieder zu lange in der Sonne stehen lassen. Was würde ihre Mutter sagen? Und was Korzak? Seufzend schöpfte sie die trübe Masse mit den hohlen Händen ab und sah zu Finka hinüber, die ruhig in der Sonne lag. Es blieb ihr wohl nichts anderes übrig, als das arme Tier noch einmal zu melken.
Auf dem Rückweg ließ Manja Korzaks Kübel einfach vor dem Gartenzaun stehen, nachdem sie sich vergewissert hatte, dass Durka nicht in der Nähe war. Dann schlich sie zum Haus ihrer Mutter hinüber. Diese empfing sie freundlich, doch sichtlich abwesend, und bat die Tochter, das Unkraut im Garten zu jäten, während sie selbst im Haus blieb und an einem ihrer Weidenkörbe flocht. Manja wusste, dass sie demnächst zum Markt im Nachbardorf gehen und die fertigen Körbe verkaufen würde. Das tat sie zumeist einmal im Monat, und stets nahm sie den beschwerlichen Weg auf sich, um das Getuschel auf dem heimischen Markt zu vermeiden.
Der Tag schleppte sich dahin, und als beide später beim Abendessen saßen, war die Stimmung noch immer gedrückt. Manja stocherte lustlos in ihrem Brei, während Arinai nur zwei Mundvoll zu sich nahm und schließlich die Schüssel zur Seite schob.
»Manja?«
Der unerwartet sanfte Ton ihrer Mutter ließ sie erstaunt aufblicken.
»Du hast mich gestern etwas gefragt«, sagte Arinai langsam, und es war ihr anzumerken, dass die Worte sie einige Überwindung kosteten.
Manja starrte sie mit offenem Mund an.
»Du hast mich gefragt, wer dein Vater war«, ergänzte Arinai. »Ich habe den ganzen Tag mit mir gerungen – aber ich denke, dass du ein Recht hast, es zu erfahren.« Sie versuchte sich zusammenzunehmen, konnte jedoch nicht verhindern, dass ihre Mundwinkel zitterten.
Das plötzliche Zeichen von Schwäche berührte Manja eigenartig: Sie fühlte Ärger und Bitterkeit in sich dahinschmelzen. Unvermittelt sprang sie auf, ließ sich an der Seite ihrer Mutter nieder und umarmte sie fest.
Arinai war ihr unendlich dankbar. Wie seltsam, dachte sie: So oft hatte sie ihre kleine Tochter getröstet, wenn diese sich verletzt hatte oder traurig war, und nun lag sie selbst in ihren Armen und weinte wie ein Kind. Es war, als ob all die jahrelang aufbewahrte Trauer in einem gewaltigen Strom aus ihr herausrann. Arinai hatte niemals einen Menschen gehabt, bei dem sie Schutz oder Trost fand. Nun endlich verstand sie, dass ihre Tochter kein Kind mehr war: Sie war erwachsen genug, um die Trauer ihrer Mutter zu verstehen und ihr Halt zu geben.
»Er war ein Skythe«, sagte Arinai, als sie einige Zeit später im Schein des schwelenden Feuers auf ihren Schlafbänken lagen.
»Ein Pferdemensch?« Manja richtete sich entsetzt auf.
Arinai erwiderte den Blick der Tochter nicht; stattdessen folgten ihre Augen dem Rauch, der sich seinen Weg zum Abzugsloch im Dach bahnte.
»Einer ihrer Häuptlinge«, sagte sie schließlich. »Seine Leute überfielen mein Heimatdorf und töteten alle Einwohner bis auf meine Mutter und meine Schwestern. Du musst wissen: Meine Mutter war die Herrin jenes Dorfes und Priesterin der Großen Mutter Erde.«
Sie unterbrach sich, denn die Erinnerung an das Massaker ließ erneut Tränen in ihr aufsteigen.
»Warum … taten sie das?«, flüsterte Manja, die fassungslos zuhörte.
»Sie betrachten die Bauern als wenig mehr denn Vieh«, sagte Arinai. »Und sie jagen sie genauso, wie unsere Leute das Rotwild im Wald jagen oder Kaninchen in ihren Erdlöchern ausräuchern. Sie glauben, dass der Gott des Himmels und der Stürme, den sie anbeten, stärker ist als die Große Mutter, und dass er ihnen Gewalt über alle Menschen gegeben hat, die Felder bebauen und von den Früchten der Erde leben. Sie selbst kennen weder Felder noch Häuser, sondern reiten auf Pferden und ziehen mit Wagen durch die Steppe. Sie leben von ihren Herden, von der Jagd – und vom Raub.«
Wie zum Schutz vor dem Unbegreiflichen zog Manja ihre Schlafdecke aus Lammfell fester um die Knie.
»Und du … du …« Sie suchte verzweifelt nach Worten.
Arinai blickte wieder zum Rauchloch empor.
»Ich ging zu ihrem Häuptling, um Gnade für meine Mutter und meine Schwestern zu erbitten. Ich sprach mit ihm. Ich flehte ihn an, meine Familie zu verschonen …«
»Hat er dir … Gewalt angetan?«, flüsterte Manja. Sie hatte von solchen Dingen gehört, doch galten sie als derart ungeheuerlich, dass selbst die Erwachsenen nur hinter vorgehaltener Hand darüber redeten.
»Nein«, sagte Arinai. »Es war anders … ich weiß selbst nicht, wie es dazu kam … ich lernte ihn kennen, und ich erkannte, dass er kein böser Mensch war. Er begann, mich so anzusehen, wie ein Mann eine Frau ansieht – wenn du verstehst … Und ich …«
Entsetzt starrte Manja ihre Mutter an.
»Ich glaubte, er würde mich zur Frau nehmen«, sagte Arinai nach einer unbehaglichen Pause. »Doch am Ende zogen die Skythen weiter, und er ließ mich zurück.«
»Dann ist er gar nicht gestorben?«, fragte Manja mit jäher Kälte. »Du hast mich also belogen?«
»Ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Ich habe ihn nie wiedergesehen und auch nie mehr von ihm gehört.«
Sie schwiegen eine Weile, und obwohl Arinai sich nicht überwinden konnte, ihrer Tochter ins Gesicht zu blicken, empfand sie deutlich, wie tief sie Manja mit diesem Geständnis verletzt haben musste.
»Was ist danach geschehen?«, fragte Manja schließlich.
»Wir blieben in unserem zerstörten Dorf zurück«, sagte Arinai. »Es gab nichts mehr, wovon wir hätten leben können, und so brachen wir auf, um Verwandte unseres Volkes im Osten zu finden, so weit fort wie möglich.«
»Was ist aus deiner Familie geworden?«
»Sie … verstießen mich. Sie wollten nicht mit mir am selben Ort leben und ließen sich bei einem anderen Stamm weiter nördlich nieder. Sie sagten, ich sei die … die Hure des Mörders unserer Verwandten …«
Endlich wandte Arinai den Kopf, um ihre Tochter anzublicken. Vergeblich suchte sie nach einer Spur von Verständnis oder gar von Mitgefühl, doch Manjas Augen waren starr auf das schwelende Feuer gerichtet. Arinai spürte, dass ihre Tochter ihr denselben Vorwurf machte – machen musste – wie damals ihre Schwestern.
Ein Wunder, wenn es anders wäre, dachte sie verzweifelt. Es gab keine Vergebung; niemand konnte sie freisprechen. Sie würde mit diesem stummen Vorwurf leben müssen bis ans Ende ihrer Tage.
Doch wie erst mochte Manja sich fühlen? Arinai hatte ihr eröffnet, dass sie die Tochter eines Mannes war, den sie fürchten und hassen musste. Konnte es eine grausamere Art geben, das Herz eines Kindes zu zerreißen?
An diesem Abend flossen keine Tränen mehr, und keine der beiden Frauen kam zur anderen herüber, um sie in die Arme zu nehmen. Stattdessen lagen beide schlaflos auf ihren Bänken, zu beschäftigt mit Verwirrung und Trauer, um einander Trost geben zu können. Irgendwann nach Mitternacht hörte Arinai an Manjas verändertem Atem, dass ihre Tochter eingeschlafen war.
Gut, dachte sie, das ist gut. Sie ist jung und braucht ihren Schlaf.
Doch Manjas Träume waren unruhig; sie wälzte sich auf ihrem Lager und stöhnte benommen – und jedes Stöhnen war ein schmerzhafter Stich in Arinais eigene Brust.
In den folgenden Tagen änderte sich rein äußerlich nichts in Manjas Leben: Sie stand bei Sonnenaufgang auf; sie fütterte die Gänse; sie reinigte das Geschirr; sie ging zum Brunnen, um Wasser zu holen, an den Waldrand, um Feuerholz zu sammeln, und zur Weide, um die Ziege zu melken. In wenigen Wochen würde die Ernte beginnen, und sie würde gemeinsam mit ihrer Mutter auf Korzaks Feldern arbeiten – da der Nachbar ihnen einen Teil seines Getreides überließ, verstand es sich von selbst, dass sie halfen. Auch das Gemüse im eigenen Garten bedurfte ausgiebiger Pflege, denn es war heiß, und der letzte Regen lag lange zurück. Die Pflanzungen mussten mehrmals täglich bewässert werden, und wenn dann noch Zeit übrig blieb, gab es stets irgendeine undichte Stelle am Lehmbewurf des Hauses, die ausgebessert werden musste.
Manja tat ihre Arbeit, doch innerlich war sie abwesender denn je. Sie war klug genug, nicht mehr auf jene Geheimnisse zurückzukommen, die ihre Mutter ihr anvertraut hatte, teils aus Rücksichtnahme, teils aus eigener Scheu. Auch Arinai erwähnte die Angelegenheit nicht wieder, und so konnten beide im Alltag ebenso reibungslos zusammenarbeiten wie früher. Freilich war diese Zusammenarbeit bislang einem unbefangenen Vertrauen entsprungen – nun dagegen eher einer stillschweigenden Übereinkunft, nicht an Dinge zu rühren, die für beide schmerzlich und verstörend waren.
Hatte Arinai immer schon ein gewisses Gefühl der Fremdheit bei Manjas Anblick empfunden, so sah nun auch Manja ihre Mutter mit anderen Augen. Bislang hatte sie Arinai nur als eine stille, doch herzensgute Frau in mittleren Jahren gekannt, die von einer missgünstigen Laune der Götter zum Witwendasein verurteilt worden war. Nun jedoch ahnte Manja unbekannte Züge hinter dem ruhigen Äußeren, und oft versuchte sie, sich die junge Arinai vorzustellen, die noch nicht ihre Mutter gewesen war: Eine Frau von betörender Schönheit, in den Armen eines grausamen, barbarischen Kriegers liegend. Manja stellte sich den Mann als riesengroßen, dunkelhäutigen Hünen mit wildem Haar und struppigem Bart vor, und sie schauderte bei dem Gedanken, welch unaussprechliche Dinge zwischen den beiden geschehen waren. Ihre Mutter hatte ihr erklärt, was beim Geschlechtsakt geschah – doch nun verband sie diese Vorstellung mit jenen Räubern und Mördern aus der Steppe, die Bauerntöchter auf ihr Lager zerrten und einen Samen in sie legten, der wahrscheinlich ebenso schwarz war wie ihre Seelen. Verzweifelt schwankte sie zwischen der Vorstellung, dass der wilde Mann ihrer Mutter Gewalt angetan hatte, und der noch viel unglaublicheren, dass sie ihn freiwillig in sich eingelassen hatte, und vermochte nicht zu entscheiden, welche von beiden erschreckender war.
Und sie, Manja, das Mädchen, das die Gänse fütterte, die Ziege molk und Wasser vom Brunnen holte, sollte das Ergebnis dieser Vereinigung sein? Soweit sie wusste, zeugten Stiere nur Kälber; Ziegenböcke zeugten Ziegen und Hunde zeugten Hunde; so hatten die Götter es eingerichtet. Doch wie konnte eine wilde Bestie ein kleines Mädchen zeugen?
Fragen solcher und ähnlicher Art hätte sie früher ihrer Mutter gestellt, die erstaunlich viel über die Natur der Dinge und die Einrichtung der Welt wusste und ihr zuweilen von fernen Gegenden, von fremden Menschen und von den Taten der Götter und Helden der Vorzeit erzählt hatte. Nun jedoch kam es nicht mehr infrage, sich an Arinai zu wenden, denn Manjas Vertrauen hatte einen empfindlichen Schlag erlitten.
Arinai gab sich die größte Mühe, die Nachwirkungen dieses Schlages abzumildern. Obwohl sie in sich gekehrt und sichtlich mit eigener Trauer beschäftigt war, behandelte sie Manja ausnehmend nachsichtig und ließ ihr viel Zeit, um sich mit Vilufar auf der Weide zu treffen – wahrscheinlich in der Hoffnung, die Atempausen würden ihr Gelegenheit geben, das Erfahrene zu verarbeiten. Sie mochte Vilufar und wusste wohl, dass das Zusammensein mit ihm eine heilsame Wirkung auf ihre Tochter hatte.
»Lass dir ruhig Zeit«, sagte Arinai drei Tage später, als Manja sich soeben mit dem Melkkübel auf den Weg machte. »Ich muss ohnehin noch den letzten Korb zu Ende flechten und bin gewiss nicht vor dem Abend fertig.«
Manja nickte. »Gehst du dann morgen auf den Markt ins Nachbardorf?«
»Ja, das muss ich wohl.« Arinai seufzte. »Wir brauchen dringend haltbare Lebensmittel, wenn es so heiß bleibt. Ich gehe morgen bei Sonnenaufgang fort und werde vermutlich erst in zwei Tagen zurück sein.«
Manja nickte abermals.
»Den Segen der Götter auf deinem Weg«, sagte sie, wie es sich gehörte.
»Auch auf deinem, Kind«, erwiderte Arinai die rituelle Formel. Dann küsste sie sie auf die Wange und ging zurück ins Haus.
Vilufar erwartete Manja wie üblich auf der Weide. Er war bemerkenswert guter Laune, geradezu ausgelassen, und Manja vergaß für einige Zeit ihre Sorgen. Sie hatte Vilufar nichts von dem erzählt, was ihre Mutter ihr eröffnet hatte, und sie wollte es auch in Zukunft nicht tun – erst recht nicht, wenn er so viel Frohsinn verströmte, dass er sie damit anstecken konnte.
Zuerst spielten sie Fangen zwischen den verwirrten Ziegen, die von der Unruhe angesteckt wurden und aufgeregt hin und her liefen; dann saßen sie eine Weile auf dem niedrigen Weidenzaun und plauderten, und am Ende landeten sie wieder Schulter an Schulter auf dem Boden im Gras und blickten in den klaren Himmel.
»In zwei Wochen findet das Ritual statt«, sagte Vilufar. Manja, die den Grund für seinen Übermut bereits erraten hatte, nickte.
»Aber ich habe eine Aufgabe zu erfüllen, bevor ich reif dafür bin«, fuhr er fort.
»Verrätst du es mir?«, fragte Manja. »Schließlich hast du neulich beim Fangen verloren! Du hast gesagt, du verrätst es mir, wenn …«
»Also gut, ich sage es dir.« Vilufar lächelte geheimnisvoll. »Stell dir vor: Ich muss eine ganze Nacht allein verbringen, mindestens tausend Schritte vom Dorf entfernt, und darf nicht schlafen, bis die Sonne aufgeht. Alle Jungen müssen das tun, sonst dürfen sie nicht am Ritual teilnehmen.«
Manja lauschte ehrfürchtig – sie selbst hatte sich noch niemals weit von dem Erdwall entfernt, der das Dorf umgab.
»Ich darf nur Zunder und Flintstein zum Feuermachen und ein Messer mitnehmen«, erklärte Vilufar stolz, als könne er es kaum erwarten, sich der Aufgabe zu stellen. »Den Platz darf ich mir selbst aussuchen … ich glaube, ich werde zu den Kiefernfelsen gehen.«
»Aber das ist viel weiter fort als tausend Schritte«, sagte Manja, die von Korzak gehört hatte, dass die Kiefernfelsen an der Grenze zu den Grassteppen im Süden lagen. »Hast du keine Angst?«
»Ich habe vor nichts Angst.« Vilufar schwang seine Gerte in der Luft. »Was soll schon passieren?«
»Und wenn ein Wildschwein kommt oder ein Bär?«
»Ach …« Er machte eine wegwerfende Handbewegung. »Dann klettere ich auf einen Baum. Außerdem haben die Tiere doch Angst vor Feuer.«
»Und … der Wolfsmann?«
Er lachte.
»Weißt du, Schwester, ich glaube manchmal, dass die Erwachsenen uns bloß deshalb vom Wolfsmann erzählen, weil sie uns Angst machen wollen, wenn wir ungehorsam sind.«
Manja schwieg.
»Hör mal, Schwester …« Vilufar hatte sich ihr zugewandt und spielte wie zufällig mit dem losen Ende einer ihrer Haarsträhnen, die im Gras lag. »Geht deine Mutter nicht bald ins Nachbardorf, um ihre Körbe zu tauschen?«
»Ja, schon morgen.«
»Dann ist sie doch sicherlich zwei Tage fort, nicht wahr?« Manja bejahte stumm – noch verstand sie nicht, worauf er hinauswollte.
»Weißt du was? Ich gehe gleich morgen Nacht zu den Kiefernfelsen«, entschied Vilufar plötzlich. Dann schoss er ihr einen raschen Seitenblick zu. »Aber es wird langweilig sein so allein im Wald … und du wirst auch einsam sein in dem leeren Haus.«
Beide schwiegen einen Moment lang.
»Willst du nicht auch kommen?«, fragte Vilufar schließlich. »Ich werde dort sein, sobald die Sonne untergegangen ist. Nimm den Weg, der am Bach entlang bis zu dem großen Stein führt, der mitten im Wald liegt, und dann immer geradeaus … Du wirst mein Lagerfeuer sehen können.«
Sie blickte ihm forschend ins Gesicht, unentschlossen, was sie von diesem Ansinnen halten sollte.
»Sollst du die Nacht nicht allein verbringen?«, fragte sie. Vilufar zuckte die Achseln und grinste.
»Es braucht ja niemand zu wissen.«
Nachtwache
Am nächsten Morgen, noch vor Sonnenaufgang, schulterte Arinai fünf ineinandergesteckte Weidenkörbe sowie ein kleines Reisebündel und verließ das Haus. Als Manja aufwachte, fand sie die gegenüberliegende Schlafbank bereits leer vor; auf dem Boden jedoch stand eine Schale mit frisch angerührtem Hirsebrei, und daneben lagen zwei Mohrrüben. Manja empfand eine gewisse zärtliche Rührung: Die Mutter hatte sie nicht vor der Zeit wecken wollen, aber ihr noch das Frühstück bereitet.
Sie aß, nahm sich Zeit und verrichtete dann ihre Pflichten wie üblich. Wenn ihre Mutter früher einmal auf den Markt gegangen war, hatte sich Durka die meiste Zeit im Haus aufgehalten, um auf sie aufzupassen – dies jedoch hatte Manja sich schon im Vorjahr erfolgreich verbeten, und Arinai hatte die Nachbarin mit der gebotenen Höflichkeit in ihre Schranken verwiesen. So hatte Manja nun viel zu tun, zugleich aber auch Gelegenheit, mit sich und ihren Gedanken allein zu sein. Sie fütterte die Gänse, holte Wasser, begoss das Gemüse vielleicht ein klein wenig nachlässiger als sonst und ging schließlich zur Weide, um die Ziege zu melken. Vilufar war nicht dort; offenbar bereitete er sich auf seine rituelle Nachtwache vor.
Manja war noch nicht sicher, ob sie sein Angebot annehmen und ihm Gesellschaft leisten sollte. Es wäre gewiss ein aufregendes Erlebnis, allein mit ihm eine Nacht in der Wildnis zu verbringen, doch musste sie sich eingestehen, dass sie Angst hatte – nicht so sehr der Wildschweine oder gar des Wolfsmanns wegen, sondern weil sie spürte, dass eine derartige Einladung eines Jungen an ein Mädchen nicht ohne tieferen Grund erging.
Als sie von der Weide zurückkam und an Vilufars Elternhaus vorbeischlenderte, hörte sie drinnen Stimmen und erkannte Tante Durka, die offensichtlich laut auf ihren Mann einredete. Das war durchaus nichts Ungewöhnliches, doch als Manja den Namen ihrer Mutter vernahm, blieb sie stehen und lauschte.
»Nun ist sie wieder fortgegangen, diese Hure«, drang Durkas Stimme zu ihr herüber. »Was treibt sie wohl drüben im Nachbardorf? Ihre Körbe könnte sie schließlich auch hier losschlagen.«
Korzak brummte eine einsilbige Antwort, die Manja nicht verstand.
»Verteidige du sie nur!«, keifte Durka. »Du gaffst doch selbst auf ihre Schenkel, sobald sie sich einmal bückt.«
Korzak schwieg – vermutlich nicht aus Schuldgefühl, sondern weil er im Lauf der Jahre gelernt hatte, dass es unklug war, ihr zu widersprechen.
»Und ihre Tochter ist auch nicht besser.« Jetzt klang es, als hätte Durka sich erbittert von ihrem Mann abgewandt und zur Tür begeben. Rasch duckte sich Manja hinter einen Busch.
»Was sie wohl da drüben treibt, wenn sie allein ist …« Offenbar spähte Durka am Türvorhang vorbei zum Nachbarhaus. »Würde mich nicht wundern, wenn sie die ganze Zeit faul auf ihrer Schlafbank liegt und die Finger zwischen den Beinen hat …«
Manja, die die Anspielung nicht verstand, runzelte die Stirn. Wovon redete diese boshafte Frau?
»Und du solltest endlich achtgeben, dass sie unseren Jungen nicht verführt!«, rief Durka nun wieder ihrem Mann zu. »Hörst du? Ich sage dir das schon seit Monaten! Dieses kleine Biest verdreht ihm noch den Kopf.«
Der Vorhang an der Tür schloss sich, und Manja huschte eilig aus ihrer Deckung und schlich zum Haus ihrer Mutter. Sie hatte genug gehört und verstanden, dass Tante Durka es ernsthaft darauf anlegte, sie und Vilufar voneinander fernzuhalten.
Aber das wird ihr nicht gelingen, dachte sie plötzlich, und in einem Anflug von Trotz fiel der Entschluss, der schon im Verlauf des Tages in ihr gereift war.
Sie würde zu den Kiefernfelsen gehen.
Kurz nach Einbruch der Dunkelheit machte Manja sich auf. Vorsorglich nahm sie Flintstein und Zunder mit, verstaute einen Schopf Feldsalat als Proviant in ihrem Leibrock und machte sich davon, wobei sie zur Sicherheit nicht den Fußweg benutzte, sondern an der gegenüberliegenden Seite des Hauses über den Zaun kletterte.
Den Weg kannte sie, obwohl sie ihn noch nie bei Nacht gegangen war. Das Haus ihrer Mutter lag ganz am Rand der kleinen Siedlung, und gleich hinter dem Erdwall, der das Dorf umgab, begann ein Streifen Brachland mit Buschwerk. Manja überquerte ihn im Mondschein und sah schließlich die finstere Silhouette des umgebenden Nadelwaldes vor sich auftauchen. Hier gab es einen selten benutzten Pfad am Rand eines kleinen Bachs, der zu jener Stelle führte, die Vilufar für seine Nachtwache auserkoren hatte.
Es war stockdunkel im Wald, doch Manja hielt sich nahe am Bachlauf, wo die Fichten weniger dicht standen und das Mondlicht sich im Wasser spiegelte. Sie zwang sich, nicht auf die leisen Geräusche zu achten, die gelegentlich aus dem Unterholz zu beiden Seiten drangen: hier ein Knacken, dort ein Rascheln oder Knistern. Sie wusste, dass viele Waldtiere um diese Zeit zur Jagd aufbrachen, und bemühte sich, an Dachse, Marder oder Hermeline zu denken und nicht an Luchse oder Bären.
… oder an den Wolfsmann.
Ihr Nacken kribbelte plötzlich, und sie begann zu laufen. Das war eine gute Idee, denn das Geräusch ihrer eigenen Schritte übertönte das verstohlene Wispern des erwachenden Waldes. Es dauerte nicht lange, bis sie an einen Felsblock mitten im Wald gelangte, wo der kleine Bach entsprang. Über diesen Ort war sie noch nie hinausgegangen, doch folgte sie einfach dem Pfad, der sich tiefer in den Wald hineinwand. Im Dunkeln war er nicht mehr als eine schmale Schneise niedergetretenen Grases, die im Mondlicht gerade noch zu erkennen war. Er führte durch dichtes Nadelgehölz, das sich wie eine Wand zu beiden Seiten erhob, dann eine steinige Erdterrasse hinab und schließlich zu einer Gruppe uralter Kiefern, deren Wipfel sich hoch über den nackten Stämmen im Nachtwind wiegten.
Schwer atmend hielt Manja inne. Hier endete der Wald, und jenseits eines flachen Felsvorsprungs, wenige Schritte vor ihren Füßen, begann die Steppe. Natürlich wusste sie von dieser Landschaft, die die Ebenen im Süden bedeckte, doch hatte sie sie noch nie gesehen und auch wenig davon erzählen gehört. Die Dörfler mieden diesen Weg und schlugen bei unvermeidbaren Reisen zumeist die Straßen nach Norden und Westen ein, wo weitere Ansiedlungen ihres Stammes lagen. Der Rand der Steppe bildete eine Grenze, die niemand aus freiem Willen überschritt, wie das Ufer eines gefahrvollen Meeres. Manja blickte zum Horizont und meinte tatsächlich, ein beständig wogendes Gewässer zu sehen: Endloses Grasland, von geräuschlosen Wellen aus Wind bewegt. Es sah genauso aus wie in ihrem Traum.
»Gruß, Schwester.«
Sie zuckte zusammen, als Vilufar sich aus dem Schatten einer der Kiefern löste, die ihre Wurzeln am äußersten Rand in die Klippe gegraben hatte.
»Schön, dass du gekommen bist.«
Manja atmete ein paar Mal tief ein und aus, um den Schreck zu dämpfen. Vilufar kam auf sie zu und strich ihr lächelnd eine Strähne ihres verschwitzten Haars aus der Stirn.
»Bist du gelaufen?«
»Ich dachte, du wartest sicher schon lange«, rechtfertigte sich Manja, erinnerte sich plötzlich ihrer Wegzehrung und zog den Salatschopf aus den Falten ihres Rocks. »Schau, ich habe uns etwas zu essen mitgebracht.«
Vilufar strahlte. »Dann komm; wir wollen ein Feuer machen.«