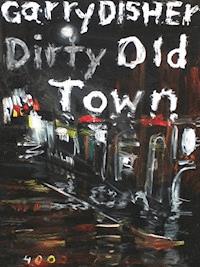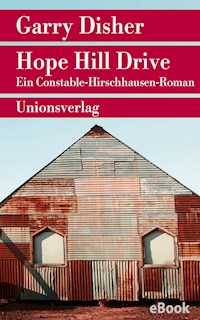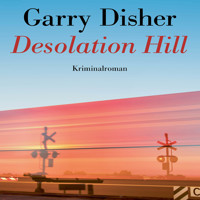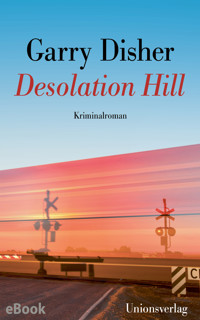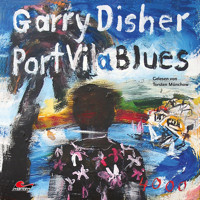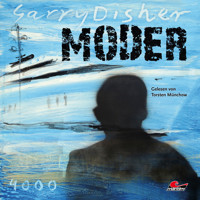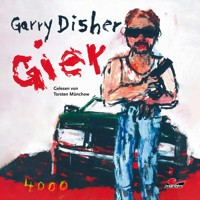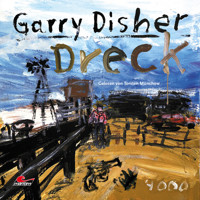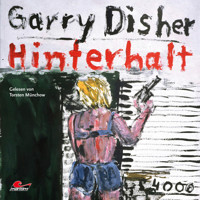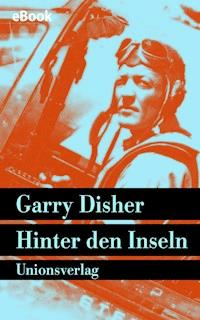
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Neil Quiller, Pilot der Royal Air Force, erfährt, dass der Krieg im Pazifik begonnen hat, als er von japanischen Truppen über dem malaiischen Dschungel abgeschossen wird. Nun beginnt eine dramatische Flucht im Chaos der zusammenbrechenden Fronten und vorrückenden japanischen Truppen. Im belagerten Singapur findet er Liebe und Freundschaft und ergattert einen Platz auf dem letzten Flüchtlingsschiff. Das Schiff wird versenkt, auf einer schwimmenden Tischplatte erreicht er schließlich Sumatra, wo er seine Geliebte wieder trifft. Die Weiterreise scheint unmöglich. Doch Quiller will um jeden Preis zurück nach Australien.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 597
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Über dieses Buch
Neil Quiller, Pilot der Royal Air Force, wird von japanischen Truppen über dem malaiischen Dschungel abgeschossen. Als die Japaner unaufhaltsam vorrücken, beginnt eine abenteuerliche Flucht durch Südostasien. Auf einer schwimmenden Tischplatte erreicht er Sumatra, wo er seine Geliebte wieder trifft. Doch Quiller will um jeden Preis zurück nach Australien.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Garry Disher (*1949) wuchs im ländlichen Südaustralien auf. Seine Bücher wurden mit mehreren Preisen ausgezeichnet, darunter zweimal der wichtigste australische Krimipreis, der Ned Kelly Award, viermal der Deutsche Krimipreis sowie eine Nominierung für den Booker Prize.
Zur Webseite von Garry Disher.
Peter Torberg (*1958) studierte in Münster und in Milwaukee. Seit 1990 arbeitet er hauptberuflich als freier Übersetzer, u. a. der Werke von Paul Auster, Michael Ondaatje, Ishmael Reed, Mark Twain, Irvine Welsh und Oscar Wilde.
Zur Webseite von Peter Torberg.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Garry Disher
Hinter den Inseln
Roman
Aus dem Englischen von Peter Torberg
E-Book-Ausgabe
Mit einem Bonus-Dokument im Anhang
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 3 Dokumente
Die Originalausgabe erschien 2001 unter dem Titel Past the Headlands bei Allen & Unwin, Crows Nest, Australien.
Die Übersetzung aus dem Englischen wurde unterstützt durch das Australia Council for the Arts (www.ozco.gov.au).
Originaltitel: Past the Headlands (2001)
© by Garry Disher 2001
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Getty Images/Taxi/Louise Murray
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30356-0
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 17.05.2024, 18:51h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
HINTER DEN INSELN
Prolog — MaschinenträumeErster Teil — RückzugFlughöheDie Kraft für ein RiesendonnerwetterEin aufgehender MondEin langsam verklingendes, einsames HeulenDie FischreuseDas Wasser schien in den Himmel zu blutenEngländer, die sich um ihre Angelegenheiten kümmern»Und kommt er um in ferner Schlacht«Ein unfreundlicher RegenschauerNimm sie, solange sie noch heiß istZweiter Teil — BlockadeTaximädchenDas gute GeschirrEnttäuschendes neues SpielzeugLodestarFestungskollerDie Durchmischung von Holländisch-IndienDritter Teil — FluchtDie vertrauten Geräusche des KriegesEng wie ein FassNicht gerade das Savoy-HotelKlapser und mürrische KlagenSeine Tage voll trügerischer HoffnungMach ein niedergeschlagenes Gesicht und mach weiterDer Wind und seine EinbildungEine leicht veränderte KarteEine Unterhaltung zwischen verletzten und zweifelnden SeelenEine Atmosphäre leichter TurbulenzenDer einzige Hoffnungsschimmer in der WeltBei dem Wort Kannibalismus erstarrte sieAls der Gelbe Frosch die Wasser der Welt entließPeitsche, Stiefel und JagdgewehrEine kümmerliche GestaltEpilog — Eine gewisse MelancholieEine Anmerkung zu den QuellenMehr über dieses Buch
Garry Disher: »Die Vergangenheit sind wir mit anderen Kleidern«
Über Garry Disher
Garry Disher: Gedanken über die Arbeit am Schreibtisch
Garry Disher: »Ich genieße es, im deutschsprachigen Raum auf Lesereise zu gehen.«
Über Peter Torberg
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Garry Disher
Zum Thema Australien
Zum Thema 2. Weltkrieg
Zum Thema Asien
Zum Thema Krieg
Für Simone Buch
Exultation is the going
Of an inland soul to sea,
Past the houses – past the headlands –
Into deep Eternity –
Bred as we, among the mountains,
Can the sailor understand
The divine intoxication
Of the first league out from land?
Emily Dickinson
Überschwang ist eine Reise
Einer Inlandsseel aufs Meer
Über Häuser – über Klippen –
In das tiefe Nimmermehr –
Wir sind aufgewachsen in den Bergen,
Ob ein Seemann je versteht
Jene göttlich Trunkenheit
Wenn das Land gerad vergeht?
Prolog
Maschinenträume
Haarlem Downs Station, die Küste von Kimberley, nordwestliches Australien, 1934
In den Tagen und Nächten seiner Auseinandersetzung mit der Hitze, dem Staub und seiner eigenen Tollpatschigkeit hält sich der Junge an eines: an das gedämpfte Knirschen der Reifenprofile auf den Schaftrampelpfaden, kurz bevor die Welt erwacht. Er rollt in sanftem, unaufhaltsamem Schwung über den festgetretenen Lehm, tritt nur gelegentlich bei einer Wurzel oder einem steinigen Buckel mitten auf dem Pfad in die Rücktrittbremse. Der Basaltsteilhang im Osten bildet eine starre rosige Linie, eine lange brechende Welle. Bald wird er sich verändern, die Sonne wird ihn rot tünchen. Nicht weit entfernt im Westen bricht sich der Indische Ozean am Eighty Mile Beach. Die Trampelpfade verschwinden an den Dünen.
Man muss sich vorbeugen und mit dem Rad über der Schulter die Sandflanken hinaufsteigen, um den Abhang und den harten Sand am Rande des Wassers zu erreichen. Manchmal ankert eine Perlenflotte am Horizont, oder ein holländischer Gulden wird nach dreihundert Jahren Bewegung und Verkrustung am Meeresboden an den Strand gespült. Auch Neil Quiller besitzt solche Dinge. Ansonsten herrscht nur seine Benommenheit.
Als er in den lang gestreckten Schatten der aufgehenden Sonne die Trampelpfade entlangfährt, spürt er in den Lenkergriffen aus Kork zwei schwache Schläge. Er schlingert, riskiert einen Blick nach hinten und sieht eine Schlange, die sich aufbäumt und nach ihm schnappt, bevor sie im Gras verschwindet. Welchen Nutzen sollen die Gamaschen, dornenfesten Reifen und Seilstücke, die er zwischen die Radgabeln gespannt hat, um Kletten fern zu halten, gegen Schlangen haben? Von Schlangen hat ihm Onkel Leonards Hufschmied nichts gesagt.
Neil fängt an zu zittern. Seine Ellbogen können das Gewicht nicht mehr halten, seine Knie die Pedale nicht mehr antreiben. Er steigt ab und müht sich durch ein trockenes Bachbett, bis er weit genug weg ist von den tückischen Grasschatten und lebenden Dingen, dann setzt er sich auf den Boden, atmet aus und ein und hört das Blut in den Schläfen rauschen. Als er sich wieder gefasst hat, legt er sich auf den einladenden Sand. Wäre der Sand der winterliche Schnee eines Februars im Norden Englands, dann würde er einen Engel zeichnen.
Komische Vorstellung, dass hier die Zeit zehn Stunden vor der Zeit dort ist. Wenn hier der Morgen dämmert, legt sich dort ein langes abendliches Zwielicht über den Tyne. In seinem früheren Leben würde er sich nun weigern, sich hinzulegen, und seiner Mutter klagen, es sei zu hell, um einzuschlafen. Er würde sich vielleicht sogar auf die Hintergasse hinausschleichen und die Eulen beobachten, die in Jesmond Dene nisten, wo in den windgeschützten Schatten heiße Stimmen flüstern, Gummilitzen schnalzen, Stoff an Oberschenkeln schabt, Kohlenaugen aufflammen und beißender Qualm weht. In stillen Nächten kann man die Nietschläger auf den Schiffswerften hören. Dann Dunkelheit und ein neuer Tag. Vielleicht kein Schultag, sondern einer, den er mit seiner Mutter verbringt. Ein Tag, der ihrer kranken Lunge gut tut, an dem sie Kräfte sammelt und sie mit der Eisenbahn in die eine Richtung nach Durham oder zu dem Römerwall fahren oder in die andere Richtung zu der von den Dänen geplünderten Priorei, in der auf einer Landspitze drei uralte Könige begraben liegen, zusammen mit denen, die ihr Leben erst kürzlich an die See, ans hohe Alter oder an die Leiden der Geburt verloren haben.
Neil Quiller ist in Gedanken am Grab seiner Mutter gleich an der Mauer, die den Friedhof von der Schule trennt, in der er ein wenig Freude kennen gelernt hatte.
Das Licht in Newcastle war fahler gewesen, Baumwipfel, Laternenpfähle und Schornsteine hatten einem ständig die Sicht versperrt. Nie hatte er Grund gehabt, nach oben zu schauen und die Farbe des Himmels zu benennen.
Hier, auf der anderen Seite der Welt, schon.
Er schlägt die Augen auf. Der Himmel über ihm ist grenzenlos, und das kann er nicht ertragen.
Vielleicht hatte auch seine Mutter gespürt, wie dieser Himmel auf ihr lastete. Am Ende war sie vor ihm davongerannt.
1917, nach einer Seereise von sechzehn Wochen, war sie mit anderen Krankenschwestern in einem Armeekrankenhaus südlich von London stationiert worden. Kein Marschbefehl, die Abenteuerlust hatte sie dorthin gebracht, denn Hazel war stets gewillt gewesen, Risiken einzugehen und Gelegenheiten beim Schopf zu packen.
Die ganzen netten Kerle, die durch ihre pflegenden Hände gingen. Viele von ihnen sah sie an Wunden, verätzten Lungen und Hoffnungslosigkeit sterben.
Dann war der Krieg zu Ende, und es zog sie nach Aberdeen. Sie konnte nicht zurück ins nordwestliche Australien, nur vorwärts, anderswohin. »Ich dachte, Schottland wäre auch nicht schlechter als anderswo. Aber als wir über die Brücke über den Tyne kamen, hast du in meinem Bauch so gestrampelt, und ich war von dem Fluss, den Schiffen und der Burg so angetan, dass ich einfach aus dem Zug gestiegen bin.«
Sie war voll von Geschichten dieser Art, voll von Geheimnissen. Neil lauschte, zählte zwei und zwei zusammen und zauberte sich so eine Gestalt herbei, die sein Vater hätte sein können: ein englischer Offizier, nein, ein Australier, nein, ein Kanadier, ein Soldat mit einer harten, flachen, tabakbraunen Brust, an den sich die liebeshungrige Wirbelsäule eines Sohnes kuscheln konnte. Ein Mann, der immer ein Grinsen auf den Lippen trug; stets spielten Lichter in seinen Augen. Ein Mann, der später starb oder nach Hause zurückkehrte.
Doch Neils Mutter sagte: »Ach, dein Vater könnte überall und nirgends sein, mein Junge. Mach dir keine Sorgen. Wir haben ja uns zwei.«
In Newcastle war Schluss mit Wegrennen. Es gab einen Sohn durchzubringen und jede Menge Arbeit für eine Krankenschwester in einer Stadt der Hochöfen und des geschmolzenen Metalls. Sie siedelte sich in Jesmond an, nur zwanzig Minuten zu Fuß bis zur Royal Infirmary und zum Stadtzentrum. Als ihre Lungen dreizehn Jahre später der alles durchdringenden Feuchtigkeit erlagen, fragte sich Neil, ob sie dies nicht aus Sympathie mit ihren Soldaten und Schiffbauern taten. Seine Mutter ersparte ihm nichts; das war ihre Art, ihn auf ihren Tod vorzubereiten, und schon bald war er so in ihr Sterben vertieft, dass es ihm wie ein Lebenszustand erschien.
Dass sein Vater ein kanadischer Soldat war, bestätigte oder leugnete sie allerdings nie.
»Tante Crystal und Onkel Len werden dich aufnehmen, mein Lieber«, sagte sie. »Sei stark, mir zuliebe.«
Neil war mit Überseekoffer und Fahrrad vierzehn Wochen auf See. In Fremantle holte ihn der Agent der Schifffahrtslinie ab, eilte mit ihm den Kai entlang und sagte: »Wir haben nicht viel Zeit.« Neil bestieg ein zweites Schiff, den monatlich verkehrenden Dampfer von Fremantle nach Singapur, der ihn in Broome absetzen sollte. Die folgenden sechs Tage stand er an der Reling im gammelnden Gemüsedunst der Kisten rings um ihn herum, frischer Proviant für die Häfen des Nordens.
Crystal, die Schwester seiner Mutter, die sich ein parfümiertes Taschentuch vor die Nase hielt, holte ihn am anderen Ende der Reise ab. Sie war so steif und knorrig wie ein Stück Seil und hatte das rohe Aussehen einer enttäuschten Frau in einem trockenen Klima – ganz anders als seine Mutter, die bis kurz vor ihrem Tod rund und weich gewesen war, stets scharfsinnig und humorvoll. Neil ging neben ihr den langen Anlegesteg in Roebuck Bay entlang, das Fahrrad schlug ihm gegen die Hüfte, ein Timorese hinter ihnen trug den Überseekoffer, doch seine Tante fragte ihn nicht einmal, wie es ihm ging, erwähnte Hazels Tod mit keinem Wort, stellte keinerlei Vermutungen an. Es war, als könne sie ihre Gedanken nicht auf England konzentrieren, auf eine Seereise oder die Bedürfnisse und Kümmernisse eines dreizehnjährigen Jungen. Neil sah ihren Strichmund, was ihn an einen Tag kurz vor dem Tod seiner Mutter erinnerte, an einen Brief, den sie in der Faust zerknüllte:
»Meine Schwester hat nie ein Wort über dich verloren, hat nie anerkannt, dass ich krank bin, hat nie angeboten zu kommen und bei mir zu sein, obwohl Leonard ihr die Überfahrt bezahlt hätte. Ich war immer die bevorzugte ältere Schwester, sah besser aus, war klüger, hatte mehr Glück, und offenbar gilt das selbst auf meinem Sterbebett.«
Dann hatte sie innegehalten und sich weit zurückerinnert. »Leonard war in mich verliebt, musst du wissen.«
Neil, der spürte, dass er nur ein weiterer Schicksalsschlag im Leben seiner Tante war, ging stumm bis zum Ende der Anlegestelle, wo ein staubiger Tourenwagen unter einem Baum wartete. Haarlem Downs, sagte Crystal zu ihm, sei sechs Stunden entfernt, die ganze Strecke nur Staubpisten.
An jenem ersten Abend hatte sein Cousin Cameron gesagt: »Neil, sag mal ›heim‹.«
»Hoim.«
»Hah! Sag mal ›stehen‹.«
Neil tat, wie ihm geheißen. »Stohn.«
Die Dunns rings um den Esszimmertisch grinsten ihn an. Der Schimmer in Crystals Augen war wie ein Nagel zu Hazels Sarg; Onkel Leonards Pfeife gluckerte feucht; Cameron schaute unter seinen schläfrigen Lidern hervor. Neil zog die ihm vertraute Beklommenheit fester um sich und säbelte an seinem Stück Ziegenfleisch herum. Er saß in einem steinernen Zimmer in einem Haus an der Grenze der Zivilisation. Die Esszimmerstühle waren mit Büffelleder bezogen, Gewehre hingen an hölzernen Haken über der Anrichte, es gab ein zerschundenes Klavier, und auf den Regalen setzten Porzellanteller und -schäferinnen Staub an. Er wusste sofort, er würde niemals in der Lage sein, die Gesichtsfarbe der Dunns anzunehmen oder sich ihre Geschichten zu Eigen zu machen, selbst wenn er gewollt hätte.
»Sag mal ›Glas‹.«
»Glos.«
Leonard nahm die Pfeife aus dem Mund. »Cam, lass deinen Cousin in Ruhe.«
Neil warf seinem Onkel einen dankbaren Blick zu und erkannte den Schmerz des Mannes. Du bist deiner Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten: Das Erste, was Onkel Leonard zu ihm gesagt hatte.
Neil steht wieder auf und klopft sich den Sand ab. Das Dämmerlicht ist die Zeit des Herzklopfens: Flüche, die ihn im Zwielicht in Jesmond Dene verfolgten, Schlangen im frühmorgendlichen Staub neben dem Indischen Ozean, böse Erinnerungen.
Er steigt aufs Rad und fährt die Ebene entlang. Er ist nun seit einem Jahr in der hügeligen Gegend von Haarlem Downs; er hat dessen Zerklüftungen und Furchen genau im Kopf, war über und über von Schlamm und Bullendreck bedeckt, war durch Schlammlöcher gewatet, hatte Schutthalden winziger roter, erodierter Steinsplitter durchquert – so rot, als seien Riesen vorbeigezogen und hätten Blutflecken hinterlassen. Er hat sogar das Dollar-S um die parallelen Spuren seiner eigenen alten Reifenspuren gewoben, und letzten Monat verfolgte er die Leprapatrouille, die klaren Umrisse von Hufeisen und die weicheren Abdrücke blanker Füße, als Trooper Dalvean und seine berittenen Eingeborenenpolizisten ein halbes Dutzend Schwarze bewacht hatten, die an den Hälsen zusammengekettet gewesen waren.
Neil fährt, um allein zu sein und die Vergangenheit heraufzubeschwören – manchmal sogar, um sie zu bannen –, doch stets hört ein Teil von ihm auf die Melodie des Fahrrades. Jede Ausfahrt ist ein Test, sind Reifen, Sattel, Pedale und Lenkergriffe Übermittler von Informationen: Die Kette dehnt sich; ein Gewinde ist ausgeschlagen; er hat im Staub hinter sich eine Mutter verloren; eine Schweißnaht ermüdet.
Diesmal ist es der Sattel. Er kippt nach vorn und rutscht im Takt der Bewegung seiner Oberschenkel hin und her. Neil steigt ab: Es fehlt eine Mutter.
Er schiebt das Rad nach Hause.
Dies ist ein Land, in dem Männer, Frauen und Kinder mit den Pferden verschmolzen sind und neue Geschöpfe bilden. Als Neil an der Hengstkoppel vorbeikommt, eine Hand auf dem losen Sattel, kommt Cameron auf einer Stute über den Hof galoppiert und wippt dabei lässig hin und her.
Zu spät – Cameron hat ihn gesehen. »Wer ist denn das da auf dem Drahtesel? Ein Schafscherer? Eine Gewerkschaftsratte?« Er schlägt sich mit dem Handballen vor die Stirn. »Moment mal, das ist doch der Bursche.«
Cameron galoppiert wieder davon. Neil schaut ihm hinterher, wie er an der Frauenhütte der Schwarzen und der Unterkunft des Kochs vorbei hinaus aufs flache Land am Rande von Haarlem Downs reitet, wo die schwarzen Viehhirten weiße Farbe auf eine Begrenzung aus Kopfsteinen klatschen und die frische Erde harken und absammeln. Bald ist Cameron kaum mehr als eine staubige Erscheinung, und Neil stellt sich im Geiste vor, wie er an einem weit entfernten Akazienhain neben einem festgemachten Pferd absteigt und »Jeannie, Jeannie« ruft.
Vergiss die beiden. Neil geht in die Werkstatt, einen riesigen kühlen, dunklen Holzschuppen mit einem von Motoröl durchtränkten Lehmboden. Der Schuppen riecht nach gehämmertem Metall, heißen Abgaskrümmern, geschweißten Rohren, geflickten Reifenschläuchen, nach Ventilen und Dämpfern, die in Schalen mit öligem Benzin liegen. Über der Hauptwerkbank hängen Werkzeuge an einer Wand voller aufgemalter Umrisse – der Himmel helfe denen, die sich etwas ausleihen und nicht wieder hinhängen. Neil bleibt in dem Lichtstreifen am offenen Scheunentor stehen und schaut sich im übervollen Inneren um; schließlich entdeckt er in der hinteren Ecke den Schmied, der vor einer Pumpe hockt. Daneben wartet ein Acht-Zylinder-Motorblock in einem rechtwinkligen Eisengestell, zusammen mit einem Stapel verbogener Brunnenrohre und einer zerbrochenen Mangel aus der Wäscherei darauf, repariert zu werden. Wally Webb ist unersetzlich. Er kann einen kaputten Stuhl flicken, ein Tischbein schnitzen oder eine Viehpeitsche flechten.
»Ach, du bists, Bursche«, sagt Wally.
Das ist ganz freundlich gemeint. Der Schmied ist damit beschäftigt, Kugellager einzuschmieren, und hat nicht genügend Finger für diese Aufgabe. Sein knochiges Kinn weist hinunter in die Eingeweide der Pumpe. »Neil, hältst du mal, bitte?«
Ihre Köpfe berühren sich. Bevor er den Schmied kennen lernte, waren Neils Hände gerade mal gut genug gewesen, einen Löffel festzuhalten oder sich den Hintern zu wischen. Von Anfang an hatte Wally sich geweigert, das Fahrrad aus England zu reparieren. Stattdessen hatte er ihm gezeigt, wie es gehen könnte, und die schlichte Schönheit logischen Denkens gepriesen. Schnell hatte Neil geschickte Finger bekommen und kriegte den Bogen heraus, wie man die einzelnen Schritte einer mechanischen Aufgabe durchdachte, bevor man sich daranmachte, und schon bald konnte er sich in die geheimnisvollen Bewegungen eines Motors oder einer Gangschaltung hineinversetzen, in die Spannungen und Belastungen eines Chassis, so wie andere geboren sind, Pferde zu begutachten.
»Fertig«, sagt Wally.
Sie stehen auf und wischen sich die Finger mit Baumwolllumpen ab. »Dein Sattel ist schief, Junge.«
»Ich hab ’ne Mutter verloren.«
»Schau mal unter der Werkbank nach.«
Neil kauert sich vor eine Kiste mit Bolzen, Muttern und Unterlegscheiben. Hinter ihm schlurfen die Stiefel des Schmieds leise über den Lehmboden. Wally zieht es oft zur Tür. Er lehnt sich gern an den Türrahmen und döst dort für ein oder zwei Minuten, wobei er den Blick auf die verschwommene Linie zwischen Sand und Horizont richtet.
Er hüstelt. »Cameron war vor ’ner Minute da. Hat gesagt, der Boss hätte aus Wyndham gefunkt. Wir können im Laufe der nächsten Stunde mit ihm rechnen.«
Neil findet eine Ersatzmutter und geht zu dem Schmied. Beide starren sie hinaus auf die Landebahn. Die Viehtreiber sind fertig mit Harken und Anpinseln. An einem Ende der Landebahn hängt ein Windsack, aber es gibt keinen Wind, und einen Hangar gibt es auch noch nicht. Einen Monat zuvor hatte es noch nicht mal eine Landebahn gegeben.
»Und nun mach ein niedergeschlagenes Gesicht und mach weiter.«
Neil weiß, was der Schmied denkt. Er denkt an die zusätzliche Arbeit, die ein Flugzeug mit sich bringen wird: ein unbekannter Motor, Staub, verdreckter Treibstoff, Risse in der Bespannung.
Wally kehrt in den kühlen Schatten zurück, Neil bleibt stehen und schaut zu, wie zwei Gestalten aus den Hitzeschleiern auf der Ebene hinter der Steinbegrenzung auftauchen. Jeannie Verco war wohl wieder mit ihrem Zeichenheft losgezogen, und Cam hat sie geholt, damit sie auf Leonards Rückkehr warten können. Sie lassen ihre Pferde langsam gehen, so als hätten sie alle Zeit der Welt, doch schließlich treten sie über die weiße Steingrenze und reiten vorsichtig über die Landebahn auf die Werkstatt zu. Als Jeannie Neil entdeckt, steht sie in den Bügeln auf, winkt und lächelt gerade genug, dass sein Herz einen Purzelbaum schlägt. Ist dieses Lächeln von ihr etwas Besonderes, oder gilt es wahllos allen? Ist sie nur freundlich? Cameron hat Ortsnähe und Geschichte auf seiner Seite, Pferdeverstand und Sorglosigkeit; Neil ist nichts weiter als der arme, blasse Vetter aus einem zugeknöpften, bitterarmen Land. Na ja, Jeannie wird nächste Woche sowieso nicht mehr hier sein. Dann ist sie wieder unten im Süden, trägt eine Schuluniform mit Faltenrock, geht zur Kirche, spielt Hockey, liest mit tintenverschmierten Fingern Wordsworths Gedichte und wartet darauf, dass endlich die Maiferien kommen.
Neil verlässt die Werkstatt und hilft ihr beim Absitzen. Dabei ist Absitzen etwas, das sie schon tut, seit sie laufen kann, aber sie bedankt sich dennoch bei ihm aus einem unerschöpflichen Quell der Zuneigung und guten Laune. Im selben Augenblick erstarren sie, hören das weit entfernte Dröhnen und schauen hoch. Wally steht neben ihnen und reckt ein Ohr in den Himmel. Schließlich beschirmt sich Cameron die Augen gegen die schräg stehende Sonne und bemerkt eher ihre erwartungsvolle Haltung als das Dröhnen des sich nähernden Flugzeugs. Wie Wally öfter in der geschützten Ecke der Werkstatt murmelt, könnte Cameron Dunn keinen Kolben von einer Kneifzange unterscheiden.
Neil entdeckt den Fleck am Himmel. Onkel Leonard ist einen Monat lang an der Ostküste gewesen, hat vom Lieferanten eine Percival Gull übernommen und sich von einem Piloten des Sydney Aero Club Flugstunden geben lassen. Im großen Haus liegt noch die Broschüre: Ein Kabineneindecker mit niedrig angesetzten Flügeln, stromlinienförmig, herausragende Flugeigenschaften, Höchstgeschwindigkeit 165 Meilen pro Stunde, 160-PS-Napier-Javelin-Motor. Noch während Onkel Leonard zum ersten Mal sein Anwesen überfliegt und über dem Schlachtstall und der Nachtweide eine steile Wende macht, verschmilzt Neil bereits mit den schicken Radabdeckungen, der schmucken Schnauze, dem Flugzeuggerippe unter der silbrigen Haut, sein Herz macht einen Sprung, seine Zehen heben sich vom Boden, und sein Schicksal verändert sich für immer.
Erster Teil
Rückzug
7. bis 10. Dezember 1941
Flughöhe
Um 0600, der unverrückbaren Stunde des tropischen Tagesanbruchs so nahe am Äquator, ließ Neil Quiller den Boden unter sich und trimmte die Buffalo für einen nordöstlichen Aufstieg in Richtung der Kumulusformation, die sich über dem Golf von Siam gebildet hatte. In achtzehntausend Fuß Flughöhe bildete sich Eis auf den Flügeln, einzelne Stücke davon platzten ab und peitschten am Cockpit vorbei; als er sich bei zwanzigtausend Fuß wieder ausrichtete, lag die Welt unter einer Wolkendecke, die von Horizont zu Horizont reichte. Für Quiller, das Auge der Morgendämmerung, war das gleichbedeutend mit Blindheit.
Er signalisierte dem Flughafen in Bandar Star, dass er auf fünftausend Fuß über dem Wasser heruntergehen würde. Hier lugte er manchmal unter der Wolkenmasse hervor, glitt durch eine Wolkenschlucht hindurch, links und rechts Wände aus wirbelndem, weißgrauem Wasserdampf. Der Golf lag leer und friedlich unter ihm, doch er wusste, der Wind würde bald auffrischen und die See zu rollen beginnen.
So ging das Tag für Tag: kurze Gelegenheiten zur Aufklärung, bevor der Himmel wieder grau wurde und sich mit heftigen Schauern und massiven Regenfronten füllte, die hoch und schwer hingen und weiter übers Meer hinausragten, als ein einfaches Flugzeug fliegen konnte. Unter diesen Bedingungen war nichts zu sehen, keine Neuigkeiten von japanischen Konvois, die Quiller mit nach Bandar Star hätte nehmen können.
Die Schlucht umschloss ihn. Er war vollkommen blind.
Einen Augenblick später, zwischen 0642 Uhr und der Zeit, die er brauchte, um die Buffalo zu stabilisieren und den Fotoapparat auszulösen, blieb die Sicht klar und enthüllte einen leichten Kreuzer und drei Transportschiffe auf Position 0900 Grad, Kurs 270 Grad. Während er die Einzelheiten nach Bandar Star durchgab und weiter die Kamera bediente, eröffnete der Kreuzer das Feuer, an den Geschützen waren Rauchwölkchen zu sehen, und er spürte, wie sich sein Magen vor lauter Angst und Hochgefühl zusammenkrampfte. Wenn Japan der Krieg erklärt worden war, dann war er wohl der Letzte, der davon erfuhr.
Er drehte ab und war dankbar für die niedrigen Wolken und den Regen, der plötzlich an ihm vorbeifiel.
Danach hielt er sich an das Beobachtungsgebiet und flog es bis an die Grenze seines Treibstoffvorrats ab, doch entdeckte er weder den Konvoi wieder noch irgendein anderes Schiff. Mit einem Auge auf dem Geschwindigkeitsmesser wendete er. Er war nun seit mehr als zwei Stunden in der Luft und musste noch den südwestlichen Golf und die Landenge von Malaya überqueren – wobei er von Wolke zu Wolke hopste, während sich Schauer und Sonne abwechselten –, bevor er nach Bandar Star kam, das zwischen der Andamanensee und der Malakkastraße lag. Sollte vom Kreuzer ein Wasserflugzeug katapultiert worden sein, um ihn abzufangen, dann brauchte er Augen im Hinterkopf.
Quiller tauchte aus den Wolken auf, überquerte die Küste von Malaya bei klarer Sicht und überflog mit hoher Geschwindigkeit einen Streifen verdreckten Sandstrandes, der von den Kokospalmen eines Fischer-Kampongs gesäumt wurde. Dann Reisfelder, Dschungel und schließlich terrassierte Hügelflanken mit Lehmstraßen wie braune Risse in dem vielfältigen Grün. Er flog tief, in der Hoffnung, durch die ihn verdeckenden Wolken nicht gesichtet werden zu können, falls jemand hinter ihm her war. Seine Angst löste sich langsam, zurück blieb nur das Hochgefühl. Malaya war so bemerkenswert und komplex, wie es für ihn fünfzehn Monate zuvor England gewesen war, als er die Grafschaften im Südosten des Landes vom Cockpit eines RAF-Trainingsflugzeuges aus gesehen und seinen langen Aufenthalt im leeren Norden Australiens endlich abgestreift hatte. Er schaute einfach zu, wie sich alles vor seinen Augen entfaltete – von den Palmwedeln hin zu dem von Hühnern zerscharrten Boden und den knochigen, vom Schwanz umwedelten Flanken der Dorfkühe. Kinder schwärmten rennend umher, und winzig kleine Ziegen zitterten vor Nervigkeit und dem reißenden Heulen des Motors in ihren weichen Ohren. Als er später nach Süden abdrehte und den Anflug auf Bandar Star vorbereitete, überraschte er auf der Jitra Road eine Kompanie von Pandschabi-Soldaten in einer Reihe offener Laster.
Als er den Flugplatz sehen konnte, klappte er die Landeklappen herunter und nahm das Gas zurück, bis er den Motor fast abgewürgt hatte, dann ließ er sich vom buckligen Rücken des Elephant Hill fallen und fing die Maschine ab, wobei er gegen einen Wind halten musste, unter dem sich die Kokospalmen bogen. Er überquerte den kleinen Fluss, die Umzäunung und die Blenheim-Bomber in ihren Erdunterständen und traf in einem flachen Winkel auf die Hauptlandebahn. Selbst jetzt noch drückte ihn der Wind nach unten und zur Seite, und er spürte, wie sich die Maschine im feuchten, grasigen Randstreifen verfing. Bevor sie bis zur Achse darin versinken konnte, gab er Gas und fuhr unter dem höhnischen Jubel der Bodenmannschaft, die ihre Tage damit verbrachte, die kleinen Tankfahrzeuge und die Schlepptraktoren aus dem klebrigen Matsch zu buddeln, auf die mit Metallplatten belegte Landebahn zurück.
Neil Quiller rollte nach links in den Schutz eines Hangars, wo Whitney und seine Mechaniker einen Bomber ausrüsteten. Er machte den Motor aus, beugte sich seitwärts aus dem Cockpit und rief über den Wind und den Motorenlärm, der noch immer in seinen Ohren klang, hinweg: »Irgendwelche Löcher drin?«
Der Unteroffizier legte den dicken Kopf zur Seite. »Sollten denn da welche sein?«
Quiller sprang ab. »Die Mistkerle haben auf mich gefeuert, Whit.«
»Wirklich? Sind Sie sicher? Is ja ’n Ding.«
Sie gingen gemeinsam eine Rumpfseite ab, um das Höhenleitwerk und die andere Seite wieder zurück. Die Außenhaut, die im blassen Blaugrün des Himmels gestrichen war, spannte sich eng um das Gerippe; es gab keine Risse, keine klaffenden Löcher. Die Zwanzig-Inch-Kamera in ihrem Schacht war unversehrt. Whitney kauerte sich hin, linste an der Unterseite entlang und fuhr mit dem Finger über einen schlierigen, stinkenden feuchten Fleck. »Wie hübsch.«
Immer wieder ergoss sich Benzin aus dem Überlauf unter dem Rumpf entlang, direkt unterm Cockpit. Whitney und Quiller waren sicher, dass es sich eines Tages entzünden würde. Sie betrachteten das ganz gelassen. Es lohnte sich nicht, an der Buffalo herumzutüfteln. Es handelte sich um eine veraltete Maschine, die zu fast nichts taugte, und alles, was man tun konnte, war die Arme zu verschränken und sich von nichts überraschen zu lassen.
Quiller zog das Filmmagazin aus der Buffalo, während Whitney weiter ohne große Erwartung oder allzu viel Interesse den Kopf an der Unterseite entlang reckte. Er war ein großer, grobknochiger Mann, der sich stets an etwas festhielt, wenn er um seine Maschinen turnte: eine Radverstrebung für die Zehen, der Rand eines Bombenschachts für den Bauch, ein Hebel für eine seiner Hände. Angesichts des Rostes, des Schimmels, der sorglosen jungen, unerfahrenen Bomberpiloten und des Mangels an Magnetzündern, Reifen, Bewaffnungen, Handbüchern, eigentlich allem, was eine Flugstaffel brauchte, blieb er die Ruhe selbst.
Ein Stabswagen kam hereingefahren und hielt an, und Whitney murmelte hinter einer Radabdeckung: »Himmel, Arsch und Wolkenbruch, Janeway.«
»Der will was von mir«, sagte Quiller.
Whitney kam unter der Maschine hervor und klopfte sich die Hände ab. »Oder von uns beiden.«
Der Fahrgast stieg aus und kam auf sie zu. »Neil. Mr. Whitney.«
»Captain«, entgegneten sie.
Janeway trug eine Army-Uniform und die Ordensbänder des 16th Punjabi Regiment; er hatte früher einmal an der Nordwestgrenze Indiens gegen die Pathanen gekämpft. Nun war er Verbindungsoffizier zur Luftaufklärung und Quillers und Whitneys Schatten, hing ihnen stets an der Hacke oder linste ihnen über die Schulter. Sein Gesicht, seine ganze Art passte dazu: scharf geschnitten, aufmerksam und unabänderlich neugierig, schleichend und stets auf der Hut. Seine Wachsamkeit wirkte manchmal anziehend, vor allem, wenn plötzliche Erkenntnis in seinen Augen aufblitzte und seine Zähne vor Geheimnissen und Verbindungen glitzerten, doch manchmal fand Quiller ihn einfach nur abstoßend. Janeway konnte keine klare Antwort akzeptieren, sondern suchte nach Einschränkungen, lauerte und bohrte nach, selbst wenn Quiller ausgepowert war oder zu spät zu einem Termin kam.
Janeway wandte sich an Whitney. »Whit, wenn ich mit Flight Lieutenant Quiller fertig bin, möchte ich das Flugfeld besichtigen.«
»Hat sich seit gestern nicht viel verändert«, sagte Whitney.
»Seit gestern hatten wir ziemlich viel Regen und Wind«, erwiderte Janeway. »Ergo: Sind wir voll funktionstüchtig? Die Bomber stehen im Wasser; Blechfetzen und Holzstücke sind die ganze Nacht umhergeflogen; die Grasstreifen sind schlammig; was tun wir, wenn alle vier Tankwagen stecken bleiben?«
Whitney zuckte mit den Schultern. »Sie sind der Chef.«
Dann nahm Janeway Quiller beschützerisch und vertraulich beiseite. »Neil, ich will alle Informationen über Ihr Abenteuer heute Morgen.«
Fragen stapelten sich auf Fragen. Wie viele Schiffe? Welche Peilung, ganz genau? War er sicher, dass sie auf ihn gefeuert hatten? Hatte er vielleicht eine Übung für einen feindlichen Angriff gehalten? Wie lange war der Konvoi zu sehen gewesen? War er sich sicher?
Dann: Hatte er ein klares Sichtfeld für die Kamera? Hatte er Vertrauen in die Buffalo? Worüber genau gab es was zu meckern? Arbeitete er effektiv, seiner Meinung nach? Schätzten sie in der Einsatzzentrale unten in Singapur seine Arbeit?
Und: Nur mal für den Augenblick angenommen, Quiller sei der Feind – wie würde er Bandar Star funktionsunfähig machen?
Einige der Fragen waren schon älter, so als erwarte Janeway, dass Quiller in den vergangenen Tagen und Wochen darüber gebrütet habe; andere hatten nur wenig mit Quillers Aufgaben zu tun. Quiller versuchte zu antworten, hielt manchmal inne, um seine Erwiderungen zu formulieren, doch Janeway sprang jedes Mal in diese Lücke, warf noch eine Frage nach und erschöpfte ihn damit. Janeway roch nach Seife und Rasiercreme und hatte offensichtlich nicht den Befehl gehabt, bei Sonnenaufgang aufzusteigen und in einem Cockpit zu schwitzen, aber er war zugleich voll freundlicher Neugier, also antwortete Quiller – er war müde, hungrig und musste dringend aufs Klo – so höflich, wie er konnte, fuchtelte schließlich mit dem Filmmagazin herum und sagte: »Mike, ich muss das hier abliefern und dann zur Einsatzbesprechung.«
»Haben Sie später Zeit?«
Quiller warf einen Blick zum tosenden Himmel hinauf. »Ja.«
»Wir fahren nach Penang.«
Penang war eine halbe Stunde entfernt. Janeway hatte dort eine Weißrussin als Geliebte. Im Kampong auf der anderen Flussseite vom Flugplatz hatte er eine Malaiin und in Tanah Rata, am höchsten Punkt der Cameron Highlands, eine grüne Witwe aus Buckinghamshire. Manchmal, wenn er getrunken hatte, beschrieb er eine von ihnen. »Doras Möse ist wie eine große, alte aufgeplusterte Rose – wahrscheinlich vom jahrelangen Reiten.« Er wusste auch, wo man in den vielen kleinen Seitengassen von Penang essen konnte.
»Mike, ich muss bei Sonnenaufgang wieder zur Aufklärung raus.«
Janeway zuckte freundlich mit den Schultern. »Na gut, dann bleiben wir irgendwo hier in der Nähe. Wie wärs mit dem Lulu-Club in Bandar Star?«
»Prima.«
Janeway drehte sich um und kletterte auf den Beifahrersitz des Stabswagens. Whitney starrte hinter ihm her und rief schließlich: »Sir, ich dachte, Sie wollten eine Führung über den Flugplatz?«
»Später. Muss mich sputen.«
Janeways Fahrer fuhr die Gänge des Wagens jaulend aus und ließ eine Abgasfahne hinter sich, die schon bald vom Wind weggepeitscht war. Whitney schüttelte den Kopf. »Der Mistkerl hetzt immer irgendwo rum.«
Quiller ging zu ihm, und gemeinsam schauten sie zu, wie der Wagen durchs Haupttor hinaus auf die Brücke und über den Fluss fuhr. »Er hat eine Frau im Kampong.«
Whitney nickte. »Ich sag Ihnen, Quill, ich würde hier draußen keine Möse anrühren, und wenn Sie mir Geld dafür anbieten würden.«
Aber der Wagen bog nicht zum Kampong ab. Er fuhr nordwärts auf Jitra zu. Whitney sagte: »Vor zehn Tagen hat er sich von einem der Fahrer bis an die Grenze bringen lassen. Hat den ganzen Tag auf Nebenstraßen verbracht und Brücken und Abzugskanäle fotografiert.«
Quiller nickte. »Letztens musste ich für ihn Luftaufnahmen machen. Straßen und Wasserwege. Er meint, wir sind auf einen Luftangriff eingerichtet, aber was, wenn ein Angriff vom Boden aus erfolgt?«
Der Adjutant des Staffelkommandanten tauchte auf. »Quill, Freddy möchte Sie sehen.«
Quiller folgte ihm und bahnte sich einen Weg zwischen den Hangaren und den Zapfanlagen, dann hinter dem Gefechtsstand hindurch zum Einsatzraum. Die Einsatzbesprechung dauerte eine Stunde, und Quiller beharrte stur darauf, dass von einem leichten Kreuzer auf ihn gefeuert worden sei. Diese Information beunruhigte die Männer, die ihn befragten. Quiller erkannte, dass seine Auskunft für den Rest des Tages an den Ecken angefasst und vorsichtig weitergereicht werden würde und dass sie sich eine ganze Weile am Kopf kratzen würden, bevor jemand Singapur benachrichtigte.
Als sie ihn wieder gehen ließen, war es fast Mittag. Er machte sich daran, den umgrenzenden Zaun an der Innenseite abzulaufen, wie es ihm nach einem Einsatz zur Gewohnheit geworden war. Quiller sah nicht zum Flugplatz hinüber, sondern hinaus wie ein Gefangener, den es nach den Möglichkeiten der Welt hungerte. Er schlenderte am nördlichen Zaun entlang, von wo aus er den Lipis-Fluss, den Kampong und die Küstenstraße sehen konnte, die bis zur Grenze nach Siam führte. Janeways Kampongfrau lebte in einer kleinen Hütte am Flussufer, oberhalb eines seichten Abschnitts, wo sich die Kampongmänner jeden Morgen erleichterten und ihre dürren Hintern über den Schlamm hielten. Westlich der Straße lag Elephant Hill, und auf einer Linie damit, zwischen dem Fluss und der Straße nach Bandar Star, stand ein Gebäude, das er gut kannte: das Gästehaus der Regierung. Quiller hatte im Oktober dort eine Woche verbracht, bis auf dem Flugplatz eine Unterkunft frei wurde. Es hatte dort ein dickes, klammes Gästebuch gegeben, das in der Rezeption auf einem Teaktisch lag, und als Quiller eines Abends müßig darin blätterte, war er auf einen Eintrag vom Mai 1930 gestoßen. Amy Johnson. Er wusste alles über diesen Flug. Sie hatte in neunzehn Tagen eine DeHaviland Moth von Croydon nach Darwin geflogen.
Er setzte seinen Weg am Zaun entlang fort und lauschte, wie ein Bambushain von dem Wind, der ihn umwehte, klackte und knarrte. Quiller schnüffelte: In einer Luftströmung, die satt war von den Ausdünstungen des Flugbenzins, der Sturmfront und den vor sich hin modernden menschlichen und tierischen Behausungen, wirbelte ein Hauch von Gewürzen, Fisch und Hühnerfleisch, die in heißem Öl brutzelten. Der Hunger trieb ihn fort vom Zaun quer über den Flugplatz. Er hüpfte über die grasbewachsenen Landebahnen. Sie waren durchweicht, schwammig wie Matratzen, das Wasser lief nicht gut ab. Nichts war zufrieden stellend – nicht die Pandschabi-Wachen und ihre armseligen Stellungen, nicht der rudimentäre Kontrollturm, die schlechte Wartung der Bomber und seiner Buffalo, nicht das Durcheinander der Oktanzahlen, dem er hin und wieder begegnete. Es gab keinen Schutz aus der Luft, kein Radar, und alles versank in Langeweile, Rost und Schimmel. Vieles davon hatte er Janeway gesagt, in der Hoffnung, dass irgendjemand in Singapur vielleicht eines Tages aufschreckte und Notiz davon nahm.
Quiller ging durchs Haupttor hinaus auf die Straße nach Bandar Star. Nach einer Weile kam er an die Anlegestelle einer Fähre, wo er sich vier Chinesen anschloss, die mit ihren Fahrrädern warteten, einem Jeep und dessen Fahrer von den 2/16. Punjabi und einem Malaien, der einen Karren voller Bananenblätter schob. Quiller schaute zu, wie das zerfranste Kabel sich aus dem trägen braunen Wasser hob und die Fähre sich ächzend und schaudernd auf sie zu bewegte; das Kabel war nun gespannt, und Wasserperlen sprangen davon ab, als würde ein elektrischer Strom hindurchgejagt.
Im Kampong auf der anderen Flussseite wurde Quiller von salutierenden Kindern überfallen, die »Hello, Joe« riefen und zwei Finger v-förmig als Siegeszeichen in die Höhe reckten. Sie umschwärmten ihn, zerrten an seinen Händen und zupften an seinem Baumwollhemd, das ihm an der verschwitzten Haut klebte. »You want cigarette, Joe? You want soap? Apple, twenty cent.«
Quiller gab einem Kind das Geld und steckte ein weiches, braunes Bällchen von Apfel in die Tasche. Als er weiterging, folgte ihm die Hälfte der Kinderschar, doch er ging schnell, ein verrückter Engländer in der Hitze, und sie blieben nach einer Weile zurück und riefen selamat jalan, gute Reise.
An der Seeseite des Kampong, dort, wo die Haubitzen hinter Sandsäcken aufgebaut worden waren, inmitten der Bäume und Papayas, die übervoll mit gelben Früchten hingen, entdeckte er den Essensverkäufer. Der alte Mann sah ihn und eilte schnell fort von den indischen Artilleristen, und seine Flechtkörbe hüpften auf einem verbeulten Blechtablett, das über dem Vorderrad seines Dreirades montiert war. Quiller kaufte Reisbällchen in Bananenblättern und ein dickes Stück trockenen gewürzten Fisch. Die Augen des alten Mannes waren feucht, das Weiße darin schlammfarben. Dürres Haar sprang wie überrascht von seiner runzligen Stirn nach hinten. Er war sehnig und sehr alt und hatte manchmal einen Affen dabei, den er abgerichtet hatte, um Kokosnüsse zu holen. Der Affe war unentwegt zornig und bleckte der Welt die Zähne.
Quiller wanderte zwischen den Bambushütten zurück, und die Dörfler schauten ihm von ihren Treppenstufen aus hinterher. Sie wussten, dass er ihren verschiedenen Haushalten etwas Geschäft brachte – eine kleine Mahlzeit hier, ein Haarschnitt oder Nadel und Faden dort –, doch ansonsten interessierten sie sich nicht für ihn oder für die Bedrohung durch den Krieg. Sie waren anders als die Chinesen, denen Quiller in Bandar Star begegnet war. Er fragte sich, wie sehr sie ihn wohl mögen würden, wenn er kein Kleingeld in der Tasche und nicht ein paar holprige Grußformeln und Segenswünsche auf den Lippen hätte.
Ein kleines, schüchternes, strahlend lächelndes Mädchen, das an einem festen Stock über der Schulter zwei offene Benzinkanister voller Brunnenwasser schleppte, kam auf ihn zu. Es war ihm schleierhaft, woher sie die Kraft dafür nahm. Ihre Augen sahen ihn unentwegt an, und ihre Last schob sie voran; sie konnte nicht stehen bleiben, und ihre bloßen Füße lösten kleine pudrige Staubexplosionen aus und umkurvten geschickt die ziellos umherspringenden Zicklein und beinahe federlosen Hühner. In der Nähe stand eine Kuh, und Quiller fragte sich, warum das Kind die Stange nicht einfach über deren mächtigen Rumpf legte und ihr auf dem Weg zum Brunnen und zurück mit der Hand aufs zähe Leder klopfte oder an den langen Ohren zog
Jede noch so kleine Anstrengung war schweißtreibend. Quiller warf einer Ziege den schrumpligen Apfel zu und öffnete einen Hemdknopf. Er schätzte die Temperatur auf über dreißig Grad, trotz der drohenden Stürme. Die Luftfeuchtigkeit war durchgängig hoch, und die Männer, mit denen er diente, klagten unablässig. Er selbst war während der Regenzeit in Broome und Darwin gewesen und kannte sich damit aus. In Broome und Darwin hatte er auch seine Vorliebe für scharfe Gerichte aus einem zischenden Wok entdeckt. Er bemühte sich, nah bei den Hütten zu bleiben, suchte Schatten und wischte sich ab und zu die Stirn. Er öffnete einen weiteren Knopf an seiner schweren, unpassenden Uniform und warf einen neidischen Blick auf die Hemden und Sarongs, die langsam an den Stangen trockneten, die aus den Fensterläden ragten. Er fragte sich, ob man in Whitehall die Welt stets nur in den Begriffen der nördlichen Welthalbkugel betrachtete.
Er trat unter einer Telefonleitung hindurch, die zu den Stellungen am Strand führte. Sie hatten es mit Funk versucht, doch sie waren vom statischen Rauschen besiegt worden, die Wattleistung war mit der allgegenwärtigen Feuchtigkeit des Bodens, den Kokospalmen, den riesigen Dschungelblättern, die überall wie Schwerter und Schilde herumhingen, davongesickert. An der Anlegestelle schaute er flussabwärts zu einer weiten Biegung, wo die Nährstoffe der Erde sich im Laufe der Zeit angesammelt hatten und nun Reisfelder trugen. Ein Wasserbüffel hatte ihm den Schädel zugedreht und starrte ihn an; seine Hörner ragten nach hinten über den Nacken. Dann schüttelte er die Insekten aus den tränenden Augen, und der Eindruck böswilliger Absicht verflüchtigte sich.
Quiller überquerte den Fluss zusammen mit einem Kurier der 6th Rajput Rifles und einem Hadsch, der zum Zeichen, dass er die Pilgerfahrt nach Mekka unternommen hatte, ein weißes Käppi trug. Über ihnen kam ein Blenheim-Bomber zu schnell über den Elephant Hill, und Quiller hörte, wie die Maschine die Landung abbrach und eine Schleife drehte. Der nächste Anflug war langsam und zögerlich.
Quillers Zimmer befand sich in einer lang gezogenen, tristen Hütte mit zehn ähnlichen Zimmern. Er duschte, nahm eine seiner täglichen Atribintabletten zur Malariaprophylaxe und versuchte zu schlafen, doch der Wind nahm zu, und dann regnete es. Die Bambuswände rings um ihn gaben nach, die Palmwedel über seinem Kopf entwirrten sich, und seine Metallpritsche bewegte sich im Wind, der um die Zementblöcke pfiff, die die Hütte der Offiziersmesse über dem feuchten Boden hielten. Er lag mit offenen Augen da. So früh am Tag und bei diesem stürmischen Wetter gab es keine Moskitos, dennoch hatte er das Moskitonetz rings um die Pritsche geschlossen, um so etwas wie Nacht anzudeuten und sich das Einschlafen zu erleichtern. Er schwitzte in der klammen Luft. Leichte Windböen, die durch schmale Spalten in den Außenwänden pfiffen, zerrten und drückten am Netz. Im Nebenzimmer hörte er das Knarren von Bettfedern, bloße Füße, die auf den Boden patschten, das kehlige, stickige Stöhnen eines Mannes, der schlecht geschlafen hatte und der dies, bevor er in diese Hölle auf Erden versetzt worden war, auch noch nie zuvor am helllichten Tag versucht hatte. Der Nachmittag ging vorbei. Dann gab es vor Quillers Fenster einen Ausbruch von Gelächter, als eine Horde junger Piloten zur Kantine ging, Michael Janeway klopfte an die Tür, und in der Moschee jenseits des Flugplatzes riefen heilige Männer zum Abendgebet.
Janeway brachte ihn zu einem Stabswagen. »Sie fahren.«
Quiller setzte sich hinters Steuer. »Wo sind Sie denn heute hingefahren?«
Janeway deutete in Richtung des nördlichen Grenzlandes. »Ach, überall und nirgends. Gibt ja immer irgendeinen Mist zu erledigen.«
Quiller bremste am Haupttor und beschleunigte dann, als er auf die Straße nach Bandar Star hinausfuhr. Janeway saß halb seitlich auf dem Beifahrersitz, einen Arm über Quillers Rückenlehne, und seine Finger trommelten einen Rhythmus hinter Quillers Nacken. Als es wegen der Chinesen und Chinesinnen auf ihren Fahrrädern am Eingang zu den schmalen Straßen der alten Stadt eng wurde, bremste Quiller ab. Er kroch vorwärts. Tiefe Gräben zogen sich an den offenen ebenerdigen Veranden der verschmierten, weiß getünchten Läden entlang. Chinesische Schriftzeichen liefen die netzartig verzierten Säulen hinab, und neuere Schilder auf Packkistendeckeln und Blechtafeln verkündeten: Tommy Digger Steak and Egg Cafe, oder English Australian Cafe Fish and Chip Served. Sie kamen an einem Kino vorbei, das Quiller ein halbes Dutzend Mal aufgesucht hatte, meistens allein. Er mochte die Gangsterfilme, die dort gezeigt wurden, ebenso gern wie die malaiischen und chinesischen Besucher, und fand, dass nichts das europäische Prestige besser unterminierte als ein Gangsterfilm, in dem Europäer das Gesetz brachen und ihre Frauen nackte Schultern zeigten. Die Einheimischen waren hingerissen und neigten dazu, Schock und Freude verbal zum Ausdruck zu bringen, und sie beäugten Quiller, wenn sie danach den Saal verließen, und schätzen dieses Rundauge nun ein, zwei Stufen niedriger ein als zuvor.
Quiller legte den Ellbogen auf die Fensterkante und hob seinen klebrigen Rücken vom Rücken des Ledersitzes. Janeway trommelte mit den Fingern. »Sagen Sie mal, Neil, sind Sie auch der Ansicht, dass die Japse nachtblind sind?«
Quiller zuckte mit den Schultern. »Jedenfalls erzählt man das.«
Janeway sah hinaus auf die Masse der Radfahrer, deren schwarze Schöpfe über den weißen Hemden wippten. »Wie würden Sie denn die Dinge in Bandar Star verbessern?«
»Das hatten wir doch schon alles, Mike.«
»Mir zuliebe. Was reden denn die Piloten so untereinander? Ich werde Sie auch nicht zitieren.«
Quiller wandte sich zu ihm um. All seine Enttäuschung brach aus ihm heraus. »Wir haben nicht genug Codebücher, Karten und Instrumente, um über die Runden zu kommen, also ist jeder bei der Einsatzbesprechung vor dem Flug auf sich allein gestellt. Die Flugzeuge stehen schlecht ums Feld verteilt, die Erdwälle der Schuppen sind völlig nutzlos, wenn wir jemals angegriffen werden. Wir haben keine Luftdeckung, und die Wartung ist ein Albtraum.« Er sah weg. »Das wissen Sie alles. Tun Sie was.«
Janeway rieb die Hände aneinander. »Alles zu seiner Zeit. Bewaffnung? Würden Sie die für adäquat halten?«
Quiller machte eine Handbewegung. »Fragen Sie den Stückmeister.«
»Das mach ich«, sagte Janeway. »Was ist mit dem Nebelvorhang? Wird der funktionieren? Haben Sie ihn schon mal in Aktion gesehen?«
»Mike«, entgegnete Quiller, »das ist alles noch nicht spruchreif. Reden Sie mit Freddy darüber.«
»Ja, natürlich«, sagte Janeway. Dann: »Die Australier haben eine Buffalo-Jägerstaffel bei Kota Bharu. Wie würden Sie die Buffalo als Jäger einschätzen?«
Quiller zuckte mit den Schultern. »Langsam. Ich brauche eine halbe Stunde, um Gipfelhöhe zu erreichen. In einer halben Stunde kann viel passieren.«
»Es gibt Gerüchte aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen, dass wir Hurricanes kriegen.«
»Gerüchte«, sagte Quiller und gab Gas, schaltete in den ersten Gang zurück und beschleunigte, als die Straße wieder frei wurde. Dann staute sich der Verkehr wieder. Sie steckten im Schwarm der unvermeidlichen heimkehrenden Radfahrer und standen hinter einer Schlange staubiger Tourenwagen, die langsam durchs Tor zu einer großen Villa verschwand, die ein wenig zurückgesetzt von der Straße stand. Das war der Club der ortsansässigen Europäer: Plantagenbesitzer, Zinnminenverwalter, Beamte, Schiffsagenten, Army- und Luftwaffenoffiziere. Es gab jetzt mehrere Gesellschaftsräume und eine Tanzfläche, doch vor zehn Jahren war es noch ein reiner Männerclub gewesen, und die Frauen mussten sich auf den so genannten Kuhstall beschränken. Das Schild hing noch immer an der Tür zu dem Raum.
In Quiller fand eine Veränderung statt. In den Jahren des Exils in Australien hatte er sich an die Vorstellung geklammert, er sei Engländer und gehöre nicht dorthin. In England hatte man seine lang gezogenen Vokale bemerkt, und er wurde nie wirklich in die Gesellschaft der Engländer aufgenommen.
Hier in Malaya war er vollkommen entwurzelt. Er hielt die englischen Zivilisten für nutzlos, für immer verloren, mit ihrer Abhängigkeit von ihren Clubs, ihren Longdrinks in Rohrstühlen bei Sonnenuntergang, dem ganzen Brimborium der Klassen und der Feinheiten in Kleidung und Essen, ihrer Obsession mit der Hitze und dem Bedienstetenproblem. Die Offiziere in Quillers Messe waren nicht viel besser: jene besondere, alles beherrschende Empfindlichkeit hinsichtlich seiner Aussprache und seiner Tollpatschigkeit mit Rugby-Ei und Cricketschläger; seine Einfühlung in örtliche Gepflogenheiten, seine Neugier und Anpassungsfähigkeit. Quiller musste sich nach dem Dienst nicht in einen Club zurückziehen. Er brauchte keine Erholung von dem Stress, mit fremdländischen Lebenseinstellungen zu tun zu haben oder sein Gesicht wahren zu müssen.
Sie fuhren am Club vorbei und kamen ein Stück weiter die Straße entlang zum Lulu-Club, in dem es ein Kabarett gab, eine Bar, eine Tanzfläche und Whisky Soda für fünfundvierzig Cents. Quiller parkte in der nächsten Seitenstraße, sie gingen zurück und bahnten sich einen Weg durch ein Knäuel aus australischen und indischen Militärangehörigen, die sich vor der Tür drängten. Janeway trennte sich sofort von ihm und senste sich mit seinen spitzen Ellbogen einen Weg durch die tanzenden Paare hin zu einer Animierdame, die auf einem Hocker an der Bar saß. Quiller schaute eine Weile durch den Qualm hinweg zu, wie Janeway mit ihr tanzte. Der Tanz war voller Schlenker und Andeutungen. Janeway knabberte der Frau am Hals und fuhr mit der rechten Hand nach dem Spalt ihrer Gesäßbacken. Quiller ging zur Bar und bestellte sich über den Lärm hinweg ein Bier. Etwas später sah er Janeway mit einem indischen Lieutenant zusammen. Der indische Offizier hatte sich über den kleinen Tisch zwischen ihnen gebeugt, schob eine Tabaksdose durch einen Fleck vergossenen Bieres und hörte Janeway aufmerksam zu, der ihm ins Ohr redete. Dann schauten die beiden Männer ein paar Sekunden lang auf ihre Uhren, so als zählten sie die Stunden bis zu einem für sie wichtigen Ereignis. Quiller hatte den Lieutenant schon mehrere Male vorher im Lulu-Club und in der Offiziersmesse gesehen. Janeway wollte zwar immer eine Verbindung zwischen ihnen hervorheben, die sich aus ihrer unbehaglichen Zeit in den Diensten Seiner Majestät ableitete – »Keiner von uns passt wirklich hierher, wissen Sie? Ravi, Sie wollen ein befreites Indien; Quill, Sie sagen selbst, dass Sie weder Brite noch Australier sind; und ich bin im Fernen Osten aufgewachsen« –, aber Quiller hatte nicht den Eindruck, dass einer von den beiden ihm traute.
Quiller, der sich in dem Qualm, den Rufen und dem dicken Dunst verschütteten Biers ziellos und einsam vorkam, bahnte sich einen Weg zu ihrem Tisch hinüber. Er brauchte jemanden, der ihm auf die Schulter klopfte und ihn in die warme Mitte zog. Noch bevor er bei ihnen ankam, bemerkte der Inder ihn und drückte kurz Janeways Unterarm, und Janeway richtete sich auf und beobachtete Quiller beinahe wütend mit einer Mischung aus Wachsamkeit und schnell zurechtgelegten Kriegslisten:
»Neil, wir sind beschäftigt.«
Quiller zog sich zurück und fand sich später am Abend an einem anderen Ecktisch wieder, wo man ihn willkommen hieß. Whitney war betrunken, und Taffy, einer der Stabsfahrer, war kurz davor. Sie waren in der Stimmung, über Janeway herzuziehen.
»Is schon ’n krummer Hund«, sagte Taffy.
»Taff hat da ’ne Geschichte«, sagte Whitney. »Sags ihm, Taffy.«
»Heute Nachmittag hab ich den Heini über die Grenze gefahren«, sagte Taffy. Er war ein süffisanter Waliser, dem langsam die Haare ausgingen und der die nervöse Art eines Mannes an sich hatte, der ununterbrochen auf Schlaglöcher, schwankende Fahrräder, plötzlich auftauchende Rikschas und Kühe in unübersichtlichen Ecken achten musste.
»Und?«, setzte Whitney nach.
»War nich das erste Mal, Euer Ehren. Da gibts ’nen Holländer, den er besucht, auf ner Plantage. Is immer dasselbe: Ich warte im Wagen, während Seine Lordschaft für ein, zwei Stunden im Bungalow des Holländers verschwindet, dann fahrn wir zurück. Nachrichten sammeln nennt er das.«
»Ein Holländer?«, fragte Quiller.
»Sagt er jedenfalls, Euer Gnaden.«
Ihre Nähe, die Wand aus Lärm und eng gedrängten Leibern rings um sie herum wärmte Quiller und löste ihm die Zunge. »Manchmal komme ich auf ’nem anderen Flugplatz runter und stelle fest, dass er an dem Tag auch da gewesen is und das Bodenpersonal gelöchert hat von wegen Wartung, Bewaffnung, Schutz aus der Luft, Warnsystemen, was ihr wollt.«
Sie verstummten, dann meinte Taffy: »Der Kerl ist nicht gerade oberste Schublade.«
»Was meinste damit?«
»Nimm Freddy, zum Beispiel. Ein echter Gentleman, quatscht mich nie von oben herab an. Janeway is einfach nur ’n aufgeblasener Corporal, aber behandeln tut er mich wie Dreck.«
»Vorsicht, er beobachtet uns.«
Sie schauten alle. Janeway stand allein an der Bar, vielleicht schon länger. Auf seine spöttische, finstere Art sah er recht gut aus, und er erwiderte kühl Quillers Blick. Dann richtete er seine Augen auf Whitney und Taffy. Quiller fügte im Geiste zu den Vorhaltungen gegen Janeway noch die privaten Vorwürfe an, die nicht bewiesen oder bemessen werden konnten: sein ewiges Drängen, sein Gesicht. Es war ganz einfach: Auf Grund einer gewissen Konstellation aus Erscheinung, Geruch und Stofflichkeit fand Quiller Janeways Gesicht und Körper einfach abstoßend. Er wandte den Blick ab und versuchte, darüber nachzudenken. Er wollte nicht unfair sein. Hatte er ihn unbewusst schon immer abstoßend gefunden, oder waren seine Gefühle durch die Unterhaltung mit Whitney und Taffy erst ausgelöst worden?
Dann stand Janeway neben ihnen und sagte kein Wort. Sie starrten auf den Tisch.
»Sind Sie und Taff mit dem Wagen hier, Whit?«
»Sind mitgenommen worden, Sir.«
Janeway sah auf die Uhr. »Mr. Quiller und ich haben den Alvis. Taff wird uns alle damit zurückfahren, nicht wahr, Taff?«
»Ja, Sir.«
Unterwegs schwiegen sie und schlugen nach den Moskitos. Taffy setzte sie an der Messe ab und brachte den Wagen fort. Ihre Blasen waren voll, und die drei Männer stellten sich in einiger Entfernung voneinander hin und sprengten den Boden. Dann schlenderte Whitney davon. Quiller gähnte und räkelte sich, dann fragte er: »Was ist denn das für ein Holländer, Mike?«
Janeway erstarrte. Quiller bemerkte eine übermäßig wache, durchdringende Aufmerksamkeit im Ausdruck des Mannes. »Sie wissen doch genau, dass ich Ihnen das nicht sagen kann.«
Die Kraft für ein Riesendonnerwetter
Jeannie wurde in ihrem Zimmer im Gästetrakt von Haarlem Downs von einer lauten Stimme auf dem Hof geweckt: Crystal. Da war noch eine Stimme, das tiefe Brummeln eines Mannes: Wally? Harry Horsetalk? Das Dach über ihr stöhnte und knarrte von den Blechplatten, die sich in der Morgensonne ausdehnten und gegen Nägel und Dachbalken drückten. Jeannie warf das Laken von sich, schwang die Füße auf den Boden und blieb eine Weile so sitzen, dann duschte sie und zog sich an.
Sie trat hinaus in die ölige Hitze. Die ersten Tage der Regenzeit waren immer ein Dampfbad, die Sonne stach durch dichte, feuchte Luft. Regenwolken hingen im Westen, Frösche quakten, und Moskitos schlüpften in den Regenpfützen, die sich hier und da auf dem Grundstück gebildet hatten, in weggeworfenen Autoreifen, in leeren Blechdosen und in den Emailschüsseln, in denen die Viehhirten sich den Schmutz des Tages abwuschen. Jeannie hatte heute Morgen nicht die Kraft für ein Riesendonnerwetter, aber Crystal stand da, stemmte die Hände in die Hüften und schaute Wally Webb auf die Finger, der mit einer Picke ein Rechteck in den Boden kratzte, während Harry Horsetalk geduldig mit einer Schaufel wartete.
Jeannie überquerte den steinigen Rasen, und Crystal wirbelte herum. Sie tat, was sie immer tat, und beäugte Jeannie von Kopf bis Fuß, so als suche sie nach Spuren unaussprechlicher nächtlicher Handlungen. »Wird Zeit, dass wir einen Luftschutzkeller bauen.«
Das nächste Gebäude war über hundert Meter entfernt. Es gab einen waldigen Vorsprung. Das große Haus lag in einer geraden Linie von dem Platz entfernt. Es war eine gute Stelle für einen Luftschutzkeller. Klar, dass Crystal sich dafür entschieden hatte. Wenn es sein musste, konnte sie denken.
Wally und Harry trugen aus Respekt vor Crystal Hemden, aber sie wirkten erhitzt und verschwitzt. Als Wally sich streckte, um den Schweiß mit dem Unterarm vom Gesicht zu wischen und Jeannie anzulächeln, tat er dies knarrend und stockend. Der alte Schmied hatte sein Lebtag gebeugt über Motorräumen und Schraubstöcken verbracht; sein Rücken klappte knirschend auf wie eines seiner Werkzeuge. »Morgen, Sonnenschein.«
»Morgen, Wally. Morgen, Harry.«
Harry war grau und gebeugt, seine Augen vom Trachoma und den Strahlen der Sonne verbrannt. Er tippte an die Krempe seines Filzhuts, schaute sie aber nicht an, sondern starrte nur auf den Umriss, der in den Boden gekratzt war, so als wolle er ihn sich ins Gedächtnis brennen. »Missus Jeannie.«
Wally war der einzige weiße Mann, der noch auf der Farm geblieben war. Er war zu alt, um einberufen zu werden. Und Harry der einzige Schwarze. Die schwarzen Viehhirten und ihre Frauen waren für die Dauer der Regenzeit auf der jährlichen Wanderschaft zu ihren heiligen Orten und kehrten erst zum April-Auftrieb zurück. Harry, der Boss der Viehhirten, war auf einer Pallottiner-Mission an der Küste zwischen Broome und Derby aufgewachsen. Er ging nie auf Wanderschaft, Haarlem Downs war nicht sein Land und die Schwarzen auf der Station nicht sein Volk.
Crystal wirkte fiebrig und aufmerksam. »Erst eine nette, tiefe Grube mit Stufen nach unten, dann schneiden wir den alten Eisentank hinter der Nachtweide auf und machen ein Dach daraus, und schließlich eine Lage Erde.«
Wally ließ die Spitzhacke fliegen. Wenn er ein Stück der obersten Erdschicht gelockert hatte, schaufelte Harry Horsetalk sie zur Seite. »Da drunter ist es immer noch steinhart, Mrs. Dunn«, sagte Wally. »Schade, dass die Regenzeit noch nicht zu Ende ist.«
»Lasst euch Zeit.«
Bei jedem Schlag der Spitzhacke stöhnte Wally. Er hatte breite Hände, dicke Finger und Unterarme wie die Stränge der Taue auf der Schiffswerft, die Jeannie in Broome gesehen hatte. Graue und weiße Strähnen zeigten sich in dem Haarbüschel an seiner Kehle, und sein Gesicht war von einem Leben mit den Dunns, ihren Motoren, Pumpen, Hufeisen und Streitereien faltig und runzlig. Für Jeannie hatte er stets ein Zwinkern und ein Grinsen übrig. Neil Quiller war die einzige andere Person gewesen, für die er je Zeit gehabt hatte.
Jeannie räusperte sich. »Soll ich uns allen Tee holen?«
Crystal konzentrierte sich wieder auf die Grube. »Und Rosinenkekse.«
Jeannie ging ins große Haus. Während sie auf den Tee wartete, zog sie ihre Sandalen aus und lief leise über den knarrenden Flur in Crystals Schlafzimmer. Sie probierte die oberste Schublade des dunklen Sekretärs, in der Crystal ihre Post aufbewahrte, aber sie war verschlossen. Jeannie ging in die Küche zurück. Es war nicht sehr hilfreich, dass Crystal und sie auf Nachrichten von ein und demselben Mann warteten, den sie liebten. Sie waren einander so nah, so eingepfercht und so an ein Leben des Zeittotschlagens gebunden, dass sie einander nur wenig zu sagen hatten. Wann immer sie sich im Flur, vor einer Tür oder in dem Spalt zwischen Küchentisch und Tassenregal oder vor dem immerwährend kochenden Kessel begegneten, drückten sie sich wortlos aneinander vorbei, zogen Bauch und Ellbogen ein und drehten die Nasen beiseite. Crystal Dunn zu lieben war schwer, aber Jeannie Verco hatte nicht vor, sich ins Bockshorn jagen zu lassen oder klein beizugeben, also warteten sie tagelang, wochenlang in einer Atmosphäre voller Schmerz und Hass.
Jeannie brachte den Tee und die Rosinenkekse zu der tiefer werdenden Kammer des Luftschutzkellers und wandte sich dann schuldbewusst in Richtung des Gästetraktes ab.
»Wo um alles in der Welt willst du jetzt schon wieder hin?«
»Ich brauch nicht lange, Mrs. Dunn.«
»Und was hast du vor?«
»Ich dachte, ich schreibe Cameron.«
Crystal schüttelte den Kopf vor bitterer Verwunderung. »Wenn du nicht Briefe schreibst, brütest du über deinem Skizzenbuch. Du schneidest mich immerzu …«
«Das ist unfair«, entgegnete Jeannie. »Cameron ist mein Mann. Ich kann ihm doch schreiben, so oft ich will.«
»Das ist hier kein Ferienlager, Jeannie.«
»Ich brauch nicht lange, Mrs. Dunn«, sagte Jeannie. »Was steht denn heute an?« Sie rieb freudig die Hände aneinander. »Meine Schuhe müssten mal geputzt werden, und ich könnte ja Ihre mit putzen, wenn ich schon dabei bin. Staub wischen. Das Silber muss geputzt werden.«
»Rede nicht in diesem Ton.«
»In welchem Ton?«
»Alles lächerlich zu machen. Mich zu verspotten.«
»Hab ich nicht. Ehrlich.«
Crystal beschattete sich die Augen mit einer Hand und schien den Zustand des Himmels, des Windes und ihrer inneren Stärke abzuschätzen.