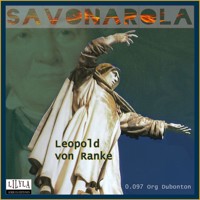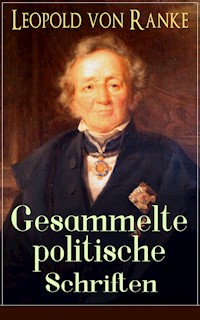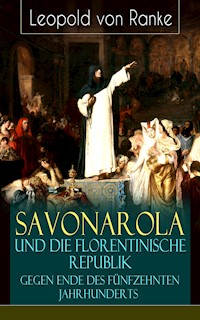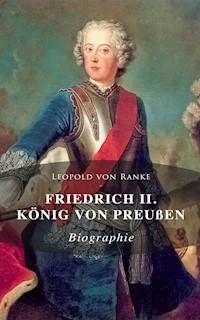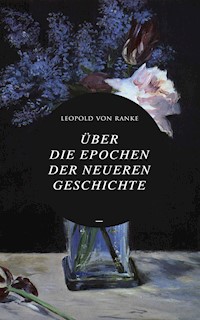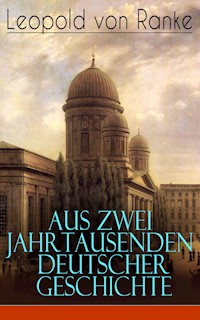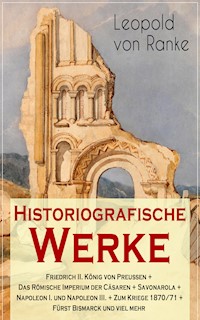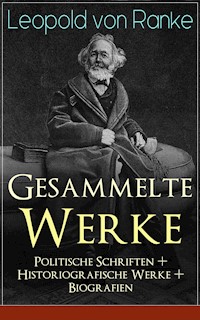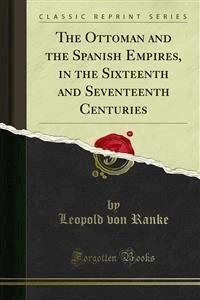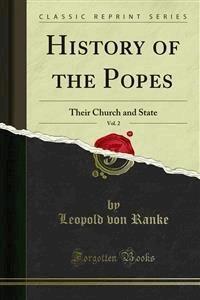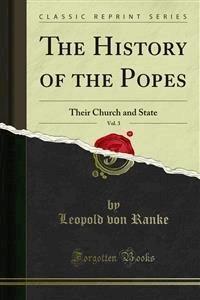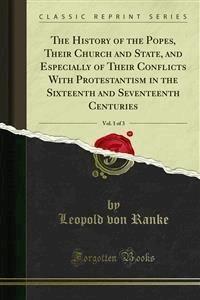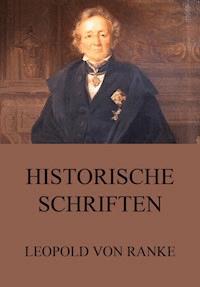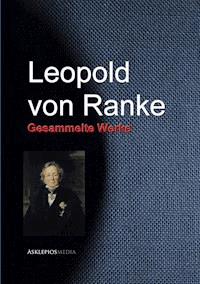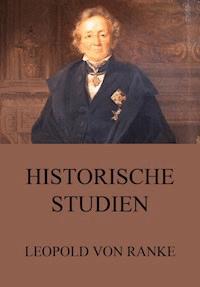
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ranke ist einer der Gründerväter der modernen Geschichtswissenschaft. Nach den preußischen Reformen (um 1810) und der Gründung der ersten Berliner Universität unter Wilhelm von Humboldt hatte sich das Wissenschaftskonzept des Historismus durchgesetzt. Der Historismus unterschied sich durch einen systematischen und quellenkritischen Ansatz von der bisherigen vornehmlich philosophischen Geschichtsbetrachtung. Dieser Band beinhaltet seine Studien: Savonarola und die florentinische Republik gegen Ende des fünfzehnten Jahrhunderts Geschichte des Don Carlos Die großen Mächte
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 376
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Historische Studien
Leopold von Ranke
Inhalt:
Leopold von Ranke – Biografie und Bibliografie
Savonarola und die florentinische Republik gegen Ende des fünfzehnten Jahrhunderts
Vorrede.
Erstes Kapitel. Emporkommen des Hauses Medici in Florenz.
Zweites Kapitel. Piero Medici und die Staatsveränderung von 1494.
Drittes Kapitel. Sinnesweise Savonarolas.
Viertes Kapitel. Einführung einer populären Verfassung in Florenz.
Fünftes Kapitel. Republikanische Agitationen bis zum Frühjahr 1496.
Sechstes Kapitel. Einwirkungen der europäischen Verhältnisse.
Siebentes Kapitel. Savonarola und Francesko Valori.
Achtes Kapitel. Koinzidenz der geistlichen und weltlichen Fragen.
Neuntes Kapitel. Feuerprobe; Gefangennehmung Savonarolas.
Zehntes Kapitel. Verdammung und Tod Savonarolas.
Geschichte des Don Carlos
Herkunft des Don Carlos.
Jugendzeit.
Anteil an der Staatsverwaltung. Vermählungspläne.
Beziehung zu den Niederlanden. Digression über die kirchliche Politik Philipps II.
Oppositionelles Verhalten des Prinzen zu seinem Vater.
Fluchtentwürfe des Prinzen. Seine Gefangensetzung.
Tod des Prinzen Don Carlos.
Die großen Mächte
Die Zeit Ludwigs XIV.
England, Österreich, Rußland.
Preußen.
Französische Revolution.
Wiederherstellung.
Nachwort.
Historische Studien, Leopold von Ranke
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849639044
www.jazzybee-verlag.de
Leopold von Ranke – Biografie und Bibliografie
Deutscher Geschichtschreiber, geb. 20. Dez. 1795 (nach dem Kirchenbuche. nach der Familienüberlieferung 21. Dez.) zu Wiehe in Thüringen, gest. 23. Mai 1886 in Berlin, in Schulpforta erzogen, studierte in Halle und Berlin Theologie und Philologie und wirkte seit 1818 als Oberlehrer am Gymnasium in Frankfurt a. O., wurde aber infolge seiner »Geschichten der romanischen und germanischen Völker von 1494–1535« (Bd. 1, Berl. 1824) und die dazu gehörige Schrift »Zur Kritik neuerer Geschichtschreiber« (das. 1824; von beiden 3. Aufl., Leipz. 1885) 1825 als Professor der Geschichte an die Universität Berlin berufen. 1827 sandte ihn die Regierung zur Sammlung archivalischen Materials nach Wien, Venedig, Rom und Florenz, und er entdeckte dabei die von ihm erfolgreich verwerteten venezianischen Gesandtschaftsberichte. Die Resultate seiner Forschungen legte R. nieder in den Werken: »Fürsten und Völker von Südeuropa im 16. und 17. Jahrhundert« (1. Bd.: »Die Osmanen und die spanische Monarchie«, Hamb. 1827, 4. Aufl. 1877); »Die serbische Revolution« (das. 1829, 3. Aufl. u. d. T.: »Serbien und die Türkei im 19. Jahrhundert«, Leipz. 1879); »Über die Verschwörung gegen Venedig im J. 1618« (Berl. 1831) und die Vorlesungen »Zur Geschichte der italienischen Poesie« (das. 1837). In seiner damals begonnenen »Historisch-politischen Zeitschrift« (Bd. 1, Hamb. 1832; Bd. 2, Berl. 1833–36) suchte er durch ein auf Einsicht in die geschichtlichen Vorbedingungen des Staatslebens gebautes Programm den Liberalismus zu bekämpfen. Großen Beifall fand das erste seiner Hauptwerke, zugleich als 2. Band der »Fürsten und Volker«: »Die römischen Päpste, ihre Kirche und ihr Staat im 16. und 17. Jahrhundert« (Berl. 1834 bis 1836, 3 Bde.; 10. Aufl. 1000). Die andre Seite des europäischen Lebens im 16. und 17. Jahrh., die Gründung des Protestantismus, behandelte er in seinem zweiten Hauptwerk, der »Deutschen Geschichte im Zeitalter der Reformation« (Berl. 1839–47, 6 Bde.; 7. Aufl., Leipz. 1894, 6 Bde.). 1841 zum Historiographen des preußischen Staates ernannt, schrieb er »Neun Bücher preußischer Geschichte« (Berl. 1847–1848, 3 Bde.), wovon eine neue, mit einer Einleitung: »Genesis des preußischen Staats«, vermehrte Ausgabe u. d. T.: »Zwölf Bücher preußischer Geschichte« (Leipz. 1874, 5 Bde.; vermehrt 1878–79, 5 Bde.) erschien. Er wandte sich darauf der französischen und englischen Geschichte zu und lieferte die »Französische Geschichte, vornehmlich im 16. und 17. Jahrhundert« (Stuttg. 1852–61, 5 Bde.; 3. Aufl. 1877–79) und »Englische Geschichte, vornehmlich im 16. und 17. Jahrhundert« (Berl. 1859–68, 7 Bde.; 4. u. 3. Aufl. 1877–79, 9 Bde.), bei der er ebenfalls neueröffnete Quellen benutzte. Daran schlossen sich: »Geschichte Wallensteins« (Leipz. 1869, 5. Aufl. 1895); »Zur deutschen Geschichte. Vom Religionsfrieden bis zum Dreßigjährigen Krieg« (das. 1869, 3. Aufl. 1888); »Der Ursprung des Siebenjährigen Kriegs« (das. 1871); »Die deutschen Mächte und der Fürstenbund« (das. 1871, 2 Bde.; 2. Aufl. 1876); »Abhandlungen und Versuche« (das. 1872, 2. Aufl. 1877; neue Sammlung, hrsg. von A. Dove, 1888); »Aus dem Briefwechsel Friedrich Wilhelms IV. mit Bunsen« (das. 1873, 2. Aufl. 1874); »Ursprung und Beginn der Revolutionskriege 1791 und 1792« (das. 1875, 2. Aufl. 1879); »Zur Geschichte von Österreich und Preußen zwischen den Friedensschlüssen zu Aachen und Hubertusburg« (das. 1875); die »Denkwürdigkeiten des Staatskanzlers Fürsten von Hardenberg« (das. 1877 vis 1378, 5 Bde.), daraus als Auszug: »Hardenberg und die Geschichte des preußischen Staats von 1793 vis 1813« (das. 1880–81, 2 Bde.); ferner: »Friedrich d. Gr.; Friedrich Wilhelm IV. Zwei Biographien« (das. 1878); »Historisch-biographische Studien« (das. 1878); »Zur venezianischen Geschichte« (das. 1878); »Zur Geschichte Deutschlands und Frankreichs im 19 Jahrhundert« (hrsg. von A. Dove, das. 1887). Einen großartigen Abschluß seiner historiographischen Tätigkeit sollte die noch in spätem Alter begonnene und daher nicht vollendete »Weltgeschichte« (Leipz. 1881–88, 9 Bde. in wiederholten Auflagen; Bd. 7–9 hrsg. von Dove, Wiedemann und Winter; Textausgabe in 4 Bdn. 1895, 2. Aufl. 1896) bilden; sie behandelt nur das Altertum und einen Teil des Mittelalters. Als Separatausgabe aus dem 9. Band erschienen die 1854 vor König Max II. von Bayern gehaltenen Vorträge »Über die Epochen der neuern Geschichte« (3. Abdruck, Leipz. 1906). Eine Gesamtausgabe der Werke Rankes erschien 1868–90 zu Leipzig in 54 Bänden. Im akademischen Unterricht (bis 1872) pflegte R. außer seinen Vorlesungen besonders die historischen Übungen. Aus diesen Übungen ist die Rankesche Schule hervorgegangen, der namhafte Historiker der 2. Hälfte des 19. Jahrh. angehören. Die von ihm begründeten »Jahrbücher des Deutschen Reiches unter dem sächsischen Haus« (Bd. 1–3, Abt. 1, Berl. 1837–40) enthielten Arbeiten seiner Schüler. Am 21. Dez. 1865 wurde er geadelt und nach Böckhs Tod 1867 Kanzler des Ordens Pour le mérite. Bei der Feier seines 50- und 60jährigen Doktorjubiläums (20. Febr. 1867 und 1877) ward er von der deutschen Geschichtswissenschaft als ihr Altmeister geehrt und 1882 zum Wirklichen Geheimen Rat mit dem Prädikat »Exzellenz« ernannt. Als Geschichtschreiber nimmt R. eine hervorragende Stelle in Deutschland ein. Er besaß einen seltenen Fleiß und Scharfsinn im Aussi uden von Quellen und im Sichten des Materials und übte methodische Kritik; sein Sinn für die konkreten Erscheinungen des Lebens, sein zugleich scharfer und tiefer psychologischer Blick geben seinen Darstellungen eine plastische Form von hoher Vollendung; namentlich in der Charakteristik einzelner hervorragender Personen und der sie bestimmenden psychologischen Elemente ist er Meister. Am 3. März 1906 wurde in seiner Vaterstadt, wo ihm schon vorher ein Denkmal errichtet war (enthüllt 27. Mai 1896), ein Leopold von Ranke-Verein begründet, der sich die Erhaltung des im Geburtshaus untergebrachten Rankemuseums zur Pflicht macht. Rankes Bildnis s. Tafel »Deutsche Geschichtschreiber« (Bd. 7). Vgl. Rankes Schrift »Zur eigenen Lebensgeschichte« (hrsg. von Dove, Leipz. 1890); Winckler, Leopold v. R. Lichtstrahlen aus seinen Werken (Berl. 1885); v. Giesebrecht, Gedächtnisrede auf Leopold v. R. (Münch. 1887); Guglia, Leopold v. Rankes Leben und Werke (Leipz. 1893); M. Ritter, Leopold v. R. (Rede, Stuttg. 1895); Nalbandian, Leopold v. Rankes Bildungsjahre und Geschichtsauffassung (Leipz. 1901); Helmolt, Leopold R. (das. 1907).
Savonarola und die florentinische Republik gegen Ende des fünfzehnten Jahrhunderts
Savonarola.
Terracottabüste. Fälschung im Stil des 15. Jahrhunderts, von Giovanni Bastianini (1830– 68). London, Victoria und Albert Museum
Vorrede.
Wenn die deutsche Forschung sich auch auf die Geschichte fremder Nationen erstreckt, so ist der dabei vorwaltende Gesichtspunkt der universalhistorische. Auch in dieser Beziehung mag jedoch ein Unterschied gemacht werden. Nationen und Staatengebilde, wie die von Frankreich und von England, hat man das Bedürfnis, sich in ihrer Totalität zu vergegenwärtigen, immer ohne auf das Lokale und Provinzielle einzugehen, indem man vielmehr die Perioden, in denen sie eine allgemeine Einwirkung ausübten, hervorhebt und deren Motive erörtert.
Mit der italienischen Geschichte verhält es sich insofern anders, als nicht die Nation selbst handelnd auftritt. Die Geschichte des Papsttums ist ihrer Natur nach eine universale; sie hat ein eigenes, von dem rein italienischen gesondertes Interesse. Aber auch die Abweichungen von dem Papsttum haben eine Geschichte in Italien. Die Gegensätze zwischen Staat und Kirche sind daselbst immer vorhanden gewesen und haben zu eigentümlichen Erscheinungen von nationalem Charakter geführt. Die eigentümlichste von allen bildet wohl der Dominikanermönch Hieronymus Savonarola; er machte den Versuch, auf dem Boden der lateinischen Christenheit ohne Abweichung in den Glaubensformen doch der Hierarchie Schranken zu ziehen und eine selbständige Stellung ihr zum Trotz zu gewinnen. Unbedingte Hingebung ist eine Sache der Gewohnheit und des Gemütes, unbedingte Negation meistens leichtfertig und inhaltsleer. Gerade in der Koinzidenz des positiven Glaubens und der Negation der absoluten Macht des Papsttums liegt das Interesse, das Savonarola erweckt.
In allen Nationen hat man sich mit dieser Persönlichkeit, dem Leben und Tod Savonarolas, viel beschäftigt, und es könnte überflüssig scheinen, nochmals darauf zurückzukommen. Wenn ich es dennoch wage, so liegt der Anlaß dazu in den nur wenig benutzten Nachrichten einiger florentinischen Chronisten der Zeit, die eigentlich Tagebücher derselben enthalten, und in den zahlreichen, in unseren Tagen bekannt gewordenen Dokumenten. Es schien mir möglich, mit Hilfe derselben zu einer selbständigen Anschauung der Ereignisse zu gelangen, unabhängig von der Legende der Anhänger des Mönches und den einseitigen Erzählungen gleichzeitiger Schriftsteller. Dabei konnte ich jedoch nicht allein von kirchengeschichtlichen Gesichtspunkten ausgehen, da sich mit der Abweichung Savonarolas von dem Papsttum eine sehr bestimmte politische Absicht verband, der an und für sich eine große Bedeutung zukommt. Als er in Florenz auftrat, war der lebhafteste Widerstreit zwischen einer Tendenz zur Monarchie und den aristokratischen Selbständigkeiten ausgebrochen; der Mönch brachte in ihrer Mitte ein demokratisches Element zur Geltung. Wir gehen von dem Ursprung dieses Widerstreites aus.
Erstes Kapitel.Emporkommen des Hauses Medici in Florenz.
In der Divina Commedia ruft Dante einmal Wehe über den deutschen Kaiser Albrecht, welcher nach einer Hausmacht trachte, aber dadurch Anlaß gebe, daß das römische Reich seinen Kaiser vermisse; was helfe es, daß Justinian die Zügel der Gerechtigkeit verbessert habe, wenn das gesattelte Pferd keinen Reiter finde. Dante stand an den Marken zwischen einer Epoche, welche abschloß, und einer anderen, welche eintrat. Sein Herz gehörte ganz der älteren an; die Erscheinungen, die eine neue ankündigten, – die aufkommende Tyrannei und Gesetzlosigkeit, die Zwietracht unter denen, die eine Mauer umschließe, erschreckten seine Seele. Auch in Florenz vermißt er die alte Einfalt und Zucht; er beklagt ausdrücklich seine Vaterstadt wegen der Zunahme der Bevölkerung und ihrer unzuträglichen Mischung; wegen des wachsenden Reichtums, der die guten Sitten verderbe. Mit einer sonst bei ihm nicht gewöhnlichen Ironie vergleicht er einmal Florenz mit den Republiken des Altertums; deren Art, sich an die einmal gegebenen Gesetze zu halten, bleibe fern von der Feinheit der Florentiner, die, was im Oktober gesponnen, schon im November wieder auflösen; wie oft habe Florenz seit Menschengedenken die Gesetze, Münzen, Ämter und Gewohnheiten, selbst seine Glieder verändert?
Eben diese unruhige Bewegung aber ist es doch wieder, was der florentinischen Geschichte ihr historisches Interesse für die spätere Zeit verliehen hat.
In dem Kampfe zwischen Kaisertum und Papsttum hatte sich Florenz auf seiten der Päpste gehalten; Kaiser Heinrich lV. hatte einst vor den zum Teil erweiterten und wiederhergestellten Mauern der Stadt zurückweichen müssen. Florenz war eine Metropole der Opposition gegen das Kaisertum; es verdankt dieser Stellung sein Emporkommen und sein Ansehen. Dies beruht dann weiter auf folgendem Momente. Von der Parteiung der Guelfen und Gibellinen, die das übrige Italien schon seit einiger Zeit entzweite, war Florenz noch vor Dante im Jahre 1248 ebenfalls ergriffen worden, dergestalt, daß auch die Gemeinen daran Anteil nahmen. Alle Nachbarschaften der Stadt stritten von ihren Türmen widereinander.
Im Jahre 1263 gewannen die Gibellinen die Oberhand. Die Guelfen, Adlige und Popolanen wurden aus Florenz und ganz Toskana verjagt. Während aber die einen, die Edelleute, in verschiedenen lombardischen Städten ihrer Partei zu Hilfe kamen, und dabei sich Beute, Kriegsübung und Namen erwarben, besonders im Dienste Karls von Anjou, so gingen die anderen, Kaufleute, wie sie waren, auf einen Weg der Erwerbes zu denken genötigt, über die Alpen, vornehmlich nach Frankreich und breiteten ihr Geschäft, das bisher meist auf Toskana und Italien beschränkt war, jenseits derselben aus. Siege auf der einen, Reichtümer auf der anderen Seite konnten nicht verfehlen, den Verjagten eine rühmliche Rückkehr zu verschaffen. Und nicht wenig kam ihnen der Umschwung in den öffentlichen Angelegenheiten, der Untergang der letzten Hohenstaufen zustatten. Nunmehr mußten die Gibellinen weichen, und niemals haben sie sich wieder zu eigentlichem Einfluß zu erheben vermocht.
Seitdem aber ging die Entwicklung der Adligen und Popolanen der guelfischen Partei nicht mehr zusammen. Von ausgezeichneten Kriegstaten der Großen schweigt die Geschichte; vielmehr entzweiten und schwächten sie sich untereinander und übten ihren Mut in Gewalttätigkeiten gegen das Volk. Die Popolanen dagegen wurden in allen europäischen Reichen die Kassierer des Papstes, die allgemeinen Wechsler des westlichen Europa, Bankhalter der Könige, wie auch die Produkte der städtischen Betriebsamkeit den Weg nach aller Welt fanden. Die Zünfte, von denen die großen Handelsleute den vornehmsten und wirksamsten Teil ausmachten, bewaffnet und unter ihren Fahnen vereinigt, gaben ihnen innerhalb der Mauern ein unleugbares Übergewicht. Es kam alles zusammen, Stärke, Reichtum und das natürliche Recht. Die Häupter der Zünfte vereinigten sich im Jahre 1282, gemeinschaftliche Vorsteher, Prioren, zu ernennen. Diese aber wurden der Magistrat der ganzen Stadt, indem sie Ordnungen der Gerechtigkeit wider den Adel, die man wohl als die Magna Charta des Volkes von Florenz bezeichnet hat, festsetzten und ein bewaffnetes Gonfalonierat der Gerechtigkeit zur Handhabung derselben einrichteten. Von einer eigentlichen Demokratie blieb man hierbei doch weit entfernt. Wie wäre eine solche in einer merkantilen Stadt, in welcher sich Reichtümer in den verschiedensten Abstufungen anhäuften, möglich gewesen.
Im Anfang des 14. Jahrhunderts erhoben sich einige Häuser, unter denen wir die Acciajuoli und Peruzzi finden, zu einer Art von Herrschaft in Florenz. In der Ausübung derselben behaupteten sie sich vorzüglich dadurch, daß sie die Prioren für viele Monate auf einmal erwählen, die Namen derselben in Beutel werfen und nach dem Lose ziehen ließen; nur in dem so bestimmten Kreise läßt man dem Zufall sein Spiel; wenn alle imborsierten Namen gezogen sind, fängt man von neuem an.
Im Jahre 1340 wurden die sechs Quartiere der Stadt, wie Villani versichert, von je zwei der größten, mächtigsten und reichsten Popolanen regiert. Diese ernannten zu den Ämtern, wen sie wollten, und ließen weder Großen noch Mittleren noch Kleinen einigen Anteil. In ihrem Dienste war der Exekutor der Gerechtigkeit, der die Stadt mit ausländischen, namentlich katalanischen Söldnern in Pflicht hielt, waren die Hauptleute der Wacht, die man einführte, als eine Priorenwahl, die man beabsichtigte, Widerstand fand; waren endlich die Konservatoren des Friedens, die ein wahrhaftes Schreckenstribunal errichteten und obwohl öfters abgeschafft, doch ebensooft erneuert wurden.
Es ist für diesen Zustand sehr bezeichnend, daß er eben damals durch einen großen Bankrott der Häuser Peruzzi und Bardi erschüttert ward, denen König Eduard III. von England das ihm dargeliehene Geld nicht zurückzahlte. Hierauf brachen Unruhen aus, in denen die Großen aufs neue emporkamen. Um sie wieder zu stürzen, brauchten die reichen Kaufherren das Volk, dem für seinen Beistand neue Rechte eingeräumt werden mußten. Allein sowie die Stürme vorbei, Macht und Kredit der vornehmen Popolanen hergestellt waren, so fand man Mittel, um doch jede unbequeme Teilnahme, die sich aufdrängen wollte, zurückzuweisen.
Die Capitani di Parte guelfa besaßen eine außerordentliche Autorität, die sich hauptsächlich darauf gründete, daß sie die den Gibellinen bei dem Sturze derselben konfiszierten Güter verwalteten und zu ihren Zwecken benutzten. Mit diesen vereinigten sich die mächtigsten popolanen Häuser und setzten fast mit Gewalt das Gesetz durch, daß niemand ein Amt bekleiden dürfe, der nicht ein wahrer Guelfe sei. Nicht als hätte man von den Gibellinen noch zu fürchten gehabt; aber man bekam das Recht, einen jeden zu behandeln, als sei er Gibelline. Auf diese Weise ausschließen, nannte man ammonieren. Man ammonierte die besten Männer der Republik, zuweilen Männer, deren Namen schon zu einer zukünftigen Signoria – so bezeichnete man jetzt Prioren und Gonfaloniere – gezogen waren.
Die Verfassung bekam hierdurch einen oligarchischen Charakter, dem sich naturgemäß eben diejenigen widersetzten, die den vorherrschenden Geschlechtern sonst am nächsten standen. Ricci, Scali, Alberti und endlich auch dasjenige Haus, das die größte Rolle in Florenz zu spielen bestimmt war, die Medici, die aus dem Mugello stammten, – sie stellten sich an die Spitze der populären Interessen, um die Oligarchie zu brechen.
Salvestro de' Medici wollte dem Mißbrauch der Ammonitionen, durch welche die individuelle Sicherheit gefährdet werde, ein Ende machen. Der Beschluß wurde gefaßt, die ursprünglich gegen den alten Adel gerichteten Ordnungen der Gerechtigkeit auch gegen die Oligarchen, die an dessen Stelle getreten waren, in Anwendung zu bringen. Salvestro versuchte das populäre Element in den eingeführten Formen der Verfassung wieder zu beleben; aber er hatte doch nicht die Stellung und das Ansehen, vielleicht auch nicht die Energie des Geistes, die dazu erforderlich gewesen wären. Er gab Anlaß zu einem Aufstand, in welchem sich nicht allein die Zünfte wider die Regierung, sondern auch die Arbeiter wider ihre Meister und Brotherren erhoben; die Arbeiter nahmen einen selbständigen Anteil an der Regierung in Anspruch. In diesem Tumult trat ein Augenblick ein, der die Republik mit völligem Umsturz bedrohte. Eben deshalb aber schlug alles fehl; aus der Mitte der Empörten selbst ging eine Reaktion hervor, durch welche die Verfassung im ganzen und großen aufrechterhalten wurde. Und wenn man dem Volke einige Zugeständnisse gemacht hatte, so wurden diese abermals nach und nach wieder zurückgenommen.
Alle die folgenden Bewegungen von 1387, 1393, 1397, 1400 führten nur dahin, diejenigen, welche der Partei des Volkes zugetan gewesen, ihres Ansehens zu berauben; die kaufmännische Oligarchie setzte sich so vollkommen in Besitz, wie es vor 1340 der Fall gewesen war.
Was sie darin besonders befestigte, war eine Reihe großer Erwerbungen, die ihr gelangen. Es stimmt mit ihrer Natur sehr gut zusammen, daß sie Eroberungen zu machen begann, als sie die Waffen aus der Hand legte.
Die Eroberungen waren Folgen nicht der Tapferkeit, sondern des Reichtums, wie dies die Florentiner selbst anerkannt haben. In dem Proömium der Statuten der Konsuln des Meeres sagen sie: "Durch Ausübung der Kaufmannschaft sind von den florentinischen Bürgern unzählige Güter erworben worden, mit denen sie nicht allein Vaterland und Freiheit beschützt, sondern auch ihre Republik vergrößert und viele Städte, Flecken und Ortschaften mit gerechten Ansprüchen an sich gebracht haben." Es war ein Verein vorwaltender kaufmännischer Häuser, welcher Florenz zugleich groß machte und beherrschte; sie erwarben die auswärtigen Besitzungen, ihre Weltverbindungen machten Handel und Kredit erst möglich; jene z. B. durch die Ämter, welche neu geschaffen wurden, diese durch den anwachsenden Verkehr kamen ihren Mitbürgern zugute. Aber die ausgedehnten Befugnisse, die sie sich anmaßten, erhielten zugleich auch eine Gärung im Volke.
In der Menge war immer das Gefühl, daß ihr unrecht geschehe, und es kam nur darauf an, daß einmal ein anderes Oberhaupt stark genug würde, um sich an ihre Spitze zu stellen.
Ein solches ging abermals aus dem Hause Medici hervor. Giovanni di Bicci de' Medici, ein entfernter Verwandter Salvestros, war durch glückliche Handelsgeschäfte reich geworden. Er war mildtätig, verständig, ruhig und liebte nicht, in den Palast zu gehen und an den Geschäften teilzunehmen. Aber sein Reichtum und seine Art und Weise zu sein, verschaffte ihm Autorität. "Als ich arm war," sagt er, "gab es keinen Bürger, der mich hätte kennen wollen und die Republik dachte nicht an mich. Nicht die Republik hat mir Reichtümer gegeben, sondern die Reichtümer haben mich in der Republik groß gemacht." Über den Aufwand, den ein gegen die Ansicht Giovannis unternommener Krieg verursachte, und die Kosten, die zu dessen Fortsetzung erforderlich waren, kam es zu lebhaften Irrungen unter den Oligarchen selbst und zu einer ernstlichen Entzweiung zwischen ihnen und dem Volke. Hauptsächlich unter der Mitwirkung Giovannis de' Medici geschah es, daß in den Räten des Popolo die Einrichtung eines Katasters durchgesetzt wurde, das heißt, eine Bestimmung der zu dem Kriege erforderlichen Auflagen nach dem Vermögen eines jeden. Wie sehr die mächtigsten Bürger davon betroffen wurden, sieht man daraus, daß der angesehenste von allen, Niccolo da Uzzano, dessen Beiträge nie über 16 Fiorini gestiegen, jetzt 250 zahlen mußte.
Hierüber bildete sich eben um Uzzano her eine Partei, die man die uzzaneske nannte, deren Versammlungen zuweilen auf siebzig Häupter stiegen. Sie machten den Anspruch, daß, wie die Republik durch ihre Altvorderen gegründet worden, so auch die Kommune eben durch sie gebildet werde. Es waren die Männer, welche in der letzten Epoche die Regierung geleitet hatten. Uzzano hielt sie noch im Zaum; nach dessen Tode übernahm Rinaldo degli Albizzi ihre Führung, der selbst einem der vornehmsten Geschlechter angehörte, wie denn Viero degli Albizzi vor dem Tumult der Ciompi, ebenso nach demselben, und zwar im Gegensatz gegen die Medici eine große Rolle gespielt hatte. Rinaldo hatte sich neutral gehalten, denn unter der Autorität eines anderen wollte er nicht stehen. Die Partei war der Meinung, daß der Popolo aus lauter von den benachbarten Gebieten hereingezogenen Menschen, die eigentlich nur zu dienen bestimmt gewesen, bestehe und kein eigentümliches Recht in Anspruch zu nehmen habe.
An der Spitze dieses herabgewürdigten Popolo aber erschien nun Cosimo de' Medici, der Sohn Giovannis, der dessen Reichtümer geerbt hatte, ihn aber an Tatkraft und Ehrgeiz bei weitem übertraf. Er wurde dadurch besonders angesehen, daß er in vornehmen Verwandtschaften stand und einige Mitglieder der anderen Partei von Bedeutung, unter denen wir Guicciardini und Soderini finden, ihm beitraten. Auch die Popolanen, die er führte und die jetzt das Übergewicht hatten, ließen sich dazu verleiten, einen Krieg zu unternehmen, der aber ebenso wie der vorige mißlang und ebenso eine sehr empfindliche Reaktion in der Parteistellung herbeiführte.
Da ist es nun zu einer großen und für alle Folgezeit entscheidenden Krisis gekommen. Durch die Bemühungen Albizzis ward eine Signoria zustande gebracht, die zwar nicht dem Anschein, aber dem Wesen nach den Oligarchen völlig ergeben war; sie wagte es, Cosimo festzuhalten und berief eine jener tumultuarischen Volksversammlungen, die man Parlamente nannte, in der die Oligarchen vollkommen die Oberhand bekamen. Cosimo mußte es noch für ein Glück halten, daß er nur verbannt ward, was allein dadurch erreicht wurde, daß er einige der wirksamsten Gegner durch Geld gewann; er selbst spottete ihrer leicht zu befriedigenden Habsucht. In der Partei waltete überhaupt nicht mehr die frühere Zucht und Energie, Albizzi konnte sie nicht zu durchgreifenden Maßregeln bewegen; die alten Granden wurden nicht rehabilitiert, wie er vorschlug, die Wahlbeutel nicht erneuert, wie er forderte; denn ihm selbst trauten die übrigen nicht, da er nicht immer auf ihrer Seite gestanden hatte. Eigentlich in der Verbannung gelangte Cosimo de' Medici zu dem überwiegenden Ansehen, das die Größe seines Hauses begründet hat; die Signoria, die ihn verwiesen hatte, konnte ihn doch nicht entbehren, sie blieb mit ihm in Korrespondenz. Auch in seiner Abwesenheit übte er auf seine Partei einen alle zusammenhaltenden Einfluß aus. Ohne viele Mühe, durch den natürlichen Lauf der Dinge geschah, daß im Jahre 1434 eine Signoria eintrat, die aus Anhängern Cosimos bestand. Um ihren Beschlüssen zuvorzukommen, unternahmen die Uzzanesken unter Rinaldos Führung, sie mit Gewalt zu sprengen. Sie erschienen mit ihren Bauern und ihrem Anhange aus dem Stadtvolke, um den Palast zu stürmen; allein auch auf der anderen Seite war man bewaffnet. Es schien zu dem blutigsten Kampfe kommen zu müssen. Die Nobili drohten, die Weiber und Kinder der Signoren auf ihre Tartschen zu binden, so daß diese zuerst von den Waffen getroffen werden müßten. Aber dagegen ließen die Popolanen vernehmen, sie würden die Straßen mit Leichen und die Paläste mit Witwen anfüllen. Indem alles zu offenem Kampfe sich bereitete, zeigte sich doch in der städtischen Oligarchie ein auffälliges Schwanken; Palla Strozzi, der herbeigekommen war, um zur Seite der übrigen den Kampf zu bestehen, zog es nach der Hand vor, sich nach Hause zu begeben, worauf Rinaldo nicht zum Angriff zu schreiten wagte. Unter Vermittlung des Papstes Eugen, der sich gerade in der Stadt befand, ging er einen Vertrag ein, dessen Folge war, daß sein Anhang sich auflöste. Die Partei der Oligarchen konnte sich dann nicht länger behaupten; die Partei des Popolo kam empor, sie hatte bereits einen Führer, der nur nicht gegenwärtig war.
Indem sich die ganze städtische Menge für die Signoria erklärte, rückten ein paar Tausend stolze und trotzige Bauern aus dem Mugello heran, um sich bei dem Palast der Medici aufzustellen. Auf Veranlassung der Signoria, die Cosimo hatte wissen lassen, daß er nichts gegen ihren Willen tun wolle, führte Bartolommeo Orlandini die Kompagnie Nicolos da Tolentino, die immer Cosimo ergeben gewesen war, in die Stadt und besetzte die Zugänge des Palastes.
Die große Glocke läutete zum Parlament, es war am Michaelstag (29. September) 1434. Das Volk kam herbei, zahlreich und ganz in Waffen. Eine neue Balia wurde ernannt und alles widerrufen, was in dem letzten Jahre verordnet worden war, namentlich der damals gegen die Medici gefaßte Beschluß; die Formen der Republik wurden dabei möglichst gewahrt, Signoria und Popolo waren auf seiten der Medici.
An dem nämlichen Tage, am 5. Oktober, und in der nämlichen Stunde, in der Cosimo vor einem Jahre das florentinische Gebiet verlassen, trat er jetzt wieder in dasselbe ein. Des folgenden Tages nach Sonnenuntergang, dem versammelten und ihn erwartenden Volke auf einer Nebenstraße ausweichend, gelangte er in den Palast und wurde von den Signoren als Freund und Verbündeter empfangen. Schon waren Rinaldo degli Albizzi, Peruzzi und viele andere verbannt. Wie einst in den Republiken des Altertums aus dem Kampfe gegen die Oligarchen nicht selten derjenige zur Herrschaft gelangt ist, der das Volk gegen sie anführte, so bildete sich jetzt in Florenz eine Art von Verfassung aus, die sich wohl mit der älteren griechischen Tyrannis vergleichen läßt, aber doch ein höchst eigentümliches Gepräge hat.
Cosimo wollte nicht sein Bestehen dem Zufall überlassen, wie seine Vorgänger in der Gewalt, er wollte sein Glück auf sicheren Grundlagen erbauen.
Die neue Signoria für November und Dezember ward ohne alle Wahl von der alten ernannt. Ein Gonfaloniere stand an ihrer Spitze, Giovanni Minerbetti, ein Mann, wie Cavalcanti sagt, mehr unternehmend als vernünftig, welchem Beschäftigung auch im Bösen lieber war, als ruhig zu sitzen. Es begannen die großen Verbannungen; alle, die einen Anteil an der Entfernung Cosimos oder an dem Widerstand gegen seine Rückkehr gehabt, wurden verbannt; Palla Strozzi half es nichts, daß seine Untätigkeit so viel zu den glücklichen Erfolgen seines Gegners beigetragen; zugleich mit seinem Sohne wurde er nach Padua verwiesen. Niemand ward geschont, der sich zu den Gegnern Cosimos gehalten.
Hiermit aber war man noch nicht zufrieden; ganze Geschlechter, und zwar solche, die zu den vornehmsten gehörten, wurden auf immer für unfähig erklärt, ein Amt zu bekleiden. Dagegen wurden die zurückberufen, die seit der Reaktion gegen die Bewegung von 1378 vertrieben worden waren. Cosimo schuf zehn Akkoppiatoren, um die Wahlbeutel für Signoria und Collegio, d. h. die Gonfalonieren der städtischen Miliz vollständig zu erneuern. Obgleich er nur ihm ergebene Namen in diese Beutel aufnahm, so ließ er doch auch nachher die Akkoppiatoren bestehen, um die Wahlen nach Gutdünken zu regulieren. So gelangten die öffentlichen Ämter mehr oder minder sämtlich unter seinen Einfluß.
Diesen Zustand, den man mit dem Worte Stato bezeichnete, zu behaupten, wurden die Acht der Guardia mit dem Rechte ernannt, über Gut und Blut aller zu richten, die wider denselben handeln oder auch nur reden würden. So weit war es schon, als mit dem Januar 1435 Cosimo de' Medici selbst Gonfaloniere wurde. Er hütete sich wohl, jemand unrecht zu tun, er verbannte niemand; er ließ die Bewaffneten, von denen der Palast bisher besetzt gewesen war, abziehen; sein Ehrgeiz war, nach vollbrachter Veränderung den Frieden herzustellen.
Aber die Maßregeln, die im Augenblick ergriffen waren, erhielten sich; weder die Stimme des Volkes, noch auch das Los entschied über die Besetzung der Ämter; die Akkoppiatoren, unmittelbar unter dem höchsten Einfluß, ernannten dazu.
Wohl bestand nun die Republik; Cosimo ließ den Bürgern in den untergeordneten Kreisen eine gewisse Freiheit, aber alles, was das Wesen der Regierung ausmachte, behielt er in seinen Händen. Man wollte bemerken, daß er selbst die Freunde, durch deren Gunst er emporgekommen, doch in gewisse Schranken zu bannen suchte, in denen sie ihm nicht gefährlich werden konnten; dazu habe er sich seines Einflusses auf die Bestimmung der Auflagen bedient. Die Freiheit hatte vor allem in der unbeschränkten Wahl der Magistrate bestanden. Diese aber wurden nun nach dem Dafürhalten eines Oberhauptes, dem gleichwohl keine bestimmte Autorität übertragen worden war, eingesetzt. Cosimo stand an der Spitze der populären Partei. Aber die Ideen der republikanischen Freiheit wurden durch ihn nicht realisiert, denn das würde auch seinen Gegnern zugute gekommen sein. In die Republik kam dadurch ein monarchisches Element, das in Cosimos Persönlichkeit einen großartigen Ausdruck fand.
Er war der reichste von allen, so daß er viele in ihren Geschäften unterstützte, zuweilen selbst seine Gegner, denen er in ihren Verlegenheiten aushalf; der angesehenste im Auslande, so daß Venedig seinen Bund mit Florenz gleichsam persönlich mit ihm geschlossen zu haben schien, und auch Franz Sforza sein glückliches Aufkommen, das er ihm vornehmlich dankte, zu seinen Gunsten brauchte.
In der Stadt hatte Cosimo nach allem, was geschehen war, doch keine leichte Stellung. Trotz der Imborsationen traten mißliebige Wahlen ein. Die Verjagten, die sich zuweilen zu Versuchen, ihre Rückkehr mit Gewalt der Waffen zu erkämpfen, ermannten, aber geschlagen wurden, hatten doch immer Freunde und Verbündete in der Stadt. Im Jahre 1458 war wieder ein Parlament erforderlich, um eine neue Balia zu erwählen, welche sehr ausgedehnte Befugnisse erlangte. Die Akkoppiatoren, deren man eine Zeitlang entbehren zu können geglaubt hatte, wurden auf eine Reihe von Jahren wieder eingerichtet. Jene Ridolfi, Pitti, Acciajuoli, Neroni, welche den nächsten Kreis von Cosimo bildeten, hatten immer die wichtigsten Aufträge und die einträglichsten Ämter. Ihr Verhalten erweckte vieles Mißvergnügen. "Sie wollten", sagt Cambi, "die Eier allein in ihrem Korbe haben." Cosimo selbst dagegen gab keinen Anlaß zu Klagen dieser Art. Er widmete dem Schuldenwesen der Stadt eine fördernde Aufmerksamkeit, so daß die Zinsen des Monte Comune von 10 bis auf 30 Prozent stiegen; ein anderer Monte, der zur Aussteuer der Töchter bestimmt war, fing wieder an zu zahlen. Überhaupt stellte sich der alte Wohlstand allmählich wieder her; man hatte Geld und reiche Warenlager von jeder Art. Die Häuser und Güter stiegen im Preise. Man sah nichts als Feste, glänzende Repräsentation, die Frauen mit Perlen und Edelsteinen geschmückt, die Männer in Seide und feines Tuch gekleidet. Mannigfaltige Bauwerke erhoben sich, welche die Bewunderung der Nachwelt bilden; viele von ihnen dienten kirchlichen Zwecken. Indem Cosimo diese im Auge behielt und förderte, war er doch zugleich von den Ideen der großen Philosophen des Altertums ergriffen; noch unmittelbar vor seinem Tode ließ er sich von Ficinus die platonischen Ideen über das Eine und Unvergängliche vortragen. In seiner Stellung hat er sich dreißig Jahre lang behauptet; noch während seiner letzten Krankheit hat er die Angelegenheiten der Republik verwaltet und zugleich seine merkantilen Geschäfte wahrgenommen. Man kennt den Lobspruch, den Piero, sein Sohn, ihm gewidmet hat, als dem angesehensten Manne, welchen die Stadt jemals gehabt; er rühmt seine Tätigkeit nicht allein in den politischen, sondern auch in den merkantilen Geschäften. Viele Bürger hatte er reich gemacht durch seinen Handelsverkehr; er war nicht allein ein weiser, sondern auch ein glücklicher Kaufmann; auch seinem Hause hinterließ er große Reichtümer. Cosimo war durch öffentliche Urkunde als Vater des Vaterlandes bezeichnet worden; seine Nachkommen bewahrten das Dokument hierüber auf das sorgfältigste auf. Ob sie aber auch fähig sein würden, die Stellung, die er gegründet hatte, zu behaupten? Es ist die Frage, welche die Geschichte von Florenz und Toskana entschieden hat.
Nach dem Tode Cosimos 1464 erfolgte eine Spaltung der Partei, die sich um ihn gebildet hatte. Neroni, Acciajuoli, Niccolini setzten sich unter Führung Luca Pittis, der bisher das meiste vermocht hatte, dem älteren Sohne Cosimos Piero entgegen; Ridolfi, Guicciardini, Pazzi, Corbinelli hielten zu Piero. Jene verlangten die Abschaffung der von Cosimo getroffenen, die alte Freiheit beschränkenden Einrichtungen; diese betrachteten das Fortdauern derselben als unerläßlich. In dem Gegensatz der beiden Parteien schien es oft, als müsse die Sache mit den Waffen ausgemacht werden. Aber es lag gleichsam in der Natur dieser Republik, daß sie inmitten der Krisen dies Äußerste vermied. In einem neuen Wahlkampf zeigte sich, daß Piero doch die Oberhand hatte. Die Signorie wurde wieder aus seinen Anhängern gebildet, und da dies Widerstand fand, ein Parlament berufen, das abermals eine Balia wählte, welche die Ernennung der Magistrate auf weitere zehn Jahre festsetzte und über die vornehmsten Gegner die Verbannung verhängte.
Was nun aber bei dem Tode Cosimos erfolgt war, wiederholte sich nach dem Tode Pieros (1469). Um seine Söhne Lorenzo und Giuliano vereinigte sich unter Tommaso Soderinis Führung eine starke Partei, die selbst dadurch nicht erschüttert wurde, daß die kaufmännischen Geschäfte schlechter zu gehen anfingen; die Freunde des Hauses, früher von ihm unterstützt, kamen ihm jetzt mit ansehnlichen Geldleistungen zu Hilfe, wogegen dann wieder die angesehensten Bürger in den wichtigsten Angelegenheiten zu Rate gezogen und zu Ehrenstellen befördert wurden. Nicht alle aber wollten sich in diesen Kreis, der doch eine Art von Unterordnung in sich schloß, bannen lassen. Die reichsten unter ihnen, die Pazzi, obwohl Verwandte der Medici, gerieten in offenen Widerspruch mit ihnen. Die vornehmste Differenz betraf ein Geldgeschäft mit Papst Sixtus IV., das die Pazzi gegen den Wunsch der Medici unternommen hatten. Auf den Nepoten des Papstes Girolamo Riario sich stützend, faßten die Pazzi den Gedanken, die Medici zu stürzen. Sie wagten nicht, sich ihnen auf dem Weg, den die Republik möglich machte, entgegenzusetzen; sie gingen den beiden Brüdern unmittelbar zu Leibe. Sie bedienten sich alter Vertraulichkeit, des ehrwürdigsten Ortes, der Kathedrale von Florenz, einer hochheiligen Handlung zur Ausführung ihrer dunklen Zwecke. Aber sie erreichten dieselben nicht; nur den minder bedeutenden der beiden Brüder schafften sie aus dem Wege; Lorenzo, dem ihr Haß bei weitem am meisten galt, ward durch Geistesgegenwart, Leibesstärke und sein gutes Glück errettet. Das mißglückte Attentat nun ist dem Enkel nicht viel weniger zustatten gekommen, als dem Großvater die Verbannung; das Volk strömte vor dem Palast der Medici zusammen, um Lorenzo zu sehen und begrüßte ihn, als er sich zeigte, mit Jubel. Das unregelmäßige Prinzipat, das er innehatte, bekam dadurch eine Art von Bestätigung; er war der widerwärtigsten Nebenbuhler entledigt und zugleich wurde ihm bewilligt, zu seiner Sicherheit mit bewaffnetem Gefolge einherzugehen, wie einst in Athen dem Pisistratus bei einem ähnlichen Konflikt auf sein Wort Keulenträger bewilligt worden sind.
Lorenzo wurde nun auch äußerlich das Oberhaupt der Republik; seine Freunde, die ihm bisher gleich gewesen, gerieten in eine untergeordnete Stelle. Das hatte aber alles um so mehr zu bedeuten, da die auswärtigen Angelegenheiten sich infolge jenes Ereignisses in einer Weise verwickelten, wie sie bisher noch nicht vorgekommen war. Wie die Pazzi den Nepoten des Papstes zu ihrem Verbündeten gehabt hatten, so nahm der Papst im Fortgang des Kampfes, um die gegen hohe geistliche Würdenträger ausgeübte Gewalt zu bestrafen, gegen Lorenzo Partei und sprach den Bann über ihn und alle seine Anhänger aus. Aber die Florentiner betrachteten die Sache Lorenzos als ihre eigene, was nicht ohne Gefahr für sie war, da der Papst nicht allein eine Macht von Bedeutung besaß, sondern auch den König von Neapel, Ferrante, auf seiner Seite hatte. Ein Krieg brach aus, in welchem anfangs Mailand und Venedig auf der Seite von Florenz standen, ohne jedoch einen sicheren Rückhalt zu gewähren; in kurzem sah sich Florenz ohne Geld, ohne Verbündete und in äußerster Gefahr. Lorenzo war der Mann dazu, diese Gefahr zu bestehen, er faßte den außerordentlichen Entschluß, sich persönlich aufzumachen, um seinen gefährlichsten Feind, König Ferrante von Neapel, für sich zu gewinnen. Man bemerkte auf der Reise, daß er zwar bei Tage die heitere Munterkeit zeigte, die ihm eigen war, aber bei Nacht von der Besorgnis, daß er sich in eine Gefahr begebe, in welcher er umkommen könne, heimgesucht wurde. Seine Verwegenheit führte ihn zum Ziele; er schloß mit Ferrante eine Freundschaft, welche für die Verhältnisse von Italien maßgebend wurde; nach wohlausgeführtem Werk wurde er bei seiner Rückkehr in seine Vaterstadt mit herzlichem Beifall begrüßt. Auch den geistlichen Waffen des Papstes gegenüber, die sich hauptsächlich gegen Lorenzo, der ein Tyrann sei, richteten, hielt die Stadt treulich bei ihm aus; das Emporkommen des päpstlichen Nepoten Girolamo Riario lief dem städtischen Interesse ebenso entgegen, wie dem des Hauses Medici. Lorenzo leistete demselben oftmals, z. B. bei den Bedrohungen der Vitelli in Città di Castello glücklichen Widerstand; vor allem durch ihn wurde im Jahre 1482 der Angriff, den der Papst in Verbindung mit den Venezianern auf Ferrara unternahm, hintertrieben; eben durch die Unterstützung von Florenz behauptete sich Ercole I. von Este in seinem Herzogtum. Daß die Florentiner Pietrasanta über Lucca, Sarzana über Genua behaupteten, geschah vornehmlich durch Lorenzo, dessen städtische Autorität hierdurch um so tiefere Wurzeln schlug. Er versäumte nicht, dieselbe auch durch zweckdienliche Einrichtungen zu befestigen.
Wenn Cosimo diejenigen, welche seit seiner Rückkunft in den höchsten Würden gesessen, in einen Rat der Hundert vereinigt hatte, welcher den Übergang der von seiner Verwaltung genommenen Beschlüsse in die unteren Kreise vermittelte, so ging Lorenzo auf diesem Wege noch weiter; er bildete drei aus seinen Anhängern bestehende Ratsversammlungen, den Rat der Siebzig, aus denen, die als Gonfalonieren di Giustizia, den der Hundert aus denen, die zugleich als Prioren, den der Zweihundert aus solchen, die überdies in dem Collegio, das die städtischen Gonfalonieren umfaßte, und in wenigen anderen höheren Ämtern gesessen hatten. Die Mitglieder des Rates der Siebzig wurden auf Lebenszeit ernannt; sie schienen dem Hause Medici eine feste Stellung auf immer zu sichern.
Doch war Lorenzo entfernt davon, diese Ratsversammlungen wirklich zu Rate zu ziehen oder auch den republikanischen Magistraten eine eigentliche Selbständigkeit zu lassen. Es ist einmal vorgekommen, daß ein Gonfaloniere andere Beamte, die ein Versehen begangen hatten, ammonierte; Lorenzo geriet darüber in eine gewisse Aufwallung; denn was solle daraus werden, wenn die Autorität der Signorie sich einmal ihm entgegensetze; zur Sicherheit seiner Person und seines Stato hielt er für notwendig, den zu ammonieren, welcher die Ammonition ausgesprochen hatte, sobald derselbe aus dem Amte getreten war. In dem Stato, in dieser engeren Bedeutung gefaßt, liegt das eigentümlichste Institut dieser Republik; der Stato bestand aus den großen Familien, die sich seit Cosimo mit den Medici verbunden hatten; er bildete eine Genossenschaft der mächtigsten Häuser, die gleichsam im Mitbesitz der Herrschaft war, ohne doch selbst die Regierung auszuüben. In den wichtigsten Geschäften zog Lorenzo nur diese zu Rate; man gab ihre Anzahl auf zwanzig an, die Bestunterrichteten zählen nur siebzehn. Die genannten Ratsversammlungen und die Magistrate waren mehr das Werkzeug der Regierung, als daß der Nerv derselben in ihren Händen gewesen wäre. Lorenzo trug Sorge, daß niemand emporkam, durch welchen seine Autorität erschüttert werden konnte. Obgleich die Verwaltung durch die Magistrate und in der Form der alten Freiheit geführt wurde und die oberste Regierung selbst keine stabile Form hatte, so war es doch nicht anders, als daß alles von dem Willen und Wink Lorenzos selbst abhing. Auch unter den vornehmen Geschlechtern zog er die minder selbständigen nicht selten den anderen vor. Die Verwandtschaften, welche diese untereinander eingingen, waren ein Gegenstand seiner fortwährenden Aufmerksamkeit; keine Vermählung hätte ohne seine Genehmigung vollzogen werden dürfen. In die Räte zog er auch Leute von geringer Herkunft, die dann in den besonderen Geschäften oft die Oberhand hatten. Alle Ernennungen gingen von ihm aus. Wer ein Amt haben wollte, bat ihn darum; auch die Geistlichen folgten der Gewohnheit, bei dem Eintritt in ihre Ämter sich ihm vorzustellen. Er war in der Tat ein Fürst, ohne diesen Namen zu führen. Damit hing es aber wieder zusammen, daß die kaufmännischen Geschäfte des Hauses auch unter ihm einen weniger guten Fortgang hatten, als selbst unter seinem Vater. Gerade der Aufwand, den Lorenzo aus politischen Rücksichten anordnete, überstieg die Kräfte der nahen oder fernen Bankhäuser, die ihm gehörten; er kam öfter in den Fall, sich des Geldes der Stadt zu bedienen. Die Magnifizenz, die ihm seinen Beinamen gegeben hat, ging über die Stellung eines Privatmannes hinaus, seine Handlungen lassen sich nicht mehr unter diesen Begriff einengen. Er wollte mehr der erste florentinische Bürger, als er erste florentinische Kaufmann sein; die schönsten Besitzungen (bei Pisa und Volterra breitete er sie aus) mußten ihm gehören; er mußte den erlesensten Marstall haben, die trefflichste Jagd, die seltensten Edelsteine, die reichsten Sammlungen. Sein Ehrgeiz war auch, die ausgezeichnetsten Männer in jedem Fache um sich zu haben. Als er die Universität Pisa wieder erneuerte, bemerkte man ihm, sie werde sich doch nie an Zahl der Studierenden mit Padua oder Pavia messen können; er antwortete, es sei ihm schon genug, wenn sie nur das vorzüglichste Professorenkollegium habe. Für die Kunst bildete Florenz eine Art von Metropole; Lorenzos Urteil war so treffend, daß die Künstler um seinen Beifall wetteiferten. Ein hochgewachsener Mann von schwarzem Haupthaar, fahler Gesichtsfarbe, dessen Stimme meistens einen heiseren Ton hatte; liebenswürdig im Umgang, in der Diskussion scharfsinnig und beredt. In Sachen der Regierung liebte er sich kurz auszudrücken; er verlangte, daß man seinen Wink verstehe. Sein Wille war allmächtig in der Stadt. Guicciardini merkt an, seit dem Verfall des römischen Reiches habe es nirgends und niemals Bürger von so großer Autorität gegeben, wie Cosimo und dessen Enkel Lorenzo. Der vornehmste Unterschied zwischen diesen beiden großen Bürgern möchte darin liegen, daß der jüngere weniger ein guter Geschäftsmann des Hauses war, aber seine Familie zu vornehmeren Verbindungen erhob als der ältere. Seinen ältesten Sohn vermählte er mit einer Dame aus der Familie der Orsini, Alfonsina. Mit Papst Innozenz VIII. war er in enge Familienverbindung getreten; eine seiner Töchter vermählte er mit dem Sohne dieses Papstes, Francesko Cibo, und machte dann allen seinen Einfluß auf den Papst geltend, um für dieses Paar eine gute Ausstattung auszuwirken. Sein zweiter Sohn, Giovanni, wurde in das Kardinalkollegium aufgenommen. Man meinte, Lorenzo könne über den römischen Hof disponieren. Auch unter Lorenzo war Florenz in jener Blüte, welche die volle, durch den Frieden gesicherte Tätigkeit hervorbringen kann. Man wußte es demselben Dank, daß er das Gebiet erweiterte, die Häfen und Grenzplätze befestigte und mit Neapel sowohl, wie mit Mailand in ein gutes Vernehmen getreten war. In der Verwaltung der äußeren Angelegenheiten liegt vielleicht sein vornehmstes Verdienst. Er verstand es, das Gleichgewicht und den Frieden unter den italienischen Fürsten zu erhalten, nicht ohne die größten Schwierigkeiten; er hat wohl gesagt, er wünsche ein halbes Jahr verborgen zu bleiben, um nichts von ihren Zwistigkeiten zu hören. Aber es gelang ihm, solange er lebte, dem Ausbruch derselben vorzubeugen. Sein Name ist mit jener Epoche, in welcher Italien von direkten Einflüssen fremdländischer Potenzen frei war, unauflöslich verknüpft.
Zweites Kapitel.Piero Medici und die Staatsveränderung von 1494.
Wenn der Übergang von einer Regierung zur andern selbst in der erblichen Monarchie die Verschiedenheit der Epochen begründet, wie viel wichtiger und schwieriger ist es in der Republik, einem mächtigen Oberhaupt einen Nachfolger zu geben, der ihn wirklich fortsetze. Wiewohl Florenz Republik war, so lag doch ein Moment für die Erblichkeit der Gewalt darin, daß jene Genossenschaft der vornehmsten Geschlechter bestand, welche die Autorität zu teilen sich berechtigt glaubte, aber sich daran gewöhnt hatte, ein Oberhaupt anzuerkennen, dessen Ansehen auf einem großen Besitz und der Gewohnheit einer indirekten Gewalt beruhte.
Nach Lorenzos Tode wurde nun Piero ohne Schwierigkeit durch die vornehmen Geschlechter, die Magistrate und die allgemeine Bestimmung als Oberhaupt der Republik anerkannt. Die benachbarten Fürsten begrüßten ihn in dieser Eigenschaft, gleich als könne es nicht anders sein.
Allein wie schon bei dem Eintritt des älteren Piero und hernach gegen Lorenzo selbst unter den nahen und befreundeten Geschlechtern ein starkes Aufwallen der republikanischen Gesinnungen hervorgetreten und nur mit Anstrengung und Gefahr beseitigt worden war, so ließen sich auch unmittelbar nach Pieros Eintritt ähnliche Regungen bemerken. Zu den vertrautesten Freunden Lorenzos hatten Paol Antonio Soderini und Bernardo Rucellai gehört und an dem Regiment teilgehabt, aber schon unter Lorenzo waren sie dadurch verletzt worden, daß dieser sie weniger konsultierte als einige Vertraute von Verstand und Geist, die aber von niederer Herkunft waren. Unter Lorenzo war die Autorität durch die Intelligenz gleichsam geheiligt worden; was aber unter ihm geduldet werden konnte, schien unerträglich unter dem Nachfolger, der die bürgerlichen Tugenden seines Vaters nicht besaß, sich vielmehr in den Äußerlichkeiten des Lebens eines jungen Fürsten gefiel. Soderini und Rucellai stellten ihm vor, daß er nur unter Begünstigung der Mitglieder des Stato, d. h. des aristokratischen Elementes sich werde behaupten können. Andere aber, unter denen der Cancelliere Bibbiena als der vornehmste erscheint, entgegneten, daß er gerade auf diese Weise zugrunde gehen könnte. Ihnen schien das Heil allein in dem Übergewicht der einheitlichen Politik zu liegen, die bisher beobachtet worden war. Zwei geistliche Herren traten hierbei einander entgegen; der Bischof von Arezzo, Gentile, der alte Lehrer Lorenzos, dessen Ratschläge bei diesem immer viel vermocht hatten, jetzt aber von Piero ebenso hoch angeschlagen wurden, und Francesko Soderini, Bischof von Volterra, Bruder Paol Antonios, welcher die Partei der beiden Mißvergnügten nahm. Um die letzteren gruppierten sich bald die übrigen Mitglieder des Stato, die durch Familienverbindungen mit dem reichen Hause der Strozzi und noch mehr durch die Stellung der jüngeren Linie der Medici Rückhalt gewannen. Cosimo der Alte und dessen Bruder Lorenzo, beide Söhne des Giovanni, genannt Bicci, hatten ihre Geschäfte gemeinschaftlich betrieben. Nachdem aber der letztere verstorben und dessen Sohn Pier Francesko zu männlichen Jahren gekommen, war das Vermögen geteilt worden und diesem die ganze Hälfte desselben zugefallen. Man meinte in der älteren Linie, daß die jüngere bei der Teilung bevorzugt worden sei. In den folgenden Zeiten, in welchen die ältere so viele Gefahren zu bestehen, so viel Aufwand zu bestreiten hatte, war die jüngere zu größerem Reichtum gelangt, womit sich dann naturgemäß der Anspruch auf einen angemessenen Anteil an der Regierung verband. Die Söhne Pier Franceskos, Giovanni und Lorenzo, sahen es ungern, daß Piero sich weit über sie erheben solle; sie gesellten sich den unzufriedenen Geschlechtern bei.