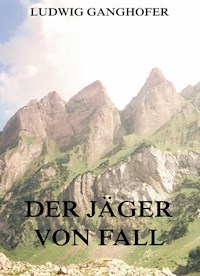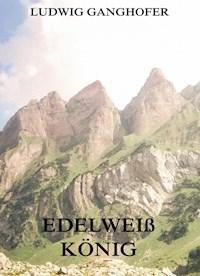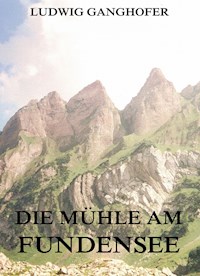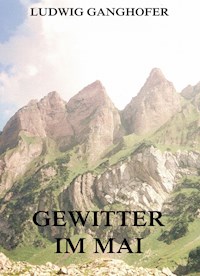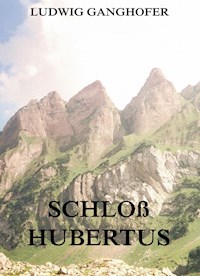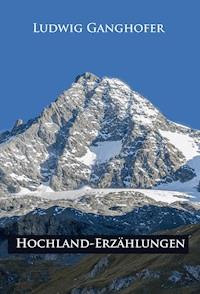
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: idb
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie blieben stehen – unter dem Fall der schweren Tropfen, die von den Bäumen niederklatschten – und blickten dem taumelnden Lichtlein nach, bis es im Dunkel des Waldes verschwunden war. Dann küßten sie sich und schritten weiter. Bei einer Biegung des Weges konnten sie durch eine breite Waldgasse weit hinaussehen in das dämmernde Tal. Dort unten war alles weiß – als läge noch überall der Hagel. Aber das war der See im Schaum seiner Wellen, und was so weiß über allen Gärten lag, das waren die Apfelblüten, die der Hagel von den Bäumen geschlagen. Es sollte an ihren Ästen keine Frucht mehr reifen in diesem Jahr. Der Lärm des Dorfes tönte schon mit dem Rauschen der Wellen über den Wald herauf. Und wo sich der See mit breiter Bucht in den Wald hineinschob, dort unten klangen schreiende Stimmen, aus deren erregtem Hall es wie Angst und Sorge zitterte. Doch die beiden, die so still und langsam durch den Wald hinunterstiegen, eins an das andere gedrängt – die beiden hörten nicht. Der rote Schein der Wolken war erloschen. Doch manchmal leuchtete im Geklüft der ziehenden Nebel ein fahles Blau, und manchmal zeigte sich in einer Spalte des Gewölks ein heller Streif – doch nur für kurze Dauer – dann woben sich wieder die grauen Schleier darüber. Und immer schwiegen die beiden. Nur ihre Augen sprachen, die sich immer wieder suchten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ludwig Ganghofer
Hochland-Erzählungen
idb
ISBN 9783961505319
Gewitter im Mai
Wie schön das war, dieses stille Rasten, fern von aller Unruh da draußen, nach langen Jahren wieder in der Heimat, an solchem Morgen, in der linden Maiensonne!
Ohne sich zu regen, die gebräunten Hände im Schoß, an die weißglänzende Mauer gelehnt und wunschlos träumenden Glanz in den blauen Jünglingsaugen, saß er zwischen Tür und Fenster auf der Hausbank und trank mit tiefen, ruhigen Atemzügen alle Schönheit in sich, die der Mai seiner Heimat um ihn herschüttete.
Über dem vorspringenden Hausdach, dessen Ränder sich in der Sonne wie goldflimmernde Linien vom zartblauen Himmel abhoben, zwitscherte ein Schwalbenpärchen, das vom Nestbau ein wenig ruhte. Lockende Finkenrufe klangen im Garten von den Ulmen her, deren weitgespannte Zweige schimmerig übersät waren mit den jungen Blättchen, mit tausend kleinen, blaßgrünen Herzen, die sich zitternd sehnten, in die große Sommerfreude ihres kurzen Lebens hineinzuwachsen. Und manchmal hörte man einen süßen Amselschlag in der schwarzgrünen, von zahllosen jungen Trieben licht übersprenkelten Fichtenhecke, die wie eine hohe lebende Mauer den Hof und Garten des Forsthauses umzog, als wär das eine abgeschlossene Welt für sich. Alles, was über der Hecke draußen war, schien ferner zu sein, weil es halb versunken lag: das ganze Dorf umher, die Nachbarhäuser, von denen man nur die rotbraunen Dächer mit den rauchenden Schornsteinen sah, die Kronen der blühenden Apfelbäume, die wie weiße Schneehügel über die Hecke hereinlugten, und die breite, zierlich ausgezahnte Wipfelreihe des Waldes, der zwischen Dorf und Bergen das Tal erfüllte. Nur der Kirchturm streckte lang seinen roten Hals und guckte von oben herab über die Hecke her, wie ein Neugieriger, der alles sehen will.
Und in weitem Kreis der ergrünenden Berge, über deren höchsten Wäldern und Felsen der Schnee noch lag, übergossen vom Duft des Morgens, eine blau erstarrte Riesenwoge neben der anderen – und je weiter sich die Höhen hinausschwangen in die Ferne, um so blauer wurden sie, bis sie ganz mit dem Himmel verschwammen, als wäre das letzte Felsgewänd in durchsichtige Luft verwandelt.
Rufende Stimmen klangen aus dem Dorf, Gebell der Hunde, Wagengerassel und der rastlose Hammerklang einer Schmiede, doch all diese Laute nur halb verständlich bei dem sanften Rauschen des jungen Laubes und bei dem spielenden Geplätscher, mit dem der glitzernde See seine kleinen, vom Morgenwind geschürten Wellen dicht vor der Hecke des Forsthauses an das kiesige Ufer spülte. Dieses gaukelnde Klingen der Wellen war wie die Trällerstimme eines Sängers, der sich bei schönem Wandern eines heiteren Liedes halb erinnert, immer wieder von vorne beginnt und das Ende nicht finden kann.
Und der ganze, weite See schien trunken von Sonne. Das Spiel seiner Wellen war wie ein Zaubertanz von Millionen weißen Flämmchen. Jeden anderen hätte dieses Glitzern und Gleißen geblendet. Doch der lächelnde Träumer dort an der leuchtenden Mauer sah mit ruhigem Blick über all das strahlende Geflimmer hinaus, denn seine Augen waren gewöhnt an den brennenden Glanz des Wassers. Und da lachte er plötzlich auf, als hätte ihn irgend etwas belustigt – irgend etwas an diesem lieblichen Gezitter und Geglitzer, mit dem sich der See in die blaue Ferne dehnte.
Die Handvoll Wasser da – und das Meer!
Wieder lachte er.
Dieses kindliche Getändel der kleinen Wellen – und der Taifun bei Madagaskar, gegen den sein Schiff drei Tage hatte ringen müssen, bis es mit rasierten Masten unter dem Notsteuer den Hafen gewann! Und sieben Mann waren über Bord gegangen – mit ihnen sein bester Kamerad, Fritz Radspeeler, der Sohn eines Rostocker Reeders.
»Min leiwer Jung!«
Dem lachenden Träumer grub sich eine ernste Furche in die braune Stirn. Und während er hinausblickte über das sonnige Spiel der Wellen, stiegen die Bilder aller Gefahren vor ihm auf, die er überstanden hatte da draußen in fernen Welten. Der Schiffbruch an der kalifornischen Küste – auf seiner ersten Fahrt als Leichtmatrose. Sieben Tage im Boot! Und nach der Rettung das Gelbe Fieber. Und das Jahr darauf, als er schon die volle Heuer hatte, die Revolte im chinesischen Theater zu Hongkong – die tausend bezopften Zuschauer in schreiender Wut gegen die vier deutschen Jungen, die beim Anblick dieser absonderlichen Kunst ein bißchen lustig und übermütig wurden. Wollten sie nicht erschlagen werden, so mußten sie sich mit dem blanken Messer einen Weg bahnen! Und die Tigerjagd in Indien, auf die der Prinz den jungen Försterssohn als Büchsenspanner mitgenommen hatte! Als der angeschossene Tiger, gereizt durch die Feuerbrände und den Paukenlärm der Treiber, dem Elefanten, der den Prinzen trug, auf die Schulter sprang, da hatte es gegolten, in allem Aufruhr einen sicher treffenden Schuß zu tun! – Und im Garten der Navigationsschule jener böse Sturz vom Top des Flaggenmastes! Und dieses traurige halbe Jahr auf dem Krankenbett! Und die Freude der Genesung! Dazu noch der Stolz auf die goldene Borte, als ihn Fritz Radspeelers Vater als Dritten Offizier für die ›Denderah‹ angemustert hatte! Und gleich auf der ersten Fahrt wieder die furchtbarste aller Gefahren – jene grauenvolle Nacht im Kanal, auf brennendem Schiff . . .
So stieg ein Bild um das andere vor ihm auf – doch alles mit gemildertem Schatten, alles in die linde Sonne dieses Morgens getaucht, der das vergangene Dunkel so schön und blau machte wie die Berge da draußen.
In verklärendem Glanz und mit heiterem Geflimmer, wie die spielenden Wellen im See, glitt alles an seinen Augen vorüber, was er erlebt hatte in diesen sieben Jahren, seit ein unüberwindlicher Widerwille gegen die Schulbank den Fünfzehnjährigen aus der Heimat fortgetrieben und dem Seemannsberufe zugeführt hatte. Und jetzt die stolze Freude, so heimzukehren, mit der Offiziersborte, als gemachter Mann, der einen schönen Lebensweg vor sich hat – und eine Stellung, die was trägt!
Das hatte er sich geschworen: nur so wieder heimzukehren. Und er hatte seinen Schwur gehalten – wenn ihm das Heimweh in der Brust auch gebrannt hatte wie zehrendes Feuer!
Und diese zitternde Erwartung während der langen Bahnfahrt! Von Rostock bis in die Berge, eine Nacht und einen ganzen Tag! Und dieses Gehämmer in seinem Herzen, dieses Glühen im Blut, als er am vergangenen Abend bei sinkender Dämmerung die dunkelblauen Gipfel der heimatlichen Berge unterschied! Und jetzt daheim! »Vater! Mutter!« Wie schnell sich das machte, diese Versöhnung nach sieben Jahren, unter Lachen und Tränen! Und dann das Sitzen in der lieben Stube, deren weiße Mauern übergittert waren von den Schatten der Hirschgeweihe! Und all das Erzählen bis in die späte Nacht hinein – und alle mit großen Augen um den Tisch herum, die Eltern, der alte Forstwart und die neuen Jagdgehilfen, der weißhaarige Dekan und der Schulmeister, der vor Jahren am Förstner-Poldi seine dicksten Haselnußstecken entzweigepredigt hatte. Und die wunderlichen Gesichter, die sie machten zu seinem Durcheinander von heimischem Dialekt und seemännischem Platt, das er sich an Bord von den Matrosen angewöhnt hatte! Das war das einzige, was dem Vater an seinem Buben nicht gefiel. »Ist alles recht«, meinte der Alte, »aber kein Vogel sollt das Gesangl vergessen, das er gelernt hat in seinem Nest!« Da hatte sich Poldi alle Mühe gegeben, beim Erzählen die Sprache der Heimat wiederzufinden. Aber das wollte ihm nicht recht gelingen. Damals vor sieben Jahren, als er an Bord gekommen, hatten ihn die anderen wegen seiner heimatlichen Sprache immer gehänselt und hatten ihm, weil er so gerne von seiner Mutter redete, den Spitznamen ›Muatterl‹ gegeben, wobei sie das ›u–a‹ in die Länge zogen, als wär's ein Gähnen. Um diesem Spott zu entgehen, der ihm oft die Tränen in die Augen trieb, hatte er seine Zunge gemartert, bis sie sich an das Platt der anderen zu gewöhnen begann. Und die jahrelange Gewohnheit dieses fremden Klanges sollte er nun in der ersten Stunde unter dem Dach seiner Eltern wieder abwerfen, weil sich der Vater ärgerte über diese Sprache, die er nur halb verstand, und weil die Mutter so wehmütig lächelte bei diesen fremden Lauten, die ihr nur an das Ohr klangen, doch nicht ins Herz. Ihr zuliebe plagte sich Poldi redlich die ganze Nacht bis zwei Uhr morgens, um wieder so reden zu lernen, wie er einst daheim als Bub geschwatzt und geplaudert hatte. Und wenn er langsam sprach, gelang es ihm auch. Doch wenn er beim Erzählen in Erregung geriet, dann ging ihm wider Willen das gewohnte Platt von der Zunge, so daß die Mutter fragen mußte: »Was, Bub? Was hast gesagt?« Aber den frohen und zärtlichen Blick seiner Augen verstand sie leicht und ganz. Und wenn er sie mit solchen Augen ansah, fühlte sie auch in ihrem Herzen: Diese fremde Sprache, das ist nur ein äußerliches Ding, das hat mit seiner Liebe zu Mutter und Vater, mit seinem Festhalten an der Heimat nichts zu schaffen. »Bist halt doch mein Bub noch, gelt!« Diese Erkenntnis machte sie wieder froh – und wie Poldi sich plagte, so zu reden, daß ihn die Mutter verstehen möchte, so gab die Mutter sich alle Mühe, ihren Buben so zu verstehen, wie er redete. Der Vater brummte und lachte dazu – und so löste sich für Poldi der unbehagliche Mißton, der seine Rückkehr ins Elternhaus schon bedroht hatte, zu glücklicher Heiterkeit.
Und dann dieser feste, gute Schlaf in dem Stübchen seiner Schulzeit, in dem alten Bett mit den geblumten Kissen!
Und jetzt dieser zaubervolle Morgen! Und Urlaub für zwei herrliche Wochen! Nur rasten – nichts anderes wollte er – nur rasten, so recht von Herzen die Ruhe in der Heimat genießen und die linde Sonne trinken, die Berge schauen, nur immer so sitzen wie jetzt!
Wie schön das war! Dieses lächelnde Träumen unter dem leuchtenden Maienhimmel, wunschlos und fern von aller Unruh in der Welt da draußen, jede Minute wie ein ganzer Tag in stillen Herrlichkeiten!
Auf dem Hausdach zwitscherte das Schwalbenpärchen. Doch plötzlich schwiegen die Zärtlichen und huschten unter den Vorsprung des Daches, wo das halbgebaute Nest an der Mauer hing.
Ein Sperber war vom Walde her über das Haus geflattert.
Auch in den Ulmen, in der Fichtenhecke, überall schwiegen die Vogelstimmen. Doch nicht lange. Nach einem Weilchen tönte schon wieder von allen Ecken das zärtliche Gepisper, das Locken und Schlagen.
Aus dem offenen Hausflur klang die lebhaft heitere Stimme der Försterin, die sich in der Küche um die Leibspeisen ihres Buben sorgte und der alten Köchin von Madagaskar erzählte, von den Elefanten auf Ceylon und von den indischen Tigern. Und in der Kanzlei, deren Fenster offen stand, brummte der Förster mit einer Bäuerin, weil sie Waldstreu in einer jungen Schonung gerecht hatte. Ein doppelter Forstfrevel! Denn erstens ist das Streurechen im Frühjahr überhaupt schon ein Kapitalverbrechen am Wald, der im frischen Safttrieb und bei den gefährlichen Nachtfrösten seine sichere Bodenwärme braucht. »Dir tät's auch nicht taugen, wenn du bei der ärgsten Kälten im warmen Bett liegst, und es reißt dir einer die Zudeck weg!« Und zweitens gehört der Staatswald nicht den Bauern – und was einem anderen gehört, das soll man in Ruh lassen! Diese alte Weisheit unterstrich der Förster mit so kräftigem Ton, daß der lächelnde Träumer, der draußen unter dem offenen Fenster saß, aus seinen schauenden Gedanken erwachte. Er tat einen Blick in die Runde und legte die Arme auseinander, als stünde der schöne, sonnige Frühlingsmorgen wie ein Glück vor ihm, das sich umarmen ließe.
»Freilich, ja«, meinte die Bäuerin in der Kanzlei, »aber wenn die Kuh ihr Sach halt haben will! Und wenn's schon so ist in der Welt, daß das Beste allweil einem andern gehört!«
»So? Und da muß man gleich stehlen, meinst? Nette Grundsätz! Brav! Jetzt mach, daß du weiterkommst, gelt! Und sei froh, daß gestern mein Bub heimgekommen ist und daß ich eine Freud im Haus hab! Sonst tät ich die Anzeig machen, und du könntest für acht Tag ins Loch spazieren! Soll's halt gut sein für heut! Punktum und Streusand drauf!«
Die Bäuerin kam aus der Haustür, machte vor dem jungen Seemann ein Buckerl, als wär's der hochwürdige Herr Dekan, und sagte demütig: »Vergelts Gott, Herr Poldi, weil d' wieder daheim bist!«
Poldi lachte, ohne den schlau vergnügten Blick zu gewahren, den die Bäuerin über das Kanzleifenster huschen ließ. Im Glanz dieses Morgens wurde alles für ihn zu traulicher Schönheit, und die alte verschmitzte Walddiebin verwandelte sich in ein liebes, freundliches Menschenkind, mit dem sich herzlich und heiter schwatzen ließ.
Dann wieder dieses wohlige Ruhen, dieses lächelnde Träumen, das trinkende Schauen über den glitzernden See hinaus und in die blauen Berge – bis ihm eine linde, schmeichelnde Hand über das lockige Blondhaar streifte.
Die Mutter stand vor ihm, halb städtisch und halb wie eine Bäuerin gekleidet, mit der weißen Küchenschürze. Ihr Haar war grau, doch in der Sonne schien es noch blonden Schimmer zu haben. Keine alte Frau. Sie hatte kaum ein paar Jährchen über die Vierzig. Aber in ihrem Leben waren Jahre, die doppelt und dreifach zählten. Sieben Jahre des Harrens, sieben Jahre der Sorge um ihren Buben hatten sich mit scharfen Linien in ihr Gesicht geschrieben und ihre Augen schwermütig und ernst gemacht. Doch an diesem Morgen sah sie aus, als wäre ihr mit dem Sohn auch ein Stücklein der eigenen Jugend wieder zurückgekommen. Stolz und Freude glänzten ihr aus den Augen, und eine Zärtlichkeit wie mildes Feuer war in ihren Worten, als sie sagte: »Gelt, Bubele, daheim ist's halt am schönsten?«
Er nahm ihre Hände und sah mit glücklichem Lächeln zu ihr hinauf. »Ja, Mutting!« Doch er merkte gleich, daß sie das fremde Wort nicht gerne gehört hatte – und drückte ihre Hände an seine Wange. »Mutterl, mein gutes!« Und nach einer Weile sagte er: »Weißt, meine Kameraden an Bord, wenn die von daheim so spraken hewwen . . . bei denen heißt es halt: Mutting. Dat is mi so im Ohr blewen. Und tausendmal hab' ich es gesagt . . . so oft ich heim hab' denken müssen.«
Da strich sie ihm wieder mit der Hand übers Haar, zärtlich und langsam. »Sag halt, wie du magst! Ist der rechte Klang drin, schau, so ist jedes Wörtl gut.« Sie setzte sich zu ihm auf die Bank und fing zu erzählen an, vom Haus, das man hatte umbauen müssen, weil der Regen überall durch das morsche Dach gegangen war – und vom Garten, der vor sieben Jahren ganz anders ausgesehen hatte wie heute. Die hohe Fichtenhecke war damals noch eine magere Reihe kleiner Pflanzen gewesen, junge Setzlinge hatten sich inzwischen zu schattenden Bäumchen ausgewachsen, und von den Ulmen des Gartens hatte man eine vierhundertjährige fällen müssen, denn die Jagdgehilfen hatten, um ihre Büchsen einzuschießen, eine Scheibe an den Stamm genagelt, und schließlich war der Baum mit Bleikugeln so gespickt, daß die Krone dürr wurde.
Mit aufgeregtem Gesicht erschien die alte Köchin unter der Haustür: Die Frau Försterin möchte doch nachsehen, ob der Teig für den Äpfelstrudel dünn genug ausgezogen wäre.
»Leg ein Zeitungsblättl drunter! Kann man durchlesen, so ist der Teig gut!«
Aber besser war's doch, wenn die Försterin selber Nachschau hielt; denn an dieses erste Mittagsmahl in der Heimat, an diesen Parademarsch aller Leibspeisen, sollte ihr Bub noch denken müssen ›da hinten in Mexiko und da drüben in der Japanei!‹
Sie erhob sich und nahm den Blondkopf des Sohnes zwischen die Hände. »Laß dir halt die Zeit nicht lang werden, gelt! Ein Stündl muß ich schon in der Kuchl bleiben. Und der Vater hat Kanzleitag heut. Was tust denn derweil?«
»So sitzen halt! Und schauen! Was Lieberes weiß ich mir nicht.«
»Magst denn nicht ein bißl ins Dorf gehen?« Sie meinte in ihrem glücklichen Stolz: ›Daß doch die Leut meinen Buben sehen!‹ Aber sie sagte: »Daß doch schauen kannst, was deine Kameraden machen! Ja, Bub, die sind große Mannsbilder worden, alle! Dem Schulmeister der seinig! Und der Fischernaz! Und 's Nagelschmieds Domini! Den, mein' ich, freut's am meisten. Schau, dem sind Vater und Mutter derweil gestorben.«
»Geh!« Er sagte viel mit diesem kurzen, bekümmerten Wörtchen. »Ja, Mutter, hast recht! Da möt ick hinschauen, zum Dom'ni! Und gleich!«
Sie lief in den Hausflur und brachte ihm die Schirmmütze mit der Goldborte – ganz vorsichtig, zwischen den Fingerspitzen, trug sie dieses kostbare Ding. Und dann blieb sie in der flimmernden Morgensonne auf der Hausschwelle stehen und sah in ihrem Glück und Stolz dem Buben nach, der über den leuchtenden Kiesweg auf das Tor der Hecke zuging.
Wie schmuck er aussah in seiner knapp sitzenden Seemannstracht, in der kurzen Jacke mit den blitzenden Goldknöpfen, die schimmernde Mützenborte um das Blondhaar! Das hübsche Gesicht, in dem sich heitere Gutmütigkeit seltsam mischte mit jenem strengen Ernst, den die Stunden dunkler Gefahr in junge Gesichter zeichnen, war von der Tropensonne so dunkel gebräunt, daß das Bärtchen auf der Lippe und der leicht gekräuselte Flaum der Wangen fast weiß erschienen. Etwas ruhig Wiegendes war in der Art, wie er sich hielt – der Schritt energisch, und doch der Gang ein wenig schwerfällig, wie man sich das an Bord eines rollenden Schiffes so angewöhnt.
Als er an der Hecke das Gatter öffnete und auf die Straße trat, kam der Vater aus dem Haus und blieb neben der Mutter stehen – in brauner Lederjoppe mit dem goldenen Eichenlaub auf grünem Stehkragen, ein derbknochiger Mann, im groben Wetter der Berge gehärtet, mit grauem Vollbart und über der furchigen Stirn einen dicken Haarschopf, der sich im Ärger der Kanzleistunden wie elektrisch gesträubt hatte. Dem Gesicht war es anzusehen, daß Beruf und Leben dem Förster Hohenleitner mehr Verdruß als Freude bereitet hatten. Aber das Vaterglück dieses Tages hatte auch in diesen müd-verdrossenen Augen einen hellen, heiteren Schimmer geweckt.
»Wo geht er denn hin?«
»Ein bißl ins Dorf halt. Dem Domini ›Grüß Gott‹ sagen.«
Poldi war schon auf der Straße verschwunden. Doch die beiden hörten noch seinen Schritt und ließen die Augen in freudigem Betrachten über die Hecke hingleiten, als wäre sie durchsichtig. Und schmunzelnd legte Hohenleitner den Arm um den Hals seiner Frau: »Gelt, Mutter, jetzt hat's der Herrgott halt doch mit unserem Buben noch gut und recht gemacht!«
»Halt ja! . . . Freust dich, Xaverl?«
»Und wie!«
Sie schmiegten sich aneinander wie junge Liebesleute und lauschten. Denn vom Nachbarhaus herüber hörten sie die Stimmen, die ihren Buben begrüßten.
Was das ein Aufsehen gab: der Förstner-Poldi wieder daheim! Mit einer Goldborte! Wie der Bezirksamtmann am Fronleichnamstag!
Poldi brauchte eine Stunde, bis er an den paar nächsten Häusern vorüberkam. Überall rannten die Leute an die Zäune und schwatzten mit ihm und wollten gleich was erzählt bekommen. Und immer stand ein Häuflein Kinder um ihn her, die mit großen, staunenden Augen an ihm hinauf guckten, denn sie sahen nicht nur den Förstner-Poldi und die Goldborte, sie sahen ein riesenhaftes Schiff mit weißen Segeln, Wasserwogen wie Berge, Neger und Löwen, Haifische und Indianer.
Auch in Poldi begann etwas zu erwachen, das der Märchenstimmung glich, die aus den Augen der Kinder leuchtete. Die Freude und Freundlichkeit, mit der ihn alle Leute begrüßten, wärmte sein Herz; und das Gefühl, daß er für das Dorf eine Hauptperson geworden, um die sich alles zu drehen anfing, weckte etwas wohlig Heißes in seinem Blut, einen heiteren, glücklichen Stolz. Und wie die Augen der Kinder bei Poldis Anblick in märchenhafte Ferne schauten, so blickten seine eigenen Augen auf Schritt und Tritt zurück in die lieben Märchen der entschwundenen Kinderzeit.
Da stand die Linde, in deren Gezweig er seine ersten Kletterversuche gemacht und sein erstes Höschen zerrissen hatte! Da standen die Apfelbäume, von denen er heimlich die verbotenen Früchte genascht – die erste Sünde seines Lebens. Das waren die Zäune, durch die er geschlüpft, die Wiesen, in deren kühlem Gras er gelegen, wenn ihm von Spiel und Lauf die Wangen glühten. Dieses schmale Sträßlein neben dem See, das war der Weg zur Schule, dieser rauhe Kriegspfad seiner Knabenzeit! Und am Ufer kannte er jeden Fleck – hier, in der kleinen Bucht hinter dem alten Badehäuschen, hatte er am liebsten mit der Angelrute gestanden – hier, wo das Wasser seicht wurde über weißem Kies, war er mit aufgestülptem Höschen an jedem Sommertag in den See gewatet, um die flachen Kiesel für seine Schleuder zu suchen, oder um das Schifflein, das er aus einer Borkenrinde geschnitten und mit weißen Lappen aufgetakelt hatte, in den Wind zu setzen für eine Fahrt, die immer mit einem Schiffbruch endete! Dort stand des Nagelschmieds Schiffhütte, das geheimnisvolle Paradies seiner Knabenfreuden, die ›Räuberhöhle‹ und ›Festung‹, die er mit seinem ›Blutsbruder‹ Domini gegen alle feindlichen Mächte siegreich verteidigt hatte. Und da drüben vor dem Garten des Altwirtes schwamm das große Fährfloß, bei dem er das kleine Weber-Dorle aus dem Wasser gezogen hatte. Die Fähre war schon seit Jahren außer Dienst gestellt, denn Kielboote und Motoren vermittelten den gesteigerten Verkehr zwischen den Ufern – aber das alte Fährfloß mit den schwarzen, schlüpfrigen Balken schwamm noch immer im See.
Auch sonst war vieles anders und neu geworden im Dorf. Die Häuser hatten sich verändert, um dem Geschmack der Städter zu dienen – fast an jedem Hause hing ein großer Zettel mit der Inschrift: ›Sommerwohnung‹ und ›Fremdenzimmer‹ –, neue Villen mit roten Ziegeldächern lugten zwischen den Baumkronen hervor, an der Seestraße entlang erhoben sich Stangen mit den Telephon- und Telegraphendrähten, und über alle Dächer hinaus ragten die plumpen, grüngestrichenen Masten der elektrischen Leitung.
Den klugen Einfall, die gute und billige Wasserkraft der Ache für die Erzeugung elektrischen Lichtes nutzbar zu machen, hatte Nagelschmieds Domini gehabt. In einem langen, arbeitslosen Winter hatte der junge Bursch alles Eisenzeug für die Anlage und Leitung mit eigener Hand geschmiedet – und hatte seine Trauer um Vater und Mutter, die damals im Herbst gestorben waren, in das glühende Eisen hineingehämmert. Zuerst hatte man im Dorf über den ›neumodischen Planer‹ gelacht – bis der Erfolg die Leute bekehrte. Nach drei Jahren waren alle Schulden, die Domini für die Anschaffung der Dynamomaschine hatte machen müssen, bis auf den letzten Heller abbezahlt. Und im vergangenen Winter hatte man den ›Lichtschmied‹, wie man ihn zu nennen anfing, in den Gemeinderat gewählt – der erste Fall, daß man einem ledigen Burschen so ernste Würde übertrug.
Als sich Poldi auf dem Seesträßlein der Nagelschmiede näherte, aus deren Werkstätte der rastlose Schlag der Hämmer tönte, konnte er's dem alten Haus auch von außen ansehen, daß unter dem Dach des Domini der Wohlstand einzukehren begann. Die Mauern waren frisch getüncht, Haustür und Fensterläden neu gestrichen, milchblau mit roten Linien, und im Garten waren Taglöhner beschäftigt, um den Zaun zu bessern, die neu angelegten Wege zu bekiesen, Bäumchen zu setzen und die Beete umzugraben. Das Haus, das vor sieben Jahren ein verwahrloster und brüchiger Bau gewesen war, schien wie für ein neues, festliches Leben aufgeputzt, wie geschmückt für ein wartendes Glück, das seinen Einzug halten wollte! Und über seinem Dach die strahlende Sonne, der Himmel in seinem reinen Blau, um die Mauern her ein Kranz von blühenden Obstbäumen – und das alles spiegelte sich im See, der sich mit einer windstillen Bucht bis an den Zaun des Gartens heranbog.
Zu der warmen Sonnenfreude, die der schöne Morgen in Poldis Herz hineingeleuchtet hatte, kam beim Anblick dieses verwandelten Hauses noch die Freude über das werdende Glück des Freundes, der ihm von allen Kameraden immer der liebste gewesen, obwohl sie im Alter um fünf Jahre auseinander waren.
Er machte raschere Schritte, als könnte er den Augenblick nicht erwarten, in dem er die Hände des Freundes in den seinen halten und zu ihm sagen durfte: ›Gelt, Domini, aus dir und mir ist was geworden! Jetzt hat ein jeder von uns sein gutes Glück in der Hand – aber das deinige ist das bessere, weil es daheim ist – das meinige liegt in der Welt da draußen!‹
Schon wollte er von der Seestraße in den Fußweg einbiegen, der zur Nagelschmiede über eine Wiese führte, die mit Butterblumen gelb übersät war. Da ging ein junges Mädchen an ihm vorüber, das mit einem großen, steinernen Henkelkrug vom Altwirt kam – eine Gestalt, so zierlich schlank, als wäre eine zarte Städterin in dieses grobe, mit wenig Kunst geschneiderte Wollkleid verwunschen. Der derbe, braun und blau karierte Stoff wollte sich nicht in Falten schmiegen, und dennoch erkannte man die feinen Linien des jugendlichen Körpers, der sich unter dem Gewicht des schweren Kruges elastisch gegen den freien Arm zur Seite neigte. Ein weißes Kopftuch war offen um die Zöpfe gelegt, und unter dem Dächlein des Tuches lugte aus goldigem Schatten ein schmales, sanftes Gesichtchen hervor, mit rosigen Farben, mit spielenden Grübchen in den Wangen, ein freudig verlegenes Lächeln um den roten Mund und erregten Glanz in den nußbraunen Augen, über denen sich ein widerspenstiges Ringelchen des dunklen Haars in die weiße Stirn lockte. Sie zögerte ein wenig und machte kleinere Schritte, als möchte sie angesprochen werden – doch Poldi stand nur und schaute – und da wurde sie noch verlegener: grüßte ganz leise und ging vorüber.
Er sah ihr nach. »Herr Gott, wat en smuckes Mäten!« Das war ihm so auf die Lippen gekommen, er wußte nicht wie!
Wer war das Mädel?
Er meinte sie zu kennen – – Und jetzt stand sie da drüben still und sah sich um – nur ein wenig, mit halbem Gesicht, für einen flüchtigen Blick nur, dann ging sie hastig weiter und verschwand hinter einer Hecke, über deren grünen Saum ihr schimmerndes Kopftuch hinglitt wie ein silberweißes Täubchen, das über die Zweige trippelt.
Wer war das Mädel?
Immer suchte er in seiner Erinnerung und konnte dieses Gesichtchen nicht finden.
War's eine Fremde im Dorf? Und hatte ihre Neugier nur seinem blauen Tuch und der Goldborte an seiner Mütze gegolten?
Warum aber war sie so seltsam verlegen? So merkwürdig erregt?
»De möt mi kennen!«
Er suchte und suchte – –
Wie alt sie wohl sein mochte? Zwanzig! Oder neunzehn erst?
Kannte sie ihn, und war sie im Dorf daheim, so mußte sie damals, als er die Heimat verlassen hatte, ein zwölfjähriges Dingelchen gewesen sein!
Alle die Kindergesichter, an die er sich erinnerte, ließ er an seinem Blick vorübergleiten – immer suchte und suchte er – – und als er in der Nagelschmiede unter die Tür der Werkstatt trat, hatte er völlig vergessen, daß er dem Domini sagen wollte: ›Aus dir und mir ist was geworden! Du und ich, von uns beiden hat jeder sein Glück in der Hand!‹
Ganz verträumt, noch immer mit suchenden Augen, blickte er in den dämmerigen Raum mit den geschwärzten Mauern, die von der großen, glutstrahlenden Esse mehr Licht empfingen als von den kleinen Fenstern und der halb geöffneten Tür.
Helles Klingen und hastiger Hammerschlag, dazu das schwere Fauchen des Blasbalges, der die Glut der Kohlen schürte, und das Sausen des Schwungrades, dessen Treibriemen durch zwei Mauerlöcher hinauslief in die Turbinenkammer. Und draußen das Rauschen und Geplätscher der Ache und der schütternde Lärm des Wasserwerkes.
Alle Ecken des Raumes waren mit langen Eisenstangen angefüllt, und rings um die Mauern standen vier Gesellen vor den Nagelbänken, jeder bei einer kleinen Esse, jeder Gesell in der Linken das glühende Stabeisen und in der Rechten den rastlosen Hammer. Immer ein Dutzend flinker Schläge, und der fertige Nagel, noch ein wenig glühend, federte aus dem Kopfloch heraus und sprang in eine Eisenschale, um sich auszukühlen und geduldig abzuwarten, wem er dienen würde, dem Tischler, der für ein junges Glück den Hausrat bosselt, oder dem Schreiner, der die Särge macht.
Vor der großen Esse, aus deren Höhle der rote Glutschein leuchtete, stand ein mächtiger Amboß inmitten des Raumes. Ein Lehrbub hielt in langer Zange einen weißglühenden Eisenklumpen, und Domini, mit nackten, rußgeschwärzten Armen, in dunklem Wollhemd, eine blauleinene Überhose über dem Beinkleid und mit dem ledernen Schurzfell, schwang über dem glühenden Eisen den schweren Streckhammer. Bei jedem Schlag ging ein Sprühregen blitzender Funken nach allen Seiten aus; das war über dem Amboß wie das Bild einer Sonne, während an den Nagelbänken nur kleine Sterne aufloderten.
Schweigend legte Poldi seine Hand auf die Schulter des jungen Schmiedes.
Domini ließ den Hammer rasten und drehte den Kopf. Als er den Freund erkannte, nickte er und lachte – in seinem berußten Gesicht blinkten die weißen Zähne wie beim Lachen eines Negers. Und Domini schien einer von den Menschen zu sein, in denen die Freude langsam wächst. Die paar zögernden Worte, die er sagte, blieben unverständlich bei dem Hammerschlag der Gesellen und bei all dem Lärm, der in der Schmiede herrschte. Dann aber glänzte es in seinen Augen auf, und er machte eine Bewegung, als wollte er den Freund an die Brust drücken. Doch lachend sah er seine Hände und sein Schurzfell an – und weil nun auch von den Gesellen einer nach dem andern den Hammer ruhen ließ, um in Neugier den Gast und die Goldborte an seiner Mütze zu betrachten, konnte Poldi verstehen, wie Domini zu dem Lehrbuben sagte: »Tu das Eisen in die Glut!« Lachend ging der Schmied auf einen Wasserbottich zu und begann die Hände und das Gesicht zu waschen.
Alle Hämmer schwiegen. Nur der Blasbalg fauchte, mit Rauschen fuhr der Luftstrom durch die wachsende Glut der Esse, und draußen brummte die Turbine.
Domini trocknete sich mit einem Handtuch, das er wie ein Mensch, der an Ordnung gewöhnt ist, wieder an den Nagel hängte. Dann kam er auf Poldi zugegangen. Dabei sah man, daß er mit dem rechten Fuß ein wenig hinkte – vor zehn Jahren, als er bei seinem Vater in der Lehre gestanden, war einem Gesellen während der Arbeit der Stiel des Streckhammers entzweigebrochen, und das schwere Eisen hatte dem Buben das Schienbein zerschlagen. Ganz war der Schaden nicht wieder gut geworden – und Dominis Vater und die anderen im Dorf hatten damals gesagt: »Was der Bub ein Glück hat! Jetzt muß er nimmer Soldat werden und kann daheimbleiben!«
Lachend streckte der Schmied dem jungen Seemann die beiden Hände hin. »Grüß dich, Poldi! Die Freud, daß du wieder daheim bist! Ich wär schon gestern abend gern hinuntergekommen, Grüß Gott sagen. Aber weißt, ich hab zur Weberin hinauf müssen.« Es war etwas Langsames in seiner Art zu reden. Als dächte er sich bei jedem Wort viel mehr als er sagte. »Und heut in der Früh hat die Arbeit wieder angehoben. Die Leut, die pressieren halt. Aber allweil ist mir's fürgangen: Du kommst! Und Vergelts Gott halt, daß du denkt hast an mich! Gelt, bist mir noch allweil gut?«
Poldi sagte kein Wort. Er lachte nur und drückte die Hand des Kameraden.
»Aber geh, komm! Jetzt setzen wir uns ein bißl hinaus in die Sonn. Arbeit ist da wie Wasser beim Regen. Aber dir z'lieb leidet's schon ein Feierstündl! Und draußen hast ein leichters Reden!«
Als sie zur Türe gingen, drehte Domini das Gesicht nach den Gesellen zurück. »Machts weiter, Leut!«
Wieder klangen die Hämmer.
Die beiden traten hinaus in den Glanz der Sonne, in den Duft der blühenden Apfelbäume, in allen Maienzauber des schönen Morgens.
»Wart ein bißl!« sagte Domini und wischte sorgfältig mit dem Schurzfell die Hausbank ab. »Daß dir keinen Schaden tust an deiner nobligen Montur . . . Herr Kapitän!«
»Kapthein! So weit sind wi noch lang nich! Aber wat nich is, kann noch werden!«
Nun lachten sie alle beide, Poldi über seine Kapitänswürde und Domini über die fremdklingende Sprache, die er da zu hören bekam.