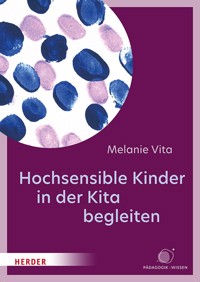
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Um Hochsensibilität bereits bei kleinen Kindern zu erkennen, richtig einzuschätzen und zu begleiten, müssen pädagogische Fachkräfte lernen die Eigenschaften hochsensibler Kinder zu verstehen. Dazu braucht es eine entsprechende innere Haltung, vertiefte Kenntnisse über die Entwicklungsphasen, sowie eine aktive Unterstützung dieser Kinder und letztlich ihrer Eltern - auch in herausfordernden Situationen. Wie ein professioneller Umgang mit hochsensiblen Kindern in der Kita gelingen kann, zeigt dieses Buch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 196
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Aus Umweltschutzgründen wurde dieses Buch ohne Folie produziert.
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2025
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Lektorat: Caroline Baumer, Freiburg
Umschlagkonzept: Sabine Hanel, Gestaltungssaal
Umschlaggestaltung: Verlag Herder
Umschlagmotiv: © Marlen Mia Vita
Illustrationen & Abbildungen: siehe Abbildungsverzeichnis
Papierstruktur im Innenteil: © Charunee Yodbun – shutterstock
Satz: Sabine Hanel, Gestaltungssaal
E-Book-Konvertierung: Newgen Publishing Europe
ISBN Print 978-3-451-39785-1
ISBN EBook (EPUB) 978-3-451-83448-6
ISBN EBook (PDF) 978-3-451-83449-3
Inhalt
Einleitung
1. Hochsensibilität in der frühen Kindheit
1.1 Was heißt hochsensibel?
1.2 Neurologische und weitere Besonderheiten
1.3 Wie erkenne ich ein hochsensibles Kind?
1.4 Einflussfaktoren auf die Entwicklung hochsensibler Kinder
1.5 Abgrenzung zu anderen Diagnosen
1.6Auf einen Blick
2. Entwicklungsbegleitung hochsensibler Kinder
2.1 Innere Haltung der pädagogischen Fachkraft
2.2 Brückenhilfen und Sicherheitsanker
2.3Auf einen Blick
3. Herausforderungen im Kita-Alltag
3.1 Überblick über alltägliche Herausforderungen
3.2 Eingewöhnung
3.3 Strukturelle Gegebenheiten
3.4 Umgang mit Stress
3.5 Strategien zum Umgang mit Emotionen
3.6 Beobachtungsbögen zur Erfassung der Bedürfnisse
3.7Auf einen Blick
4. Systemischer Blick auf das Ganze
4.1 Zusammenarbeit mit Eltern gestalten
4.2 Auf das eigene Wohlbefinden achten
4.3 Team ins Boot holen
4.4Auf einen Blick
5. Häufige Fragen
5.1 Allgemeine Fragen zur Hochsensibilität
5.2 Fragen zum Krippenbereich
5.3 Fragen zum Umgang mit abweichendem Verhalten
5.4 Fragen zur Förderung hochsensibler Kinder
Schlusswort
Anhang
Anlaufstellen
Buchempfehlungen
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Danksagung
Einleitung
Das Thema Hochsensibilität gewinnt in unserer Gesellschaft zunehmend an Aufmerksamkeit. Als ich vor über fünfzehn Jahren begonnen habe, mich damit auseinanderzusetzen, gab es nur eine Handvoll deutschsprachige Literatur. Inzwischen findet sich vielfältige Lektüre zu diesem Thema und die Beiträge in den sozialen Medien steigen ins Unermessliche. Dabei herauszufinden, welche Beiträge sich mit dem aktuellen Forschungsstand decken und welche nicht, kann schwierig sein. Denn trotz zunehmender Präsenz des Themas sind viele Fragen offen, sodass nach wie vor großer Aufklärungsbedarf besteht – auch beim Kita-Personal. Für den pädagogischen Bereich fehlt es bislang insbesondere an Literatur, die konkrete Handlungsstrategien für den pädagogischen Alltag bietet. Mit diesem Buch möchte ich Ihnen als pädagogische Fachkräfte darum sowohl Wissen über die Hochsensibilität vermitteln als auch die Herausforderungen in der Kita beschreiben. Je mehr Kenntnisse Sie haben, desto besser können Sie einschätzen, ob ein Kind die Persönlichkeitsstrukturen einer Hochsensibilität in sich trägt, und entsprechende Handlungsstrategien ergreifen.
Sigmund Freud soll gesagt haben: »Wenn wir die Gründe für das Verhalten der anderen verstehen könnten, würde plötzlich alles einen Sinn ergeben.« Unabhängig davon, ob das Zitat echt ist, erlebe ich in meiner Praxis genau diesen Sachverhalt fast täglich. Regelmäßig kommen Eltern in die Beratung, die das Verhalten ihrer hochsensiblen Kinder nicht verstehen, sich nicht zu helfen wissen und nach seinem Sinn suchen. Ähnlich geht es auch pädagogischen Fachkräften, die bei Handlungen der Kinder vor Rätseln stehen und versuchen, Lösungen zu finden. Schlüsselt man kindliches Verhalten auf, ermittelt die Hintergründe und erkennt die dahinter verborgenen Bedürfnisse, so ergeben bestimmte kindliche Reaktionen plötzlich einen Sinn. Das Wissen um die Bedeutung kann darum helfen, bedürfnisorientiert vorzugehen und das Kind pädagogisch zu unterstützen. Wie wichtig dieser Verständnisprozess ist, zeigen neueste Studien. Sie legen dar, dass eine achtsame und verständnisvolle Begleitung hochsensibler Kinder dafür sorgt, dass die Vorteile einer Hochsensibilität überwiegen und gelebt werden können. Die Erfahrungen der ersten Lebensjahre sind prägend, insbesondere hinsichtlich Selbstbild und Selbstwert. Darum lautet eine zentrale Frage: Welche Botschaften vermitteln wir als Bezugspersonen hochsensiblen Kindern?
In diesem Buch erhalten Sie Denkanstöße und alltagserprobte Impulse für Ihre pädagogische Arbeit, damit Sie hochsensible Kinder optimal unterstützen können. Wie erkennen Sie ein hochsensibles Kind in der Kita? Welchen Herausforderungen begegnen die Kinder im Alltag? Wie sieht eine wertschätzende und stärkende Entwicklungsbegleitung aus? Und wie können Kleinst- und Kleinkinder sowohl strukturell als auch in der konkreten Situation so unterstützt werden, dass Hochsensibilität zu einem wertvollen Potenzial in ihrem Leben wird? Auf all diese Fragen und mehr finden Sie im Buch Antworten.
1.
Hochsensibilität in der frühen Kindheit
Die Themen in diesem Kapitel sind
→ Grundlagen des Konzepts Hochsensibilität
→ typische Merkmale und Verhaltensmuster hochsensibler Kinder
→ Ursachen von und Einflüsse auf Hochsensibilität
→ Abgrenzung zu Autismus und AD(H)S
1.1 Was heißt hochsensibel?
FALLBEISPIEL
Anders und doch gleich
Rebecca (3;4 Jahre) ist ein freundliches, zurückhaltend wirkendes Mädchen, das in unbekannten und neuen Situationen viel Zeit benötigt, um sich einzufinden. Entsprechend lange dauerte die Eingewöhnung in die Kita. Die Trennung von der Mutter fiel ihr sehr schwer. Auch nach einem Vierteljahr wirkt Rebecca noch sehr vorsichtig, unsicher und beobachtend. Kontaktangebote von anderen Kindern nimmt sie nur sehr zögerlich an. Meist weicht sie nicht von der Seite ihrer Bezugserzieherin. Im Morgenkreis hält Rebecca sich komplett zurück und wirkt mitunter überfordert. Wenn sie spricht, dann meist kaum hörbar. Es hat den Anschein, als fehle ihr Selbstvertrauen und (Selbst-)Sicherheit. Dabei hat das Mädchen für sein Alter einen ausgeprägten Wortschatz. Auch die Inhalte sind klug gewählt und weisen auf eine gute sprachlogische Wahrnehmungsverarbeitung hin. Die Mutter beschreibt Rebecca im häuslichen Umfeld als selbstsicher, humorvoll und lebhaft. Kontakte pflege sie meist zu den älteren Nachbarskindern. Sowohl in der Kita als auch zu Hause fällt ihre hohe Anpassungsfähigkeit auf. Wird ihr alles zu viel, weint sie schnell und sucht nach Rückzugsmöglichkeiten, die in der Kita allerdings rar sind. Darum benötigt Rebecca viel Zuspruch, um sich der herausfordernden Situation zu stellen. Minimale Veränderungen im Tagesablauf bringen sie schnell aus dem Gleichgewicht.
Noah (4;5 Jahre) wirkt auf den ersten Blick ganz anders. Sein Wesen ist nach außen gerichtet. Er liebt es, neue Dinge auszuprobieren, und hält sich gern in Gruppen auf. Er zeigt ein großes Herz für seine Freunde, tröstet andere Kita-Kinder und setzt sich bei Ungerechtigkeiten für sie ein. Von Zeit zu Zeit kippt Noahs Stimmung allerdings scheinbar plötzlich. Als die pädagogischen Fachkräfte die Szenen genauer beobachten, in denen es zu Gefühlsausbrüchen kommt, stellen sie bestimmte Stressoren fest: Mal führen Noahs hohe, teils perfektionistische Ansprüche an sich selbst zu Frustrationen, mal bringen ihn Ungerechtigkeiten unter anderen Kindern, die er durch seine gute Beobachtungsgabe schnell bemerkt, aus der Balance, mal lösen Übergänge oder Veränderungen im Tagesablauf Stress aus. Steckt Noah mitten in diesen emotionalen Ausbrüchen, lässt er sich nur schwer beruhigen und ist kaum ansprechbar. Befindet er sich hingegen im Gleichgewicht, zeigt er Stärken wie Empathie, Ideenreichtum und Kreativität und ist ein gern gesehener Spielkamerad.
Beide Kinder wirken sehr unterschiedlich und doch haben sie eine wesentliche Gemeinsamkeit: Sie haben eine hochsensible Persönlichkeitsstruktur. Doch was genau bedeutet das?
Das Konzept der Hochsensibilität hat in den 1990er-Jahren durch die Psychologin Elaine Aron Popularität erlangt. Sie führte umfangreiche Forschungen durch und stellte fest, dass es Menschen gibt, die ihre Umwelt viel intensiver wahrnehmen als die meisten anderen. Diese Personen – Erwachsene wie Kinder – reagieren stärker auf sensorische Reize wie Geräusche, Licht, Gerüche und emotionale Stimmungen. Aron definierte Hochsensibilität als ein angeborenes Persönlichkeitsmerkmal. So kommt es nicht von ungefähr, dass bereits einige Säuglinge auffällig stark auf ihre Umgebung reagieren, besonders tiefe Emotionen zeigen und mehr Zeit benötigen als andere, um sich von überstimulierenden Situationen zu erholen (vgl. Aron 2010, S. 11 f.).
In der Vergangenheit wurden andere Bezeichnungen verwendet, um Charakterzüge wie diese zu beschreiben. Sie beleuchteten jedoch nur Teilaspekte der Hochsensibilität, wie sie heute verstanden wird. Hierzu gehören Zuschreibungen wie »Schüchternheit, Introvertiertheit, Ängstlichkeit, Hemmung« oder das Vorhandensein einer »niedrige[n] Reizschwelle […], einer negativen Grundhaltung oder Furchtsamkeit« (ebd., S. 13).
Begriffe wie diese kennen Sie als pädagogische Fachkraft aus der Praxis vermutlich alle. In jeder Kita befinden sich Kinder, die Sie als schüchtern, introvertiert oder ängstlich beschreiben würden. Auch die niedrige Reizschwelle, das heißt, schnell gestresst zu sein, die »kurze Zündschnur« oder die rasche Überreizung mancher Kinder kennen Sie sicher aus Ihrem Alltag. All diese einzelnen Aspekte können einen Teil der Hochsensibilität beschreiben. Das von Aron entwickelte ganzheitliche Konzept beinhaltet jedoch wesentlich mehr. Es ist unter anderem deswegen hochrelevant für den Kita-Alltag, weil laut Forschung circa 15–20 Prozent aller Jungen und Mädchen diesen Wesenszug haben (ebd., S. 11). Wie viele Kinder wären demnach rein statistisch in Ihrer Einrichtung hochsensibel?
Aron betont bis heute, dass Hochsensibilität keine Krankheit oder Störung darstellt, sondern vielmehr ein positiv zu bewertendes Persönlichkeitsmerkmal ist. Ob Kinder das selbst so wahrnehmen können, hängt davon ab, wie pädagogische Fachkräfte bestimmte Verhaltensweisen interpretieren und darauf reagieren. Wie reagieren Sie persönlich, wenn ein Kind den ganzen Tag nicht von Ihrer Seite weicht, egal welche Alternativangebote Sie ihm unterbreiten? Welche Gedanken schießen Ihnen durch den Kopf, wenn ein Kind ohne Unterlass nörgelt, weil es durch den hohen Geräuschpegel gestresst ist?
Abb. 1: Ergebnisse einer eigenen Umfrage unter pädagogischen Fachkräften auf die Frage »Was verbinden Sie mit Hochsensibilität?«
Fragt man pädagogische Fachkräfte, was sie unter »Hochsensibilität« verstehen, so zeigen sich vielfältige Assoziationen zu dem Begriff (siehe Abb. 1). Nicht selten werden damit Kinder in Verbindung gebracht, die zurückhaltend, ängstlich und kontaktscheu, manchmal aber auch aufgedreht oder angespannt sind. Schnell werden hochsensible Kinder auch als überempfindliche Mimosen abgestempelt. Dabei steckt hinter der Hochsensibilität viel mehr.
DEFINITION
Hochsensibilität
Der im Englischen verwendete Fachbegriff für das Konzept der Hochsensibilität lautet »sensory-processing sensitivity« (SPS; hohe sensorische Verarbeitungssensibilität). Im Deutschen hat sich zunächst der Ausdruck »Hochsensibilität« (HS) etabliert, zusammen mit »hochsensible Personen« (HSP) und »hochsensible Kinder« (HSK) (Aron 2010). In den letzten Jahren gesellte sich der Begriff der »Neurosensitivität« hinzu, der die neurologische Funktionsweise des Gehirns bei diesem Konzept betont (vgl. Wyrsch 2020).
Die neurologischen Besonderheiten bei der Interpretation kindlicher Verhaltensweisen zu berücksichtigen, ist zentral. Denn die von hochsensiblen Kindern oft als lästig empfundene Falte in der Socke, die emotionalen Ausbrüche beim Umziehen in der Garderobe und viele andere kleine Situationen, die im Alltag auftreten, sind keineswegs bloße Marotten, sondern stehen in direktem Zusammenhang mit einer besonderen Verarbeitung im Gehirn.
Aron beschreibt die Auswirkung der unterschiedlichen Reizverarbeitung mit aussagekräftigen Worten: »Hochsensible Individuen haben die angeborene Neigung, ihre Umgebung deutlicher wahrzunehmen und gründlich nachzudenken, bevor sie handeln. Nicht-hochsensible Personen nehmen im Vergleich dazu weniger wahr und handeln rasch und impulsiv. Hochsensible Erwachsene und Kinder sind meist mitfühlend, klug, intuitiv, kreativ, umsichtig und gewissenhaft. […] Hochsensible Personen fühlen sich häufig überwältigt, sei es von einem ›starken Geräuschpegel‹ oder einem Übermaß an anderen äußeren Reizen, die auf sie einströmen« (Aron 2010, S. 26 f.).
Hochsensible Kinder besitzen von Geburt an ein besonders empfindsames Nervensystem. Die ausgeprägte Sensibilität führt dazu, dass sie Sinneseindrücke intensiver wahrnehmen und verarbeiten als andere. Sie haben das Bedürfnis, alles Gesehene, Gefühlte und Erlebte zu verstehen und gründlich zu verarbeiten, um daraus Rückschlüsse für ihr Handeln zu ziehen. In einer Kindertageseinrichtung kann es deshalb schnell zu einer Reizüberflutung kommen. Laute Geräusche, unterschiedliche Gerüche, hektisches Treiben oder auch die Atmosphäre in der Gruppe führen dazu, dass hochsensible Kinder sich rasch überfordert oder gestresst fühlen und den Wunsch nach Rückzug haben. In solchen Situationen werden die sonst sehr ruhigen und freundlichen Kinder unruhig, weinen oder machen durch Wutausbrüche deutlich, dass sie überfordert sind. Auch körperliche Beschwerden wie Kopf- oder Bauchschmerzen können Anzeichen für eine Überreizung sein. Bei neuen Situationen, wie einem Wechsel der Bezugspersonen oder dem Übergang von der Krippe zur Kita, gehen hochsensible Kinder oft vorsichtig und beobachtend vor. Sie wägen alle Risiken ab und handeln erst, wenn sie sich sicher und wohl fühlen (vgl. Vita 2024, S. 20 f.). Nur wenn pädagogische Fachkräfte das Verhalten hochsensibler Kinder in der Entwicklungsbegleitung richtig interpretieren, können sie achtsam damit umgehen.
1.2 Neurologische und weitere Besonderheiten
Hochsensible Kinder zeichnen sich durch einige Besonderheiten aus. Besonders in der Reizverarbeitung unterscheiden sie sich deutlich von anderen, aber auch ihr ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis, ihr Reflexionsvermögen und ihre Vorsicht gegenüber unbekannten Situationen und Personen prägen ihr Verhalten.
Reizverarbeitung
Hochsensible Kinder nehmen ihre Umwelt intensiver wahr als andere Kinder. Nichts prallt an ihnen ab. Während eines Kita-Tages beobachten sie viele Szenen, achten auf Stimmungen von Fachkräften und Kindern, wägen Entscheidungen sorgfältig ab, richten sich nach Erwartungen, halten sich an Regeln und lassen sich nebenbei noch auf Aktivitäten und Spiele mit Freund:innen ein. Es wirkt, als arbeite ihr Gehirn ohne Unterlass auf Hochtouren, vergleichbar einem Radar, der kontinuierlich abgleicht, ob Unregelmäßigkeiten auftauchen.
FALLBEISPIEL
Ein voller Kita-Tag
Der 4-jährige hochsensible Paul betritt am Morgen die Kita »Birkenschlösschen«. Bereits an der Eingangstür beginnt er, sein Umfeld ganz genau zu beobachten. Während er an der Garderobe sitzt und seine Schuhe wechselt, erzählt er seiner Mutter, in welchem Raum sich seine Freunde befinden, welcher Raum aufgrund Personalmangels geschlossen ist, dass Maja traurig in der Leseecke sitzt, Frau Maurus’ Auge wieder komisch zuckt und es im Bewegungsraum heute sehr laut ist. All diese Informationen hat Paul blitzschnell bis ins Detail aufgenommen. Dafür trödelt er beim Umziehen. Denn er verarbeitet an seinem Garderobenplatz alle Informationen, um dann entscheiden zu können, an welchem Ort er den Tageseinstieg wagt.
Über den Tag verteilt begegnen ihm in der Kita noch viele weitere Reize. Während er mit seinem Freund Patrick spielt, bemerkt er, wie zwei Jungs miteinander streiten und ein Mädchen daneben weint. Er sieht die verärgerte Bezugserzieherin, die vergeblich zum Essen ruft. Er beobachtet beim Spaziergang auf den nahe gelegenen Spielplatz die angrenzende Baustelle, bemerkt die hupenden Autos, den Lärm der Asphaltfräse, die kreischenden Kinder. Wird Paul am Ende des Kita-Tages von der Mutter abgeholt, wirkt er sehr zufrieden, zugleich gähnt er aber auch und stolpert die Treppe herunter – erschöpft von den vielen Eindrücken.
Sein Freund Patrick hat den Kita-Tag ganz anders erlebt. Als er morgens in das »Birkenschlösschen« kommt, zieht er sich schnell um und geht dann zielgerichtet in den Bewegungsraum. Dort erwartet ihn laute Musik, und die tobenden Kinder reißen ihn unverzüglich in das Spielgeschehen. Holt ihn seine Mutter nach dem Kita-Tag ab, fragt er sie mit leuchtenden Augen: »Was machen wir heute noch?«
Wie kommt es zu dieser unterschiedlichen Art der Wahrnehmungsverarbeitung? Grundsätzlich nehmen alle Menschen über ihre Sinnesorgane stetig Informationen aus ihrer Umgebung auf. Um eine Überlastung des Kurzzeitgedächtnisses zu verhindern, werden Reize in einer Art Filter vorselektiert. Die Entscheidung, welche Informationen relevant sind und welche nicht, findet unbewusst statt. Unser Gehirn verarbeitet nur die wichtigen weiter und leitet sie durch Botenstoffe (Neurotransmitter) an die entsprechenden Gehirnareale weiter. Dort erfolgt eine tiefere Verarbeitung der Reize (vgl. Vita 2024, S. 18).
Dass der amerikanische Psychologe Jerome Kagan bei hochsensiblen Kindern (bei Kagan »gehemmte Kinder«) eine erhöhte Menge an Botenstoffen nachweisen konnte, zeigt, warum bei ihnen eine größere Menge an Informationen im Gehirn ankommt und sie ihre Umwelt besonders detailreich verarbeiten. Der Wahrnehmungsfilter ist bei ihnen niedriger eingestellt (vgl. Lüling & Lüling 2014, S. 17). Nun sind hochsensible Kinder in der Kita aufgrund von Reizüberflutung oder Zeitmangel oft nicht in der Lage, alle Eindrücke zeitnah zu verarbeiten. Während andere Kinder die Informationen schlicht löschen und damit vergessen, speichern hochsensible Kinder alle Reize in einer Art »Zwischenablage«. Erst in ruhigen Momenten beginnen sie damit, die nicht verarbeiteten Impulse zu analysieren. Machen Sie hierzu gern einen kleinen Versuch: Stellen Sie einem hochsensiblen Kind während des Morgenkreises eine Frage. Sollte es noch nicht von Reizen und Beobachtungen überflutet sein, wird es Ihnen antworten. Im Falle einer Überlastung wird es nicht reagieren. Stellen Sie Ihre Frage zu einem späteren, ruhigeren Zeitpunkt erneut, werden Sie feststellen: Das Kind war zu jeder Zeit präsent und kann Inhalte detailliert wiedergeben.
Diese spezifische Art, Informationen zu erfassen und zu verarbeiten, hat Vorteile. Hochsensible Kinder zeichnen sich durch ganzheitliches Denken aus. Sie gehen reflektiert und detailliert an Aufgaben und Sachverhalte heran. Sie haben ein gutes Gedächtnis und zeigen eine Stärke im logischen, verknüpfenden Denken. Sind diese Kinder allerdings mit innerpsychischen Prozessen und unverarbeiteten Sachverhalten beschäftigt oder stehen sie unter Zeit- oder Leistungsdruck, fällt es ihnen schwer, sich zu konzentrieren, obwohl sie grundsätzlich über ein gutes Konzentrationsvermögen verfügen (vgl. Vita 2024, S. 18).
Abb. 2: Unterschiede in der Reizverarbeitung hochsensibler und nicht hochsensibler Kinder
Stellt man die unterschiedlichen Gehirnvorgänge bildlich dar (siehe Abb. 2), zeigt sich, welche unterschiedliche Menge an Reizen bei Kindern ankommt. Je nach Temperament bleiben nach einem langen Kita-Tag noch Kräfte übrig für weitere Aktivitäten oder aber das Maß ist voll. Im letzten Fall brauchen Kinder eine Ruhezeit, um das intensiv erlebte Geschehen im Gehirn zu verarbeiten.
Stop and go
Aron beobachtete an hochsensiblen Personen ein Verhaltensmuster, das sie als »Stop-and-go-System« (dt. »Innehalten-und-nachdenken-System«) bezeichnet (Aron 2010, S. 45). Hochsensible Kinder analysieren und reflektieren Situationen und Gegebenheiten intensiv, bevor sie handeln. Daher wirken sie oft über längere Zeit passiv, zögerlich und scheinen, vor sich hinzuträumen. Währenddessen arbeitet ihr Gehirn jedoch auf Hochtouren, um alle Informationen zu verarbeiten und daraus wichtige Schlüsse zu ziehen. In der Regel handeln die Kinder erst, wenn sie sich sicher sind.
FALLBEISPIEL
Vom Beobachter zum Akteur
Der 3-jährige Daniel hat sich nach einer längeren Eingewöhnungsphase gut im Kindergarten »Sonnenblume« eingelebt. Zu Beginn nahm er die Rolle eines Beobachters ein. Daniel saß nur neben seiner Bezugserzieherin Jana, redete wenig und schlug Kontaktangebote von gleichaltrigen Kindern aus. Auch im Morgenkreis zeigte er keine aktive Beteiligung. Für Jana fühlte es sich an, als würde Daniel konstant auf der Bremse stehen.
Glücklicherweise hat sich dies mit zunehmender Sicherheit und dem Wissen um das jeweilige Tagesprogramm geändert. Inzwischen nimmt Daniel von sich aus Kontakt mit anderen Kindern auf, beteiligt sich aktiv an Aktionen und agiert selbstständig. Schwierigkeiten treten nur noch auf, wenn unvorhergesehene Ereignisse eintreten, wie etwa die plötzliche Erkrankung seiner Bezugserzieherin oder spontane Änderungen im Ablauf. In solchen Situationen zieht er sich zurück und zeigt deutliche Anzeichen von Überforderung.
Welchen Hintergrund hat diese behutsame Herangehensweise an neue Situationen und Gegebenheiten? Was genau ist das »Stop-and-go-System«? Jede Person besitzt ein inneres Verhaltenssystem, das aus zwei Komponenten besteht: einem Aktivierungssystem und einem Hemmsystem. Das Aktivierungssystem motiviert uns, Neues zu erkunden, aktiv zu werden, uns auszuprobieren. Im Gegensatz dazu fungiert das Hemmsystem als Gegenpol, das uns daran hindert, impulsiv zu handeln. Es fördert die Selbstreflexion und hilft, Situationen genau zu durchdenken, bevor Entscheidungen getroffen werden und gehandelt wird. Beide Systeme erfüllen wichtige Funktionen und tragen entweder zur Sicherheit oder zur Erfahrungserweiterung bei (vgl. Lüling & Lüling 2014, S. 23).
Nun haben hochsensible Kinder laut Aron in der Regel bereits von Geburt an ein ausgeprägtes Hemmsystem, das ihnen hilft, Informationen intensiv zu analysieren, verschiedene Perspektiven zu betrachten und abzuwägen, bevor sie Entscheidungen treffen. Dies wurde durch bildgebende Verfahren belegt, die eine starke Aktivierung der rechten, kognitiven Hirnhälfte zeigen. Erst wenn ein Sachverhalt von allen Seiten beleuchtet und sämtliche Risiken durchdacht wurden, kommt das Aktivierungssystem in Gang. Verständlich, dass hochsensible Kinder Zeitdruck und Überraschungen nicht mögen (vgl. Aron 2010, S. 45 f.; Lüling & Lüling 2014, S. 23).
Schnelle Antworten im Morgenkreis zu geben, zügig zu entscheiden, ob man an einem Spaziergang teilnimmt oder in der Kita bleibt – all das stellt für hochsensible Kinder eine Herausforderung dar. Ihr ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis hat oberste Priorität. Sie möchten Risiken gründlich abwägen, bevor sie handeln. Dieses Vorgehen lässt sich mit dem Warten an einer Kreuzung vergleichen: Wenn die Ampel rot ist, bleiben wir stehen. Bei grünem Licht gehen wir weiter. Hochsensible Kinder befinden sich überwiegend in einem Zustand, in dem ihre innere Ampel zunächst rot leuchtet, weshalb sie einen bestimmten Sachverhalt besonders aufmerksam beobachten, statt direkt zu handeln. Sobald sie sich jedoch sicher fühlen, wechselt ihre innere Ampel auf Grün und sie werden aktiv. Nur wenn die jeweiligen Bezugspersonen ein Verständnis für diesen Ablauf entwickeln, können sie hochsensiblen Kindern ermöglichen, in ihrem eigenen Tempo aktiv zu werden. Durch gezielte Maßnahmen wie das Bereitstellen von Routinen, Vorhersehbarkeit und Reflexionszeiten haben Kinder die Möglichkeit, mit ihrer Sensibilität umzugehen und ihre Stärken zu entfalten (vgl. Vita 2024, S. 17/28 f.).
DEFINITION
Introvertiert und extrovertiert hochsensible Kinder
Entgegen der gängigen Meinung, hochsensible Kinder seien ausschließlich introvertiert, führen Studien zu anderen Erkenntnissen. Laut Aron kann davon ausgegangen werden, dass circa 70 Prozent der hochsensiblen Kinder introvertiert und 30 Prozent extrovertiert sind (Aron 2010, S. 54). Das Fallbeispiel mit Rebecca und Noah (siehe S. 8) zeigt, wie unterschiedlich hochsensible Kinder agieren, je nachdem ob sie introvertiert oder extrovertiert hochsensibel sind. Auch wenn Kerneigenschaften einer Hochsensibilität feststehen und das neurologische System gleich funktioniert, zeigen sich in den Bedürfnissen und Verhaltensweisen Unterschiede, die in Abhängigkeit von Introversion und Extraversion stehen.
Bei extrovertiert hochsensiblen Kindern sind beide Verhaltenssysteme – das Hemmsystem und das Aktivierungssystem – gleichermaßen ausgeprägt: Das Verlangen nach neuen Erfahrungen steht gleichwertig neben dem Bedürfnis nach Sicherheit und dem Vermeiden von Risiken. Das bedeutet, dass diese Kinder – wie introvertierte – Mühe damit haben, Entscheidungen zu treffen, da ihre gegensätzlichen Bedürfnisse zu inneren Konflikten führen. Extrovertiert hochsensible Kinder neigen dazu, sich schnell zu langweilen, sind aber auch rasch überstimuliert. Sie probieren gern Neues aus, können dabei jedoch schnell mit einer Überforderung konfrontiert werden. Dies wirkt für Außenstehende mitunter befremdlich und widersprüchlich (vgl. Vita 2024, S. 34).
Ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis
Hochsensible Kinder haben ein ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis. Dieses steht in engem Zusammenhang mit dem bereits dargestellten »Stop-and-go-System«. Passives Verhalten weist bei diesen Kindern in der Regel darauf hin, dass sie sich unsicher fühlen. Sobald sie aktiv werden, ist das Sicherheitsbedürfnis gestillt.
FALLBEISPIEL
Klettern? Aber sicher!
Theo (4;1 Jahre) liebt es, wenn die »Igelgruppe« auf den nahe gelegenen Spielplatz geht. Sandeln und Schaukeln sind seine Lieblingsbeschäftigungen, wohingegen er die Kletterspinne meidet. Zu hoch ist ihm das Risiko, dass er abstürzt oder stecken bleibt und nicht mehr weiterkommt. Während er im Sandkasten sitzt, beobachtet er die kletternden Kinder genau. Er sieht, welche Strategien andere anwenden, und analysiert auf kindliche Weise, welche davon funktionieren und welche nicht. Wiederkehrende Ermutigungen seiner Erzieherin, es doch auch zu versuchen, scheitern.
Eines Tages, als die »Igelgruppe« wieder einmal auf dem Spielplatz ist, steht Theo kommentarlos auf und geht auf die Kletterspinne zu. Mühelos klettert er in die Höhe. Die pädagogischen Fachkräfte sind sprachlos, als er stolz wieder unten bei ihnen ankommt.
Das Fallbeispiel verdeutlicht das starke Sicherheitsbedürfnis hochsensibler Kinder und beschreibt ihre Vorgehensweise in herausfordernden Situationen. Theo zeigt, dass er zunächst ein hohes Bedürfnis nach innerer Sicherheit hat, bevor er bereit ist, sich der Herausforderung zu stellen. Diese Vorgehensweise ist ein typisches Merkmal von Hochsensibilität. Anstatt impulsiv zu handeln, durchläuft er einen Prozess der Beobachtung und Reflexion. Das hängt damit zusammen, dass hochsensible Personen oft tiefer über ihre Erfahrungen nachdenken und sich ihrer Umgebung und ihrer eigenen Gefühle intensiver bewusst sind. Der Reflexionsprozess ermöglicht es dem Jungen, Strategien zu entwickeln und eine Vorstellung davon zu bekommen, wie er den Kletterakt bewältigen kann. Sobald Theo einen klaren Plan hat und seine eigene Sicherheit gefestigt ist, wird er aktiv und kann die Herausforderung erfolgreich meistern. Dies zeigt, wie stark hochsensible Kinder davon profitieren, sich Zeit nehmen zu dürfen, um sich auf neue Erfahrungen vorzubereiten.
Wenn Fachkräfte diesen individuellen Prozess ermöglichen und unterstützen, schaffen sie ein Umfeld, in dem hochsensible Kinder ihr volles Potenzial entfalten können. In der pädagogischen Praxis ist es darum von großer Bedeutung, hochsensiblen Kindern die nötige Zeit und den Raum zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um ihre eigenen Lösungen zu finden und sich sicher zu fühlen.
Aufgrund ihres ausgeprägten Sicherheitsbedürfnisses neigen hochsensible Kinder allerdings auch häufig dazu, sich neuen, unbekannten und als unsicher empfundenen Situationen zu entziehen und in eine Vermeidungshaltung zu verfallen. Sie fühlen sich in ihrer Komfortzone wohl – einem Zustand, in dem ihnen alles vertraut ist und keine Veränderungen anstehen. Auch wenn Kinder auf diese Weise glücklich wirken können, bleibt so persönliches Wachstum aus. Deshalb ist es unerlässlich, regelmäßig die Komfortzone zu verlassen und Risiken einzugehen, um Lernmöglichkeiten wahrzunehmen. Dabei kann die Risikozone sowohl Erfolge als auch Misserfolge mit sich bringen. Ist die Herausforderung jedoch zu groß, zu unsicher oder wirken die Risiken unübersichtlich auf hochsensible Kinder, kann dies zu Panik führen und Blockaden auslösen. Um persönliches Wachstum zu fördern, kommt pädagogischen Fachkräften darum die Aufgabe zu, Kinder zu ermutigen, sich zwischen der Komfortzone und der Risikozone aufzuhalten. Mit der Unterstützung wohlgesonnener und achtsamer Bezugspersonen können sie auf diese Weise ihre Grenzen erweitern und neue Lebensabschnitte erfolgreich bewältigen (vgl. Vita 2024, S. 29).





























