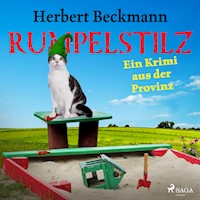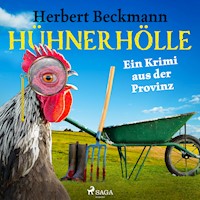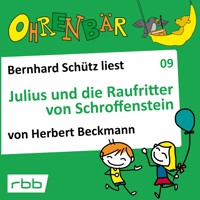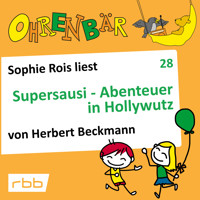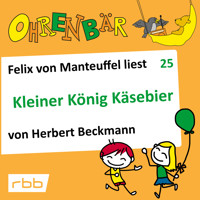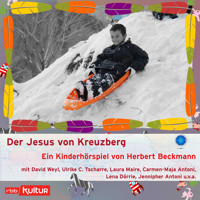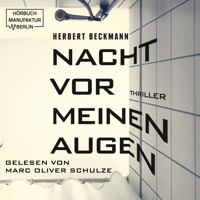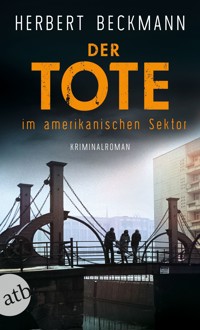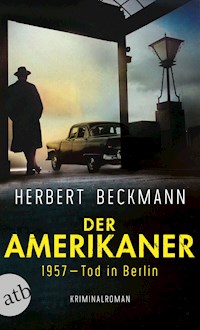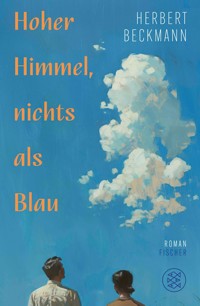
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Das Recht auf Glück hatte jeder. Oder etwa nicht?« Der große Roman über drei starke Frauen in Zeiten des Krieges Die Insel Bornholm wird zum rettenden Ort vor dem NS-Regime. Mit seiner Frau Elli, seiner Schwägerin Sibyl und den Kindern bewirtschaftet Hans Henny Jahnn, Schriftsteller, Orgelbauer und Pferdezüchter, den Hof Bondegaard. Dorthin bringt er 1935 auch die Fotografin Judit, eine ungarische Jüdin: »Sie wird ab heute bei uns wohnen. Mit uns leben.« Die drei Frauen suchen einen Weg, sich gemeinsam, zwischen Eifersucht und Solidarität, zu behaupten angesichts der eigenartigen Faszination, die von dem tabulosen Mann in ihrer Mitte ausgeht. Doch als der Krieg die Insel erreicht, steht für die Schicksalsgemeinschaft im Exil alles auf dem Spiel. Ein faszinierend neuer Blick auf die Frauen um den genialischen Autor Hans Henny Jahnn, bewegend erzählt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 440
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Herbert Beckmann
Hoher Himmel, nichts als Blau
Roman
Über dieses Buch
»Hoher Himmel, nichts als Blau« erzählt vom Dichter Hans Henny Jahnn aus ganz neuem Blickwinkel: Jahnns Frau Elli, ihre Schwester Sibyl und seine Geliebte Judit stehen im Zentrum der Ereignisse auf der Insel Bornholm, die in den 1930er Jahren zum Zufluchtsort wird; dort schreibt der den Nazis verhasste Schriftsteller den Großteil seines Monumentalwerks Fluss ohne Ufer.
Es sind die Frauen in dieser Gemeinschaft, die miteinander leben, miteinander streiten, die hin- und hergeworfen sind zwischen Eifersucht, Solidarität und Überlebensnot. Sie sind es, die das alltägliche Leben bewältigen müssen, während sie die eigenartige Faszination spüren, die von dem Mann in ihrer Mitte ausgeht – in tausendseitige Werke vergraben, von freier Liebe überzeugt, besorgter Vater, ökologischer Visionär und egomaner Künstler.
Für die deutschen Flüchtlinge spitzt sich die Lage vor dem Hintergrund des drohenden Krieges zu: Sibyl verlässt den Hof Bondegaard, Elli bleibt an Hennys Seite, und Judit muss um ihr Leben fürchten, als Dänemark besetzt wird und die so lange rettende Insel zur Falle zu werden droht.
Hervorragend recherchiert und mit zeitlos vielschichtigen Frauenfiguren, erzählt der Roman von der Liebe in dunklen Zeiten.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Herbert Beckmann, Jahrgang 1960, ist Psychologe und Autor von Romanen, Hörspielen und Sachbüchern. Er ist Mitglied im Verband deutscher Schriftsteller und im PEN-Zentrum Deutschland. Für seinen Bornholm-Roman recherchierte er intensiv Materialien zu Hans Henny Jahnns Leben. Der Autor lebt mit seiner Familie in Berlin.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2025 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Coverabbildung: Hauptmann & Kompanie mit Midjourney
ISBN 978-3-10-492029-0
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
[Motto]
Prolog
Sibyl
Judit
Elli
Erster Teil
»Das Land«
Unter dem Strohdach
Fluchtpunkte
Auf Sand gebaut
Zweiter Teil
Ein grünes Band
Weißes Licht
In Trümmern
Epilog
Signe
Nachbemerkung
Für Susanne
Alle Geheimnisse sind real; die Wirklichkeit beschämt mich tagtäglich mit ihrer Phantastik.
Hans Henny Jahnn, Briefe
Prolog
Drei Frauen
Juli 1935
Sibyl
Sie steht an einem der rückwärtigen Fenster des Haupthauses und schaut hinaus in den Garten. Mit zwei Badetüchern über dem Arm wartet sie geduldig auf ihren Einsatz. Wie jeden Morgen tanzt ihre Schwester Elli noch vor dem Frühstück um acht mit Edvard und Signe auf dem verwilderten Rasen.
Die Kinder lieben diese Nacktturnübungen mit Elli im Freien, selbst wenn der salzige Wind Gänsehaut auf ihren drahtigen Körpern wachsen lässt. Nachdem sie sich gegenseitig ihre Nachthemden vom Leib gerissen haben, stürmen sie, trotz Sibyls Ermahnungen, die hölzerne Treppe hinunter und durch den Windfang des Hinterausgangs ins Freie. Dort hat sich Elli neben dem Brunnen schon in Positur gebracht, nackt, biegsam wie eine Ballerina und am ganzen Körper knochig wie ein Ziegenknie. Das Haupthaus, quer zu den Wirtschaftsgebäuden von Bondegaard auf der anderen Seite des Hofs, schützt sie vor den Augen der Männer. Nur Ditte, die Hauswirtschafterin, und Eydis, die Magd, die bereits seit dem Morgengrauen geschäftig sind, werfen hin und wieder belustigte Blicke durch die schlierigen Fenster der Küche hinaus in den Garten.
Nach einer guten Viertelstunde kommen Ellis Übungen an ihr Ende. Sibyl eilt mit den Tüchern hinaus, wo ihre Schwester bereits mit energischen Bewegungen den Pumpenschwengel in Fahrt bringt und die Kinder sich kreischend mit dem eiskalten Brunnenwasser bespritzen.
Nachdem sie gefrühstückt haben, Hafergrütze mit beinahe noch kuhwarmer Milch, hilft Sibyl Eydis dabei, den Küchentisch abzuräumen. Elli klimpert nebenan auf dem Klavier, und die Kinder trällern hin und wieder dazu. Auf einmal sind klappernde Hufe zu hören und das Rattern eines leichten Pferdegespanns, das im Hof zum Stillstand kommt.
Sibyl beugt sich über den Spülstein und wirft einen Blick aus dem Fenster. Henny. Der wie angekündigt heute früh mit der Fähre von Kopenhagen gekommen ist und nun hüftsteif vom Kutschbock heruntersteigt. Und überraschend Besuch mitbringt. Einen sehr jungen Mann, wie es scheint, groß gewachsen, gut aussehend, in einem weit geschnittenen, beigen Leinenanzug.
Erst als Henny schwungvoll die Küchentür aufstößt und mit seinem Besuch im Schlepptau eintritt, begreift Sibyl, dass es sich bei dem Neuankömmling in Wahrheit um eine Frau handelt: vier, fünf Jahre jünger als sie, Anfang zwanzig, weiche Gesichtszüge, helle Haut, dunkle, etwas flackernde Augen, die braunen Locken kurz geschnitten und doch kaum gebändigt.
Die Frau wirkt verlegen, dort im Türrahmen, und Sibyl entgeht nicht, dass ihre kräftigen Finger unruhig nach Hennys Hand suchen, die sie sogleich fest umschließen.
Signe und Edvard stürzen plötzlich an Sibyl vorbei. Doch in Anbetracht des unerwarteten Besuchs bleiben die Kinder überrascht stehen, Edvard sogar mit offenem Mund.
»Henny …« Ellis zaghafte Begrüßung ist nur ein Hauchen. Ihre Schwester hat sich im Windschatten der Kinder unbemerkt herangeschoben und bleibt neben ihr stehen. Sibyl spürt den schnell gehenden Atem, Elli hat die Hand der jungen Frau in Hennys Hand bemerkt.
Er strahlt, scheint besoffen vor Glück, seine Augen funkelnd vor Verliebtheit. »Judit, das sind meine Frau Elli und Sibyl, meine Schwägerin.« Er löst sich von ihr und tritt einen Schritt vor, seine breiten fleischigen Wangen zittern vor Aufregung. »Elli, Sibyl, ich möchte euch Judit vorstellen. Sie wird ab heute bei uns wohnen. Mit uns leben.«
Mit ausschweifender Geste deutet er auf die junge Frau, die noch immer statisch an der Tür verharrt. Ihr helles Gesicht flammt auf. Sie mustert furchtsam Sibyl und Elli, die vollen Lippen aufeinandergepresst, offenbar unfähig, zu sprechen oder auch nur einen Schritt auf sie zuzugehen.
Judit
Noch bevor Henny sie vorstellt, kann sie es an den Mienen der beiden Frauen und an dem verdutzten Verhalten der Kinder ablesen, dass er sie nicht angekündigt hat. Nicht mal seiner Ehefrau, Elli.
Dort steht sie ihr frontal gegenüber, in der Küche von Bondegaard, eine vierzigjährige, sehr schlanke, dunkelhaarige Frau, mit versteinertem Gesicht, wie in Schockstarre.
Auch Sibyl, seine Schwägerin, mittelblond und zartgliedrig, deutlich jünger als ihre Schwester, scheint ihre Ankunft nicht einmal erahnt zu haben. Die hellen, wachen Augen in dem ovalen Gesicht mustern sie verblüfft.
Zum Glück gibt es die Kinder, mit denen sie den ersten Schockwellen ihrer Begegnung entfliehen kann.
Sie beugt sich zu ihnen hinunter. »Und wer seid ihr? Zeigt ihr mir euren Hof, damit ich weiß, wo ich gestrandet bin?«
Sie antworten nicht, scheinen perplex. Horchen vielleicht noch auf den ungewohnten Nachklang ihrer Stimme, die besondere Sprachmelodie ihres ungarischen Akzents.
Doch dann strecken die beiden Blondschöpfe ihr die Hände entgegen und übernehmen das Kommando. Ziehen sie hinaus ins Freie. Über die groben Pflastersteine des Innenhofs, der durch das Wohnhaus, die Stallungen und die Scheune von vier Seiten gebildet wird, zu den Pferde- und Kuhställen in einem der Wirtschaftsgebäude. Gegenüber wird soeben das frisch geerntete Getreide in die Scheune eingebracht, geduldig warten zwei kolossale Zugpferde darauf, dass die Arbeiter die Wagen entladen. Ein vertrauter Anblick, ganz unverhofft.
Im Sonnenlicht döst vor der Scheune ein großer Hofhund mit braunem zotteligem Fell, der den mächtigen Kopf hebt, als er sie wahrnimmt. Sein Schatten plötzlich scharf umrissen auf der weiß gekalkten Scheunenwand, mitten in einem Rechteck aus braunschwarzen Fachwerkbohlen.
Im tierwarmen Innern des Pferdestalls stellen ihr die Kinder, die sie noch immer an den Händen halten, einen Wallach vor, rehbraun mit einer weißen Blesse. Die beiden anderen Wallache befänden sich draußen auf der Koppel.
»Vater liebt Pferde«, sagt Signe.
»Vater mag keinen Traktor auf unserem Bauernhof«, ergänzt Edvard mit gedämpfter Stimme, die deutliches Bedauern ausdrückt.
Sie wundert sich, dass auch der Junge Henny seinen Vater nennt.
Im Kuhstall steht geduldig oder gelangweilt, wer weiß das schon, ein gutes Dutzend Kühe. An den Deckenbalken nisten Schwalben. Das durch die schmalen Stallfenster von Osten hereinfallende Morgenlicht zeichnet ein klares Linienmuster der Bohlen. Fotos von Moholy-Nagy fallen ihr plötzlich ein, ihre Ausbildung am Bauhaus, unwillkürlich zucken ihre Finger, als hielte sie ihre Leica in der Hand.
Im Schweinestall, in dem Quergebäude gegenüber dem Haupthaus, fressen sich zwei Dutzend Fettschweine schmatzend und grunzend ihrem unausweichlichen Schicksal entgegen.
Auf dem Weg zum Ententeich, der sich hinter dem Stall befinde, sieht sie sich von manchen der Arbeiter im Hof neugierig beäugt. Die übrigen scheinen sie nicht zu beachten oder senken die Köpfe.
Auf dem Teich, einer anscheinend auf natürliche Weise gebildeten Granitwanne, schwimmt ein halbes Dutzend Enten. Täuschende Idylle: Eine schlanke, braun-grau getigerte Katze schleicht im hohen Gras darum herum – die Lust am Töten, und sei es nur, um in Übung zu bleiben, blitzt in ihren Augen.
»Wir haben auch noch Schafe«, sagt Edvard, und Signe deutet auf einen Pfad, der neben einem Weizenfeld her zu einem Waldstück führt.
Sie nehmen Judit wieder bei den Händen und ziehen sie mit sich über den offenen Feldweg, auf dem ihr warm wird, und durch den Waldstreifen, der kühlen Schatten spendet. Die plötzliche Stille zwischen den mächtigen Buchen ist beinahe fühlbar, stellenweise betäubende Gerüche wie in einem Szegeder Gewürzladen.
Der Schafstall erweist sich als backsteinerner Anbau einer verlassenen alten Kate. Der ehemals weiße Putz der Fachwerkfassade ist an vielen Stellen rissig oder herausgebrochen, das bemooste Reetdach gerupft und eingesunken, die Holztüren hängen schief in den Angeln. Narben der Witterung, die Struktur des Zerfalls.
Hinter dem windschiefen Gatter baut sich ein halbes Dutzend Tiere frontal vor ihnen auf, die Schafe starren sie glubschäugig an, misstrauisch, als wäre sie ein zusätzlicher Fresser.
Elli
Am frühen Nachmittag ist das Mittagessen fertig. Eine Kartoffelsuppe mit verkochten Zutaten, die dann bis zur Unkenntlichkeit zerstampft werden. Elli sieht die fragenden Blicke der anderen am Tisch, den stummen Vorwurf in ihren hungrigen Augen, dass es so lange gedauert hat – wieder einmal, wenn sie die Verantwortung für das Essen übernommen hat. Sie kann ihnen keine Erklärung dafür geben. Die Zeit ist eben dahingeflossen. Ihre Gedanken verästeln sich immerzu, manchmal stehen sie ihr wie ein Bild vor Augen, dessen Botschaft sie zu entschlüsseln versucht, und wenn sie daran denkt, was heute … Henny hatte doch …
Sibyl berührt sie plötzlich mit dem Ellbogen an der Schulter: »Hilfst du mir den Tisch abräumen, Elli?«
Als sie um sich blickt, haben alle schon gegessen, auch sie selbst, stellt sie überrascht fest. Ihre Schwester steht mit dem schweren Topf in der Hand neben ihrem Stuhl und deutet mit dem Kinn auf die benutzten Teller und das Besteck.
Ja, sicher hilft sie ihr. Auch wenn sie hier nicht die Hausfrau ist, falls das jemand denken sollte.
Ihr Blick fällt auf Henny und die neue Frau, so jung noch und so schön, diese Judit sieht aus wie der fleischgewordene Hermaphrodit, von dem er in der Kunst so schwärmt. Seine Augen sprühen vor Verlangen. – Und warum auch nicht. Wenn er nur ihr Verlangen ebenso respektiert und keine Szenen macht, falls sie jemanden …, der …
»Elli?«
»Ja?«
»Die Teller.«
Ach, richtig! Sie reicht Sibyl den Stapel. Geht dann zum Spülstein, pumpt Wasser und stellt den gefüllten Kessel auf den monströsen Herd, den Sibyl schon angefeuert hat, oder vielleicht ist es auch Henny gewesen, er liebt ja das Feuermachen.
Während des Abwaschs, den sie mit Sibyl erledigt, zieht sich Henny mit der Frau in das Musikzimmer hinten zurück. Die Kinder lassen sich von Elli das Kartenspiel geben, Firkort, ein Quartett mit Inselmotiven, das sie, warum auch immer, gestern mit hinauf in ihr Zimmer genommen hat.
»Aber es braucht mindestens drei Mitspieler dazu!«
»Wissen wir.« Signe winkt ab.
»Wir wollen uns nur die Bilder ansehen.« Edvard in seinem etwas schleppenden Tonfall.
Fyrtaarne, Badesteder, Klipper, Ruiner, Elli sieht sie vor sich, die Bildmotive von der Insel, alle in Sepiafarben, obwohl sie knallbunt sind. Eine Weile hört sie die Kinder noch sprechen und streiten. Später, als die Erwachsenen beim Kaffee sitzen, sind sie still. Sitzen vermutlich an dem kleinen achteckigen »Kartentisch« im Esszimmer und lauschen mit gespitzten Ohren, horchen durch den schmalen Spalt der nicht ganz schließenden Tür zur Küche auf das, worüber die Erwachsenen reden. Und spüren vielleicht, wovon sie schweigen.
Am Abend bittet Elli Signe, von der wilden Wiese hinterm Haus ein paar Blumen mit schönen Blüten zu pflücken.
»Für wen? Für Judit?«
»Für Judit, ja.«
Signe bringt Blumen mit blauen, gelben und karminroten Blüten. Elli arrangiert sie in einer kleinen Glasvase, und Signe soll sie auf die Konsole im Gästezimmer stellen.
»Dort schläft Judit?«
»Ja, dort.«
Signe kommt mit dem Sträußchen enttäuscht zu ihr zurück. »Judit ist nicht in dem Zimmer.«
Das Kind hat recht. Sie hört Judits dunkel perlende Stimme kurz darauf aus dem Musikzimmer. Wo sie auch in der Nacht bleibt, mit Henny.
Elli geht hinauf in ihre Bettkammer, die noch hinter dem Zimmer der Kinder liegt. In den Nachtstunden bleibt es ruhig. Gegen Morgen, der Nebel hängt noch dicht wie Wolle vor dem Fensterkreuz, sind Geräusche von unten zu vernehmen, aus dem Musikzimmer. Knarren, Stöhnen, erstickte Schreie. Später dann Hennys leises, aber brunnentiefes Lachen.
»Hast du sie auch gehört, heute Nacht?«, fragt Signe bei der Morgengymnastik.
»Wen soll ich gehört haben?«, sagt Elli.
»Na, die Geister.«
»Nebelgeister«, ergänzt Edvard.
»Sie haben geflüstert und geflucht.«
»Und gelacht, einer von ihnen hat gelacht.«
»Nur ein Traum«, erklärt sie ihnen.
Erster Teil
Bondegaard
1934–1938
»Das Land«
Das Einlaufen der Fähre in den kleinen Hafen, unmittelbar nach dem Umrunden der Inselspitze, schien nicht ohne Gefahren. Sibyl, mit den zwei Kindern an der Hand unter Dutzenden Reisenden an der Reling, blickte hinunter auf die durch das Schiffsmanöver aufgewühlte, weiß schäumende Wasseroberfläche. Die Fahrrinne, die der Bug zerteilte, war schmal, und aus der Tiefe drohten die Spitzen scharfkantiger Felsen als dunkle Schatten nach dem Schiffsrumpf zu greifen.
Doch die Fähre glitt elegant in das Hafenbecken ein. Ihre Besorgnis kam Sibyl plötzlich kindisch vor, vielleicht sogar angestoßen durch altes Seemannsgarn, Schauergeschichten, die sie kürzlich über die Insel und ihre Bewohner gelesen hatte. Sie musste über sich selbst den Kopf schütteln.
Edvard und Signe, die beiden Fünfjährigen, sahen sie verwundert an.
Sie beugte sich zu ihnen hinunter und brachte die Lippen dicht an ihre Ohren. »Die Inselbewohner früher«, rief sie inmitten des Lärms der dröhnenden Schiffsmotoren und umherflatterndender Stimmfahnen, »sollen ankommende Schiffe mit Absicht auf Felsen oder Sandbänke vor der Küste gelockt haben. So konnten sie nicht mehr fortsegeln.«
»Aber warum haben sie das getan?« Signes Blick drückte Empörung aus.
»Wegen der Schiffsladung. Sachen zum Essen. Die Menschen auf der Insel waren arm damals, aßen immerzu Hering.«
»Hering?«, wiederholte Edvard.
»Ja, der war billig. Morgens, mittags und abends Salzhering, stellt euch das vor.« Sie verzog das Gesicht, und die Kinder taten es ihr nach.
Das Fährschiff dockte an und wurde nach einigen weiteren Manövern am Kai vertäut. Das Wasser beruhigte sich schnell und glitzerte flaschengrün unter dem lichtblauen Himmel. Motorboote und kleine Segler lagen auf der Oberfläche wie Wasservögel, die in der Sonne dösten. Über den wippenden Landgang balancierte ein Teil der Fahrgäste mit ihnen zusammen zum Kai hinunter, beäugt und beschimpft von einem Möwengeschwader, das dicht über ihren Köpfen lärmte.
Geschäftiges Treiben herrschte auf dem mit klobigem Granit gepflasterten Gelände, das rechter Hand von einem wuchtigen Backsteingebäude begrenzt wurde, dem Pakhuset, wie ein Schild verriet. Es roch nach Salz und Motorenöl und nach stinkendem Fisch. Männer in blauer Drillichkleidung eilten mit Schubkarren über den Platz und entluden Frachtpakete. Passagiere mit Gesichtern, die ihr Ziel klar vor Augen zu haben schienen, entfernten sich rasch, andere warteten wie sie darauf, abgeholt zu werden.
Sibyl ging mit den Kindern zu der Stelle, wo die Koffer platziert worden waren, griff sich ihren grauen mit den auffälligen roten Lederverstärkungen an den Ecken und hielt ein paar Meter weiter Ausschau nach Henny. Sein freundliches Froschgesicht würde sie auch im Gewimmel sofort entdecken.
Sie atmete durch. Zum ersten Mal an diesem Tag stieg ein Gefühl von Zuversicht in ihr auf.
Als sie am Vormittag in Kopenhagen mit Signe und Edvard aus dem Zug gestiegen war und anschließend mit ihnen die Bahnhofshalle verlassen hatte, hatten die Kinder enttäuscht die Köpfe hin- und hergewendet. Nichts als hohe Häuser, Straßen, Autos und Menschen, deren Gesichter ebenso gehetzt und sorgenvoll wirkten wie in Hamburg, das sie im Morgengrauen verlassen hatten. Die Kinder hielten die erste Station ihrer überstürzten Abreise von Zuhause bereits für die Endstation. Das hatte Sibyl gezeigt, wie verängstigt sie waren. Edvard sagte: »Ich dachte, wir fahren auf eine Insel.« Und Signe vermisste ihre Eltern.
Sibyl hatte den Kindern aus Vorsicht erst am Abend vor ihrem plötzlichen Aufbruch, von dem sie inzwischen wohl spürten, dass er eine Flucht war, versprochen, sie würden am nächsten Tag zu Elli und Henny nach Dänemark reisen, auf eine Insel mitten in der Ostsee. Henny befand sich bereits auf Bornholm, und Elli, Sibyls Halbschwester, die sich derzeit noch bei ihrem gemeinsamen Vater in der Schweiz aufhielt, würde ebenfalls dorthinkommen.
»Wir fahren jetzt mit dem Taxi zum Hafen«, hatte sie Signe und Edvard vor dem Bahnhof in Kopenhagen erklärt. »Und mit dem Schiff geht es dann weiter zur Insel. Wie ich es euch versprochen habe.«
Die Kinder fest an beiden Händen, sah sie sich jetzt auf dem Kaigelände um, hob den Blick zur Straße, die parallel zum Hafenbecken verlief. Pferdefuhrwerke, wenige Autos, Fußgänger, Fahrräder. Kein freundliches Froschgesicht. Nach kurzer Zeit waren sie beinahe die Einzigen, die noch auf irgendwen oder irgendetwas zu warten schienen.
Ein schlaksiger Mann in einem verwaschenen graublauen Overall und mit einem verbeulten Hut auf dem Kopf schälte sich wenig später aus der Szenerie und schlenderte auf sie zu. Etwas verlegen, wie es schien, fasste er sich an den speckig glänzenden Hutrand, als er sie begrüßte: »God dag.«
Sie schnappte seinen Namen auf, der sich wie Kuhfuß anhörte, dann Bondegaard, schließlich verstand sie kaum noch etwas, weil der Mann viel zu schnell für sie sprach. Sie bat ihn freundlich zu wiederholen, was er gesagt hatte. Darauf wandte er sich um und deutete mit zwei knochigen Fingern zur Hafenstraße. Auf einen Leiterwagen, vor den ein rotbraunes Pferd gespannt war.
Sie warf einen misstrauischen Blick auf das Gefährt und konnte ein leichtes Seufzen nicht unterdrücken: »Kommt, Kinder, das Taxi wartet.«
Der Mann im Overall griff sich ihren Reisekoffer, dann stakste er ihnen voran über die klobigen Pflastersteine des Vorplatzes, und sie stiegen die hohen Steinstufen zum Leiterwagen hinauf.
Signe verharrte vor dem Pferd und schaute zu ihm auf. »Wie heißt es?«, fragte sie den Mann, ohne den Blick von der Stute zu nehmen.
»Mira.«
»Mira.« Flüsternd wiederholte sie den Namen.
Das Pferd senkte den Kopf und sah das Mädchen an, erst mit einem Auge, dann mit beiden. Ein zaghafter Vertrauensbeweis.
»Mira.« Signe hob den Arm und legte dem Pferd sachte, mit einer verblüffend selbstverständlich anmutenden Geste ihre kleine Hand an die wulstigen Lippen und fuhr über seine stacheligen Nüstern. Der Einfluss ihres Vaters war unverkennbar. Für Henny war das Pferd geradezu ein Totemtier, Sinnbild dafür, dass der Mensch nicht über den Tieren stand. »Gleichwertig, ja«, das hatte Sibyl ihm zugestanden. »Aber nicht gleichartig, Henny. Als Tiere, quasi nackt der Natur ausgesetzt, wären wir Menschen ziemliche Versager, meinst du nicht?« Er hatte ihr lachend zugestimmt. »Das zeigt aber die Entfremdung zwischen Mensch und Tier«, hatte sie hinzugefügt. Der Gedanke gefiel ihm sichtlich nicht mehr.
Der Mann hievte unterdessen Edvard und dann auch Signe auf die Ladefläche des Leiterwagens, danach half er Sibyl vorne auf den Kutschbock. Seine rissigen roten Hände, mit denen er nach den Zügeln langte, fielen ihr auf. Und er roch nach Schnaps. Er schnalzte mit der Zunge, das Pferd stemmte sich ins Geschirr.
Sibyl drehte sich um und warf einen Blick auf die Kinder. Sie saßen still nebeneinander auf gefalteten Jutesäcken, lehnten mit dem Rücken gegen die schrägen Holzwände des Leiterwagens und pressten ihre kleinen Reisetaschen gegen den Leib, als könnten sie davonfliegen.
Die Stute zog schnaubend den Wagen die gewundene, steil ansteigende Hauptstraße hinauf bis zu einer Kreuzung, die zugleich eine Anhöhe bildete. Von da an gab es kaum noch Steigung. Im Schritttempo fuhren sie in südlicher, dann westlicher Richtung, und allmählich fühlte sie sich in der Lage, die Landschaft in sich aufzunehmen. Hauchdünner Dunst war aufgezogen. Das Graublau des Himmels verschmolz am Horizont mit der matt schimmernden Oberfläche des Meers und im Vordergrund mit dem Gras- und Waldgrün der auf breiter Linie hinabgleitenden Landmasse zu einer einzigen Formation. Die Elemente Erde, Wasser, Luft, scheinbar getrennt durch flimmernde Linien, verschoben sich mit dem steten Schritt des Pferds kaum merklich gegeneinander. Im Kontrast dazu das harte Klatschen der Hufeisen auf dem gepflasterten Weg und der scharfe Schnapsgeruch des Mannes, der neben ihr mit den Zügeln schlenkerte.
Mit dem Blick nach vorn wanderten ihre Gedanken zurück zu den Bildern der letzten Stunden, ihrer Überfahrt mit den Kindern auf die Insel.
Am Kai in Kopenhagen hatte schon das Dampfschiff gelegen, die Østbornholm. Auf dem Schiffsschornstein leuchtete korallenrot ein sechszackiger Stern, und an den Masten zitterten drei rotweiße Fahnen im milden Maiwind. Sie kaufte die Karten im Hafenkontor, und gegen Mittag legte das Schiff ab. Die Luft war diesig, der Himmel aschgrau, die Ostsee lag ruhig wie ein Teich, schimmerte matt und bleifarben. Doch sobald sie aufs offene Meer hinausfuhren, wogte es lebhafter, und der Himmel klarte nach und nach auf, als zöge jemand Stück für Stück einen Schleier zur Seite. Plötzlich hatte sie das Gefühl, alles Licht der Welt würde auf sie niederbrennen. Ihr wurde ein wenig schwindlig, und da sie fürchtete, die Kinder könnten Sonnenbrand bekommen, stieg sie mit ihnen vom Oberdeck zum Passagierdeck hinunter.
Als sie die Sitze an den Tischen erblickte, konnte sie ein lautes Auflachen nicht verhindern. Die Polsterbezüge waren schwarz-weiß gefleckt wie Kuhhäute, doch auf der weiteren Fahrt erwiesen sich die Sessel als äußerst bequem. Sie nahm einen der Tische in Beschlag, ließ sich erschöpft in einen Kuhsessel fallen und setzte sich die Kinder auf ihren Schoß. Schon nach wenigen Minuten wiegten das beruhigende Brummen der Schiffsmotoren und die sanft schaukelnden Bewegungen des Dampfers die Kinder in den Schlaf. Die Gesprächsfetzen, die von den Tischen der anderen Fahrgäste herüberwehten, taten vielleicht ein Übriges. Die dänische Sprache, die sie geübt hatte, seit der Entschluss feststand, dass sie Hamburg verlassen und nach Bornholm ziehen würden, klang in ihren Ohren sanft und zugleich lebhaft im Vergleich zu dem schwer schleppenden Tonfall des Norddeutschen.
Nach einiger Zeit hatte sie die Kinder vorsichtig, ohne dass sie aufwachten, auf einen der beiden anderen Sessel gehoben und sich eine Zigarette angezündet. Sie hatte an nichts denken können. An nichts.
Der Leiterwagen rumpelte plötzlich über einen Stein oder dicken Ast, und als hätte ihn das aufgeschreckt, rief Edvard: »Wann sind wir da, Mama?«
»Sicher schon bald«, antwortete sie, ohne sich umzudrehen.
Ihre Aufmerksamkeit galt einer Rundkirche, laut Baedeker-Reiseführer ein Charakteristikum der Insel, heidnischen Ursprungs, wie Henny glaubte. Der weiß gekalkte Rundturm mit dem Dach aus dunklen Holzschindeln, der mehr und mehr in den Blick kam, warf in der späten Nachmittagssonne einen bauchigen Schatten auf die Straßenkreuzung, die sie nun erreichten.
Sibyl wandte sich über die Schulter halb zu den Kindern um. »Schaut mal, eine ganz besondere Kirche.«
Signe richtete sich ein Stück auf und reckte den Hals. »Nein, das ist keine Kirche. Kirchen sehen anders aus.«
Das dunkle Dröhnen der Schiffssirene hatte die Kinder erst bei der Anfahrt auf Bornholm geweckt. Sibyl stieg mit ihnen an Deck. Das Schiff umrundete die Nordspitze der Insel. Sie standen eingezwängt zwischen anderen Fahrgästen, und die Kinder linsten mit zusammengekniffenen Augen durch das Drahtgeflecht der Reling auf eine Szenerie wie aus einem schaurigen Märchen: zerklüftete Felsen, die an Fabelwesen erinnerten, doppelköpfige Kamele, gigantische Echsen, wie Kathedralen wuchsen die Klippen aus dem Meer. Sie hob den Blick. Wälder krochen die steilen Hänge hinauf, und die Plateaus schienen mit grünen Weiden wie mit einer dicken Moosschicht bedeckt. Die Ruine einer mittelalterlichen Burg kam in Sicht, majestätisch, tragisch und dunkel thronte sie auf einer schroffen Felsformation.
Auf der Ostseite der Inselspitze passierten sie den ersten Ort in respektvoller Entfernung zu den eiszeitlichen Findlingen, die aus dem Wasser ragten wie Walrosse auf einer Sandbank. Ein Fischerdorf, sein Name fiel mehrfach in den Bemerkungen anderer Reisender in ihrer Nähe, doch sie verstand ihn nicht. Geduckte, maisgelbe, himmelblaue und malvenfarbene Häuser leuchteten in der lichtgefluteten Bucht und erinnerten an Glassplitter in einem Kaleidoskop. Als Nächstes tauchte bereits der Hafen von Allinge vor ihnen auf. Oberhalb der Hafenstraße stapelten sich salzweiße, gelbe und rostrote Fachwerkhäuser in die Höhe, dicht an dicht wie Nester von Seevögeln. Die Hafenanlage war, auch das hatte sie im Baedeker gelesen, mitten in den Felsen hineingesprengt, das Granitgestein für den Kai und als Wellenbrecher verwendet worden. Und in der Tat war ihre Fähre ja trotz der kabbeligen See erstaunlich ruhig eingelaufen.
Das Pferd bog mit einem Mal ohne Zutun des Kutschers rechts ab und fiel nun, da es ein wenig abwärts ging, in einen leichten Trab. Wind kam auf, sie fröstelte ein wenig, nestelte an ihrem Seidenschal und legte den Kopf in den Nacken. Der Himmel war leer, bis auf einige Seevögel, die in der Höhe kreuzten und kreischten. Und ohne dass sie sich dagegen wehren konnte, formten sich in ihrem Innern Fragmente und Bilder, Gravuren der Ereignisse, die ihre Flucht besiegelt hatten und nicht zurückgeblieben waren – natürlich nicht, wie hatte sie das annehmen können –, sondern sich offenbar bereits tief in ihr Gedächtnis eingeschrieben hatten.
Es war keine Vertreibung aus dem Paradies gewesen, die sie hierhergeführt hatte, auf diese Insel. Aber eine aus ihrem Leben. Bis zu Friedels Tod – Gott, drei Jahre war das nun schon her!, Februar einunddreißig – hatten sie in Hamburg-Winterhude gewohnt, drei enge Zimmer im Parterre eines Mietshauskomplexes mit brombeerfarbenen Klinkersteinen: sie und Friedel, Elli und Henny und die Kinder, sie alle zusammen. Hinzu kamen die Besucher. Manche blieben nur kurz, für eine oder zwei Nächte, andere quartierten sich mitunter wochenlang bei ihnen ein. Die Wohnung war Ort zahlloser Zusammenkünfte und Sitzungen von Hennys Künstlerfreunden und Friedels Verlagsleuten gewesen. Lebhafte, hitzige Diskussionen im Nebel unzähliger Tabakpfeifenfüllungen und gerauchter Zigarren, angeheizt durch steile Thesen und literweise Schnaps. Lauter Männer. Die sich am Abend auch gerne von dem Sirenengesang ihres Hausmädchens in die Küche locken ließen. Sie hatte die Angewohnheit, traurige Liebeslieder zu singen, während sie splitternackt ihren schneeweißen, sehnigen Körper in einer großen Emailleschüssel wusch –, und nichts dagegen einzuwenden, wenn die jungen Kunstfreunde ihr ergriffen dabei zusahen, wie die Seifenlauge ihre makellose Haut zum Glänzen brachte, sie schien nicht einmal Notiz von ihnen zu nehmen.
Dann wurde Friedels schmales Gesicht von Tag zu Tag fahler. Eine Weile arbeitete er noch in dem kleinen, hoffnungslos unterfinanzierten Musikverlag, den er zusammen mit Henny gegründet hatte. Doch ihre kleine Wohnung glich mehr und mehr einem Lazarett. Sibyl fühlte sich wie paralysiert, als sie ihn so dahinschwinden sah. Es war Elli, die ihn schließlich in ein Sanatorium begleitete. Doch es war zu spät für ihn, und Sibyl verstand bis heute nicht, warum Elli sich anschließend solche Vorwürfe deswegen gemacht hatte. Es hatte in niemandes Macht gelegen, Friedels Tod zu verhindern.
Kurz darauf waren sie in den Hirschpark umgezogen, nach Blankenese. Doch Friedel fehlte schmerzhaft, ihnen allen, die Familie war wie amputiert.
Der Mann neben ihr auf dem Kutschbock streckte plötzlich seinen Arm aus und deutete nach rechts, nach Westen. »Bondegaard!«, rief er mit heiserer Stimme und so laut, als hielte er sie für schwerhörig.
Auf einer flachen Anhöhe lag weithin sichtbar der Viereckhof, den Henny für sie alle erworben hatte. Ein Karree weiß gekalkter Gebäude inmitten eines Meers aus Grün und Braun und Gelb, aus sanft geschwungenen Weiden, Äckern und Getreidefeldern. Nicht weit vom Hof blinkte ein Weiher in der schräg stehenden Sonne. Und hinter dem kleinen Waldstück, das angrenzte, musste Granly liegen, eine Kate, die nicht zum Landbesitz gehörte, aber günstig dazugemietet worden war, um sie als Schafstall zu nutzen.
Sie bogen in den ungepflasterten Wirtschaftsweg ein, der über eine Strecke von gut einem Kilometer in schnurgerader Linie zum Hof führte. Zum Hof und sonst nirgendwohin, denn dort endete er offensichtlich.
Die Dinge erschienen ihr mit einem Mal sehr einfach und übersichtlich: eine wellige Landschaft in gedämpften Farben, ein Weiher, der den Himmel spiegelte, ein Hof, zu dem genau ein Weg führte, der einzig mögliche, nämlich fort von ihrem letzten Zuhause.
Ein Vormittag im März, zwei Monate nachdem Hitler an die Macht gekommen war, hatte sich besonders in ihr Gedächtnis eingebrannt. Männer in braunen SA-Uniformen waren in ihr Haus im Hirschpark eingedrungen und durchsuchten es von unten bis oben. Rissen die Schranktüren auf, zerrten wahllos Kleider und Gegenstände heraus, durchwühlten sämtliche Regale, Fächer und Schubladen.
»Jahnn versteckt kistenweise Waffen in diesem Haus! Was wissen Sie darüber?«, brüllte sie der Anführer an.
»Er versteckt keine Waffen«, widersprach sie dem Mann in der Gewissheit, dass er ihr nicht glauben würde.
Sie war allein mit den Kindern, Henny bereits mit Elli in die Schweiz gereist, um dort nach Arbeitsmöglichkeiten zu suchen. Edvard und Signe drängten sich an sie, und sie zitterten gemeinsam aus Angst vor der Männerhorde, die ihr Haus verwüstete. Ein Wunder, dass die Barbaren das Porträt, das Heinrich Stegemann einige Jahre zuvor von Henny gemalt hatte, nicht zerstörten; sie hielten es für wertlos. Ihr Anführer höhnte: »Wer ist denn der tote Mann? Ist ja ganz grün im Gesicht!«
Die Männer rissen Sibyl von den Kindern los und trieben sie fluchend und brüllend durch das Haus. Bis sie schließlich eine Pistole fanden.
»Ein Erbstück meines Schwiegervaters an meinen verstorbenen Mann«, versuchte sie, ihnen zu erklären. »Ohne Munition. Ich könnte auch gar nicht damit umgehen.«
Sie steckten die Waffe ein und verschwanden.
Kaum hatten die Männer das Haus verlassen, stellten die Kinder ihr Fragen: nicht mit Worten, sondern mit ihren Blicken, mit vor Angst aufgerissenen Augen. Doch Sibyl konnte ihnen nicht antworten. Ihre Ohnmacht beschämte sie bis zum Verstummen.
Unmittelbar nach seiner Rückkehr aus der Schweiz, Elli war bei ihrem Vater geblieben, wurde Henny von der Polizei zu einem Verhör abgeholt. Am Abend war er wieder zu Hause, körperlich unversehrt, wie es aussah, aber zutiefst verstört und schweigsam. Seine Reden und öffentlichen Auftritte, seine frühen, vergeblichen Warnungen vor Hitler – man hatte ihn nicht überhört damals. Und auch nicht vergessen, dass dieser Jahnn jede Form von Krieg verurteilte. Vor dem letzten war er nach Norwegen geflohen, und den nächsten, »verheerender als der Dreißigjährige Krieg«, hatte er prophezeit, sah er bereits am Horizont heraufziehen, sollte Hitler die Macht erlangen. Mit seiner Partei von Judenhassern.
Was würde als Nächstes geschehen? Elli und Sibyl hatten jüdische Vorfahren, holländische Kaufleute, von denen Carlo, ihr gemeinsamer Vater, abstammte. Dieser Hintergrund hatte in ihren Familien bislang kaum eine Rolle gespielt, und doch braute sich hinter ihrem Rücken nun auch noch das absurde Gerücht zusammen, einer von Ellis früheren Liebhabern, angeblich ein Jude, habe geholfen, den Reichstag in Brand zu setzen.
Nein, sie hatten fortgemusst, die ganze Familie.
Das Pferd schwitzte und ging wohl schon eine Weile wieder im Schritt, der Erntewagen rumpelte über Schlaglöcher und große Steine, die Kinder rappelten sich auf, hielten sich hinter Sibyl an der Rücklehne des Kutschbocks fest und richteten ihre Blicke auf den Hof, das Ziel ihrer Reise.
Ihr Kutscher hielt direkt vor dem lang gestreckten Haupthaus. Es bildete den Kopf gegenüber den drei Wirtschaftsgebäuden, die sich rechtwinklig um den mit groben Granitsteinen gepflasterten Hof gruppierten. Das ganze Hofensemble war weiß geschlämmtes Fachwerk mit baumdicken braunen Bohlen und krebsrot gestrichenen Fensterkreuzen, Türen und Toren. Es roch streng nach Mist und mit einer leichten Windbö, die aufkam, auch ein wenig süßlich. Eine Handvoll Hühner, die Körner zwischen den Granitsteinen pickten, ein Hund, der hinter einem der Ställe bellte, ein älterer, untersetzter Arbeiter im grauen Overall, der eine schwarzbunte Kuh am Strick über den Hof führte, ohne die Neuankömmlinge zu beachten; er verschwand mit dem Tier in dem offenen Scheunentor eines Seitenflügels.
Der Kutscher half zuerst Sibyl vom Kutschbock und dann den Kindern von der Ladefläche. Noch ehe er den Koffer heruntergewuchtet hatte, wurde die Tür des Wohnhauses geöffnet, und Henny trat heraus. Mit strahlendem Gesicht – der lachende Frosch –, die Arme wie Adlerschwingen weit geöffnet. Eigentlich von zierlicher Statur wirkte er in den letzten Jahren zunehmend kompakter. Er war jetzt vierzig, und im Augenblick sah er ganz und gar nicht aus wie ein Mann, der vor kurzem erst aus seiner Heimatstadt geflüchtet war, sondern wie der sprichwörtliche Prinz im Märchen, dem mit der Prinzessin auch das halbe Königreich zugefallen war.
Nur dass die »Prinzessin« in diesem Fall Edvard war, Sibyls fünfjähriger Sohn, mit dessen Geld aus Friedels Erbe der Hof zum großen Teil bezahlt worden war.
Die Kinder rannten auf Henny zu, und er beugte sich breit lächelnd zu ihnen herab und schloss seine Schwingen um sie.
»Endlich da!«, rief er Sibyl bereits freudestrahlend zu, während er noch die Kinder umschlang.
In diesem Moment tauchte in seinem Rücken eine große blonde Frau in einem rostfarbenen Wollkleid auf, etwa im selben Alter wie Henny. Die Frau drängte sich geschickt an dem kleinen Menschenknäuel, Henny und den Kindern, vorbei und steuerte auf Sibyl zu. »Herzlich willkommen auf Bondegaard! Ich bin Dorit Herron.«
»Sibyl Harms.«
Die Frau schüttelte ihr kräftig die Hand. Eine Bö zauste an ihren ondulierten Locken. »Henny hat Sie und die Kinder schon sehnlichst erwartet. Nicht wahr, Leiv?« Sie wandte sich um und blickte in das bleiche Gesicht eines deutlich jüngeren Mannes, der inzwischen neben ihr aufgetaucht war.
Ihre rhetorische Frage beantwortete er mit einem unverbindlichen Lächeln. »Leiv. Gregersen«, stellte er sich Sibyl vor, leise und mit gepresster Stimme.
Dorit Herron und Leiv Gregersen, Henny hatte von ihnen erzählt. Dorit hatte seinen Roman gelesen, hatte die sinnliche Traumwelt seines »schwachen Helden« Perrudja betreten und schwärmte seitdem für Hennys Visionen. Auch im Leben, auch für die Idee, Bondegaard zu kaufen. Und nachdem Dorit bei der Trennung von ihrem vermögenden Mann offenbar großzügig abgefunden worden war, wollte sie das Vorhaben, den Hof zu erwerben, auch finanziell unterstützen.
Sie hatte ein eigenes Interesse daran, Deutschland zu verlassen. In Hamburg war sie von der Gestapo verhört worden, weil sie mit einem Ausländer, mit Leiv, ihrem dänischen Geliebten, unehelich zusammenlebte. Spionageverdacht, so die absurde Begründung.
Leiv war Violinist und dem Anschein nach gut zehn Jahre jünger als Dorit. Doch als Sibyl genauer hinsah, wirkte er auf sie eher zehn Jahre älter: kränklich, hinfällig.
Henny hatte das Paar, das zwischenzeitlich nach Kopenhagen gezogen war, gebeten, vertretungsweise auf den Hof zu ziehen, bis zu seiner Rückkehr von einer Reise durch Frankreich und Dänemark.
»Ich bin sicher«, sagte Dorit mit ihrer kraftvollen dunklen Stimme und ergriff dabei erneut Sibyls Hände, »es wird Ihnen und den Kindern genauso gefallen wie Leiv und mir, hier auf unserem Hof.«
Henny blickte verärgert zu Dorit hin und machte sich von den Kindern frei. Mit energischem Schritt kam er auf Sibyl zu, musste sie jedoch buchstäblich aus Dorits Händen befreien, um sie auch selbst begrüßen zu können.
Sibyl bot ihm ihre Wange hin. Sein Kuss fiel nicht ganz so flüchtig aus wie sonst. Das war keine Kälte seinerseits, jedenfalls empfand sie es nicht so, sie schrieb es vielmehr seinem hanseatischen Wesen zu, seinem betont bürgerlichen, auf Konventionen bedachten Auftreten.
Etwa eine Stunde später saß sie endlich mit Henny allein in der Küche beim Tee. Die Kinder waren nebenan im Esszimmer mit Malen beschäftigt, Eydis, die junge Küchenmagd, hatte ihnen Papier und Buntstifte besorgt. Und Dorit und Leiv hatten sich zu einem Spaziergang nach Finnedalen aufgemacht, einem nahe gelegenen Tal. Dort gebe es, hatte Henny in seiner überzeugenden Art sehr nachdrücklich behauptet, eine magische Quelle, die den Weiher hinten an der Grundstücksgrenze speise. »Ihr müsst wissen«, hatte er den beiden versichert, »dass auch Bondegaard ein alter germanischer Sitz ist. Bis vor zwanzig Jahren stand vor dem Haus noch ein Thingstuhl aus Granit. Heute auf dem Friedhof in Rutsker zu bewundern.«
Sibyl bedachte ihn mit einem spöttischen Lächeln, kaum dass das Paar fort war. »Der Hof liegt doch auf einer Anhöhe, Henny. Und einen Bach, der bergauf fließt, habe jedenfalls ich noch nicht entdeckt.«
»Ich auch nicht.« Er lachte plötzlich wiehernd wie ein Gaul. Man musste sich geradezu in Deckung bringen, wenn er so loslachte.
»Du magst sie nicht, Dorit und ihren Leiv?«
»Doch, ich mag Dorit, bin ihr sogar zu Dank verpflichtet.«
»Ich denke, wir alle sind es, Henny. Sie hat den Hof mitfinanziert. Das Geld aus Friedels Erbe hätte nicht gereicht.«
»Schon. Aber muss sie sich deshalb gleich wie eine Schlossherrin aufführen?«
»Du hast sie dazu ermuntert, denke ich.«
»Schön, ich war einverstanden, dass die beiden ihren früheren Hausstand mitbringen. Ich hielt das für praktisch. Das Wohnhaus stand weitgehend leer. Und unsere eigenen Möbel aus Hamburg können wir ohnehin erst später anliefern lassen.«
Er hatte recht. Der Möbeltransport noch vor ihrer heimlichen Abreise hätte nur auf ihre geplante Flucht aufmerksam gemacht. »Aber du bist nicht auf die Idee gekommen, dass Dorit und Leiv ebenfalls auf dem Hof leben wollen, Henny? Dauerhaft, mit uns allen zusammen?«
»Aber …« Er sah sie verwundert an. »Dazu ist einfach kein Platz auf Bondegaard, das muss den beiden doch klar sein! Abgesehen davon habe ich Dorit nicht darum gebeten, auch ihre Kleider, Papiere und Bücher überall zu verteilen. Es ist, als würde sie im ganzen Haus wohnen wollen.«
Auch Sibyl hatte es bemerkt, als Henny sie vorhin durch die Zimmer des Wohnhauses geführt hatte. Dorit hatte nicht nur den größten ebenerdigen Raum, mit einem wunderschönen Kachelofen darin, in Beschlag genommen, sondern auch ihre Blusen, Jacken, Röcke und Bücher in verschiedenen anderen Zimmern abgelegt.
»Und Leiv?«, fragte sie.
»Du hast ihn ja gesehen.« Hennys Blick verdunkelte sich. »Leiv erinnert mich an Friedel. In seinen letzten Jahren.« Er senkte den Kopf, trank Tee, ließ wieder den Kopf hängen.
Friedel war vor ihrer Ehe Hennys Geliebter gewesen, schon in seinen Jugendtagen. Sie hatte darum gewusst. Er fühle sich von Männern und Frauen gleichermaßen angezogen, hatte Friedel ihr erklärt. Vor ihr war er neben Henny auch mit Elli zusammen gewesen.
Und Henny weigerte sich seit jeher, sein Geschlecht als festgelegt anzusehen. »Ich hätte Kinder mit ihm haben wollen, falls du das verstehst, Sibyl«, hatte er ihr kurz nach Friedels Tod traurig gestanden. Warum ausgerechnet sie das nicht verstehen solle, hatte sie ihm geantwortet: »Ich habe ein Kind von ihm bekommen.« Plötzlich hatten sie beide lachen können.
Draußen im Hof war auf einmal lautes Geknatter zu hören, mit grässlichem Widerhall zwischen den Gebäuden. Sie schaute durch das Küchenfenster hinaus. Ein Mann in Lederkluft und mit weißem Sturzhelm auf dem Kopf brachte sein Motorrad vor dem Haus zum Stehen.
Henny runzelte die Stirn. »Weinzierl. Er war in Rønne, um sich eine Kutsche anzusehen. Eine, die von unseren großbäuerlichen Nachbarn auch als standesgemäß angesehen wird. Aber dass er ausgerechnet dieses schreckliche Knatterrad fahren muss –«
»Wie weit ist es bis Rønne?«
»Ich schätze, fünfzehn Kilometer.«
»Mit dem Erntewagen hätte er wohl den ganzen Tag für die Strecke gebraucht.« Die Spitze konnte sie sich nicht verkneifen.
»Trotzdem. Ich mag keine Motoren.«
Das wusste sie. Nur das Pferd, auch in der Landwirtschaft nur das Pferd, war sein Leitspruch. Sie aber fragte sich, wie weit sie damit kommen würden, wenn es darum ging, den Hof so zu bewirtschaften, dass er ihnen in Zukunft keine Verluste bescherte. Zusätzlich zu den Schulden, die sie seit Friedels Tod auch schon für den Musikverlag verwaltete.
Die Tür wurde von der Waschküche her schwungvoll aufgestoßen, und in schwarzer Ledermontur, den Helm unterm Arm, trat Ottmar Weinzierl ein. Ihr deutscher Hofverwalter war groß, dunkelhaarig und hatte etwas Mokantes, Aufmüpfiges im Blick. Und zu ihrer Überraschung spürte sie, dass sie tiefrot wurde, als ihr der Mann, er mochte ein, zwei Jahre jünger als sie sein, fest die Hand drückte und seine wachen braunen Augen sie fixierten. Sein Auftreten beeindruckte sie spontan, aber sie wusste nicht, ob sie seine intensive Art, diesen brennenden Blick, mochte.
Bisher kannte sie Weinzierl nur dem Namen nach, und doch hatte er seine Anstellung vor allem ihrer Initiative zu verdanken. Sie war es gewesen, die Hennys Vorschlag, Bondegaard zu erwerben, unter der Bedingung zugestimmt hatte, dass der Hof von einem Verwalter geführt werde, der von Landwirtschaft etwas verstand. Glücklicherweise hatten sie nicht lange nach einem Fachmann suchen müssen. Der schließlich auch offen sein musste für neue Horizonte, wenigstens die dänischen, mitten in der Ostsee. Im Musikverlag arbeitete bereits seit Jahren Erik Weinzierl, und sein jüngerer Bruder Ottmar, gelernter Landwirt, gehörte wie Erik der Jugendbewegung an. Henny urteilte nach einem langen Gespräch mit Ottmar begeistert, dass in ihm noch immer »ein abenteuerlustiger Wandervogel« stecke: »Der richtige Mann für uns.«
Aus dem Nebenzimmer stürmten die Kinder herein. Sie hatten das Geknatter im Hof gehört und beäugten den Mann neugierig, der in seiner imposanten Ledermontur mitten in der Küche stand und beiläufig von dem Teller mit Gebäck naschte, das Eydis mit auf den Tisch gestellt hatte. Er mochte sich anscheinend nicht lange in der Küche aufhalten. Lachend warf er den Kindern einen Keks zu und bot an, ihnen die Tiere auf dem Hof zu zeigen. »Und wenn ihr wollt, stelle ich euch Højager vor, unseren Hofhund. Er ist schon alt und bewegt sich kaum mehr von der Stelle. Döst sicher hinten beim Ententeich in der Sonne.«
Er musste sie nicht zweimal fragen.
Sibyl schaute dem Mann durch das Fenster hinterher, der nun breitschultrig, in einem wunderbar aufrechten Gang – so selten unter Männern wie unter Frauen – mit Edvard und Signe an seiner Seite über den Hof federte, als hätte er an diesem Ort schon sein ganzes Leben verbracht. Und neben ihm schienen auch die Kinder leichter zu gehen, bauten sogar Hüpfer ein, um mit ihm Schritt zu halten. Die Angespanntheit, von der sie spürbar, zumindest für Sibyl spürbar, durchdrungen waren, schien ein wenig von ihnen abzufallen. – Kein Wunder, dass die Kinder so bedrückt waren, sie konnte ihnen ja bisher noch nicht einmal sagen, welches der Zimmer im Haus zukünftig ihres sein sollte. Geschweige denn, dass sie wusste, wie lange das alles hier, ihr Exil auf dieser Insel, andauern würde.
Henny hatte sie nach ihrer Ankunft vorhin nur in aller Eile durch das Wohnhaus geführt. »Die Stallungen und alles andere später, einverstanden?« Die geräumige Küche mit dem großen runden Tisch, an dem sie jetzt saßen, war fast quadratisch. Daran anschließend das Esszimmer für die Familie und das Hauspersonal, das derzeit aus Eydis, dem Küchenmädchen, und der Hauswirtschafterin Ditte bestand, die älter war, um die fünfzig, korpulent, grau meliert, mit einem Geflecht aus roten Adern im ernsten Gesicht.
Der größte Raum im Erdgeschoss war das Arbeitszimmer, das Henny als Musikzimmer bezeichnete.
»Dort soll auch das Klavier stehen.« Er rührte lustlos in seinem Tee. »Meine Versuchsorgel werde ich leider kaum darin unterbringen können. Kein Platz, im ganzen Haus nicht.«
Sibyl verstand nichts vom Orgelbau. Vermutlich so wenig wie Henny selbst, als er vor zwanzig Jahren begonnen hatte, sich damit zu beschäftigen. Umso erstaunlicher, dass er es als Autodidakt bis zum Orgelsachverständigen der Stadt Hamburg geschafft hatte. Ein Amt, auf das er stolz gewesen war. Hennys entscheidende Neuerung im Orgelbau war, wenn sie ihn richtig verstanden hatte, im Grunde eine Rückkehr. Bei den modernen Orgeln wurde das Betätigen der Tasten erst über einen elektrischen Impuls auf die Pfeifen übertragen. Ein Griff ins Leere, wie Henny glaubte. Jede Jahrmarktsorgel sei ehrlicher, da wisse man, dass keine Menschenhand im Spiel sei. Deshalb plädierte er für eine direkte, mechanische Übertragung vom Tastenanschlag auf die Orgelpfeifen. Zusammen mit weiteren Neuerungen, unter anderem der Teilung in weibliche und männliche Registergruppen, führe dies zu dem überwältigenden Klang, wie man ihn noch zur Barockzeit gekannt habe.
Nun hatte man ihm auch dieses Amt unter dem Einfluss der neuen Herren in Deutschland genommen. Als Orgelbauer wurde er inzwischen sogar öffentlich gebrandmarkt.
»Du schriebst, dass deine Frankreichreise nicht sehr Erfolg versprechend war«, sagte sie.
»Nein, nicht, was den Orgelbau betrifft.«
»Das klingt nach einem Aber.«
»Ich war auch in Marseille.« Seine Augen glänzten plötzlich. »Weißt du, dass man dort die Seegurken noch halb lebendig verzehrt?«
»Nein.« Aber sie verstand, dass er seine Reise nach Metz und Straßburg in Sachen Orgelbau offenbar zu einer Recherchereise nach Südfrankreich ausgedehnt hatte.
»Ein neuer Roman? Die Fortsetzung von Perrudja?« In Polen gab es Stimmen, die für dieses Werk sogar den Nobelpreis forderten.
»Vielleicht eher eine Novelle. Ich weiß noch nicht.« Seine Augen trübten sich wieder ein. »Aber ohne Honorare für den Orgelbau kann ich mir die Arbeit daran gar nicht leisten. Zumal uns der Hof sicher noch einige Zeit Kosten verursachen wird, ehe er Gewinn abwirft.«
»Und deine deutschen Verlage? Fischer, Kiepenheuer?«
»Winden sich. Wollen kein Risiko mit mir eingehen.«
»Was ist mit der Schweiz?« Henny hatte dort Förderer, Bewunderer sogar, die ihn, wie er glaubte, als Schriftsteller höher schätzten als beispielsweise Thomas Mann, den sie eher als einen durchschnittlichen Literaten ansähen.
»Nein, die Perspektiven in der Schweiz haben sich gänzlich zerschlagen«, sagte er. »Es gibt behördliche Hürden für Ausländer, von denen ich nicht wusste. Davon abgesehen ist das Leben in dem Land sehr teuer.«
»Ja, allerdings.« Sie hatte lange genug in der Schweiz gelebt, um das zu wissen. »Apropos Schweiz. Elli hat mir aus Verscio geschrieben.« Eine Postkarte, nur wenige Sätze. »Nichts darüber, wie es ihr geht und wann sie herkommt. Signe vermisst sie schon sehr.«
»Elli bleibt wohl noch einige Tage in Verscio, bei eurem Vater. Ich konnte sie von Frankreich aus telefonisch leider nicht mehr erreichen. Von einem Tag auf den anderen war sie von Zürich abgereist. Ohne irgendwem Nachricht zu geben. Es gab Beschwerden über sie. Von Nachbarn in dem Haus am Zürichsee.«
Einer von Hennys Förderern in der Schweiz, ein Literaturwissenschaftler, wenn sie das recht erinnerte, hatte die Wohnung am Zürichsee vermittelt. Und bezahlt.
»Was für Beschwerden denn?«
Er stieß einen lauten Seufzer aus. »Ach, die üblichen. Ihre angeblichen Verrücktheiten. Ellis Unordnung. Sie hat wie zu erwarten darauf reagiert, trotzig.« Er sah sie mit einem resignierten Gesichtsausdruck an. »Na, du kennst sie ja.«
Sie schwieg. Die ehrliche Antwort wäre nein gewesen. Elli war zwar anderthalb Jahrzehnte älter als sie, aber oftmals kam sie ihr wie ein verträumtes Kind vor. Wer wusste schon, was in ihr vorging, wenn sie vermeintlich nur zum Einkaufen ging und den ganzen Tag lang nicht wieder auftauchte; an wen oder was Elli dachte, wenn sie plötzlich mitten im Satz stockte und abbrach; wenn sie dem Briefträger oder dem Schornsteinfeger unwirsch die Tür öffnete, mit nacktem, schweißglänzendem Körper, unterbrochen in ihren Tanzübungen.
»Lass uns heute Abend versuchen, sie zu erreichen, Henny, auch wenn es teuer ist«, schlug sie vor. Bondegaard verfügte zwar über keine Spültoilette im Haus, aber einen Telefonanschluss, den gab es noch vom Vorbesitzer.
»Gut. Dann kann sie uns hoffentlich sagen, wann Carlo sie endlich ziehen lässt.«
Das war ja zu erwarten, dachte Sibyl, dass Henny ihrem Vater die Schuld an Ellis verzögerter Abreise gab. Die beiden Männer verstanden sich nicht. Carlo hatte Elli damals eindringlich davor gewarnt, Henny zu heiraten. Dabei hatten die zwei so viele Ähnlichkeiten. Aber vielleicht war genau das der Grund für seine Vorbehalte gegen Henny gewesen: Ihr Vater war ebenfalls Schriftsteller, schrieb Gedichte und übersetzte klassische griechische Dramen. Die aufgeführt worden waren, bis die Nazibehörden es verboten hatten. Wegen seiner jüdischen Wurzeln. Ihr Vater war nie religiös gewesen, trotz evangelischer Taufe auch nicht christlich. Ihm verdankte Sibyl einen Großteil ihrer Bildung und sicher auch die Tendenz zum gründlichen Hinterfragen der Dinge, im Geist der alten Griechen, die er bewunderte. Dadurch, das wusste sie, hatte er ihr einen Schatz mitgegeben, um den ihre ältere Schwester sie beneidete. Dagegen hatte Ellis Schulausbildung offenbar einem Hindernislauf mit zahlreichen Unterbrechungen geglichen, nachdem sich Ellis Mutter und Carlo getrennt hatten. Ihr rätselhaftes, in sich gekehrtes Wesen resultierte jedoch nicht allein aus ihrer Verunsicherung aufgrund mangelnder Schulbildung. Es war, wenn man Carlo glaubte, bereits seit den ersten Kindertagen aufgefallen. Und ihr Denken folgte auch als Erwachsene nicht den üblichen Erwartungen. Elli wartete stets mit Überraschungen auf.
Henny schob seine halb leere Teetasse von sich und stand auf. »Ich zeig dir jetzt den Hof, Sibyl, die Stallungen, die Felder. Wollen wir?«
In der nächsten Stunde führte er sie durch Kuh- und Schweineställe, zeigte er ihr Speicher und Vorratskammern für Stroh, Heu und Getreide, stellte ihr jedes einzelne Pferd auf der Koppel feierlich mit Namen vor. An dem einen oder anderen Arbeiter, der ihnen auf dem Hof begegnete, ging er hingegen vorbei, als wäre er nicht vorhanden, ja er schien ihn buchstäblich nicht wahrzunehmen.
An einem Feldrain, übersät mit Kornblumen und Klatschmohn, trafen sie auf die Kinder und Ottmar Weinzierl. An dessen Seite ein alter Hund mit zotteligem, erdbraunem Fell, Højager, der offensichtlich an einer Hüftluxation litt.
»Ich kann noch immer nicht glauben, dass das nun alles uns gehört«, sagte Henny mit schweifendem Blick über die Getreidefelder ringsum, auf denen ein leichter Wind die Ährenköpfe bog. »Der Hof, die Tiere, die Felder, der Wald, die prachtvolle Steinlandschaft. Ein Paradies.«
Er formuliert wie für sein Notizbuch, dachte Sibyl.
Und Weinzierl sagte: »Leider ziemlich unpraktisch für die Landwirtschaft, die Paradiessteine.«
Henny sah ihn ernüchtert an.
Gegen sieben, nach dem Abendbrot, rief Henny wie versprochen Elli in Verscio an. Nach einem kurzen Gruß ließ er zuerst Signe mit ihrer Mutter sprechen.
Sibyl brachte unterdessen Edvard ins Bett. Sie hatte sich zuvor mit Henny über die vorläufige Aufteilung der Zimmer geeinigt. Bis auf den Verwalter und auch Dorit und Leiv – solange das Paar bei ihnen wohnte – sollten alle anderen in den Zimmern der oberen Etage schlafen, unter dem ausgebauten Dach, wo früher einmal Vorräte gelagert hatten. Signe und Edvard würden sich ein Zimmer teilen. Das Doppelbett darin war wie die anderen Betten ein Überbleibsel der Vorbesitzer und nahm den kleinen Raum fast vollständig ein.
»Den Nachttopf stelle ich neben das Bett, siehst du, Edvard?« Das Plumpsklo befand sich hinter dem Haus, daher mussten die Kinder den Umgang mit dem ihnen völlig fremden Tontopf – für alle Fälle – erst noch lernen.
Vom Bett aus schaute Edvard einige Sekunden lang verwirrt zu der Dachluke hoch, ein tiefschwarzes Loch scheinbar.
»Wir haben Neumond, Edvard. Da sieht man ihn nicht.«
»Wieso heißt er dann neu?«, fragte er.
»Weil …«
Doch ihm fielen die Augen bereits zu.
Als sie in die untere Etage zurückkehrte, in das »Musikzimmer«, in dem auf einer kleinen Konsole aus Dorits Kopenhagener Haushalt das Telefon stand, sprach Henny leise mit Elli, und Sibyl fischte die todmüde Signe von seinem Schoß, um auch sie ins Bett zu bringen.
Signe schmiegte sich an Edvard und passte sich binnen Sekunden den ruhigen Gezeiten seiner tiefen Atemzüge an. Gleich alt, gleich groß, beide die flachsblonden Haare kurz geschnitten, sahen die Kinder nebeneinanderliegend wie Zwillinge aus.
Zurück im Musikzimmer, hatte Sibyl endlich selbst Gelegenheit, mit Elli zu sprechen. Henny ging unterdessen hinaus.
Ihre Schwester berichtete sogleich mit belegter Stimme von den Züricher Nachbarn, deren spießige Mentalität ein Zusammenleben unter einem Dach unmöglich gemacht habe. »Herrgott, ja, die Wohnung war nicht aufgeräumt. Aber wieso wird das als ungastlich empfunden, wenn man mich überraschend besuchen kommt? Sag mir das, Monna!«
Zu Ellis Eigenheiten gehörte es auch, dass sie Sibyl manchmal Monna nannte. Ihre Schwester hatte irgendwann einmal damit angefangen, ohne erkennbaren Anlass, und kam immer mal wieder auf diesen Namen zurück, den sie frei erfunden hatte.
»Und, ja, es stimmt, ich habe beim Bäcker meine Handtasche auf der Ladentheke geleert. Hab sie kopfüber gehalten, so dass alles herausfiel. Aber so geht es nun mal am schnellsten. Wer will schon am frühen Morgen auf seine Brötchen warten, nur weil eine Kundin beim Bezahlen umständlich nach den passenden Münzen fingert? Du weißt, dass meine Handtasche auch Kosmetik- und Geldbeutel für mich ist. Je nachdem.«
Sibyl hatte allerdings auch die staunenden Augen der Leute in ähnlichen Situationen, die sie miterlebt hatte, gut in Erinnerung.
»Wirst du bald zu uns kommen, Elli?«, fragte sie, um nicht weiter über das unergiebige Thema reden zu müssen. Außerdem mussten sie an die Kosten des Telefongesprächs denken. »Wir vermissen dich.«
Schweigen am anderen Ende.
»Elli?«
»Ja?«
»Du hast gehört, was ich gefragt habe?«
»Monna …«
Sibyl wiederholte ihre Frage. Ein gewohntes Ritual für sie.
»Natürlich. Sobald wie möglich werde ich kommen. Nächste Woche oder …«
Wieder vergingen lange Sekunden.
»Elli? Bist du noch da?«
»Henny sagt, ich soll über Frankreich fahren. Frankreich, Holland, dann mit dem Schiff nach Dänemark. Zu euch.«
»Ja. Jedenfalls nicht durch Deutschland.«
»Sibyl?«
»Hm?«
»Sag mir: Ist es schlimm? Auch für dich, meine ich? Es ist schlimm, nicht?«
Die Frage traf sie ins Mark. Ihre Knie begannen zu zittern, und sie sank auf den Hocker neben der Konsole.
Bis zu dieser Sekunde hatte sie die Demütigung, auf der Flucht zu sein, die Bitternis, vertrieben worden zu sein, in ihrem Kopf nicht zugelassen.