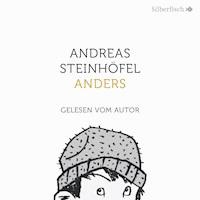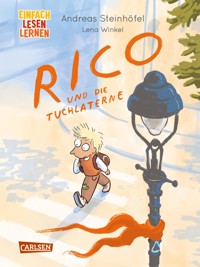6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Die zwölfjährige Lena und ihre Mutter verlieren ihre Wohnung und müssen ins heruntergekommene »Hotel Paradies« am Hafen ziehen, wo Asylbewerber und Obdachlose zusammengepfercht werden. Dort freundet sich Lena mit dem Mädchen Ajoke aus Angola an. Gemeinsam mit dem kleinen Efrem versuchen die beiden dahinterzukommen, wer für die Diebstähle verantwortlich ist, die sich in letzter Zeit im Haus ereignen. Doch die Ausmaße des Betrugs sind größer als gedacht und die Spur führt zum Besitzer und Aufseher, Herrn Schmuck …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Andreas Steinhöfel: Honigkuckuckskinder
Die zwölfjährige Lena und ihre Mutter verlieren ihre Wohnung und müssen ins heruntergekommene »Hotel Paradies« am Hafen ziehen, wo Asylbewerber und illegale Einwanderer zusammengepfercht werden. Dort freundet sich Lena mit dem Mädchen Ajoke aus Angola an. Gemeinsam mit dem kleinen Efrem versuchen die beiden dahinterzukommen, wer für die Diebstähle verantwortlich ist, die sich in letzter Zeit im Haus ereignen. Doch die Ausmaße des Betrugs sind größer als gedacht und die Spur führt zum Besitzer und Aufseher, Herrn Schmuck …
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
Das könnte dir auch gefallen
Leseprobe
1. Kapitel
Der Sozialarbeiter hieß Wichert, und er war Lena auf Anhieb sympathisch gewesen. Das Erste, was ihr an ihm aufgefallen war, als sie und ihre Mutter vor einer halben Stunde sein nüchtern eingerichtetes Amtszimmer betreten hatten, waren die unzähligen Lachfältchen, die seine blauen Augen umkränzten. Sie machten daraus zwei kleine, strahlende Sonnen.
Von ihrem Platz auf dem wenig gemütlichen Sessel in der Ecke beobachtete sie, wie Wichert etwas auf ein Stück Papier kritzelte. Wie alt mochte der Mann sein? Nicht so alt wie Mama, aber auch nicht viel jünger.
Er schob den Zettel über den Schreibtisch. »Es ist nicht gerade das, was man als erste Adresse bezeichnen würde. Aber vorläufig das Einzige, was ich Ihnen zur Verfügung stellen kann.«
Ihre Mutter würdigte das Papier keines Blickes. So wie sie sich auch seit einer halben Stunde bemühte, die Akte nicht zu bemerken, die aufgeschlagen vor Wichert lag. »Ich brauche keine Almosen.«
»Wir verteilen hier keine Almosen, Frau Behrend.« Wichert beugte sich vor und legte, wie um seinen Worten mehr Gewicht zu verleihen, die Ellbogen auf die Schreibtischplatte. »Wir sorgen lediglich dafür, dass Sie und Ihre Tochter aufgrund einer unverschuldeten Notlage nicht dazu gezwungen sind, auf der Straße zu sitzen.«
»Was doch wohl bedeutet –«
»Was bedeutet«, unterbrach Wichert, »dass wir Ihnen zu Ihrem Recht verhelfen, nicht mehr und nicht weniger.«
»Mein Recht?«, rief ihre Mutter ungehalten. »Was wissen denn Sie vom Recht? Wo war mein Recht, als ich die Schulden meines Mannes übernehmen musste, nachdem er sich aus dem Staub gemacht hat? Wo war mein Recht, als unser Vermieter uns vor die Tür gesetzt hat?«
»Ich mache die Gesetze nicht.«
»Nein, Sie führen sie nur aus! Hangeln sich von Erlass A über Paragraf B zu Absatz C, und wenn Sie dort angekommen sind, werden wir abgehakt!«
»Niemand wird abgehakt.« Wichert lehnte sich zurück. Er verschränkte die Arme, seine ganze Haltung drückte Abwehr aus. Mama hatte keine guten Karten. »Frau Behrend, Sie helfen weder sich selbst noch Ihrer Tochter weiter, indem Sie alles negativ sehen und mit dem Schicksal hadern! Sie sind nicht der erste Mensch, dem so etwas passiert.«
»Nein. Ich bin nicht der erste Mensch, der seine Würde verliert. Aber Sie«, ein Finger schoss auf Wichert zu, »sind bestimmt der Letzte, von dem ich sie mir nehmen lasse!«
»Würde hat man, oder man hat sie nicht, Frau Behrend. Ich sehe nichts Verwerfliches darin, arm zu sein. Im Gegensatz zu Ihnen. Sie graben sich mit Ihrer Haltung selbst das Wasser ab.«
Entweder, dachte Lena, sie klinkt jetzt völlig aus, oder sie hält endlich die Klappe und gibt klein bei. Warum schnappte Mama sich nicht einfach die Adresse, damit sie endlich aus diesem langweiligen Amt verschwinden konnten? Warum befolgte sie nicht einfach Wicherts Rat und versuchte, das Beste aus ihrer Lage zu machen?
Ihre Mutter schürzte die Lippen und überlegte eine Weile. Schließlich ergriff sie das Papier. »Hotel Paradies?«, sagte sie nach einem kurzen Blick darauf. »Paradies? Machen Sie Witze?«
»Keineswegs.«
»Wer wohnt da sonst noch? Noch mehr … Sozialfälle?«
»Weitere Wohnungslose, das ist richtig«, bestätigte Wichert. Er klang leicht verärgert. »Außerdem Asylbewerber. Eigentlich fast ausschließlich.«
Lena verdrehte die Augen. Das war’s. Damit war der Tag gelaufen. Sie kannte ihre Mutter. Auf Sozialfälle folgten in der Reihe aller denkbaren Schrecken nur noch Ausländer. Falls danach noch etwas Schlimmeres kam, war es mit Sicherheit nichts Menschliches. Insekten vielleicht. Kakerlaken.
»Asylanten?«, brauste ihre Mutter auf. »Sie erwarten im Ernst von mir, dass ich mit Asylanten zusammenwohne?«
Die Stimme des Sozialarbeiters dröhnte so laut, dass Lena zusammenzuckte. »Nein, das erwarte ich nicht!« Vom einen auf den anderen Moment hatten die beiden Sonnen sich verdunkelt. »Ich organisiere Ihnen auch gerne einen Platz unter einer der städtischen Brücken, falls Sie es vorziehen, dort ein Zelt aufzuschlagen!«
Ein Wunder, dass er nicht schon viel früher ausgerastet ist, dachte Lena. Seit Wichert damit begonnen hatte, ihnen ihre nicht gerade rosige Lage zu erklären, hatte ihre Mutter sich abwechselnd uneinsichtig oder beleidigt gezeigt. Dabei hatte Wichert recht, er war für ihre Lage nicht verantwortlich. Er war die ganze Zeit nett gewesen, aber Mama hatte ja nichts Besseres zu tun, als sich zu benehmen wie die letzte blöde Kuh.
Der schneidende Ton des Sozialarbeiters hatte seine Wirkung nicht verfehlt. Ihre Mutter schwieg. Ihre schlanken Hände schlossen sich um den Griff ihrer Handtasche, drückten einmal fest zu, zweimal. Schließlich sagte sie knapp: »Nun gut, dann eben dieses Hotel – vorerst!«, betonte sie. »Könnten Sie mir ein Taxi rufen?«
»Können Sie sich«, fragte Wichert langsam zurück, »ein Taxi leisten?«
»Wir nehmen den Bus«, schaltete Lena sich schnell ein. Sie erhob sich aus dem Sessel. »Der 137er fährt nach dort draußen. Und mehr als unsere zwei Koffer haben wir doch nicht.«
»Das scheint Herrn Wichert nicht weiter zu stören«, gab ihre Mutter bitter zurück. »Kommst du?«
In einer einzigen fließenden Bewegung ergriff sie den Zettel mit der Adresse, stopfte ihn achtlos in ihre Handtasche, stand auf und hatte in der nächsten Sekunde den Raum verlassen.
»Tut mir leid, das war keine gute Vorstellung«, wandte Wichert sich an Lena. Er hob die Hände in einer hilflosen Geste. »Aber deine Mutter scheint zu den Menschen zu gehören, mit denen man Klartext reden muss. Das bedeutet nicht, dass ich euch nicht wirklich bedauere.«
»Sie ist sonst nicht so«, erwiderte Lena. »Früher war sie ganz anders, aber seit Papa weg ist und das mit den Schulden rauskam …«
»Ich weiß«, sagte Wichert.
Woher will er das wissen? Sie sah zu Boden, den Blick auf die Spitzen ihrer Turnschuhe gerichtet. Woher will er das, verdammt noch mal, wissen? Die Schuhe waren kaum getragen, so gut wie neu. Teuer waren sie gewesen, Markenschuhe, das letzte Geburtstagsgeschenk von Papa. Mit teuer war nun auch Schluss.
»Tust du mir einen Gefallen, Lena?«
Sie sah auf. »Hm?«
»Kümmere dich ein bisschen um deine Mutter, okay? Gib ihr einen Tritt in den Hintern, damit sie sich demnächst ans Arbeitsamt wendet. Wird schwer genug für sie werden, ohne Berufsausbildung und in ihrem Alter einen Job zu finden.«
Lena nickte.
»Und falls du ein Problem hast, falls du Hilfe brauchen solltest – du weißt, wo du mich findest.« Er schien es ehrlich zu meinen. Die beiden blauen Sonnen waren wieder aufgegangen. »Im Übrigen schaue ich bald mal vorbei, um zu sehen, wie es euch da draußen so geht.«
Lena nickte noch einmal. Wichert schloss die schmale Akte, auf der unter einer langen Zahlenreihe in säuberlicher Druckschrift ihr Familienname stand. Eigentlich müsste man ein Drittel der Akte abreißen und wegwerfen, dachte Lena. Oder war man auch dann noch eine Familie, wenn der Vater verschwunden war? Die altbekannte Traurigkeit stieg in ihr auf wie Quecksilber in einem Fieberthermometer.
Bloß das nicht!
Entschlossen drehte sie sich um und ging auf die Tür zu. Mehr als laufen, stellte sie fest, konnte man in teuren Turnschuhen auch nicht. Unwillkürlich musste sie grinsen. Eigentlich gab es sowieso keinen Grund für Traurigkeit oder schlechte Laune. Schließlich erwartete sie irgendwo jenseits dieser Tür das Paradies.
*
Efrem war müde, und er fror. Asrat schritt kräftig neben ihm aus, er schien weder Kälte noch Müdigkeit zu spüren. Vielleicht waren es die Wut und die Angst, die ihn so schnell vorantrieben, dass Efrem auf seinen ungleich kürzeren Beinen ihm kaum folgen konnte.
»Asrat, geh langsamer!«
Sein großer Bruder sah nicht zu ihm herab, aber wenigstens verkürzte er seinen Schritt. Die dunklen Augen blieben weiter starr geradeaus gerichtet, dahin, wo der verschlungene, von Weidezäunen gesäumte Feldweg zwischen lichten Bäumen verschwand.
Die Sonne stand hoch, es musste Mittag sein, vielleicht schon früher Nachmittag. Efrem hätte nicht sagen können, wann er zuletzt geschlafen hatte. Oft hatte die Aufregung ihn wach gehalten. Dann wieder hatte er nicht zwischen Tag und Nacht unterscheiden können, weil während der meisten Zeit ihrer langen Reise Dunkelheit geherrscht hatte: im Bauch des Schiffes mit den dröhnenden, stampfenden Motoren; später dann in dem großen Lastwagen, der so beängstigend finster gewesen war, erfüllt von Hitze und dem sauren Schweißgeruch der darin zusammengepferchten Menschen. Diesen Geruch würde Efrem nie vergessen.
Keinen der Gerüche, die ihn auf seiner Reise begleitet hatten, würde er vergessen. Im Geiste sah er sie, abgefüllt in kleine, bunte Flaschen, in einem hohen Regal stehen. Man musste nur nach einer der Flaschen greifen, sie öffnen …
Hier roch es anders. Er sah sich links und rechts des Weges um. Überall wiegten sich Feldblumen im Wind. Auf den angrenzenden Wiesen lag getrocknetes, zu großen Ballen zusammengerolltes Gras. Es verströmte einen Duft, den er bis vor wenigen Stunden nicht gekannt hatte: beinahe muffig, von einer stechenden und dabei dennoch wohltuenden Süße.
»Heu«, hatte der Fahrer des Traktors gesagt, der sie die letzten Kilometer ihrer langen Reise bis zur Grenze gebracht hatte, und Heu war es gewesen, in dem sie sich versteckt hatten, hinten, auf dem Anhänger des Traktors. Ein paar trockene Halme hatten Efrems Nase gekitzelt, und er war stolz darauf, dass er nicht geniest hatte. Kein Ton! Das war die Warnung gewesen, die Asrat ihm zu Beginn der Reise eingebläut hatte. Was auch passiert, verhalte dich still, ganz still!
»River«, hatte der Mann gesagt, als er sie von dem Anhänger hatte absteigen lassen, und dabei auf den Fluss gezeigt, über dem Nebel hing wie fein gesponnene Baumwolle. Wann war das gewesen? Vor einer Stunde? Vor zwei? »You go over there. Border! Germany!« Dicke Arme hatten rudernde Bewegungen in der Luft vollführt. »You swim!«
Und so waren Efrem und Asrat in den Fluss gestiegen, waren durch das träge dahinströmende Wasser geschwommen, ihre wenigen Habseligkeiten wasserdicht verpackt in einem dunkelgrünen Seesack, den Asrat über dem Kopf balanciert hatte. Kälte hatte sich um Efrem gelegt wie ein zu enger Mantel, hatte ihn ganz durchdrungen und seinen Körper seitdem nicht mehr verlassen.
Selbst dann nicht, als das Schreckliche passiert war. Das ganz und gar Schreckliche.
»Wir können eine Weile ausruhen«, hatte Asrat gesagt, als sie auf der anderen Seite des Flusses angekommen waren und er Efrem vor sich das abfallende, steinige Ufer hinaufschob. »Und wir sollten unsere Kleidung trocknen.«
Efrem hatte sich ganz ausgezogen, im Gegensatz zu seinem Bruder. Der behielt die Unterhose an, und auch den Brustbeutel, der um seinen Hals hing, legte er nicht ab. Den hätte er niemals aus der Hand gegeben. In dem Brustbeutel befanden sich ihre Pässe. »Diese Pässe«, hatte Asrat unterwegs erklärt, »sind unsere Zukunft.«
Während Efrem sein Hemd und die kurze Hose auf den Zweigen eines Busches ausbreitete, damit sie rascher trockneten, überlegte er, wie ein Heftchen, in dem sich nicht mehr befand als ein kleines Foto, unter dem sein Name stand, die Zukunft sein konnte. Die Zukunft war morgen, und morgen war so unendlich weit entfernt; wie konnte man heute schon daran denken?
Er kam nicht dazu, seinen Bruder danach zu fragen. Ein lautes Knacken ertönte. Neben ihm erstarrte Asrat zur Salzsäule. »Efrem?«, flüsterte er. Seine Stimme war ein raues Flüstern, geraspeltes Holz.
Alles ging sehr schnell. Da tauchten zwei Gestalten aus dem Nebel auf. Groß waren sie, trugen schwere Stiefel und lange, dunkle Mäntel. Über ihre Gesichter waren Masken gezogen. Wo Augen und Mund sich befanden, waren schmale Schlitze in den schwarzen Stoff geschnitten worden. Erst als Asrat die Hände über den Kopf hob, bemerkte Efrem, dass die kräftigere der beiden Gestalten eine Pistole in der Hand hielt. Die Mündung der Waffe war direkt auf ihn und seinen Bruder gerichtet. Efrem fühlte, wie etwas in seinem Inneren zu stolpern schien. Das war sein Herzschlag.
Der Mann mit der Pistole trat vor. Er zeigte auf den ledernen Brustbeutel, der um Asrats Hals hing. »Passports«, forderte er. Es war das einzige Wort, das Efrem ihn sagen hörte.
Asrat schüttelte heftig den Kopf. Er machte einen Schritt zur Seite, um sich schützend vor Efrem zu stellen. Der große Mann setzte, unerwartet schnell, beide Hände ein: Mit der einen riss er Asrat den Brustbeutel vom Hals, mit der anderen schlug er ihm ins Gesicht. Heftig.
Ohne einen Laut von sich zu geben, senkte Asrat den Kopf. Als er ihn wieder anhob, sah Efrem, dass seine Unterlippe blutete. Und er bemerkte das Flackern ins Asrats Augen. Einmal hatte er ein aus dem Nichts entstehendes, schnell um sich greifendes Buschfeuer gesehen. Es hatte mit einem ähnlichen Flackern begonnen.
Der schmächtigere der beiden Männer machte einen Schritt nach vorn. Der mit der Pistole reichte ihm den Brustbeutel. Als der Schmächtige den Beutel in die Hosentasche steckte, klaffte sein Mantel auf. Etwas blitzte. Die Schnalle eines Ledergürtels, auf der ein seltsam verschlungenes Zeichen prangte. Zwei silberne Schlangen.
Im nächsten Augenblick waren die Gestalten wieder eins geworden mit dem Nebel. Sie nahmen nichts weiter mit als Efrems und Asrats Pässe. Ihre Zukunft.
Und während all das geschehen war, hatte Efrem sich still verhalten, ganz still. Keinen Ton hatte er von sich gegeben, obwohl sich ein Klumpen in seinem Hals gebildet hatte, von dem er wusste, dass er nur durch lautes Schluchzen zu vertreiben war. Aber Asrat hatte auch nicht geschluchzt. Der hatte wortlos ihre nasse Kleidung zusammengesucht, trockene Hemden und Hosen aus dem Seesack geholt, Efrem bedeutet, er solle sich anziehen, und war losmarschiert. Und seitdem liefen sie, liefen und liefen, und Efrem war müde.
Auf der Karte, die Asrat ihm zu Hause gezeigt hatte, war die Welt so klein gewesen. Asrat hatte ihm erklärt, wo Europa und Deutschland lag, wo Afrika war, wo Äthiopien. Efrem hatte sich die Formen der Länder so genau eingeprägt, dass er sie aus dem Gedächtnis zeichnen könnte, wenn das von ihm verlangt würde. Doch hier war alles anders als auf dieser Karte, so groß, so weit …
»Woher weißt du überhaupt, wohin wir gehen müssen?«, fragte er Asrat. Die Worte kamen nur leise heraus. Selbst seine Stimme war müde.
Asrat blieb stehen. Eine Hand versank in der Tasche seiner Jacke. Mit einem kleinen Zettel zwischen den Fingern zog er sie wieder daraus hervor. »Den haben sie uns nicht genommen«, sagte er. »Hab ich vom Traktorfahrer.«
»Was steht da drauf?«
»Es ist ein Wegplan.« Asrat beugte sich zu ihm herab. »Schau, das ist der Fluss, das unser Weg, dies hier ist die Stadt. Und hier steht, wo wir wohnen werden. Siehst du?« Er hielt Efrem den Zettel unter die Nase. An der Stelle, wo der große Fluss beinahe die Stadt berührte, war der rechte Rand des Wegplans mit einem dicken roten Kreuz markiert.
»Was ist das?«, fragte Efrem.
»Das ist ein Hotel.« Asrat faltete den Zettel zusammen und steckte ihn zurück in die Jacke. »Wir wohnen in einem Hotel.«
*
Draußen in der Eingangshalle standen die Zigeuner. Der Alte und seine Tusse bearbeiteten wie die Blöden abwechselnd das Telefon und bekamen keine freie Leitung. Schrien dabei irgendwelches Dschibdschib und schafften es trotzdem nicht, den Lärm, den ihre drei Bälger veranstalteten, zu übertönen.
Kokolores, dachte Zoni. Alles Kokolores.
Er mochte dieses Wort. Es war rund und eckig zugleich, die treffende Bezeichnung für all den Schrott und Nippes, der über Schmucks enges, düsteres Arbeitszimmer verteilt war, chaotisch wie nach einem Bombenangriff. Schmucks Lieblingsspielzeug, das einzige neue Teil in dem ganzen Gehudel, stand auf dem kleinen Ecktisch. Abgedeckt mit einem grauen Tuch, wie meistens. Und schließlich dieser verlauste Köter, der faul unter dem mit Papieren überladenen Schreibtisch zu Schmucks Füßen lag – der war auch Kokolores. Das Vieh stank. So wie alles in diesem Laden.
Hotel Paradies! Früher Warenlager, heute Menschenlager. Ein ehemaliges Hafensilo, das von Schmuck für einen Apfel und ein Ei gekauft und dann mit wenig finanziellem Aufwand umgebaut worden war. Jetzt zockte er darin die Leute ab. Verarschte alle nach Strich und Faden – die Asylantenbrut, das Sozialamt, den Staat. Paradies? Das war der kokolorigste Kokolores überhaupt.
»Was grinst du so blöd?«, blaffte Schmuck ihn an. Der Dicke versank fast auf dem niedrigen Stuhl hinter seinem Schreibtisch. Hielt sich mit seinen dicken Patschehänden an der Tischplatte fest, als wäre er kurz vorm Absaufen. »Sehe ich irgendwie witzig aus?«
»Jaaaa«, erwiderte Zoni gedehnt.
Beifallheischend wandte er den Kopf. Knister, der sich neben ihm postiert hatte, grinste zurück. Dürrer Kerl, kaum was auf den Rippen. Im Gegensatz zu Schmuck, dem fetten Schwein. Absaufen? Der nicht; no, Sir. Fett schwimmt oben, oder?
»Die Knarre und den Pass«, blaffte Schmuck. Die fleischigen Lippen formten ein empörtes kleines Loch. »Nun gib schon her das Zeug, und dann seht zu, dass ihr Land gewinnt.«
Knister hielt Schmuck die Pässe entgegen, die sie den Kaffern abgenommen hatte. Parierte immer aufs Wort, die Milchbirne. Zoni zog die Pistole aus dem Hosenbund und legte sie auf den Schreibtisch. Als der fettleibige Hotelbesitzer danach griff, zog er sie rasch wieder zurück. Immer noch grinsend. »Unser Geld«, forderte er.
Das klang cool, kinomäßig. Er sah sich selbst auf einer Leinwand, die Hauptfigur in einem Film. Trug schwarze Lederklamotten, stand mit Knister vor der fetten Qualle von Chef, die Knarre in der Hand. Ließ sich nicht einschüchtern. Schnitt, Rückblende und Großaufnahme des Schwarzen, wie er ihm in die Fresse schlug. Richtig in die Fresse, sodass die Lippe aufplatzte. Kameraschwenk auf den kraushaarigen Kleinen daneben, der die Hosen vollgeschissen hatte vor Angst. Quatsch, Hosen hatte er gar keine angehabt, nackt war er gewesen. Keinen Pieps hatte er von sich gegeben, der Zwerg. Nur die runden braunen Püppchenaugen waren aufgerissen gewesen, weit aufgerissen.
»Zwei Pässe?« Schmuck hatte eine kleine Kassette aus dem Müll gegraben, der seinen Schreibtisch bedeckte. »Warum zwei?«
»Der Kaffer hat ein Kind dabei.«
»Soll mir recht sein.« Der Dicke zog einen Hunderter daraus hervor, schob ihn Zoni zu und griff gleichzeitig nach der Pistole. »Und jetzt – verschwindet!«
Könnte mehr Knete sein, dachte Zoni. Für zwei Pässe hatte er mit zwei Hunnis gerechnet. Schmuck machte Kohle ohne Ende mit diesem Schuppen, und daneben noch mit diesem und jenem. Hätte mehr rausrücken können, der Geizhals, tat es aber nicht. So konnte er ihm und dem dürren Knister zeigen, wo der Hammer hing. Boss ist, wer das Geld hat. So einfach war das.
Irgendwann würde er selbst genug Geld haben, mehr als er ausgeben konnte. Irgendwann wäre er, Zoni, der Boss.
Er machte auf den Hacken kehrt und verließ den Raum, wohl wissend, dass Knister ihm unaufgefordert folgte. Nacheinander traten sie hinaus in die Eingangshalle, wo der Zigeuner sich auf den Tasten des Telefons immer noch die Finger wund hackte. Seine Frau und die drei Kinder tummelten sich jetzt auf den zerschlissenen Möbeln, es ging drunter und drüber. Und Florin war da, klar. Der war immer da, dieser kleine, rothaarige Rumäne; gehörte praktisch zum Inventar. Hockte in diesem abgewetzten Sessel und wartete darauf, dass er endlich bei ihm und Knister mittun durfte. Zoni nickte ihm knapp zu. Florin lächelte dankbar zurück. Demnächst in diesem Theater, Rotkopf, dachte Zoni.
Hinter ihm und Knister fiel laut die Tür zum Arbeitszimmer ins Schloss. Zwei von den Zigeunerbälgern blickten erschreckt auf. Zoni riss einen Arm hoch, ließ die Hand auf die beiden Kinder zuzischen, krümmte den Zeigefinger.
»Päng!«
Das kleinste der Kinder begann zu weinen. Zoni stapfte grinsend an der Mutter vorbei, die ihm einen bösen Blick zuwarf. Echt cool. Echt guter Abgang.
Kinomäßig.
*
Die beiden Koffer hatten Rollen, doch die waren auf dem mit Kopfstein gepflasterten, unebenen Weg, der am Kai entlangführte, eher hinderlich als nützlich. Weiter voraus beschrieb der holprige Weg eine Biegung, dahinter musste an einem Hafenbecken das Hotel liegen. Bis jetzt hatte Lena nur abbruchreife Lagerhäuser gesehen; Ladekräne, die wie stählerne Finger in den Himmel zeigten, dann ein paar abgetakelte, von der Zeit zerfressene Kutter. Jetzt kamen zwei Schiffe in Sicht, rostende alte Wannen, zwischen die sich ein Holzsteg in den Fluss schob. Aus der Ferne erklang Lachen und Kindergeschrei. Die Luft trug den aufdringlichen Geruch brackigen, abgestandenen Wassers.
Unmittelbar vor der Wegbiegung kippte polternd einer der beiden Koffer um. »Scheiße«, fluchte Lena leise. Sie bückte sich und versuchte, den schweren Koffer zurück auf seine Rollen zu wuchten.
Mama ging einfach weiter, ohne sich umzusehen, die Schritte schleppend, als befände sie sich auf dem Weg zum Schafott. Während der Fahrt mit dem Bus hatte sie schon geschwiegen, und wahrscheinlich würde sie bis zum Abend oder zum nächsten Morgen weiterschmollen. Wahrscheinlich würde sie auch wieder …
»Das darf doch nicht wahr sein«, flüsterte ihre Mutter. Sie war in der Wegbiegung stehen geblieben. »Was für ein Dreckschuppen!«
Lena ließ den Koffer liegen, lief ihr nach und trat neben sie. Und sah das Paradies.
*
Wo sie ihre Nase gegen die kühle Scheibe gedrückt hatte, war ein Abdruck zurückgeblieben, ein winziger Fleck. Ajoke trat vom Fenster zurück, von dem aus sie Ibe und Juaila beobachtet hatte, die mit ein paar anderen Kindern unten am Kai spielten. Nervig, immer ein Auge auf die jüngeren Geschwister haben zu müssen.
»Dahinten kommen zwei Neue«, sagte sie. »Eine Frau und ein blondes Mädchen. Bestimmt ihre Tochter.«
»Die werden im dritten Stock einziehen, da ist was frei geworden«, hörte sie ihre Mutter hinter sich sagen. »Schön für die beiden. Da haben sie die Duschen auf ihrer Etage. Und den Trockenraum mit den Waschmaschinen.«
Eindeutiger ging es wohl nicht! Ajoke verdrehte die Augen und sah, wie ihr blasses, durchscheinendes Spiegelbild im Fensterglas es ihr gleichtat.
»Komm schon, Ajoke, du hast es mir versprochen! Die letzte Wäsche …«
»… habe ich auch schon gemacht!« Sie drehte sich um. »Und jetzt wäre Salm dran, aber die treibt sich wieder in der Stadt herum.«
»Was soll sie hier auch tun? Sie langweilt sich.« Ihre Mutter kniete auf dem Boden. Auf dem rechten Arm hielt sie das Baby, während sie mit der linken Hand schmutzige Wäsche sortierte. »Außerdem hat sie Freunde in der Stadt. Dir täten …«
»… Freunde auch gut, ja, ja.« Ajoke zerrte zwei bunte Plastiktüten aus einem vollgestopften Regal, in dem Klamotten und Bücher, Spielzeug und allerlei Krimskrams miteinander um Platz rangen. Sie zeigte auf die beiden Wäschehaufen. »Welche soll ich mitnehmen, die bunte oder die weiße?«
»Die Kochwäsche.«
Missmutig ging Ajoke in die Knie und stopfte die weiße Wäsche in die Plastiktaschen. Ihre Mutter beugte sich zu ihr herüber und drückte ihr einen Kuss auf die Wange. Das Baby nutzte die Gelegenheit, um Ajoke ins Haar zu greifen und daran zu ziehen. Sie quietschte lachend auf. So schnell, wie ihre schlechte Laune gekommen war, so schnell war sie auch schon wieder verflogen.
Ihre Mutter stand auf. »Weißt du, was ich hier in diesem Zimmer einmal tun möchte?«
»Was?«
»Beide Arme ausbreiten, wie ein Vogel seine Flügel, und mich dann im Kreis drehen – ohne dabei irgendwo mit den Händen anzustoßen!«
»Lass es lieber, sonst fällt dir Abbebe runter«, gab Ajoke trocken zurück. Als hätte er sie verstanden, gab Abbebe ein glucksendes, zahnloses Lachen von sich. Sie stopfte die letzten Wäschestücke in eine der Taschen. »Flügel kann man sowieso nur unter freiem Himmel ausbreiten.«
Sie sah sich prüfend um. Natürlich hatte ihre Mutter recht, das Zimmer war entschieden zu klein für zwei Erwachsene und fünf Kinder. Neben dem Regal und einem wackeligen Schrank, einem ebenso wackeligen Tisch und einigen Stühlen, die zusammengenommen schon ausgereicht hätten, den Raum zu füllen, gab es auch noch die drei in Reihe aufgestellten Etagenbetten. Zwischen den Betten waren notdürftig einige grobe Wolldecken gespannt. Die Decken mochten nicht verhindern, dass man die Eltern nachts manchmal hörte, wenn sie Liebe machten. Aber immerhin verhindern sie, dachte Ajoke zufrieden, dass Papa und Mama mich dabei beobachten können, wenn ich in der Nase bohre!
Sie nahm die beiden Tragetaschen auf, ging damit erneut ans Fenster und sah hinaus. Die bunte Kinderschar, darunter Ibe und Juaila, tobte noch immer ausgelassen und lärmend über den Kai. Das blonde Mädchen und seine Mutter waren verschwunden. Ajoke schlappte zur Tür. Müsste sie nicht die Wäsche waschen, wäre sie jetzt hinunter in die Eingangshalle gelaufen, um die Neuankömmlinge näher zu betrachten. Das Paradies war voll, Neuzugänge waren selten.
Egal. Sie würde das blonde Mädchen schon noch kennenlernen. Früher oder später lernte man hier jeden kennen.
2. Kapitel
Für Florin war der mit Abstand aufregendste Ort des Hotels die Eingangshalle. Hier trafen sich alle und jeder. Hier befanden sich die Rezeption, die Ausgabestelle für Wäsche und Essen sowie das einzige Telefon für alle Bewohner des Hauses. Das war gerade belegt … wie meistens. Der Sinto, der den Apparat seit einer geschlagenen Viertelstunde bearbeitete, war endlich durchgekommen. Er kreischte aufgeregt etwas in die Leitung, um ihn herum wuselten seine Frau und die drei ebenfalls kreischenden Kinder. Das übliche Chaos.
An den Wänden der Eingangshalle hielten sich mit letzter Kraft billige, eingerissene Tapeten. Sie waren schon verschmiert und dreckig gewesen, als Florin vor zwei Jahren mit seiner Mutter hier angekommen war. Ein paar trübe Deckenleuchten verbreiteten mehr Schatten als Licht; sie brannten immer, ganz gleich, ob es draußen gerade hell oder dunkel war. Ansonsten standen nur ein paar alte Sessel herum, schäbig und abgenutzt. Einer davon, mit längst fadenscheinig gewordenem blauem Stoff bezogen, mit Gott weiß was für Flecken verdreckt, war Florins Stammplatz. In dem saß er beinahe jeden Tag, um zu beobachten, was sich im Hotel abspielte.
Eben war zum Beispiel diese verschickste Frau mit ihrer Tochter eingetrudelt, einem Mädchen mit langen, blonden Haaren. Deutsche waren die, das sah man auf hundert Meter; wahrscheinlich vom Sozialamt hierhergeschickt. Es bedurfte keines zweiten Blickes auf die Klamotten der Frau oder auf die Markenturnschuhe des Mädchens, um zu wissen, dass die beiden bisher Besseres als das Paradies gewohnt gewesen waren. Zumindest der fassungslose Blick der Frau sprach Bände.
Florin betrachtete sie aus zusammengekniffenen Augen. Deutsche waren für ihn tabu. Mit denen hatte er unangenehme Erfahrungen gemacht. Mit einem wie ihm, einem Asylbewerber aus Rumänien, wollten die nichts zu tun haben. Rothaariger Bastard, hatte ihm in der Stadt mal ein Mann nachgerufen, der an seinem Akzent erkannt hatte, dass er Ausländer war. Hey, Rattenfresser!
Das war nicht gut gewesen, gar nicht gut. Aber eines Tages würde der Rattenfresser es ihnen allen schon noch zeigen. Eines Tages würde er so sein wie Zoni. Florin grinste. Als Zoni ihm vorhin zugenickt hatte, war ihm das Herz beinahe in tausend Stücke gesprungen. Zoni war sein Idol. Der ließ sich nichts vormachen, von niemandem. Der wusste, aus welcher Ecke der Welt der Wind wehte.
Na gut, vielleicht war er in ein paar üble Geschichten verwickelt. Florin war nicht blind. Wer für Typen wie Schmuck arbeitete, war automatisch in üble Geschichten verwickelt. Schmuck war schlechte Gesellschaft. Und damit war auch Zoni schlechte Gesellschaft, aber verdammt, wem machte das schon etwas aus? Knister jedenfalls nicht, diesem wandelnden Skelett.