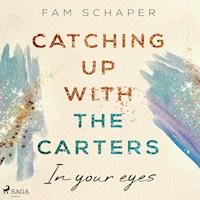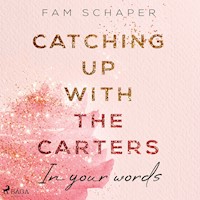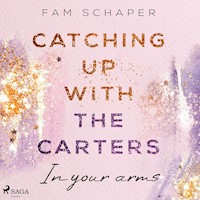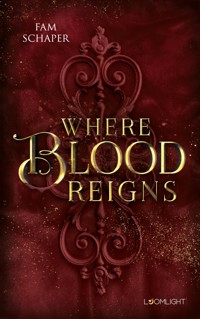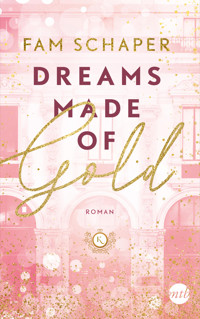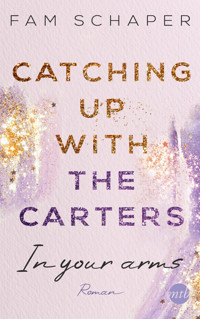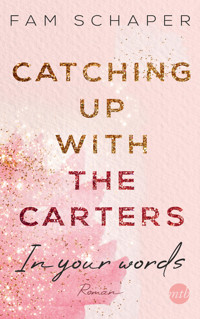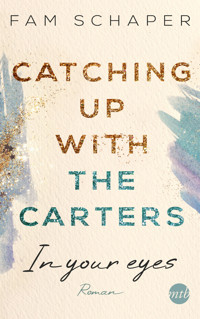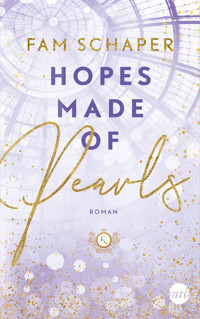
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: MIRA Taschenbuch
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Made of
- Sprache: Deutsch
Träume so kostbar wie Perlen – das große Finale der Trilogie rund um die Kronenbergers Lorena kennt das Luxuskaufhaus ihrer Familie besser als jede andere. Sie träumt davon, das Kaufhaus eines Tages zu übernehmen, doch die Tradition sieht vor, dass nur die männlichen Nachkommen das Kaufhaus weiterführen dürfen. Wenn es nach ihren Eltern geht, besteht Lorenas Aufgabe einzig und allein darin, einen reichen Ehemann finden, der gut zu den Werten der Familie passt. Lorena ist frustriert. Sie hat keine Lust, sich ihre Zukunft diktieren zu lassen und will ihrer Familie zeigen, was in ihr steckt. Dann lernt sie Milo kennen, der ihr Herz sofort höherschlagen lässt. Doch gerade jetzt kann sie es sich nicht leisten, sich auf einen Angestellten einzulassen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 489
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Originalausgabe
© 2023 by MIRA Taschenbuch in der
Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg
Coverabbildung von Kazakov / iStock, RF: FinePic®, München
Covergestaltung von zero-media.net, München
E-Book-Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN E-Book 9783745703641
www.harpercollins.de
Für Susanne.
Geht ein Buchhändler in einen Buchladen und fragt ...
Ich habe dich sehr lieb!
Playlist
If the World Was Ending – JP Saxe, Julia Michaels
IAMWOMAN – Emmy Meli
Boys Like Me – Retro Video Club
Belong – Cary Brothers
Iridescent – Zola Simone
Mona Lisa (When The World Comes Down) – The All-American Rejects
labour – Paris Paloma
Easy Tiger – Billy Raffoul
reckless driving – Lizzy McAlpine, Ben Kessler
IDKYou Yet – Alexander 23
Decimal – Novo Amor
Another Love – Tom Odell
Moral of the Story – Ashe
I Found – Amber Run
Blank You Out – Seafret
You & I – Morning Midnight
One in the Same – Jordan Mackampa
Meant To Be – Ber, Charlie Oriain
Stammbaum Kronenberger
1. Kapitel
LORENA
Silvester
Als ich ein kleines Mädchen war, habe ich den Namen Lorena Jordan umgeben von kleinen Herzchen in meine Schulbücher gemalt. Ich wollte wissen, wie mein Vorname zusammen mit seinem Nachnamen aussieht. Ich war schließlich unsterblich in ihn verliebt.
Das mache ich zwar schon lange nicht mehr, aber während ich auf diesem Dach stehe, mir den Arsch abfriere und einen direkten Blick auf Isaac Jordan habe, der Juli verliebt in die Augen sieht, fühle ich mich wieder wie das kleine Mädchen, das ich früher einmal war. Es hat mich wohl nie ganz verlassen und war ganz dicht unter der Oberfläche. Und gerade brechen all die Gefühle, die ich mir schon lange nicht mehr gestattet habe, für ihn zu fühlen, wieder aus mir heraus.
Die ersten Raketen explodieren am dunklen Nachthimmel, weil es einige Leute wohl nicht aushalten können, noch eine verdammte Minute zu warten. Es gibt Dinge, die mich irrational wütend machen. Dass das Feuerwerk jedes Jahr schon kurz vor Neujahr beginnt, gehört definitiv dazu.
Ich sollte sie nicht so anschauen, aber ich kann nicht anders. Isaacs aufrichtiges Lächeln sorgt dafür, dass meine Brust zu eng für mein Herz wird, das ihm auch zwei Jahre nach unserer Trennung immer noch gehört. Sein Gesichtsausdruck wäre wunderschön, wenn er ihn nicht gerade meiner Schwester schenken würde.
Wieso habe ich überhaupt zugesagt, Silvester in Julis WG zu verbringen? Um zwölf Uhr niemanden küssen zu können, ist eigentlich schon schlimm genug. Dann auch noch von glücklichen Pärchen umgeben zu sein, macht es auch nicht besser. Stella und Matthew sehen ekelhaft verliebt aus. Julis Mitbewohnerin Liv und ihre Freundin Ava haben den ganzen Abend nur Augen füreinander. Ihre andere Mitbewohnerin hat sich schon vor einer Weile mit ihrem Freund zurückgezogen, und ich brauche nicht besonders viel Fantasie, um mir vorzustellen, was die beiden wohl gerade machen. Jakob war der andere Single. Aber er hat die einzige richtige Entscheidung getroffen und hat sich schon vor einer Stunde verabschiedet, weil er zu einer anderen Party eingeladen war, wo bestimmt irgendjemand auf ihn wartet, mit dem er den Abend und vielleicht sogar die Nacht verbringen kann.
Ich hätte mich auch verziehen sollen. Nur meine Sturheit stand mir im Weg. Ich wollte mir beweisen, dass es mir nichts ausmacht, diesen Feiertag mit meinem Ex-Freund zu verbringen. Und wäre er nur mein Ex-Freund, könnte ich das Ganze vermutlich mit mehr Würde und weniger verletzten Gefühlen ertragen. Aber er ist eben nicht nur mein Ex-Freund. Er ist die Liebe meines Lebens. Auch wenn ich nicht seine bin.
Der Countdown beginnt. Und alle brüllen die Zahlen aus vollen Kehlen mit.
Zehn.
Neun.
Acht.
Alle strecken ihre Gläser in die Höhe.
Sieben.
Sechs.
Fünf.
Vier.
Es gibt so vieles, was ich mir gerade ansehen könnte. München bei Nacht. Das Feuerwerk. Meine anderen Freunde. Aber natürlich starre ich immer noch geradeaus.
Drei.
Zwei.
Eins.
Isaacs Lippen treffen auf Julis. Mir ist schon seit Stunden kalt, trotzdem fühlt es sich jetzt so an, als würde mir jemand auch noch einen Eimer eiskaltes Wasser über den Kopf kippen.
Ich bin hierhergekommen, um mir zu beweisen, dass ich über ihn hinweg bin. Letztendlich hat mir dieser Abend nur das Gegenteil gezeigt.
Da mich sowieso niemand beachtet, wende ich mich ab, schnappe mir eine Flasche Jägermeister von einem Tisch und klettere durch die Luke ins Treppenhaus. Ich sollte einfach gehen. Aber ich bin nicht bereit, mir eine Niederlage einzugestehen. Und noch viel weniger will ich, dass jemand erkennt, was mich in die Flucht geschlagen hat. Das könnte ich nicht ertragen.
Das Einzige, was schlimmer wäre, als Isaac Jordan immer noch zu lieben, ist die Vorstellung, er könnte es erfahren.
Die Tür zu Julis WG ist nur angelehnt, und ich schiebe mich hinein. Das hilft zwar nicht meinen angeschlagenen Nerven, aber wenigstens meinen tiefgefrorenen Gliedern. Silvester im Freien zu feiern, ist die beschissenste Idee, die jemals jemand hatte. Dass die Aussicht gut ist, kümmert mich nur wenig, wenn ich meine Zehen nicht mehr spüren kann. Aber seitdem Julis Freunde vor ein paar Monaten diese Luke entdeckt und herausgefunden haben, dass sie so aufs Dach gelangen können, feiern sie jeden erdenklichen Anlass dort oben.
Ich lasse mich aufs Sofa fallen und schnappe mir die Fernbedienung. Während ich den Jägermeister trinke, um betrunken genug zu werden, damit ich den restlichen Abend ertragen kann, werde ich meine Lieblingsserie Downton Abbey gucken und hoffen, dass ich mich dann ein bisschen besser fühle.
Gerade will ich den Fernseher einschalten, als ein wütender Ruf an meine Ohren dringt. Ich zucke zusammen und drehe mich hektisch um. Auf den ersten zornigen Schrei folgt ein zweiter. Sie dringen eindeutig aus dieser WG. Und bevor ich mir Gedanken darüber machen muss, ob hier jemand nur wenige Meter von mir entfernt ermordet wird – was mein Silvester sogar noch beschissener gemacht hätte –, höre ich auch schon, wie eine Tür aufgeht und schwere Schritte den Flur entlangkommen. Begleitet von lauten Stimmen. Doch inzwischen kann ich die gebrüllten Worte auch verstehen.
»Wieso machst du so eine große Sache daraus?«
Noch sehe ich die Schreihälse nicht, weil der Flur in dieser Wohnung mehrere Kilometer lang ist und einmal um die Ecke geht, aber ich erkenne die Stimme. Das ist Hanna, Julis andere Mitbewohnerin. Und anscheinend hat sie sich doch nicht mit ihrem Freund zurückgezogen, um zu vögeln, sondern um sich zu streiten. Sollte es mir ein Trost sein, dass ich nicht die einzige Person in diesem Haus bin, die einen schrecklichen Abend hat?
»Keine große Sache?«, gibt ihr Freund zurück. Die Schritte halten irgendwo im Flur inne. Ich kann die beiden immer noch nicht sehen. »Du hast seinen Namen gesagt. Während wir …«
Oh fuck. Also haben sie doch zuerst gevögelt und sich dann gestritten.
Ich habe den Namen von Hannas Freund vergessen, falls ich ihn jemals wusste, aber in Gedanken drücke ich ihm mein Beileid aus.
»Ich weiß nicht, was du meinst, gehört zu haben …«, setzt sie an, doch sie kommt nicht weit.
»Du hast Jakob gesagt«, ruft er.
Oh, das wird ja immer besser. Sie hat nicht nur den falschen Namen gesagt, sondern auch noch den von ihrem Mitbewohner. Ihrem sexy tätowierten Mitbewohner.
Ich hätte mich längst verziehen sollen. Doch das fällt mir erst auf, als die Schritte wieder einsetzen. Zwei Sekunden später kommen die beiden ins Wohnzimmer. Zum Glück sind sie so mit sich selbst beschäftigt, dass sie mich gar nicht entdecken. Es war eine gute Entscheidung, das Licht auszulassen. So kann ich mit den Schatten verschmelzen.
»Habe ich nicht. Und ich habe keine Lust, mich an Silvester zu streiten. Ich gehe wieder hoch zu meinen Freunden«, sagt Hanna und steuert auf den Ausgang zu.
»Das ist nicht dein Ernst«, stößt ihr Freund aus. Doch er folgt ihr nicht, als sie die WG verlässt. Er bleibt einfach mit dem Rücken zu mir im Wohnzimmer stehen.
Und auf einmal bin ich mit einem Fremden allein, dessen Namen ich kennen müsste, den ich mir aber nicht merken konnte, und habe definitiv mehr gehört, als ich sollte.
»Und ich dachte, ich hätte einen furchtbaren Abend«, sage ich, um auf mich aufmerksam zu machen.
Er fährt erschrocken zu mir herum. Nur aus dem Flur fällt Licht ins Wohnzimmer. Das reicht gerade so, um festzustellen, dass er groß und dunkelhaarig ist. Sein Gesichtsausdruck verschwindet im Schatten.
»Sorry, ich wollte dich nicht erschrecken«, füge ich hinzu. »Aber ich dachte, du solltest wissen, dass du nicht allein bist, falls du in Ruhe weinen wolltest.«
Ich hätte etwas Mitfühlenderes sagen sollen. Doch das war noch nie meine Stärke. Ich warte schon darauf, dass er mich einfach kommentarlos zurücklässt oder mit einem fiesen Spruch kontert. Zu meiner Überraschung entfährt ihm ein Lachen.
»Das ist natürlich sehr umsichtig von dir«, meint er und seufzt schwer. Er fährt sich mit beiden Händen durch die Haare. Ich glaube, er sieht mich an, aber ich bin mir nicht ganz sicher. »Du bist Julis Halbschwester, oder?«
»Schwester«, erwidere ich automatisch. Früher haben wir darauf bestanden, dass wir keine richtigen Schwestern sind. Heute sind wir über solchen Kinderkram hinaus. Ich kann Schmerz empfinden, wenn ich sie mit Isaac sehe. Gleichzeitig kann ich aber auch dankbar sein, dass wir verwandt sind. Das schließt sich nicht aus. Und ich bin froh, dass ich das irgendwann erkannt habe.
»Schwester«, wiederholt der Kerl. »Lorena«, stellt er dann fest. Es ist keine Frage.
»Richtig«, sage ich. »Und du bist nicht Jakob.«
Wieder ein äußert unsensibler Kommentar. Aber auch dieser bringt ihn zum Lachen.
»Richtig«, erwidert er. »Die meisten Leute nennen mich Milo.«
»Freut mich, dich nach zwölf während der beschissensten Silvesterparty meines Lebens kennenzulernen, Milo.« Ich halte ihm die Flasche entgegen. »Du siehst aus, als könntest du ein paar Schlucke vertragen.«
Er zögert einen Moment, dann löst er sich von der Stelle und kommt auf mich zu. Kraftlos lässt er sich neben mir aufs Sofa fallen und nimmt den Jägermeister entgegen. Er trinkt mehrere tiefe Züge und gibt ihn mir dann zurück.
»Willst du darüber reden?«, frage ich, weil das in diesem Moment wohl von mir erwartet wird.
»Eigentlich nicht«, setzt er an. Sein Blick geht in die Ferne, dann wandert er kurz zu mir herüber. »Vielleicht schon.« Er zögert wieder. »Keine Ahnung.«
Ich lächle. Eigentlich hat er mit diesen wenigen Worten gar nichts ausgesagt. Aber auf eine seltsame Weise ergeben sie für mich doch Sinn. So funktioniert auch mein Kopf, wenn es um Isaac geht. Liebe ich ihn noch? Eigentlich nicht. Vielleicht schon. Keine Ahnung.
Diese Antwort klingt verwirrend. Letztendlich versteckt sie in den meisten Fällen aber eine sehr klare Wahrheit, die man sich nur noch nicht eingestehen will.
Liebe ich ihn noch? Ja. Aber bitte verrat es niemandem.
»Du und Hanna seid schon lange zusammen«, beginne ich, falls seine verwirrten Worte auch einfach ein Ja sind, das er sich nur nicht eingestehen will.
»Wir sind nicht mehr zusammen. Nicht so richtig.«
Ich sehe ihn fragend an. Wir haben immer noch nicht das Licht eingeschaltet. Da wir schon so lange in der Dunkelheit verweilt haben, gehe ich davon aus, dass wir das auch nicht mehr nachholen werden.
»Nicht so richtig?«
»Wir sind quasi Freunde, die …«
»Sex haben.«
Er nickt, und diesmal muss ich ihm die Jägermeisterflasche gar nicht anbieten, damit er sie sich nimmt. Wenn ich mich nicht ranhalte, trinkt er sie ganz ohne mich.
Mir ist bewusst, dass es nie eine gute Idee ist, seine Sorgen in Alkohol zu ertränken. Der Gedanke an August schleicht sich immer ein, wenn ich ein Glas aus den falschen Gründen in die Hand nehme. Aber heute ist eine Ausnahme. Milo scheint das genauso zu sehen. Sobald ich ihm die Flasche zurückgebe, trinkt er beherzt weiter.
»Richtig«, sagt er verzögert.
»Ist das nicht schmerzhaft?«
»Der Sex?«, fragt er irritiert.
Mir entfährt ein Lachen. »So war die Frage nicht gemeint. Mir ist egal, welche Art von Sex ihr habt.«
Er lacht ebenfalls. Es klingt gelöst, tief und ehrlich. Es ist ein schöner Klang. Doch er verschwindet viel zu schnell wieder. »Wie war die Frage dann gemeint?«
Vermutlich gehe ich einen Schritt zu weit, und vermutlich verbessere ich seine Laune nicht, sondern tue genau das Gegenteil. Ich kann meinen Mund allerdings auch nicht halten. Die Antwort interessiert mich viel zu sehr.
»Ist es nicht schmerzhaft, nach einer Trennung mit jemandem zu schlafen, den man noch liebt?«
Ich habe keine Ahnung, ob ich Isaac wegschubsen würde, sollte er versuchen, mich zu küssen. Vielleicht würde ich es wegen Juli tun. Aber ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Und das jagt mir eine Riesenangst ein.
»Wer sagt, dass ich sie noch liebe?« Er haucht die Worte nur.
»Deine Augen und deine Stimme«, gebe ich zurück und erkenne, dass ich schon wieder Dinge sage, die mir nicht zustehen. Aber es ist nach zwölf an Silvester. Ein neues Jahr hat begonnen, in dem ich immer noch unglücklich in meinen Ex-Freund verliebt bin. Ich fühle mich furchtbar. Und vielleicht macht mich das zu einem schlechten Menschen, doch neben jemandem zu sitzen, der etwas Ähnliches fühlt, ist irgendwie tröstlich. Auch wenn ich mir eigentlich wünschen sollte, dass es ihm besser ginge als mir. Für so viel Selbstlosigkeit fehlt mir heute die Energie.
Milo schluckt schwer und umklammert die Flasche, ohne noch einmal daraus zu trinken.
»Du warst mal mit Isaac zusammen, oder?«
»Woher weißt du das?«
Er grinst mich an, und obwohl es so dunkel ist, meine ich, zu erkennen, dass eine Iris blau und eine braun ist. Irgendwie sieht die blaue trauriger aus. »Deine Augen und deine Stimme«, entgegnet er.
Ich lache leise auf. »Touché.« Ich nehme mir noch einmal die Flasche und hebe sie feierlich in die Luft. »Darauf, dass wir auch im nächsten Jahr unglücklich verliebt sein werden.«
Milo lacht, während ich trinke. Den Rest kippt er in einem Zug runter. »Gott, ich hoffe nicht.«
»Wirst du weiterhin mit ihr schlafen?«
Dass er nicht sofort antwortet, ist Antwort genug.
»Warum sollte das neue Jahr dann anders werden als das davor?«
»Hat es dir geholfen, nicht mit ihm zu schlafen?«
»Touché.« Etwas Geistreicheres fällt mir nicht ein. »Vielleicht habe ich einfach nicht mit genug anderen Männern geschlafen. Das könnte doch die Lösung sein.«
»Du meinst, man kann so viel Sex mit anderen haben, bis man sich nicht mehr daran erinnert, wie es war, Sex mit ihr zu haben?«, fragt er.
Obwohl wir eine vollkommen unsinnige Unterhaltung führen, sind unsere Stimmen sehr ernst, als würden wir über den Sinn des Lebens philosophieren. Und komischerweise fühlt es sich in diesem Moment, in dieser dunklen Wohnung, während draußen die Stadt feiert und das Feuerwerk den Himmel erstrahlen lässt, auch ein bisschen so an.
»Vielleicht«, meine ich. »Es lohnt sich auf jeden Fall, es herauszufinden.«
Das war nicht als Anmachspruch gemeint, aber ich habe mich im gleichen Atemzug zu ihm umgedreht. Und wenn man jemandem in einem dunklen Zimmer tief in die Augen sieht, während sich die Schultern berühren, klingt eigentlich alles wie ein Anmachspruch.
Milo erwidert meinen intensiven Blick. Seine Augen sind vom Alkohol glasig. Meine sehen vermutlich genauso aus. Wir rühren uns beide nicht. Wir rücken weder voneinander ab noch aufeinander zu. Trotzdem beginnt mein Herz zu rasen.
Meine Theorie war nicht als Vorschlag gemeint, dass wir sie gleich testen sollten. Doch nun betrachte ich seine kantigen Züge, die von der Seite leicht angestrahlt werden und deswegen noch schärfere Schatten werfen. Und seine verschiedenfarbigen Augen. Und seine vollen Lippen. Und auf einmal weiß ich nicht, wie ich den Satz ursprünglich gemeint hatte. Die Vorstellung, mich jetzt in seinen Armen zu verlieren, ist verlockend. Ist es nicht besser, das neue Jahr mit Sex mit einem Fremden einzuläuten anstatt mit Gedanken an den Ex-Freund?
Fuck it.
Diese zwei Wörter scheinen einmal in riesigen Buchstaben, die an Leuchtreklame erinnern, durch meinen Kopf zu laufen.
Fuck it.
Was spricht dagegen?
Vieles. Aber deswegen gebe ich mir auch keine Zeit, die ganze Liste aufzuzählen.
Ich beuge mich ihm entgegen und lege meine Lippen auf seine. Der würzige Geschmack von Jägermeister wird intensiver, obwohl er auch auf meiner eigenen Zunge liegt.
In der ersten Sekunde reagiert er nicht, und ich will schon zurückweichen und mich irgendwo verkriechen, wo man mich erst in drei Jahren wiederfinden wird.
Doch dann löst er sich von mir, stellt die Jägermeisterflasche auf dem Couchtisch ab, und bevor ich mich dafür entschuldigen kann, dass ich ihn einfach geküsst habe, zieht er mich wieder an sich.
Seine Lippen treffen verzweifelt auf meine. Ich komme ihm entgegen und genieße, dass wir alles andere als sanft sind. Er vergräbt die Hände in meinen Haaren, ich beiße ihm leicht in die Unterlippe. Es gibt kein Herantasten. Wir stürzen uns einfach ineinander. Aber das ist in Ordnung.
Der Kuss fühlt sich gut an. Er übt Druck aus, trotzdem sind seine Lippen weich. Er setzt genug Zunge ein, aber auch nicht zu viel. Ich könnte mich einfach fallen lassen und für eine Weile alles andere vergessen.
So funktioniert das allerdings nicht.
Ich kann spüren, dass er sich wünscht, jemand anderen zu küssen, während ich selbst an Isaac denke. Und sofort verlässt meine Erregung meinen Körper.
Mir ist eben nicht egal, wessen Lippen ich auf meinen spüre. Und ihm vermutlich auch nicht.
Also rutsche ich von ihm weg und lege eine Hand auf seine Brust, als er mir folgen will.
Wir unterbrechen den Kuss, und ich bin ein bisschen traurig, wenn ich daran denke, dass wir ihn nicht wieder aufnehmen werden. Ich wünschte, ich könnte meinen Kopf ausschalten und vergessen. Doch obwohl mein Körper seine Zunge, seine Lippen und seine Hände gespürt hat, spürt er doch noch viel deutlicher den Liebeskummer, der sich vor über zwei Jahren in meiner Brust eingenistet hat und seitdem nicht vertrieben werden kann.
Milo sieht mich immer noch an, und ich muss mich zwingen, seinem Blick nicht auszuweichen.
Mehrmals räuspere ich mich, bevor ich wieder sprechen kann. »Wir sollten das nicht machen.«
Sein Blick ist noch ein bisschen verhangen. Und fuck, dieser attraktive Ausdruck in seinem Gesicht reicht fast aus, um mich all die Gründe vergessen zu lassen, warum das hier eine schlechte Idee ist. Aber nur fast.
»Hanna und ich sind wirklich nicht zusammen, wenn du deswegen Bedenken hast.«
»Habe ich nicht«, antworte ich. »Also nicht nur«, setze ich dann hinzu. »Und dass du vor ungefähr einer halben Stunde noch Sex mit einer anderen Frau hattest, ist auch nicht der ausschlaggebende Grund.«
Er lacht leise auf. Unsere Berührungen waren vielleicht für andere Menschen bestimmt. Doch das Lachen, das wir einander heute Nacht entlockt haben, ist aufrichtig. Und dieses erinnert mich an die Feuerwerkskörper, die es für einen kurzen Moment schaffen, die Dunkelheit des Nachthimmels zu durchbrechen.
»Was ist dann der Grund?«, fragt er.
»Ich will niemanden küssen, der sich wünscht, er könnte jemand anderen küssen.«
Auf einmal wird er ganz ernst. Seine Züge geben keinen Hinweis darauf, dass er gerade noch gelacht hat. Er will etwas sagen, aber ich unterbreche ihn, bevor er überhaupt ein Wort ausgesprochen hat.
»Du musst das jetzt nicht abstreiten oder mir erklären, dass du mich attraktiv findest oder so. Ich weiß, dass du mich attraktiv findest. Also keine Sorge. Mein Ego ist stabil genug, um die Tatsache, dass du lieber jemand anderen küssen würdest, zu überleben.«
Er grinst. »Okay, gut. Dann muss ich mir ja keine Sorgen machen.«
»Musst du nicht«, sage ich mit Nachdruck. »Und wir müssen uns hier echt nicht belügen. Wenn man zu einem Fremden betrunken in einem unbeleuchteten Zimmer nicht ehrlich sein kann, zu wem dann?«
»Zu wem dann?«, fragt er, als würde er über diese Frage tatsächlich ernsthaft nachdenken. »Und was willst du mir Ehrliches sagen?«
»Dass ich auch lieber jemand anderen küssen würde als dich.«
Wieder grinst er. »Das ist fair.«
Und obwohl wir uns verschwörerisch angrinsen, liegt auch viel Trauer in diesem Ausdruck. Wir können so viel darüber scherzen, wie wir wollen. Das ändert auch nichts an der Tatsache, dass wir zwei Menschen sind, die unglücklich verliebt sind. Und das wird nicht weniger schmerzhaft, egal, wie gut sich ein Kuss zwischen uns auch anfühlt und wie ehrlich die Worte sind, die wir uns angetrunken trauen, miteinander zu teilen.
»Aber was spricht dann dagegen? Wenn wir beide jemand anderen küssen wollen, gleicht sich das ja quasi wieder aus.«
»Ich glaube nicht, dass das so funktioniert.«
Er nickt langsam. »Vermutlich hast du recht.«
»Ich will nicht mehr die zweite Wahl sein«, sage ich, obwohl ich diese Worte gar nicht entkommen lassen wollte. »Ich fühle mich in der Rolle schon viel zu lange viel zu wohl.«
Milo reagiert nicht sofort. Er bleibt lange still. Schließlich räuspert er sich umständlich und setzt sich noch ein bisschen gerader hin. »Ich weiß, was du meinst.«
»Dann habe ich einen guten Neujahrsvorsatz für uns.«
»Okay, schieß los«, fordert er mich auf. Das O zieht er ein bisschen in die Länge.
»Wir nehmen uns vor, dass wir uns mit der zweiten Wahl nicht länger zufriedengeben.«
Wieder zögert Milo. »Ich werde den Vorsatz vermutlich brechen.«
»Warum?«
»Weil ich noch nicht bereit bin, die nötigen Konsequenzen zu ziehen.«
»Du meinst, Hanna loszulassen.«
»Mh«, macht er nur. Es ist ein Eingeständnis, aber er ist nicht in der Lage, es mit einem richtigen Wort auszudrücken. Aber ich gebe mich auch mit gemurmelten Buchstaben zufrieden.
»Das ist auch in Ordnung. Wer hält sich schon an seine Neujahrsvorsätze?«
Sein Lächeln ist so traurig, dass ich es kaum ertragen kann, ihn länger anzusehen.
Ich will noch etwas trinken, aber die Flasche ist leer. Noch einmal seufze ich, dann stehe ich auf.
»Was hast du vor?«, fragt er.
»Ich werde gehen. Was ich schon vor Stunden hätte tun sollen.« Ich werfe ihm einen letzten Blick zu, und das Lächeln, das sich dabei auf meine Lippen legt, ist sogar aufrichtig. »Es hat mich ehrlich gefreut, dich kennenzulernen, Milo. Auch wenn ich deinen Namen morgen vermutlich wieder vergessen haben werde.«
»Es hat mich auch ehrlich gefreut.«
Ich will mich abwenden, aber noch schaffe ich es nicht. Ich verharre einen Moment und sehe ihn einfach an. »Du wirst wieder zu ihr hochgehen und so tun, als wäre nie etwas gewesen, oder?«, frage ich, obwohl ich nicht einmal weiß, warum ich die Antwort wissen will.
Ich denke schon, dass er gar nicht mehr reagieren wird, als er schließlich geschlagen nickt. »Vermutlich.«
»Mit neuen Vorsätzen startet man sowieso erst ab dem zweiten Januar. Das weiß doch jeder.«
»Das weiß doch jeder«, wiederholt er und prostet mir mit der leeren Flasche zu. »Es war mir eine Freude, Lorena Kronenberger.«
Ich erwidere nichts mehr, drehe mich um und gehe. Komischerweise muss ich weniger darüber nachdenken, was es in mir auslöst, niemals Lorena Jordan zu werden, wenn jemand meinen richtigen Nachnamen ausspricht.
2. Kapitel
MILO
Januar
»Milo!«
»Milo!«
Mehrere Stimmen rufen nach mir. Mir entfährt ein gequälter Seufzer, als ich mich umdrehe und meinen Kopf unter meinem Kissen verstecke. Trotzdem kann ich sie noch hören.
»Milo!«
»Milo!«
Mein Schädel dröhnt, und die aufgeregten Stimmen machen es nicht gerade besser. Eigentlich wollte ich so lange hier liegen bleiben wie möglich, um meiner Realität zu entfliehen. Wenigstens für ein paar Stunden. Aber während der Schlaf aus meinem Kopf weicht, kehrt der letzte Abend zu mir zurück. Ich habe viel getrunken. Der Kater kündigt sich schon jetzt erbarmungslos an. Trotzdem sind die Erinnerungen noch da. Der Alkohol konnte sie nicht verwischen. Sie sind gestochen scharf.
»Lasst euren Bruder schlafen.« Mein Vater versucht, leise vom Erdgeschoss hochzurufen. Allerdings bringt es jetzt auch nichts mehr. Ich bin wach.
Ich höre, wie sich die Schritte der anderen entfernen. Am Rhythmus kann ich erkennen, dass mein Bruder Daniel voranrennt, während meine Schwester Emma noch einen Moment vor meiner Tür zögert, bevor sie ebenfalls den Rückzug antritt. Vermutlich musste unser Vater ihr noch einmal einen kritischen Blick die Treppe hochwerfen, damit sie sich endlich in Bewegung setzt.
Ich seufze. Es hat keinen Zweck. Mit Schwung richte ich mich auf und komme auf die Beine. Sobald ich nicht mehr unter der Decke liege, ist mir eiskalt. Die Wärme hält sich einfach nicht in meinem Zimmer, und wir können es uns auch nicht leisten, noch mehr zu heizen. Meine Füße scheinen auf dem Boden festzufrieren. Schnell ziehe ich einen Hoodie über und schlüpfe in Socken. Meine Schläfe pocht, doch ich kann das Gefühl gut ignorieren. Normalerweise wird es nicht von Alkohol ausgelöst, sondern von Erschöpfung. Aber welchen Unterschied macht das schon?
Ich trete in den Flur und stoße sofort einen Fluch aus, weil ich auf irgendwas trete, das sich in meine Fußsohle bohrt.
»Man sagt nicht Scheiße!«, ruft meine kleine Klugscheißerschwester sofort nach oben.
»Ich habe Scheibenkleister gesagt«, lüge ich.
»Stimmt gar nicht.«
Als ich Emma das letzte Mal überlisten konnte, war sie vielleicht zwei Jahre alt. Seitdem ist sie schlauer als ich und lässt mich das auch jeden Tag spüren.
Ich hebe das Flugzeug aus Lego auf, das von meinem Fuß in zwei Hälften zerbrochen wurde. Dann laufe ich weiter auf die Treppe zu, die ins Erdgeschoss führt. Dabei muss ich noch weiteren Spielsachen und Legostücken ausweichen. Wenn ich nicht wüsste, wie unordentlich meine Geschwister sind, würde ich ihnen unterstellen, dass sie dieses Minenfeld extra hier aufgebaut hätten, um mich an meinem Katertag zu quälen.
Die herumliegende dreckige Wäsche hebe ich auf und werfe sie in den Wäschekorb, der immer überquillt, egal, wie oft ich die Waschmaschine auch anwerfe. Wenn ich versuche, dieses Haus aufzuräumen, fühle ich mich manchmal ein bisschen wie Sisyphos, der dazu verdammt ist, immer und immer wieder denselben Stein denselben Berg hochzurollen. Ich liebe meine Familie. Aber sie machen mein Leben nicht gerade leichter.
»Das passiert mit deinen Flugzeugen, wenn du sie vor meiner Zimmertür liegen lässt«, sage ich und drücke Daniel beide Hälften seines Flugzeugs in die Arme.
»Du hast es kaputt gemacht«, beschwert er sich grummelnd und verteilt die Legoteile auf seinem Teller, auf den unser Vater gerade Rührei geben wollte.
»Daniel, erst wird gegessen«, sagt Papa.
»Jetzt nicht. Das hier ist wichtiger.«
Noch ein paar Mal ermahnt unser Vater ihn. Aber es ist zwecklos. Wir haben Daniel an die Ideen in seinem Kopf verloren. Hat mein fünfzehnjähriger Bruder einen Plan, vergisst er alles um sich herum. Ich bin mir sicher, er würde verhungern oder verdursten, würden wir ihm nicht ab und an seine Legoteile wegnehmen und ihm einen Teller oder ein Glas direkt vor die Nase stellen. Und das funktioniert auch nicht immer.
»Hast du auch irgendwas von mir kaputt gemacht?«, fragt Emma, während ich mich neben sie an den Esstisch setze.
»Du bist zu schlau, um dein Zeug herumliegen zu lassen.«
»Stimmt.«
Ich wuschle ihr durch die kurz geschnittenen schwarzen Haare, weil ich weiß, wie sehr sie es hasst.
»Hey!«, beschwert sie sich.
»So drücke ich Zuneigung aus.«
»Gefällt mir nicht.«
»Mir egal.«
»Man könnte meinen, du wärst mein kleiner Bruder und nicht mein großer«, sagt sie auf diese besserwisserische Weise, die mich manchmal richtig nervt, aber meistens einfach zum Grinsen bringt. So auch jetzt.
»Könnte ein kleiner Bruder das?«
Bevor sie flüchten kann, packe ich sie an der Hüfte und schmeiße sie wie einen Kartoffelsack über meine Schulter. Ihr quietschender Schrei droht mir das Trommelfell im rechten Ohr zu zerfetzen.
Sie fängt an, mit ihren kleinen Fäusten gegen meinen Rücken zu hauen. »Wieso bist du so groß wie ein Baum?«, fragt sie. »Von hier oben kriegt man ja Höhenangst.« Sie versucht immer, es zu überspielen, aber sie muss jedes Mal lachen, wenn ich sie hochnehme, und sieht auch immer ein bisschen enttäuscht aus, sobald ich sie wieder auf ihre eigenen Beine stelle.
»Lass bitte deine Schwester runter, damit sie ihren Zwillingsbruder wecken kann«, sagt mein Vater mit weicher Stimme. Als meine Mutter noch gelebt hat, hat sie immer gesagt, seine Stimme erinnere sie an ein Stück Butter, das in der Sonne schmilzt. Sie hat ständig Vergleiche und Metaphern benutzt, die für mich überhaupt keinen Sinn ergeben haben. Aber ich wünschte, ich hätte eine Liste mit jeder einzelnen ihrer seltsamen Redensarten angefertigt. Dann könnte ich sie jetzt lesen, wenn ich sie vermisse, und würde beim Gedanken an sie nicht nur Trauer spüren, sondern auch Belustigung.
Ich stelle Emma wieder auf die Füße. Ihr Kopf ist ein bisschen rot angelaufen, aber sie grinst über beide Wangen. Sie hat unsere Mutter nie kennengelernt. Sie wurde nur einmal von ihr gehalten, bevor sie gestorben ist. Ich wünschte, ich wäre stark genug, um Emma zu sagen, wie viel von unserer Mutter ich jeden Tag in ihren Zügen entdecken kann. Vielleicht irgendwann.
»Emil«, brüllt Emma auf einmal los und stapft quer durch unsere Wohnküche. Das Pochen in meiner Schläfe wird für einen Moment so stark, dass ich es nicht mehr ausblenden kann.
»Brauchst du eine Aspirin?«, fragt mein Vater und fährt im Rollstuhl einmal um den Tisch herum, bis er mich erreicht hat. Dann senkt er die Stimme, obwohl Daniel ihn vermutlich nicht einmal hören würde, würde er ihm jetzt direkt ins Ohr schreien. »Wir hatten doch gesagt, dass heute dein freier Tag ist.«
Ich lächle müde. Das haben wir schon oft gesagt. Aber keiner meiner freien Tage war letztendlich wirklich frei. Immer kommt etwas dazwischen. Meine Geschwister reißen mich aus dem Schlaf. Emma braucht Hilfe bei den Hausaufgaben, und unser Papa versteht die Aufgabenstellung nicht. Daniel ist mal wieder so in seine Gedanken vertieft, dass er über seine eigenen Füße stolpert und sich wehtut. Papa kann ihn nicht tragen. Ich aber. Und solange ich das kann, werde ich niemals sagen, dass ich heute meine Ruhe brauche.
Meine Geschwister sollen nicht wissen, dass ich manchmal freie Tage von ihnen gebrauchen könnte. Sie sollen sich nie wie eine Belastung fühlen. Das ist wichtiger als mein Kopfschmerz.
»Es ist schon in Ordnung«, sage ich und meine es eigentlich auch so. Zu fünfundachtzig Prozent zumindest.
»Da bist du ja, Schlafmütze«, begrüße ich Emil, als er den Raum betritt. Emma schiebt ihn vor sich her wie einen Einkaufswagen, und er ist noch zu verschlafen, um sich darüber zu beschweren. Er reibt sich erst die Augen und dann über den Wuschelkopf, der immer ein bisschen so aussieht, als hätte eine ganze Vogelfamilie darin genistet.
»Hast du zu hart Silvester gefeiert?«, frage ich, als er sich von Emma auf einen Stuhl drücken lässt.
»Schließt du von dir auf andere?«, schießt Emma sofort zurück. Sie macht sich erbarmungslos über ihren Zwillingsbruder lustig. Andere dürfen das jedoch nicht. Sie verteidigt ihn, weil es ihr leichter fällt als ihm.
»Mir geht’s gut«, lüge ich.
»Jaja.« Sie grinst und streckt sich, um mit ihrer Hand meinen Kopf zu erreichen. Da mein Herz zu weich ist, komme ich ihr entgegen, damit sie mir jetzt durch meine Haare wuscheln kann. »Wann bist du schlafen gegangen?«
»Viel zu spät«, gebe ich zu.
»Wolltest du nicht bei Hanna schlafen?«
Auf einmal ist mein Hals zu eng, um zu schlucken.
Tatsächlich hatte ich überlegt, bei ihr zu bleiben und so zu tun, als wäre nichts gewesen. Eine Zeit lang habe ich es getan. Ich bin aufs Dach zurückgegangen und habe mit ihr und ihren Freunden zusammengesessen und geredet. An die Gespräche erinnere ich mich nicht mehr. Ich konnte mich kaum auf sie konzentrieren. Doch das konnte ich genauso gut überspielen wie meine verletzten Gefühle.
Aber als alle schlafen gegangen sind und Hanna mich in ihr Zimmer ziehen wollte, habe ich es nicht über mich gebracht, die Schwelle zu übertreten. Unser Streit war noch zu frisch. Jakobs Zimmertür war in meinem Blickfeld. Und obwohl er nicht einmal da war, habe ich seine Präsenz doch viel zu deutlich gespürt. Wie so oft. Sie hängt immer über uns, und Hanna tut noch immer so, als würde ihr das gar nicht auffallen.
Auch an den Kuss mit Lorena musste ich denken. Da Hanna und ich nicht zusammen sind, kann ich sie auch nicht betrügen. Aber ich konnte weder so tun, als hätte Hanna beim Sex nicht Jakobs Namen gesagt, noch, als wäre ich nicht bereit gewesen, eine halbe Stunde später mit einer anderen Frau zu schlafen.
Also bin ich gegangen. Und für zu wenige Stunden in einen unruhigen Schlaf gefallen, der mir keine Erholung oder klarere Gedanken beschert hat.
»Die WG war ein bisschen voll«, sage ich verzögert. »Juli und Isaac sind aus Berlin zu Besuch.«
Meine Familie muss ja nicht wissen, dass Isaacs Familie so reich ist, dass er seine Wohnung in München nach seinem Umzug nicht aufgeben musste. Oder dass schon oft so viele Leute in der WG übernachtet haben und das nie ein Problem war. Ava ist eingezogen, seitdem Juli in Berlin ist. Aber sie schläft sowieso die meisten Nächte in Livs Zimmer, also gibt es immer genug Betten.
»Du hättest Hanna mit hierherbringen können«, beharrt Emma. »Ich mag Hanna.«
Das ist eine Untertreibung. Sie liebt Hanna. Ich kann es verstehen. Ich liebe sie schließlich auch. Obwohl sich die Momente, in denen ich mir wünsche, ich würde es nicht tun, immer mehr häufen.
»Wie wäre es, wenn du ein bisschen was isst, statt deinen großen Bruder zu verhören?«, schlägt unser Vater versöhnlich vor.
»Das macht weniger Spaß.«
»Das sagst du nur, weil du das Rührei noch nicht probiert hast.«
Weil Emma so reif wirkt, vergesse ich manchmal, dass sie erst zwölf Jahre alt ist. Bis sie wie jetzt schmollt. Dann sieht man ihr ihr Alter sehr deutlich an.
Sie streckt unserem Vater ihren Teller entgegen. Sie sagt es nicht, aber sie liebt sein Rührei.
Irgendwann legt auch Daniel sein repariertes Flugzeug zur Seite und langt zu. Emma gießt Emil Orangensaft ein, schneidet ein Brötchen auf und gibt ihm die obere Seite und nimmt sich die untere.
Ich beobachte diese kleinen Rituale, die meine Familie zu dem machen, was sie ist. Jeder Handgriff bedeutet etwas, egal, wie nebensächlich er auch erscheinen mag.
Emma sagt nicht oft, dass sie uns lieb hat, aber sie zeigt es Emil, indem sie auf ihn achtet. Und mit dem kleinen versöhnlichen Grinsen, das sie mir zuwirft, wenn ich in ihre Richtung schaue. Daniel erzählt unserem Vater bis ins kleinste Detail, was er in seiner letzten Chemiestunde gelernt hat, und Papa hört aufmerksam zu und tut so, als würde er es verstehen, weil er weiß, wie viel Freude es Daniel macht, über die Dinge zu reden, die ihn begeistern. Emil sagt um diese Uhrzeit noch kaum ein Wort, aber mit jedem Bissen, den er isst, sitzt er gerader auf seinem Stuhl, bis er schließlich den ersten vollständigen Satz des Tages herausbringt.
Ich behalte sie alle im Blick. Als wären sie sicher vor der Welt vor unserer Haustür, solange ich sie nicht aus den Augen lasse. Vielleicht ist es auch so. Schlimme Dinge sind immer nur passiert, wenn ich nicht hingesehen habe.
»Freust du dich auf deinen neuen Job?«, fragt mich Emma irgendwann.
»Klar«, sage ich, obwohl ich nicht weiß, ob es stimmt. Ich habe in den letzten Jahren so viele erste Tage bei einer neuen Arbeitsstelle hinter mich gebracht, dass ich gar nicht mehr so richtig aufgeregt bin. Das Prozedere ist immer gleich, egal, wo man ist. Aber ganz ruhig bin ich auch nicht. Da ist immer diese Anspannung in meinen Muskeln. Die Vorahnung, dass ich diese Arbeit auf die gleiche Weise verlieren werde wie all die Stellen davor und dass ich diesem Kreislauf niemals entkommen werde.
»Es war wirklich lieb von Juli, dir diesen Job zu verschaffen«, meint mein Vater. »Sie ist sehr hilfsbereit. Sie kommt definitiv nach ihrer Mutter.«
Ich lächle traurig. Juli und ich verstehen den Schmerz des anderen, weil wir beide unsere Mutter verloren haben. Ich wünschte, wir hätten etwas Schöneres gemeinsam.
»Ja, das war es«, ist alles, was mir einfällt zu sagen.
»Im Kaufhaus Kronenberger zu arbeiten, macht bestimmt Spaß«, überlegt Emma laut. »Ich bin gern dort.«
Ich nicke nur langsam, weil ich keine Ahnung habe, welche Emotionen ich mit diesem großen Gebäude verbinde. Noch gar keine. Und ich hoffe sehr, dass es auch so bleiben wird.
3. Kapitel
LORENA
Einatmen. Ausatmen. Fühle die Atemzüge. Fühle die …
Ich öffne ein Auge, um auf der Uhr nachzusehen, wie lange ich noch bewegungslos hier sitzen und einfach nur atmen soll.
Es sind nur drei Minuten verstrichen, seit ich das letzte Mal geguckt habe. Mit einem Seufzen schließe ich meine Augen wieder.
Andere Leute schwärmen immer vom Meditieren. Inzwischen bin ich davon überzeugt, dass sie mich alle angelogen haben. Bewegungslos herumzusitzen, während in meinem Kopf die Gedanken wild übereinander springen, ist eine Qual.
Ich stehe früh auf, ich trinke grüne Smoothies, mache Yoga und Atemübungen. Aber alles, was diese Lifestyle-Videos mit rosigen Filtern versprechen, stimmt nicht. Ich bin nicht ausgeglichen, während ich meiner nervigen Morgenroutine nachgehe, und meine Mitte habe ich sicherlich auch nicht gefunden. Sie will eben nicht gefunden werden, und auch von Yoga und gesundem Essen lässt sie sich nicht bestechen.
Eine Kommilitonin hat mir mehrere Lifestyle-Influencer empfohlen, an denen ich mir ein Beispiel nehmen sollte, damit ich mich nicht mehr über Kleinigkeiten aufrege. Aber wenn ich ehrlich bin, gibt es kaum etwas, was ich lieber tue. Wenn ich im Stau nicht rumfluchen soll, fehlen mir auf einmal dreißig Prozent meiner Lebensfreude.
Ich will nicht immer ruhig durchatmen. Laut rumzuschreien, macht so viel mehr Spaß.
Obwohl die Übung noch nicht vorbei ist, öffne ich die Augen wieder, erhebe mich von meiner Yogamatte und mache mich auf den Weg ins Bad. Stellas Zimmertür ist natürlich noch verschlossen. Sie hat ihr Studium wieder aufgenommen und ist sichergegangen, dass keine ihrer Vorlesungen vor zehn Uhr beginnt. Ich mochte alle Veranstaltungen, die um acht angefangen haben. Da saßen weniger Menschen herum, die mir auf die Nerven gehen konnten.
Ich mache als Erstes die Filterkaffeemaschine an, damit sie durchgelaufen ist, sobald ich mit duschen fertig bin. Auf der Küchenanrichte stehen ein frischer Blumenstrauß und ein Kärtchen.
»Du rockst das heute!«, hat Stella in ihrer krakeligen Schrift darauf geschrieben und bringt mich damit zum Lächeln. Ihre aufmunternden Worte haben definitiv mehr Wirkung als eine Meditationseinheit.
Das Kärtchen stelle ich zurück und gehe ins Bad. Ich mache mich sehr bewusst fertig, weil mir ein wichtiger Tag bevorsteht. Einer, auf den ich mich wochenlang vorbereitet habe.
Ich gehe alle Punkte meiner PowerPoint-Präsentation, die ich Stella so oft gehalten habe, dass auch sie sie inzwischen wohl auswendig kann, noch mal im Kopf durch, während ich mir die Zähne putze. Würde ich jemandem erzählen, dass ich so aufgeregt bin, weil ich in wenigen Stunden meinem Vater und meinem Onkel einen Vortrag halten werde, würden sie mich vermutlich nicht verstehen. Sie sind schließlich meine Familie. Doch das macht meinen ganzen Plan nur noch heikler. Von diesem Tag hängt einfach zu viel ab.
»Übertreib nicht«, ermahne ich mein Spiegelbild. Doch natürlich hilft das nicht, um meinen Puls zu beruhigen.
Heute geht es ja nur um meine ganze Zukunft.
Mein Outfit habe ich mir gestern schon rausgesucht und in die Innenseite meines Schrankes gehängt. Eine schicke und doch feminin geschnittene Hose und eine eng anliegende Bluse. Ich sehe weder zu weiblich noch zu männlich aus. Das scheint mir die beste Strategie zu sein. Ich will sie schließlich nicht daran erinnern, dass ich diesen Vortrag niemals halten müsste, wenn ich mit einem Penis zur Welt gekommen wäre.
Mein Vater und mein Onkel, die Eigentümer und Geschäftsführer des Kaufhaus Kronenberger, wissen noch nicht, was sie heute erwarten wird. Sie haben sich die Zeit auch nur unfreiwillig für mich frei gehalten, und wäre Papas Assistent nicht ein bisschen in mich verknallt und hätte Richards Assistentin keine Angst vor mir, hätten sie sich bestimmt einen wichtigeren Termin eintragen lassen und meinen bis auf unbestimmte Zeit verschoben. Doch Tobi und Annabell haben mich nicht enttäuscht und sind sichergegangen, dass nichts dazwischenkommt.
Ein Teil von mir wartet immer noch darauf, dass irgendwas meinen Plan vereiteln wird, bevor ich ihn überhaupt angehen konnte. Und ein Teil von mir wäre darüber vielleicht sogar erleichtert. Aber auf diesen Teil höre ich nicht.
Ich trinke eine große Tasse Kaffee. Mein Jackett schließe ich währenddessen. Denn ein Kaffeefleck auf meiner weißen Bluse ist nicht das, woran ich scheitern werde. Nicht heute.
Mein Hals wird eng, als ich an meinen Cousin August denke. Er hat an mich geglaubt. Er wollte mir helfen, unsere Väter davon zu überzeugen, dass ich geeignet bin, Geschäftsführerin des Kaufhauses zu sein, obwohl seit Jahrzehnten nur die Söhne ins Unternehmen einsteigen. Er hat mich ermutigt. Er wusste, was ich kann, selbst wenn ich an meinen eigenen Fähigkeiten gezweifelt habe.
Aber er ist nicht mehr hier, um mir zu helfen. Und Stella hat recht. Ich bin für den Job geeignet, und ich werde es unserer Familie auch ohne Augusts Hilfe beweisen.
Noch einmal checke ich im runden Spiegel im Flur, der über einer Kommode aus fuchsbraunem Holz hängt, dass alles sitzt. Kein Lippenstift auf den Zähnen, kein Fleck auf der Bluse. Nichts verrutscht. Nichts ist am falschen Platz. Ich gestatte mir noch ein Seufzen – nur eins –, dann verlasse ich die Wohnung und mache mich auf den Weg ins Kaufhaus.
Meine Hände sind schweißnass, aber ich ignoriere es, als würde es dann von allein weggehen. Wenn ich mir nur vehement genug einrede, dass ich nicht aufgeregt bin, bin ich es vielleicht auch nicht mehr. Hoffentlich.
Ich fahre ins Parkhaus des Kaufhauses. Doch anstatt direkt zu den Büros zu gehen, betrete ich das Erdgeschoss. Es hat gerade erst geöffnet, noch sind nicht viele Kunden hier. Komischerweise mag ich es, wenn es so voll ist, dass einem immer mehrere Leute gleichzeitig im Weg stehen. Das bedeutet, dass auch andere Menschen diesen Ort lieben. Vermutlich nicht so sehr wie ich. Aber ich mag es, sie dabei zu beobachten, wie sie etwas finden, das ihnen besonders gut gefällt. Manchmal verbringe ich Stunden damit, sie alle zu beobachten. Kinder, die ihre Eltern anbetteln, dieses bestimmte Spielzeug zu kaufen. Pärchen, die gemeinsam schlendern. Ältere Herrschaften, die ich hier schon sehr oft gesehen habe und die immer wieder das Gleiche zu suchen scheinen.
Ich kann mich in den Vitrinen spiegeln, in denen Lippenstifte und teure Lidschattenpaletten liegen. Es ist erstaunlich, wie viel selbstbewusster ich wirke, als ich mich wirklich fühle. Zwischen dem, was ich andere wahrnehmen lasse, und dem, was wirklich da ist, liegen Welten. Das ist aber gut so.
Ich fahre sehr bewusst die Rolltreppe hoch. Ich sehe mich so genau um, als wollte ich mir jedes noch so kleine Detail einprägen. Dabei kenne ich die meisten ohnehin schon. Trotzdem zelebriere ich diesen Moment. Sollte mein Plan aufgehen, werde ich das Kaufhaus dann anders wahrnehmen? Wenn ich endlich ein Teil davon sein darf …
Ich kann es nicht länger hinauszögern, also mache ich mich mit bestimmten Schritten auf den Weg in den Bürokomplex. Sobald ich durch die Tür trete und sie hinter mir zufällt, verschwinden die Geräusche, die das Kaufhaus ausmachen. Die Stimmen der Menschen und die leise Musik verbinden sich zu einem Ton, der mich an ein Summen wie in einem Bienenstock erinnert. Ich liebe diesen Klang genauso wie alles andere hier.
Auch der Geruch ist besonders und verfliegt in diesen sterilen Gängen. Meine Schuhe klacken laut auf dem Boden. Aber sie geben wenigstens einen Rhythmus vor, an dem sich mein aufgeregtes Herz orientieren kann.
Ich erreiche den Präsentationsraum gegenüber von den Büros der Geschäftsführer. Als ich ihn betrete, finde ich schon den Assistenten meines Vaters vor.
»Das hättest du doch nicht tun müssen, Tobi«, sage ich, als ich sehe, dass er den Beamer anschmeißt, damit ich weniger vorbereiten muss.
»Ich mache das gern«, entgegnet er auf eine Weise, die mich daran glauben lässt, dass er es wirklich tut. »Ich bin mir sicher, dass du es toll machen wirst.«
Als er angefangen hat, hier zu arbeiten, hat er mich immer Frau Kronenberger genannt. Ich musste ihm bestimmt hundert Mal sagen, dass er mich duzen kann, bis er es endlich getan hat.
»Du weißt doch gar nicht, was ich vorhabe«, erwidere ich.
»Das muss ich gar nicht wissen, um davon überzeugt zu sein, dass du das richtig gut machen wirst.«
Tobi ist ungefähr so alt wie ich, aber er kam mir schon immer jünger vor. Ich glaube, es liegt an den leicht eingezogenen Schultern und dem unsicheren Gang.
Mein Herz wird ein bisschen weich, während er mich mit gutgläubigen Augen ansieht.
»Danke dir. Das bedeutet mir was.« Und das tut es. Nicht viele Menschen haben diesen Satz zu mir gesagt. Ich versuche, mich an sie zu erinnern. Stella hat mir versichert, dass sie an mich glaubt. Und es war schön, es zu hören und heute auch noch mal auf ihrer Karte zu lesen. Aber eigentlich wünsche ich mir diese Anerkennung von meinen Eltern. Darauf kann ich aber lange warten.
Ich schlucke die Bitterkeit wieder runter, die in mir aufsteigen wollte, und hoffe, dass sie von meiner Magensäure zersetzt wird, bis nichts mehr von ihr übrig ist. Für solche Gefühle habe ich keine Zeit.
»Den Rest schaffst du, oder?«, fragt mich Tobi. »Dann würde ich dich allein lassen, damit du dich noch sammeln kannst.«
Ich würde ihn gern umarmen. Tue ich aber natürlich nicht.
»Danke«, sage ich noch mal mit mehr Nachdruck. Er nickt mir nur verlegen zu, dann verlässt er den Raum. Ich stecke meinen Laptop an und gehe sicher, dass meine Präsentation gut an die Wand geworfen wird. Dann hole ich meine Karteikarten hervor, die ich eigentlich gar nicht brauche, weil ich den gesamten Inhalt auch im Schlaf aufsagen könnte.
Dann warte ich.
Und warte.
Und warte.
Es vergehen vermutlich nur wenige Minuten, aber es kommt mir vor, als wären es Stunden.
Schließlich öffnet sich die Tür, und sie betreten den Raum.
»Richard«, begrüße ich meinen Onkel, meinen Vater bedenke ich nur mit einem kleinen Nicken. Seit herauskam, dass er meine Mutter betrogen hat, spüre ich eine Distanz zu ihm, die ich auch ihn spüren lassen will. Sollte ihm das auffallen, lässt er es sich nicht anmerken. Es gibt wohl nichts, was meine Familie so gut beherrscht, wie die Dinge zu ignorieren, die sie nicht sehen will.
»Warum hast du diesen Termin ausgemacht, Lorena?« Richard kommt direkt auf den Punkt. Aber das weiß ich sogar zu schätzen. Um den heißen Brei herumzureden, liegt mir überhaupt nicht.
»Ich habe eine Präsentation vorbereitet. Es geht um die finanzielle Lage des Kaufhauses und wie man sie optimieren könnte.«
Beide setzen sich ans andere Ende des langen Tisches, der fast den ganzen Raum einnimmt. Richard zieht leicht die Augenbrauen nach oben. »Ist das Teil deiner Masterarbeit?«
»Nein«, sage ich. »Die habe ich schon fertiggestellt. Das hat nichts mit meinem Studium zu tun.«
»Du hast deine Masterarbeit schon fertig?«, fragt mein Vater verwirrt. »Das Semester geht doch noch bis April.«
»Ich war eben früher fertig.« Meine Stimme kratzt nur sehr knapp an der Grenze zur Unfreundlichkeit vorbei. Ich muss meine negativen Gefühle meinem Vater gegenüber für die nächste Stunde vergessen. Ich will schließlich etwas von ihm. Dann darf ich ihn nicht anzicken. Egal, wie groß die Versuchung jedes Mal ist, wenn ich ihn sehe.
»Das kennen wir ja von dir«, sagt Richard und lächelt gönnerhaft. Ich bin mir nicht sicher, ob er das überhaupt merkt. Aber seine Ausstrahlung lässt mich damit rechnen, dass er im nächsten Moment zu mir kommt, um mir den Kopf zu tätscheln, als wäre ich ein kleines Mädchen, das seine Mathehausaufgaben richtig gelöst hat.
»Danke«, kriege ich hervor. »Diese Präsentation hat nichts mit meinem Studium zu tun«, wiederhole ich, um sicherzugehen, dass es wirklich angekommen ist. »Ich habe sie vorbereitet, weil ich das Kaufhaus liebe und meinen Teil beitragen will.«
Mein Vater und sein Bruder sahen sich als junge Männer sehr ähnlich. Ich habe Fotos gesehen, wo ich sie nicht auseinanderhalten konnte. Die Ähnlichkeit hat sich aber in den Jahren verloren. Als wären die beiden anders gealtert. Vielleicht liegt das an unterschiedlichen Sorgen. Verbissenheit scheint andere Falten im Gesicht zu hinterlassen als eine unglückliche Ehe.
Richard zieht seine Augenbrauen zusammen, als wüsste er nicht, was er von mir halten soll.
»Das ist sehr umsichtig von dir«, sagt mein Vater in diesem versöhnlichen Tonfall, den er seit Julis Erscheinen immer anschlägt. »Dann zeig mal.«
Ich räuspere mich noch mal, dann lege ich los.
Sobald ich über Zahlen reden kann, werden meine Schultern weniger steif. Mit jedem Wort werde ich lockerer, und irgendwann komme ich mir auch selbstsicherer vor. Denn eigentlich weiß ich sehr genau, wovon ich rede. Ich bin eine der Jahrgangsbesten in meinem Studium. Ich bin ehrgeizig und fleißig. Und ich habe eine gute Präsentation vorbereitet, die ich nicht verstecken muss.
Die Zeit vergeht schnell, und schließlich komme ich zu meinem Fazit. »Die Kulinarikabteilung ist wichtig für das Prestige des Kaufhauses. Daher kommt ihr Wert. Aber sie wirft am wenigsten Jahresumsatz ab. Mit Abstand. Mit den Änderungen, die ich euch präsentiert habe, ließe sich dies jedoch verbessern, damit ihre Funktion über das Image hinausgeht.«
Sobald meine letzten Worte verklungen sind, ist es für einen Moment unerträglich still in diesem Raum. Ich mustere meinen Onkel und meinen Vater und merke, wie meine Selbstsicherheit mich schon wieder allein zu lassen droht. Ich kann ihren Gesichtsausdruck nicht deuten.
»Deine Punkte sind alle valide«, setzt Richard schließlich an. »Und du hast sie gut vorgetragen.« Er macht eine kurze Kunstpause. »Aber ich verstehe immer noch nicht ganz, warum du diese Präsentation gehalten hast.«
Der Zeitpunkt, auf den ich schon seit Monaten hinfiebere, ist gekommen. Ich habe mir sehr bewusst überlegt, wie ich auf mein Anliegen hinleiten will. Erst musste ich ihnen zeigen, was ich kann. Jetzt kann ich meinen größten Traum aussprechen. Doch ich habe Angst vor dem, was passiert, wenn ich ihn in die Wirklichkeit entlassen habe. Mit Stella darüber zu reden, hat ihn nicht real gemacht. Aber ihn hier einzufordern, wird das ändern.
Ich atme tief durch. »Ich will Teil des Kaufhauses sein«, beginne ich mit fester Stimme, die mich fast glauben lässt, dass ich gerade nicht kurz davor bin, aus der Haut zu fahren. »Ich weiß, dass es Tradition ist, dass nur die Söhne erben.«
»Es erben nicht nur die Söhne«, unterbricht Richard mich und reißt mich aus meiner vorbereiteten Rede. »Jedes Kind erbt den gleichen Teil.«
»Die Frauen erben Geld. Die Söhne das Kaufhaus«, erwidere ich.
»Auch nur zwei Söhne pro Generation.«
Meine Hände schwitzen wieder, und obwohl ich versuche, sie zu ignorieren, fühlt es sich so an, als würde die Flüssigkeit gleich von meiner Haut perlen und auf den Fußboden tropfen.
»Das ist mir bewusst«, sage ich betont ruhig. »Worauf ich hinauswill, ist, dass Töchter nicht das Kaufhaus erben und nicht Geschäftsführerinnen werden können. Aber diese Tradition stammt aus den Fünfzigerjahren. Vielleicht sollten im 21. Jahrhundert andere Regeln gelten.« Das vielleicht gehört da nicht hin. Als ich diese Rede vorbereitet habe, stand es nicht auf meinen Notizzetteln. Doch unter den kritischen Blicken dieser beiden Männer zerfällt mein Glaube, dass ich es verdient habe, Teil des Unternehmens zu sein. Ich fühle mich wie eine undankbare Göre. Ich werde eines Tages mehrere Millionen Euro erben. Reicht mir das nicht?
Ich zwinge mich, mit meinen panischen Gedanken zu meinem Ziel zurückzukommen. Meditieren und Atemübungen können mich nicht zentrieren. Aber mein Traum kann es.
Ich will nicht die Geldauszahlung als Entschädigung dafür, dass ich keinen Anteil am Kaufhaus erhalte. Ich will das Kaufhaus. Und weil wir nicht mehr in den Fünfzigern leben, kann ich es auch einfordern.
»Diese Traditionen halten unsere Familie schon seit Jahrzehnten aufrecht.« Richards Stimme ist streng. Aber ich werde nicht zurückweichen. Ich bin schon zu weit gekommen, um jetzt noch umzudrehen.
»Ja, das tun sie. Aber denkt ihr wirklich, dass das Geschlecht eines Menschen etwas über seine Fähigkeiten aussagt?«
Vermutlich würden sie gern mit Ja antworten. Aber auch diesen beiden Männern ist klar, dass man das heutzutage nicht mehr so direkt zugeben darf.
»Natürlich nicht«, setzt Richard an.
Diesmal lasse ich ihn nicht aussprechen. »Also was spricht dagegen, dass auch Töchter das Kaufhaus übernehmen?«
Er hat bestimmt eine lange Liste im Kopf, die er bereit ist, jetzt vor mir auszubreiten. Doch mein Vater lässt ihn nicht zu Wort kommen.
»Was genau möchtest du, Lorena?«
Ich atme tief durch, bevor ich antworte, denn ich werde mir diesen Moment weder von meinem wild klopfenden Herzen noch von meinen verschwitzten Händen kaputtmachen lassen.
»Ich liebe das Kaufhaus. Das war schon immer so. Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert, um es noch besser verstehen zu können. Ich bin Jahrgangsbeste. Ich verstehe Zahlen, und ich verstehe dieses Kaufhaus. Ich bin qualifiziert, und ich bin passioniert. Und vor allem bin ich eine Kronenberger. Also möchte ich Geschäftsführerin des Kaufhauses werden.«
In der Stille, die auf meine Worte folgt, könnte man eine Stecknadel auf den Boden fallen hören.
Ich schwöre, wenn jetzt einer der beiden lacht, kann ich für nichts mehr garantieren, geht es mir durch den Kopf. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass sie mich gleich auslachen, ist nicht so niedrig, wie ich mir wünschen würde.
Sie tun mir den Gefallen, mich dann doch wenigstens ein bisschen ernst zu nehmen. Aber noch lange nicht so ernst, wie ich es eigentlich verdient hätte.
»Lorena, deine Präsentation war passabel«, setzt Richard an. Sie war mehr als passabel, das wissen wir beide. Aber er will mich kleinmachen. Und leider gelingt es ihm auch. »Aber nicht gut genug, um unsere Traditionen einfach über den Haufen zu werfen.«
Ich antworte schnell, bevor ich so klein bin, dass ich nicht mehr sprechen kann. »Damit habe ich auch nicht gerechnet.«
Richard zieht die Augenbrauen noch enger zusammen. »Womit hast du dann gerechnet?«
»Mit einer gerechten Chance.«
»Für was?«
»Mich zu beweisen.«
Er setzt an, vermutlich um wieder etwas zu sagen, was mich unbedeutend fühlen lässt. Doch diesmal lasse ich ihn nicht zu Wort kommen.
»Wir sind ja der gleichen Meinung, dass das Geschlecht nichts darüber aussagt, wie fähig ein Mensch ist. Das bedeutet, dass es eigentlich keine Rolle spielen sollte, ob ein Mann oder eine Frau die Geschäftsführung übernimmt. Es geht um die Fähigkeiten. Also lasst mich diese Fähigkeiten beweisen. Wenn ich meine Arbeit gut mache, werde ich Geschäftsführerin. Wenn nicht, dann eben nicht.«
Richard und mein Vater wechseln einen Blick.
»Und wie willst du deine Fähigkeiten unter Beweis stellen?«, fragt mein Vater, dessen Tonfall ein bisschen weniger herablassend ist als der seines Bruders.
»Gebt mir Verantwortung. Übertragt mir die Führung einer Abteilung.«
Die beiden wechseln wieder einen Blick.
»Würdest du kurz vor der Tür warten? Wir müssen uns besprechen«, sagt Richard.
Ich nicke nur und trete auf den Flur. Ich laufe nervös auf und ab und fühle mich schon wieder wie ein kleines Kind, das auf seine Standpauke wartet. Dabei habe ich gar nichts falsch gemacht. Außer vielleicht die rigiden Geschlechterrollen, die in dieser Familie gelten, infrage zu stellen.
Sie lassen mich eine Weile warten, aber ich gucke nicht auf die Uhr, damit es mir nicht noch länger vorkommen kann.
Schließlich rufen sie mich zurück, und ich stelle mich mit verschränkten Händen vor die Leinwand, auf der immer noch die letzte Seite meiner Präsentation zu sehen ist.
»Wir haben eine Entscheidung getroffen«, sagt mein Vater.
»Wir werden dir Verantwortung übertragen.« Richard klingt nicht begeistert. »Du wirst die Kulinarikabteilung übernehmen und versuchen, sie lukrativer zu machen. In einem Jahr werden wir über die Ergebnisse reden.«
»In einem Jahr?«, entfährt es mir.
»Ist dir das zu lang?« Ich bin mir sicher, dass Richard darauf hofft, dass ich Ja sage. Aber ich bin auch eine Kronenberger. Wir kommen als Sturköpfe auf die Welt.
»Natürlich nicht«, sage ich, obwohl ich gehofft hatte, dass sie mich nicht so lange auf die Probe stellen würden. »Ich werde das Jahr gut nutzen.«
Richard nickt knapp. »In einem Jahr besprechen wir das, was du erreicht hast.« Er steht auf. »Der nächste Termin wartet auf uns.«
Er verlässt den Raum, bevor ich noch etwas sagen kann. Mein Vater verweilt einen Moment.
»Die Präsentation war beeindruckend, Lorena«, sagt er. Doch ich fühle mich nicht besser. Das Lob fühlt sich leer an. Seit diese Distanz zwischen uns ist, durch die immer ein kühler Luftzug zu wehen scheint, versucht er, mich zu beschwichtigen. Liebe Worte wirken falsch, wenn man die Agenda hinter ihnen durchleuchten sieht. »Ich bin davon überzeugt, dass du deine Arbeit gut machen wirst.«
»Danke«, sage ich knapp. Ich glaube auch, dass ich es gut machen werde. Aber ich bin mir nicht sicher, ob mich das meinem Traum näher bringen wird. Was ist, wenn ich alles gebe und sie trotzdem Nein sagen? Was mache ich dann mit dem Rest meines Lebens?
Ich atme tief durch, um diese Gedanken zu vertreiben.
Wenn sogar ich an mir zweifle, sollte es mich dann überhaupt noch überraschen, dass sie es auch tun?
Ich werde es ihnen beweisen. Und was vielleicht genauso wichtig ist: auch mir selbst.
4. Kapitel
LORENA
Ich bin gerade dabei, meinen Lidstrich zu ziehen, als es an der Tür klingelt. Ich verrutsche und verschmiere mein Augen-Make-up. Genervt lasse ich den Eyeliner sinken und gehe zur Tür. Ich habe gerade keine Zeit, um mich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen. Denn ich muss gleich aufbrechen, weil heute mein erster Arbeitstag im Kaufhaus ansteht.
An diesem Morgen habe ich jede Bewegung und jeden Schritt sehr bewusst gemacht, um bereit zu sein. Ich habe in Ruhe gefrühstückt. Ich habe mein Outfit schon gestern rausgelegt und heute nur noch den richtigen Schmuck ausgewählt. Ich bin früh genug aufgestanden, damit ich mich nicht hetzen muss. All das hat geholfen, mich ein bisschen ruhiger zu fühlen. Aber dieses Klingeln hat all die innere Ruhe, die ich mir mühsam erkämpfen musste, mit seinem schrillen Ton zunichte gemacht.
Wieso muss Stella eigentlich immer ihren Schlüssel vergessen, wenn sie zu Matt fährt?
Ich will meine Cousine Schrägstrich beste Freundin schon in Gedanken verfluchen, als mir die leere Schlüsselschale auffällt. Sie hat ihn also doch nicht vergessen. Aber wer sollte mich sonst unter der Woche noch vor acht Uhr morgens nerven?
»Hallo?«, frage ich kritisch in die Gegensprechanlage.
»Hier ist deine Mutter. Mach auf.« Sie klingt schroff und fordernd. Sie war nie die sanfteste Frau. Julis Auftauchen hat sie allerdings noch weiter abgehärtet.
Ich komme ihrem Befehl nach, bevor ich richtig darüber nachdenken kann.
Von meiner inneren Ruhe ist nur noch ein kläglicher Haufen zurückgeblieben. Dass meine Mutter um diese Uhrzeit vor meiner Haustür steht, kann nichts Gutes bedeuten.
Ich zwinge mich, ein entspanntes Lächeln aufzusetzen, während ich in der angelehnten Tür stehe und auf sie warte. Ich höre sie schnaufen, während sie die zwei Stockwerke überwindet.
»Dein Bruder wohnt in einem Haus mit einem Aufzug«, ist das Erste, was sie zu mir sagt, sobald sie mich erreicht.
»Dir auch einen guten Morgen, Mama«, erwidere ich nur. Es ist nicht das erste Mal, dass sie mich mit so einer Aussage begrüßt. Sie vergleicht mich ständig mit meinem großen Bruder. Würde sie ihn so sehen, wie er wirklich ist, würde sie erkennen, dass ich im direkten Vergleich eigentlich gar nicht so schlecht abschneide. Aber ich bin eben kein Mann. Irgendwie lassen sich alle meine Probleme auf diesen Punkt zurückführen.
»Willst du einen Kaffee?«, frage ich, da hat sich meine Mutter schon ungefragt eine Tasse aus dem Regal genommen. Dass ich diese Frage zu spät gestellt habe, hat sie sich vermutlich schon in Gedanken notiert. Schon zwei Minuspunkte gesammelt, und es ist noch nicht einmal acht Uhr morgens.
»Ich nehme mir schon«, sagt sie, aber eigentlich sagt sie: Weil meine unerzogene Tochter mir keinen anbietet.
»Was verschafft mir die Ehre zu so früher Stunde?«