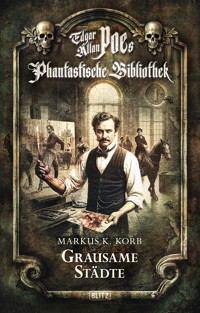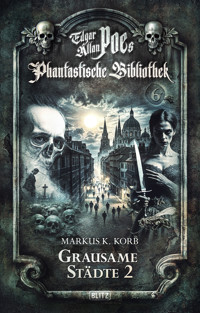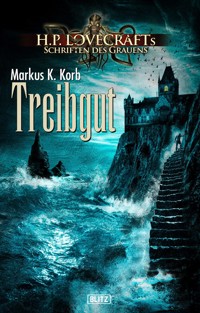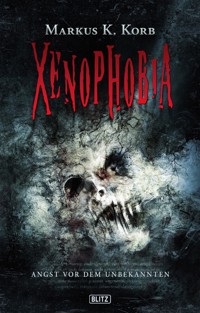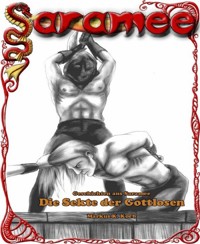Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amrun Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Horror-Legionen
- Sprache: Deutsch
Amrûn präsentiert die neueste Ausgabe der Horror Legionen – eine Sammlung mit den besten Geschichten deutscher Genre-Autoren. Jeder von ihnen hat seine eigene Art, sich mit dem Bösen zu beschäftigen, das Horrorgeschichten innewohnt. Mal blutig und grausam, mal leise und kaltblütig von hinten kommend - jeder einzelne Beitrag hat seinen eigenen Reiz und wird Ihnen einen Schauer über den Rücken jagen. Lassen Sie sich in die Welt des puren Horrors entführen - und hoffen Sie, dass Sie einen Weg zurück finden. Sind Sie bereit dafür? Geschichten von Markus K. Korb, Tobias Bachmann, Vincent Voss, Fred Ink, Rona Walter, Melisa Schwermer, Sönke Hansen, Kristina Lohfeldt, Bernar LeSton, Torsten Scheib, Constantin Dupien, Marc Hartkamp, Piper Marou und Simona Turini.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Horror
Legionen III
Herausgegeben von
Melisa Schwermer
© 2017 Amrûn Verlag Jürgen Eglseer, Traunstein
Lektorat: Melisa Schwermer Korrekturen: Jasmin Krieger Umschlaggestaltung: Mark Freier
Alle Rechte vorbehalten
ISBN – 978-3-95869-570-2
Besuchen Sie unsere Webseite:
http://amrun-verlag.de
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar
1 17
Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
du hast dich für den Kauf der Horror-Legionen entschieden - eine Zusammenstellung von Geschichten der besten deutschsprachigen Horror-Autorinnen und Autoren. Doch vorab möchte ich ein paar Worte an dich richten.
Wenn du an die gängigen Autorinnen und Autoren von Horror-Geschichten denkst, wer kommt dir da zuerst in den Sinn? Jeder hat selbstverständlich seine Favoriten, doch ich vermute, das den meisten zunächst Stephen King oder Richard Laymon (um nur zwei der gängigsten zu nennen, selbstverständlich gibt es da etliche mehr) im Kopf herumgeistert. Wer noch weiter in der Zeit zurückgeht, denkt vielleicht an Mary Shelley, H.P. Lovecraft, Edgar Alan Poe oder gar an die schwarze Romantik von E.T.A Hoffmann.
Doch gruselige und blutrünstige Geschichten sind keine Erfindung der Moderne, ja nicht mal der frühen Neuzeit, die in der Literaturwissenschaft Anfang des 17. Jahrhunderts beginnt.
Ich erinnere mich noch gut daran, dass ich als Kind eine Schallplatte über die Irrfahrten von Odysseus hatte. Eine Hörspieladaption der Odyssee von Homer, die bekanntlich vor dem Beginn unserer Zeitrechnung geschrieben wurde. Also vor weit mehr als 2000 Jahren. Ganz besonders habe ich mich vor dem Zyklopen gegruselt, der Odysseus und seine Männer fressen wollte. Doch auch die Sirenen, die Odysseus’ Männer auf ihre Insel und somit in den Tod locken wollten, sind nicht minder erschreckend.
Was fasziniert die Menschen aber schon seit Jahrtausenden an dieser Art von Geschichten? Ist es eine Art Voyeurismus, bei der man Morbidität oder Gewalt durch die Augen des Protagonisten von seiner sicheren Position aus beobachten kann? Das Adrenalin, das man bei der Gefahr verspürt, die Konfrontation mit einer Angst (vor Schmerzen, vor dem Tod, vor dem Verlust), obwohl einem selbst nichts passieren kann? Dies wäre eine logische Erklärung, denn das ist auch mit ein Grund, weshalb Menschen gerne Achterbahn fahren: Man hat den Spaß einer gefährlichen, ja vielleicht sogar lebensbedrohlichen Situation, ohne sich der wirklichen Gefahr auszusetzen. Die Regeln der Welt, die man kennt, gelten plötzlich nicht mehr und man ist gezwungen, sich der Phantasie des Konstrukteurs der Achterbahn - oder in unserem Fall der des Autors auszuliefern. Je besser die Illusion, desto mehr Freude empfindet man bei der Lektüre. In den fünfziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts bezeichnete der Psychoanalytiker Balint (Michael Balint: Angstlust und Regression. Klett-Cotta, 1959) das dabei entstehende Gefühl als »Angstlust«.
Gerade Kurzgeschichten sind besonders gut geeignet, diese Angstlust zu erzeugen. Du wirst in eine Situation hineingeworfen, ohne vorher irgendwelche Informationen über die Bedingungen oder Umstände zu bekommen. Du musst dich mit einem normalen Protagonisten oder einer Protagonistin nun in dieser Welt zurechtfinden, begleitest keinen Superhelden, während du darauf wartest, dass etwas passiert. Denn dass es kommt, wie auch immer das Unheimliche aussehen mag, ist klar.
Wie unsere Geschichten zeigen werden, entsteht der Spaß beim Gruseln nicht immer durch plakative Gewalt, Jump-Scares oder Splatter. Schon die Erwartung des Bösen jagt uns eine Gänsehaut über den Rücken. Denk nur mal an Horrorspiele wie Amnesia, Silent Hill oder die frühen Teile der Resident Evil-Reihe, in denen uns meistens schon dadurch Angst und Bange wird, dass wir etwas hören, es aber noch nicht sehen können. Wir rechnen damit, dass es hinter der nächsten Ecke auf uns lauert und uns in Stücke reist, ja wir freuen uns geradezu darauf. Der Nervenkitzel flacht auch nicht ab, wenn dem nicht so ist, im Gegenteil. Er verstärkt sich eher noch. In Erwartung des Bösen fiebern wir auf den Moment hin, in dem es sich uns offenbart.
Ich habe versucht, in diesem Buch die verschiedenen Facetten des Horrors aufzuzeigen und Geschichten ausgewählt, die diese repräsentieren. Ich hoffe, dass die Autorinnen und Autoren dich damit gut unterhalten.
Viel Spaß und ganz viel »Angstlust« wünsche ich,
deine Melisa
Trapped!
von Kristina Lohfeldt
Die Straße war Kafkas Zuhause. Sie wohnte in ihm, nistete in ihm.
Ebenso abgewrackte Gestalten wie er hatten ihm seinen Namen gegeben. In seinem abgegriffenen, ausgeblichenen Ausweis war »Franz Kaffke« zu lesen. Doch dieser Mann existierte schon lange nicht mehr, und der Ausweis war irgendwann und irgendwo auf der Strecke geblieben. Wie sein altes Leben.
»Wichspisser, elende«, fluchte er, als er die Lichter, ihre Lichter, im Dunst aufblitzen sah, jedes ein Hort ihrer Überlegenheit, ihrer Borniertheit, ihres Spießertums. Sie kreisten ihn ein, reizten ihn durch ihre bloße Anwesenheit.
»Scheißarroganz, Scheißregeln, verdammte.«
Kafka spuckte aus. »Kafka kriegste nicht, nie nicht«, murmelte er.
Er war frei. Er konnte gehen wann und wohin er wollte. Er klebte an keinem Menschen, an keinem Besitz oder gar Status.
An jenem Tag stand ihm jedoch nur eine Freiheit zu: zu erfrieren oder sich in eines der muffigen Massenquartiere zu flüchten, wo man Menschenwürde ebenso vergeblich suchte wie Freundlichkeit.
Sie alle waren Ratten der Straße, mit dem Unterschied, dass Ratten sozial waren.
Dort, in diesen abgewichsten, verwanzten Dreckslöchern gab es nichts mehr zu verlieren, bis auf die wenigen Habseligkeiten, die man noch aus Gewohnheit oder Sentimentalität mit sich herumschleppte, wie Sisyphos einen blöden Stein angeblich für ewig irgend so einen Berg hinaufrollte. Seine Vergangenheit wurde man eben nicht los. Egal, wohin man auch ging, man nahm sich immer mit. Auch sein Wissen, das ebenso überflüssig geworden war wie der Rest seines alten Ichs. Und am Ende drückte es einen nieder, nahm einem die Luft zu Atmen, bis man langsam nur mehr aus Gewohnheit weiterlebte, denn aus eigenem Antrieb.
Die Scheißkälte hatte Kafka bereits das Hirn vereist. Sie schmerzte, wie früher die Häme seiner Umwelt ihn gestichelt und gepiesackt hatte. Langsam tanzten Lichter vor seinen Augen, die da nicht hingehörten. Dabei wollte er nichts mehr, als sich hinlegen und schlafen.
Und dann sah er ihn.
Fast wäre Kafka an ihm vorbei getorkelt. Der alte Campingbus war so zugewachsen, dass er auf den ersten Blick mit der heruntergekommenen Vegetation des schäbigen Vororts nahezu verschmolzen war. Jemand hatte ihn abgestellt, hatte ihn einfach am Straßenrand entsorgt, wie Unrat, still, heimlich und ohne lästige Nachfragen.
Das Wrack sah wie eine Laune der Natur aus, ein ungeheures Gewirr aus Kletterpflanzen heimischer Arten, die ihn in Besitz genommen, ihn unter ihre Knechtschaft gebracht hatten. Sie hüllten den alten Camper fast wie ein knotiges Zelt ein. Moos gab ihm eine lächerlich wirkende, neue Farbe, nistete auf dem von Lochfraß befallenen Dach, auf der Motorhaube und überall dort, wo es sich gut festkrallen konnte. Der Tank war aufgeplatzt, Plastik spröde und porös. Die meisten Fenster waren zersprungen, und selbst die Scheinwerfer zersplittert oder angeknackst. Jedem anderen Passanten mochte dieser Anblick ein Dorn im Auge sein. Um so erstaunlicher, dass das Schrottmobil nie entfernt worden war.
Kafka erschien es dagegen wie ein Himmelsgeschenk. Er sah nicht Dreck, dachte nicht an Krankheitskeime, Ungeziefer oder Müll. Für ihn bedeutete der Camper ein Dach über dem Kopf, und die Rettung vor dem drohenden Kältetod.
Geübt darin, sich Zutritt zu verschaffen, wo er verboten war, gelang es Kafka, die Seitentür des Busses zu öffnen. Die Straße war ein einfallsreicher Lehrer, und so fand sich in dem, was andere für Müll hielten, manches, was einem wie Kafka kleine Helfer waren.
Die Kälte hatte ihm bereits die Glieder versteift. Aber Hartnäckigkeit, Überlebenswille und diebische Erinnerungen an die technischen Finessen eines Dietrichs, hatten den altersschwachen, bröseligen Gummi mit ein wenig Nachdruck zur Kapitulation gezwungen.
»Kriegste nicht klein nicht«, plapperte Kafka vor sich hin. »Kriegste die Krätze, aber kriegste nicht klein. Kafka kriegste nie nicht. Geile Sau, geile. Hast es immer noch drauf, haste.«
Scheiße schwamm immer oben. Selbst im Strudel des Lebens oder vielmehr des Überlebens.
Er schürfte sich die Haut ein wenig an dem scharfen Spalt auf, durch den er sich hindurchzwängte. Aber das scherte ihn nicht.
Auch der unangenehme Mief, der ihm entgegenschlug, schreckte ihn nicht ab. Wer oft genug in seiner eigenen Kotze geschlafen hatte oder neben getrockneter Pisse von Menschen, Katzen oder Schlimmerem, der war einiges gewohnt. Auch Alkoholgestank drückte im Laufe der Zeit jeder Geruchszelle die Kehle zu. Inzwischen war Kafka trocken, aber die Erinnerung an jegliche Art von Gesöff brannte noch in ihm.
Die Luft roch muffig, abgestanden, modrig, ein wenig süßlich und doch auch nach Wald und Erde. Jedoch nicht nach der Art von Wald und Erde, die einen freier atmen und an blauen Himmel und lauschige Lüftchen denken ließ.
Und da war noch etwas anderes. Etwas, das von den übrigen Gerüchen überdeckt zu werden schien.
»Gedärme. Mütterchens Erde welche. Schlampe die. Aufgeplatzt. Was für eine Sauerei, eine«, kommentierte Kafka das Wahrgenommene und kicherte.
Er war sich selbst sein bester Unterhalter. Und alles war besser als die Kälte draußen. Der Muff hielt wenigstens warm.
Kafka ließ sich auf eine altersschwache Matratze plumpsen. Sie schien auf ihre eigene Art lebendig zu sein. Einen Geruch konnte er allerdings nicht ignorieren.
»Stinkt nach Fischgrube, stinkt es«, wisperte Kafka. »Mitten aufm Land. Drecksloch, dreckiges.«
Dann zuckte er die Achseln.
»Besser als Katzenpisse«, murmelte er.
Wenige Augenblicke später rollte er sich auf die Seite, grub sich dabei in eine mottenzerfressene Decke ein, hustete, als ihr Staub ihn einhüllte, fluchte, und schnarchte kurz darauf geräuschvoll.
Die Straße ist dein Zuhause. Kafka. So nennen sie dich. Erinnerst du dich noch? In deinem Ausweis steht ein anderer Name. Du hast ihn verloren. Den Ausweis. Aber auch den Namen und den, der mit ihm verbunden war. Sein Wirt. Sein Körper. Sein Wirtskörper. Ein Verlorener. Erinnerst du dich an ihn? Erzähl uns mehr! Und von den Wichspissern …
Deine Worte …
Erbärmlich.
Ohne Erbarmen.
Beute. Nur Beute.
Der schlafende Kafka wälzte sich unruhig hin und her. Er war nicht mehr allein. Aus den Schatten hatten sich Fangarmen gleich schleimige, knotige Auswüchse um seine Schlafstatt geschlungen. Sie zerrissen die Schemen, quollen wie Auswurf daraus hervor und schlängelten sich durch ihr Revier auf den Eindringling zu. Beinahe liebevoll strichen die geifernden Haare über die sich feilbietende, erst langsam wieder erwärmende Haut, so lange, bis sie eine pulsierende, einladende Stelle gefunden hatten.
Wurzeln gleiche Tentakel glitten über das saftige Fleisch. Wo sie Haut berührten, da bohrten sie sich wie Nadeln hinein, stachen und kratzten und bissen und reizten das empfindliche Gewebe.
Ein kurzer, lodernder Schmerz wütete im appetitlichen Fleisch, dann breitete sich Taubheit aus, dumpf, dunkel und dankbar.
Kafka riss die Augen auf. Und doch blieb alles dunkel, sein eigener Kerker, ein Kokon aus Ekel und Leid.
Ein Gurgeln entfuhr seiner Kehle, doch wurde ihm der Mund sanft von klebrigem Schleim verschlossen. Er schrie auf, als etwas Brennendes in seine Augen tropfte, und sein Schreien verebbte auch nicht mit dem lebendigen Knebel vor, in und um seinen Mund.
»Luft ... Luft ... Bitte!«, winselte seine innere Stimme. Keuchte. Sabberte. Spie.
Er fühlte die Dornen, die sich in seine Augen bohrten. Langsam. Geduldig.
Sie scheuerten an seiner Iris. Schabten. Kratzten. Gruben.
Er spürte, wie seine Augäpfel sich aufblähten wie Ballons, um dann – langsam und unerbittlich –, betäubt in sich zusammenzufallen, zu schrumpfen, zu schrumpeln.
Ewigkeit der Folter. Äonen von Schmerz.
»Hörst du mich?«, schrie es in ihm. »Bitte ...«
Doch er war allein. Allein mit seiner Angst, die ihm die Kehle zudrückte. Wieder und wieder.
Aber die körperlose Stimme. Sie war da.
Du kommst hier nicht weg. So sehr du auch strampelst. Du steckst in deinem Leben fest.
Du wirst nicht wieder fortlaufen. Du hast es zu oft getan. Das ist keine Lösung. Sieh es endlich ein!
»Ich laufe nicht weg«, versprach er. »Ich stelle mich. Was muss ich tun, damit es aufhört? Bitte ... Bitte! Nimm es weg! Ich ... kann ... nicht ... atmen!«
Atmen wird überbewertet. Wozu atmen, wenn du dir die Lungen zuteerst, die Nasenlöcher blutig schnupfst und deine Kehle langsam wegätzt?
Wer jahrelang solch gnadenlosen Raubbau betreibt, der bettelt doch geradezu darum, dass es endet.
»Ich habe aufgehört!«, behauptete Kafka. »Ich bin nicht wie die Anderen.«
Nein? Kannst du das beweisen? Wie sind sie denn, »die Anderen«?
Aber vielleicht hast du Recht. Vielleicht bist du nicht wie sie. Denn sie haben dich immer ausgegrenzt. Du hast nie zu ihnen gehört. Du nennst sie »Wichspisser«. Warum? Weil sie dich … - wie sagst du so schön? - »gefickt« haben? Weil sie dich und deine Art zu leben verachtet haben? Warst nicht du am Ende der, der dich fallen gelassen hat? War es dir egal? Du hast zugelassen, dass sie dich wie Abschaum behandelt haben. Und vielmehr bist du auch nicht. Also ... Wer ist nun der »Wichspisser«?
Wir sagen: Deine Art zu leben ist unnatürlich. Aber gerade deshalb wird dich auch keiner vermissen. Und du wirst einen Nutzen haben. Ist es nicht das, was du immer wolltest?
Wir werden dir zeigen, wie der Neid auf eine andere Existenz einen aufwühlt, einen auffrisst. Du wirst dankbar sein. Wir sind großzügig.
»Wer bist du? Was willst du von mir?«
Wir ... sind hungrig. Wir ... sind durstig. Uns hungert nach deinem Fleisch. Uns dürstet nach deinem Schweiß, deinem Blut, deinen Tränen und ... deiner Angst.
»Ich habe keine Angst!«
Nein? Warum hast du dich dann gerade eingenässt? Danke übrigens dafür.
»Lasst mich gehen!«, wimmerte Kafka. »Ich stehe einfach auf und verschwinde. Deal?«
Du kannst nicht gehen. Die Kinder sind hungrig, durstig. Du wirst sie nähren, bis nur noch deine Hülle übrig ist. Und auch dafür finden wir Verwendung. Und nun reißen wir dir dein Maul auf. Ist doch nichts Neues für dich. Sie müssen hineinpassen, weißt du? Sie rutschen dir dann ganz allein die Kehle hinab und bohren sich in deine Innereien. Menschen haben herrlich viele Weichteile. Das ist uns gleich aufgefallen. Ah – jetzt hast du Angst. Das schmeckt gut. Sie werden viel an dir zu nuckeln haben.
Knirschend und knackend splitterte Kafkas Kiefer, als die Ranken ihm ihre Samen, Embryonen gleich, in den Schlund stopften, seine Speiseröhre hinabrutschten, sie wie eine Laufmasche in Nylonstrümpfen aufrissen – Nylons – das Einzige, was er an Frauen je gemocht hatte.
Schmerz wütete in ihm – und dann nistete sich Wahnsinn … und Verzweiflung ein.
»Das klang nach Kindergeschrei«, behauptete der kleine Marvin-Luis. »Habt ihr das nicht gehört?«
Seine Spielkameraden lachten ihn jedoch aus.
»Was du immer hören willst«, spotteten sie. »Kommst du jetzt mit? Oder willst du weiter deinen Stimmen folgen?«
»Ich gehe noch ein bisschen weiter«, meinte Marvin-Luis.
Die anderen Kinder zuckten mit den Schultern.
»Na, mach‘s dann mal gut. Wir sehen uns«, verabschiedeten sie sich und verschwanden.
Der zurückgelassene blonde Junge schaute sich suchend um und lauschte.
Da war es wieder! Er hörte es ganz deutlich. Das klang wie das Geschrei, das seine kleine Schwester Leonie-Laura veranstaltete, seit Mama sie vor zwei Wochen aus dem Krankenhaus mitgebracht hatte.
Marvin-Luis mochte Babys. Und das klang, als wäre eines in Not. Vielleicht waren es auch kleine Katzen. Ihr Geschrei klang denen von Kindern nicht unähnlich, und hier in der Gegend wurden gerne mal ungewollte Kitten ertränkt. Wenn er sich beeilte, konnte er sie vielleicht noch retten.
Marvin-Luis lief weiter – und da stand er.
»Ein alter Campingbus?«, staunte der Junge.
Merkwürdig. Sie hatten doch schon so häufig hier gespielt. Aber diesen Bus hatte er nie wahrgenommen.
Wie hatte er dieses Abenteuer übersehen können? Dabei musste der Camper hier doch schon sehr, sehr lange stehen.
Neugierig umrundete der Junge das Schrottmobil.
Der alte Campingbus war so zugewachsen, dass er auf den ersten Blick mit der heruntergekommenen Vegetation des schäbigen Vororts nahezu verschmolz. Jemand hatte ihn abgestellt, hatte ihn einfach am Straßenrand entsorgt, wie Unrat, still, heimlich und ohne lästige Nachfragen.
»Was für ein feiner Spielplatz«, freute sich der Junge. »Und da ist sogar ein Spalt in der Tür. Ich schaue mich mal um. Die anderen werden Augen machen, wenn sie das sehen.«
Voller Vorfreude zwängte er sich durch den Spalt. Vorsichtig achtete er darauf, den scharfen Kanten nicht zu nahe zu kommen. Mama hatte ihm eingeschärft, er solle vorsichtig sein. Kinder konnten sich doch so leicht beim Spielen verletzen ...
Die Tür
von Vincent Voss
Ich verstehe nicht, warum die Menschen sich bei einer unbekannten Bedrohung immer im Haus einschließen. Ich würde immer nach draußen rennen.
Unbekanntes Zitat
Ich hab die beschissene Fliege nicht gesehen. Und Francis Arm auch nicht. Er langte nach einer leeren Streichholzschachtel, die auf meinem Schreibtisch lag, und nahm sie dort gefangen. Aus den Augenwinkeln konnte ich sehen, wie fett sie war. Keine Stubenfliege, sondern so eine mit einem grünblau schillernden Panzer. Francis war abgelenkt und ich schoss mit Reus ein wunderschönes Tor.
»Du Arsch!«, fluchte er und ich imitierte Reus´ Torjubel. Zwei zu eins für mich, seine scheiß Bayern konnten einpacken.
»Du Arsch!« Er schlug mir mit der Faust auf den Oberarm. Kein Spaß mehr. Wut in seinen Augen, Schmerz in meinem Arm.
»Alter, Fuck! Lauf ma locker, Francis! Ist nur ein Spiel!«, regte ich mich auf. Seine Lippen bebten, ich nahm ihm den Controller aus den Händen.
»Francis, ey, was ist los? Hey, Mann!« Ich berührte ihn an der Schulter und er ließ sich in meinen Arm fallen.
»Ich halt das alles nicht mehr aus, Janni. Ich will nur noch weg«, brach mein bester Freund zusammen.
Francis, mit dem ich in der Grundschule eine Kaugummisammlung unter dem Schulpult gepflegt hatte, Francis, mit dem ich das erste Bier getrunken und die erste Kippe geraucht hatte. Und ich hatte nie etwas bemerkt.
Francis war einfach durch die beschissene Tür gegangen und verschwunden. Wir trugen alle unsere lustigen Silvesterhütchen, Hagen jagte eine weitere Rakete in den diesigen Nachthimmel, über uns erblühten rote und silberne Punkte und regneten zu Boden, Fiona blies zum tausendsten Mal in die Tröte, und ich lachte und hielt mich an meinem Bier und meinem Mischeglas fest. Trank. Rum-Cola, erinnerte ich mich, lachte und mein Gelächter ließ mich trunken taumeln.
»Francis«, lallte ich, holte mir, eigentlich ihm, ein weiteres Bier aus dem Kasten, klemmte meines unter den Arm, verschüttete dabei einiges auf meine Jacke, öffnete Francis’ Bier mit den Zähnen und schwankte zur Tür, die wir erst am frühen Nachmittag auf das freie Feld hinter Hagens Garten aufgebaut hatten. Fionas Idee. Wie immer bei solchen Ideen, aber es sah wirklich flashig aus, wie diese weiße, alte Holztür mit einem regenbogenfarbigen 2017 im zerfaserten Dezembernebel auf einer weitläufigen Kuhweide stand. Mitten im Nichts. Und um Punkt 24 Uhr stießen wir an und jeder ging mit seinen Wünschen ins neue Jahr durch diese Tür.
»Francis, Alter, ich hab dir ein Bier mitgebracht!« Flashig. Die Tür wurde durch eine weitere Rakete in rötliches Licht getaucht, der weiße Rahmen, die geöffnete Tür, die Dunkelheit dahinter.
»Francis!«
»Schrei nicht so rum, du machst die ganze Stimmung kaputt, Janni!«, zischte mir Sonny zu, hielt mich am Arm fest. Ich riss mich los und taumelte weiter meinem Ziel entgegen. War das heftig! Als könnte man durch die Tür ins Nichts verschwinden. Ich traute mich nicht, ein zweites Mal durch die Tür zu treten, ging herum und sah nach Francis. Kein Francis. Nicht jetzt und auch nicht später. Francis war verschwunden.
Danach. Danach glaubte uns niemand. Und wir begannen ebenfalls zu zweifeln. Obwohl wir uns erst sicher waren, Francis’ Fußspuren im Schnee ausgemacht zu haben, wie sie direkt vor der Tür endeten und nicht weiterführten, obwohl wir erst keine andere Erklärung für sein Verschwinden fanden, zweifelten wir und erfanden plausible Ausreden. Francis hätte das von langer Hand geplant, er hätte Probleme, in seinem Umfeld und mit seiner Psyche, wir suchten und deuteten jeden Hinweis so, dass wir uns sein Verschwinden erklären konnten. Damit hatten wir unser Problem mit Francis’ Verschwinden geklärt. Dachten wir.
Später. Später zog Tommy anstelle von Francis in unsere Zweier-WG. Es war nicht dasselbe. Wie auch? Aber Tommy war in Ordnung. Und es war allemal besser als alleine zu wohnen. Ich hörte Tommy, wie er in seinem Zimmer Musik hörte, während ich das neu aufgelegte X-COM zockte. Ich erkundete ein abgeschossenes UFO und erlebte nahezu ähnliche Gefühle wie früher. Spannung, Aufregung. Aber eben nur fast. Das bringt das Älterwerden mit sich. Man stumpft ab, erlebt kaum noch neue Dinge.
Früher. Früher war alles intensiver. Und Gedanken waren abgedrehter. Ich dachte als Kind zum Beispiel oft, dass, wenn meine Eltern aus meinem Zimmer gingen, sie dahinter verschwänden. Und hinter meiner Tür wäre das absolute Nichts. Ich stellte mir das Nichts schwarz vor. Wie vollkommene Finsternis. Und ich dehnte diesen Gedanken auf andere Räume aus. Und alles war nur ein inszeniertes Spiel für mich und nicht existent. Ich verfiel diesem Gedanken so sehr, dass ich meinem Kater Terence Löcher ins Fell schnitt, um zu prüfen, ob Terence ausgetauscht wurde. Aber er war nie ausgetauscht worden.
Ich warf einen Blick auf meine Katzenbande. Dean und Sam ließen es sich auf der Couch gutgehen, und Castiel war wie immer unterwegs. Ein Blick auf meine Zimmertür - und ich kostete von den Eindrücken meiner damaligen Gedankenwelt. Tommy war nur ein Konstrukt. Ich musste lächeln und sofort erstarrte dieses, als ich an Francis denken musste. Francis und diese beschissene Tür. Ein ungutes Gefühl beschlich mich.
Die Tür.
Francis ging einfach durch und war verschwunden. Was, wenn meine kindlichen Gedanken von damals gar nicht so abwegig waren? Was, wenn hinter Türen etwas anderes wartete, als das, was wir erwarteten?
Ich kämpfte mich aus meinen trüben Gedanken und wollte weiter das abgeschossene UFO inspizieren, als mir zum einen die Stille in unserer Wohnung auffiel und zum anderen, dass Sam und Dean mit angelegten Ohren auf der Couch saßen und dann gegenseitig um sich herumschlichen. Auch sie spürten etwas.
»Tommy?«, rief ich. Nichts. Keine Antwort und auch keine Musik aus seinem Zimmer. Nur die Lüftung meines Rechners und die bedrohliche Hintergrundmusik des Spiels.
»Sam Salzkreis, Dean was sagt das EMF?«, fragte ich scherzhaft, auch um mein Unbehagen zu überspielen. Sam und Dean maulten, wie nur Katzen maulen konnten.
»Tommy, bist du da?« Kein Tommy. Ich sah in den Flur, reckte den Hals. Der Flur war leer. Zumindest der Teil, den ich durch die zu Dreiviertel geöffnete Tür sehen konnte. John Travolta und Samuel L. Jackson sahen mich aus ihren Profikilleraugen mit erhobenen Waffen an. Und dahinter? Lauerte dort das Nichts? Etwas anderes?
Ich schüttelte den Kopf, wollte diesen Gedanken loswerden, als sich die Tür bewegte. Oder doch nicht? Hatte ich mich getäuscht? Sam und Dean maunzten, sprangen von der Couch, versteckten sich hinter der Lehne und sahen ängstlich zu mir hoch. Irgendetwas war anders. Ich täuschte mich nicht, so ängstlich hatte ich die beiden Kater noch nicht einmal bei dem heftigen Gewitter im letzten September erlebt.
Es knarrte. Meine Zimmertür knarrte.
»Komm Tommy, lass das. Ich steh nicht so auf diese Prank-Scheiße!«, rief ich, stand auf und ging in Richtung Tür. Wollte zur Tür gehen und blieb stehen. Warum? Ich konnte es mir selbst nicht erklären. Eine Angst durchfuhr mich, die ich so bisher noch nicht erlebt hatte. Nie. Nicht einmal mein Albtraum aus der Kindheit, wo Ernie und Bert mich verfolgt hatten und mich aufessen wollten, hatte mir eine ähnliche Angst beschert. Und eines war klar: Das war nicht Tommy, der hinter der Tür lauerte. Das war etwas Unaussprechliches. Etwas, das nicht hierher, nicht in diese Welt gehörte und etwas viel Schlimmeres mit mir vorhatte, als mich mit einem Keks zu verwechseln und mich aufzuessen.
Ich nässte ein. Kein Spruch, ich pisste mir im Stehen in die Hose, gab keinen Ton von mir und schwitzte von jetzt auf gleich mein Big-Lebowski-T-Shirt nass. Starrte die Tür an und sah, wie sich Samuel und John langsam, sehr, sehr langsam auf mich zubewegten. Ich schloss die Augen und erwartete die Hölle.
Keine Ahnung, wie lange ich dort stand, aber Jahre später hörte ich Tommy.
»Hast du in die Hose gepisst?«, fragte er mich, stand im Flur und sah mich entgeistert an.
»Warst du die ganze Zeit hier?«, fragte ich und erkannte meine eigene Stimme nicht wieder. Er nickte. Ohne eine weitere Erklärung schloss ich die Tür, schlüpfte aus meinen nassen Klamotten und ließ mich in meinen Bürostuhl fallen. Wenn Tommy die ganze Zeit da war, warum hatte ich ihn nicht gehört? Und woher kam diese verdammte Angst? Ähnlich wie bei Francis suchte ich nach Antworten und landete schließlich bei mir. Etwas stimmte nicht mit mir. Stress, Anspannung, was auch immer, alles konnte passen, alles konnte diese Angst erklären. Und diese Möglichkeit beruhigte mich. Bescheuert eigentlich, aber so war es.
Ich beruhigte mich, mein Blick wanderte in die X-COM-Welt und gab mir weitere Sicherheit. Alles nur Einbildung. Hoher Blutdruck, Schlafmangel, whatever. Ich würde es Tommy irgendwie erklären müssen. Und vielleicht sollte ich mir mal wieder eine Hose anziehen, aber erst nach dieser Mission.
Dann nahm ich eine Bewegung auf meinem Schreibtisch wahr. Die leere Chipstüte hinter meiner John Snow Tasse bewegte sich. Raschelte. Mit einer Hand rieb ich mir über die Augen, dann die Schläfe. Ging das schon wieder los? Ich schob die Tasse zur Seite, hielt die Tüte dort, wo sie aufgerissen war mit spitzen Fingern und spürte, wie sie vibrierte. Ich horchte in mich, auf der Suche nach jener Angst, von der ich erst vor einer Minute besessen gewesen war, aber sie war nicht da. Ein gedämpftes Summen, Vibration. Vorsichtig zog ich die Chipstüte zu mir. Darunter lag meine Streichholzschachtel, und sie bewegte sich und übertrug die Vibration auf die Tüte. Aus ihr tönte das Brummen. Ich nahm sie angewidert in die Hand, schob den Schuber mit dem Zeigefinger eine Daumenbreite auf und zuckte zusammen, als borstige Beinpaare ins Freie tasteten, sich ein grünblau schillernder Fliegenkörper aus der Schachtel zwängte und sich in die Luft erhob.
Die Zeit danach war nicht unbedingt die beste. Ich war angeschlagen und wollte mit niemandem darüber reden.
Mein Gott, Tommy hatte gesehen, wie ich mir in die Hose gepisst hatte, warum sollte ich mit jemandem darüber sprechen wollen? Ich zog mich zurück, schloss mich in meinem Zimmer ein, feierte krank und zockte so ziemlich alles, was mir in die Finger kam. Awakening, Lords III, X-COM, Resident Evil. Schlief nicht, aß kaum. Ufo X-COM spielte ich im zweiten Durchgang. Den ersten hatte ich nachher trotz etlicher Zwischenspeicherstände abgebrochen und neu gestartet. Ich hatte gerade das erste große UFO abgeschossen und schickte meine Truppe hin, um es zu suchen. Lagerhallen im Hafen von San Francisco. Etliche Aliens hatten sich im Dunkeln versteckt und griffen uns an. Vor allem diese Dinger, die über PSI-Kräfte verfügten, und die per Gedankenkontrolle meine Leute übernahmen.
Und dann tauchte Francis auf. Aber ich hatte kein X-COM Teammitglied namens Francis. Ich klickte ihn an. Rang: Sergeant, Bewaffnung: Lasergewehr und Sprengstoff; mit den besten Skills im Fernkampf und Physis. Die Schnelligkeit war auch in Ordnung. Von den Werten her konnte ich diesen Francis gebrauchen, überlegte ich und wollte mir seine Ausrüstung ansehen. Verschiedene Granaten, ein Medkit, eine Streichholzschachtel mit einer Fliege. Ich stutzte. Das stand da nicht wirklich! Doch! Ich rieb mir die Augen, rieb mit meinem Zeigefinger über das Namensicon.
»Francis«, flüsterte ich.
Und Francis sah auf. Sah mich an. Fuck! Das war Francis. Während die anderen X-COM-Mitglieder mit der Standard-Physiognomie eines guten Computerspiels aufwarteten, waren Francis Züge detailgetreu. Das leichte Kräuseln der Oberlippe, die ein immerwährendes zynisches Lächeln in sein Gesicht zeichnete, das linke Ohr, das etwas tiefer als das rechte saß, der leicht traurige Blick. Das war Francis.
»Hey, Janni«, war in der Sprechblase über ihm zu lesen.
»Francis?«, wiederholte ich, sah zu Vincent Vega und Jules Winnfield an meiner Zimmertür, kniff mich und kroch danach beinahe in den Bildschirm hinein.
»Ja, ich bin´s. Und ich helfe dir. Hier ist nämlich so ein verflucht cthulhuoides Ding entwischt, das nicht programmiert wurde, Mann! Und das müssen wir vernichten, aber dafür müssen wir einen Sprengsatz mit der Fliege an dem Ding anbringen, solange es noch nicht erwacht ist«, las ich. Francis gestikulierte wie Francis.
»Francis?«, flüsterte ich wieder.
»Jetzt hör auf mit dem Scheiß und beweg deine Leute!« Francis ging los. In eine unbeleuchtete Gasse hinein.
»Francis nicht!« Scheiße, wieso ging Francis vor? Sofort löste ich meinen Truppenverbund auf, klickte Sergeant Mahony und Captain Floyd an und führte sie zu Francis. Aber sie erreichten ihn nicht mit ihrer Bewegungsreichweite in dieser Runde. Mahony kam zwei Felder vor die Gasse, Floyd blieb weitere acht Felder zurück, weil er einen schweren Raketenwerfer mit sich führte. Dann war die Runde zu Ende, und ich war mir sicher, dass in dieser Gasse die Aliens lauerten.
Francis stand acht Felder tief in der Gasse und konnte nur fünf Felder weit hineinsehen. Container und Fässer standen links und rechts neben den Lagerschuppen, überall konnten sich Aliens versteckt haben.
Ein hoher Ton, drei Mal, die Psioniker griffen uns an. Das war scheiße, weil man in der Runde nicht wusste, wen sie genau angegriffen hatten. Ich schaute mir den Status meine Leute an und sah, dass der Balken, der die geistige Stabilität anzeigte, bei Francis, Peckery und Krostowz gesunken war. Francis hatte es am heftigsten erwischt.
»Francis, wie geht es dir?«, fragte ich. Francis antwortete nicht. Es war nicht meine Runde. Nach den Psionikern griffen die Aliens nun physisch an. In den dunklen Bildausschnitten konnte ich jetzt Aliens herumhuschen sehen. Aliens, die Hafenarbeiter töteten, Aliens, die meine Leute aus dem Hinterhalt angriffen.
Zwei, drei, vier Angriffe, aber keiner, der Francis betraf. Aber dann. Eine kurze Bewegung vor Francis, die mir anzeigte, dass am Ende der Gasse etwas sehr Großes von undefinierbarer Form stand. Ein Kokon? Mit Schleim überdeckt? Der Bildausschnitt wurde wieder schwarz, ein Alien, es war einer von diesen Mutanten, kam aus seiner Deckung hinter zwei aufeinandergestapelten Holzkisten hervor und feuerte auf Francis. Und traf ihn.
Francis schrie, und sofort sah ich mir seinen Zustandsmonitor an. Er hatte über die Hälfte seiner Lebensenergie verloren.
»Fuck!«, schrie ich. Francis hatte zwar ein Medkit, aber dessen Einsatz kostete ihn zwei Runden. Ein Heilpatch hatten weder er, noch Floyd oder Mahony dabei.
Eine Sekunde. Folgte noch ein weiterer Angriff? Ein Treffer noch, und Francis könnte sterben. Eine weitere Sekunde. Nichts. Der Modus wechselte, und ich war wieder am Zug. Ich atmete durch.
»Francis? Wie geht es dir?«
»Nicht gut«, las ich. »Aber wir müssen weiter, Janni. Da hinten ist das Ding.«
Ich wollte Mahony vorziehen, aber Francis ging eigenmächtig tiefer in die Gasse hinein. Mit jedem Schritt, den er nach vorne tat, deckte sich ein weiteres Feld vor ihm auf, zeigte weitere Kisten und Fässer, eine liegengelassene Alienwaffe - ich schätzte, es war eine Plasmapistole. Uninteressant für mich, denn diese erforschten schon die Wissenschaftler in meinem Forschungslabor.
»Francis, bring dich in Deckung, verdammt!«, zischte ich und sah, wie seine Bewegungsreichweite schwand. Francis reagierte nicht, schritt unbeirrt voran, hinter die Lagerschuppen auf offenes Terrain.
»Francis, verdammt!« Dann blieb er stehen. Ohne Deckung. Vor ihm sah ich am Ende seiner Sichtweite zwei Felder grünlich schimmern. Und irgendetwas waberte dort. Ich konnte nicht erkennen, was es war, obwohl meine Nasenspitze beinahe den Bildschirm berührte.
Die Musik hatte sich verändert. Was heißt Musik? Musik konnte man es nicht mehr nennen. Es hörte sich an, als würden Steine unter Wasser gegeneinander schaben, dazu ein monotones Brummen, dessen Ton mir auf die Schläfen drückte.
»Es ist vor mir. Ich kann es riechen, Janni. Es riecht wie in deinem Klamottenschrank«, las ich über Francis und sah, wie er lachte.
»Ja, es ist vor dir, aber verdammt, ich kann dir nicht helfen, Francis. Warum machst du immer solche scheiß Alleingänge?« Ich brachte erst Floyd in die Gasse und ließ ihn mit dem Raketenwerfer auf den Alienmutanten schießen, der Francis angegriffen hatte. Immerhin. Er traf, der Alien kreischte und brannte und war hinüber. Dann folgte Mahony, und weil er eine bessere Bewegungsrate hatte als Francis, kam ich mit ihm an Francis heran und hatte dann noch drei Felder, auf die er sich bewegen konnte.
»Lass ihn hinter mir, Mann!«, sah ich in Francis Sprechblase.
»Hä? Was soll das denn, Francis?«
»Er wird draufgehen, Janni. Lass ihn hinter mir!«
»Francis, du bist wichtig, ja? Alles andere ist nur ein Spiel!«, widersprach ich ihm.
»Nein, Janni. Mahony wird bald Vater. Zwillinge. Er hatte schon die ganze Zeit Schiss, dass er …«
Ich glaubte, mich verlesen zu haben oder wähnte mich im falschen Spiel. Mahony und Vater? So ein Schwachsinn. Ich bewegte ihn langsam drei Felder vor, starrte dabei auf den sichtbar werdenden Bereich.
Mein Gott! Was war das für ein Ding? Ich wollte mein restliches Team hierherbringen, klickte bei ihnen auf Truppenverband und behielt das Ding im Auge. Im weitesten Sinn ein Kokon, in dem etwas pulsierte, das am ehesten an ein weibliches Geschlechtsorgan mit blasenartigen Auswüchsen erinnerte.
Dann ertönte der schrille Ton eines psionischen Angriffs.