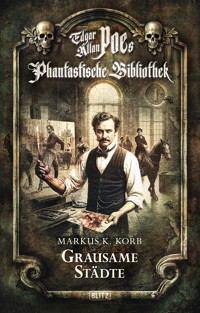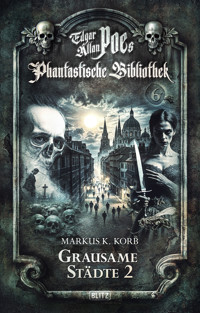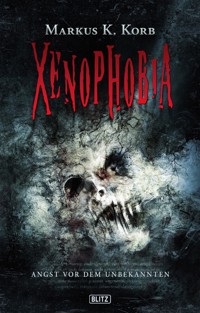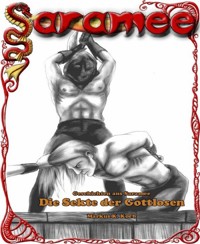Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amrun Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Wenn die Rache aus dem Reich der Toten kommt … Wenn im Genfer See ein grauenhafter Fund gemacht wird … Wenn japanische Geister nach dem Leben trachten … Wenn verhüllte Dinge Schauer über den Rücken jagen … Wenn nachts im Riesenrad schicksalshafte Begegnungen lauern … … dann ist die Zeit reif für Spuk! Unheimliche Erzählungen von Markus K. Korb.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 272
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Spuk!
Unheimliche Erzählungen von Markus K. Korb
© 2017 Amrûn Verlag
Jürgen Eglseer, Traunstein
© der Kurzgeschichten bei den jeweiligen Autoren
ISBN – 978-95869-563-4
Cover- und Umschlaggestaltung: Mark Freier
Lektorat & Korrektorat: André Piotrowski
Alle Rechte vorbehalten
Besuchen Sie unsere Webseite:
http://amrun-verlag.de
Bibliografische Information der Deutschen
Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese
Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte
bibliografische Daten sind im Internet unter
http://dnb.d-nb.de abrufbar
INHALT
Vorwort von Constantin Dupien
Nachtgespenst
Grafik von Bastian Wechsung
Genius Loci
Grafik von Björn Craig
Kein Blick zurück
Grafik von Kim Davey
Gespenstersommer 1816
Grafik von Björn Craig
Halb und halb
Grafik von Bastian Wechsung
Die Versuchung des Widersachers
Grafik von Peter Davey
Spukzeit – ein Märchen
Grafik von Björn Craig
Das Grauen nach der Völkerschlacht
Grafik von Kim Davey
Kinder, einem Fesselballon nachlaufend
Grafik von Bastian Wechsung
Das Lied der Äolsharfen
Grafik von Kim Davey
Zwiespalt
Grafik von Bastian Wechsung
Nachts im Separee
Grafik von Peter Davey
Verhüllte Dinge
Grafik von Björn Craig
Nachts im Riesenrad
Grafik von Peter Davey
Die Quote
Grafik von Peter Davey
Der letzte Flug der Enola Gay
Grafik von Kim Davey
Nachwort und Danksagung
VORWORT
Markus K. Korb.
Das ist in meinen Augen mehr als ein bloßer Name – das ist eine Aussage. Ein Versprechen. Nicht nur für mich, sondern für viele Freunde von Horrorgeschichten. Ein Markus K. Korb schürt Erwartungen bei seinen Lesern.
Doch dazu später mehr.
Zu Beginn möchte ich gern ein wenig zurückdenken. Daran, wie mir dieser Name das allererste Mal begegnet ist. Es mag mittlerweile bestimmt sieben oder acht Jahre her sein, als ich auf dem Agra-Flohmarkt in Leipzig gelangweilt in einen Wühlkarton mit verstaubten, zum Teil recht zerfledderten Büchern griff. Zufällig (oder war es Schicksal?) zog ich die Anthologie Jenseits des Hauses Usher zwischen wahllos einsortierten Kochbüchern, Schmonzetten, Krimis und Groschenromanen hervor.
Laut Untertitel auf dem Frontcover handelte es sich bei dem Buch um eine Hommage an Edgar Allan Poe, herausgegeben von eben jenem Markus K. Korb.
Nicht nur das Cover macht einen sehr guten Eindruck. Vor allem der von Markus verfasste Klappentext zog mich sofort in den Bann. Er schrieb von menschlichen Abgründen und versprach den Lesern makabre, teils groteske, aber stets unheimliche Begebenheiten. Warnte davor, in einen Strom aus phantastischen Visionen gezogen zu werden und in einen Strudel des Grauens zu geraten, der einen an den Rand der Wirklichkeit führe.
Ich überlegte nicht lange und schlug begeistert zu. Der Händler verlangte einen Euro. Ein echtes Schnäppchen also, bei dem nicht nachverhandelt werden musste ...
Die Geschichten der illustren Autorenriege –Markus selbst steuerte neben dem Vorwort sowie kurzen Einführungstexten auch eine eigene Erzählung bei – weckten in mir die Liebe zur Phantastik.
Fortan tauchte ich immer tiefer ein in die Welten des klassischen Horrors, verfolgte aber auch interessiert das weitere Schaffen von Markus K. Korb und anderen deutschsprachigen Autoren wie zum Beispiel Uwe Voehl, Arthur Gordon Wolf und Vincent Voss, um nur einige zu nennen.
Meine Gier war geweckt – erst als reiner Leser, später auch als Erschaffer düsterer Welten.
Wenige Jahre nach diesem ,verhängnisvollen‘ Flohmarktbesuch, im Herbst 2012, war es erstmals an mir, geeignete Autoren für eine eigene Anthologie zu finden.
Ich hoffte, Markus K. Korb für das Projekt gewinnen zu können und schrieb ihm eine E-Mail, trug ihm mein Konzept vor und erzählte, weshalb ich ihn unbedingt dabeihaben wollte.
Es dauerte nicht lange, bis ich eine Antwort erhielt. Markus war sofort Feuer und Flamme und freute sich, bald mit einem »jungen Enthusiasten« zusammenzuarbeiten.
Nach einigen digitalen Briefwechseln entschieden wir uns, seine Kurzgeschichte Karussells auf Rummelplätzen, die bereits zum damaligen Zeitpunkt seit über einem Jahrzehnt nicht mehr erhältlich war, neu aufzulegen. Sie passte perfekt zum Buch und bildete außerdem den Auftakt zu einer kreativen, freundschaftlichen Zusammenarbeit, die bis heute anhält.
In einer der vielen E-Mails, die wir uns hin und her schrieben, richtete er zum Abschluss folgende Zeilen an mich:
»Es braucht Menschen wie dich, welche die Phantastik-Landschaft hierzulande mit ihrem Geist beleben und weiterbringen. Weiter so!«
Diese motivierenden Worte, lieber Markus, werde ich nie vergessen. Gern erinnere ich mich daran zurück. Sie haben mich mit Stolz erfüllt und tun dies noch immer. Mit diesen Zeilen möchte ich dir etwas davon zurückgeben. Denn deine Geschichten halten die Fahnen der Phantastik hoch erhoben. Mit immer neuen Ideen und kreativen Projekten belebst du das Genre selbst wie kaum ein Zweiter.
Inspiriert von Poe und Lovecraft, hast du deinen eigenen Stil gefunden, den du meisterlich über die unterschiedlichsten Themen, Epochen, Dimensionen und historische Schauplätze stülpst.
Auch ich sage dir: »Weiter so!«
Und Sie, liebe Leserinnen und Leser, überzeugen sich nun am besten selbst, wovon ich spreche.
Es sei nicht zu viel verraten, wenn ich Ihnen garantiere, dass Markus K. Korb Sie in den folgenden sechzehn Geschichten mit auf eine Reise durch Raum und Zeit nehmen wird, bis hin an den Rand der Wirklichkeit.
Sie werden menschliche Abgründe in Tokio, Cornwall und Paris erkunden. Es erwarten Sie makabre, stets unheimliche Begebenheiten in stattlichen Herrenhäusern, auf Friedhöfen oder inmitten wilden Kriegsgetöses.
Seine stets mühsam recherchierten Blicke in die Vergangenheit verwandeln historische (Schein-?) Wahrheiten in phantastischen Visionen.
Er findet das Groteske in den Seelen von Kindern, Immobilienmaklern und Kriegsveteranen.
Doch Vorsicht, der Strudel des Grauens übt einen gefährlichen Sog aus, dem sie sich nicht entziehen werden können.
Ein echter Korb eben, damals wie heute. Eine Aussage. Ein Versprechen an die Leser, das eingelöst wird.
Viel Lesefreude mit den neuesten Korbschen Geschichten wünscht herzlichst
Constantin Dupien
Im Januar 2017
NACHTGESPENST
Ich fließe geräuschlos in dein finsteres Zimmer. Es ist nachts um 4 Uhr, und obwohl du mit dem Gesicht zur Wand liegst, weißt du, dass ich da bin.
Du spürst es in deinem Rücken. Eine Kälte, die auf deinem Unterhemd brennt, sodass du meinst, auf deinem Rückgrat würden sich weiße Froststellen bilden. Das bin ich. Dieses Gefühl geht von mir aus.
Du hast es schon lange nicht mehr gespürt. Damals, als du noch ein Kind warst, war ich dein ständiger Begleiter – in langen durchwachten Nächten voller Furcht, als du einsam unter der Bettdecke gezittert hast. Doch du warst nie einsam.
Stets war ich bei dir gewesen.
Dachtest du wirklich, die Angst käme von den Comics oder den Büchern, die du gelesen hast?
Das wollten deine Eltern dich glauben machen. Damit du deine Furcht verarbeiten kannst. Aber das stimmt nicht!
Die Angst kam durch mich.
Ich bestehe aus ihr, strahle sie aus, senkte sie in dein kleines Kinderherz.
Wie du dich an dein Metallkreuz klammertest, das du zur Erstkommunion erhalten hattest! Wie süß! So hilflos. Nutzlos. Hättest du die Augen geöffnet, wärst du schon damals mein gewesen. Auch mit umklammertem Kreuzchen.
Aber nein. Du musstest ja stets unter die Bettdecke kriechen, die Augen fest zusammengepresst, die Hände drückten das Kreuz an die bebende schmächtige Brust.
Und dazu das Beten, ja mit Inbrunst hast du gebetet: „Vater im Himmel, beschütze mich. Lass es mir gut gehen, Amen.“
Ach, wie demütig.
Doch jetzt bist du erwachsen und hast schon lange die Gebete vergessen.
Jetzt gehörst du mir!
Na komm, dreh dich um! Es hat doch keinen Zweck. Wir beide wissen, dass du es tun wirst. Du wirst dich umdrehen und mich anschauen.
Und dann wird mein Anblick dich in den Wahnsinn treiben. Was dann geschehen wird? Nun, manche vergraben ihre Fingernägel in den Augenhöhlen und reißen sich die Augäpfel heraus. Andere strecken ihre Zunge aus dem Mund und beißen sie anschließend mit einem kräftigen Biss ab.
Tja, man kann eben nie wissen, wie sich der Wahn auswirkt.
Willst du es wissen?
Mach schon! Dreh dich um und schau mich an!
Uns beiden ist klar, dass du nicht widerstehen kannst ...
Drum mach ein Ende.
Nach all den Jahren:
Schau.
Mich.
An!
GENIUS LOCI
Nur ein Narr leugnet die Existenz von Gespenstern. Nur, wer sein Leben leichtfertig auf Spiel zu setzen bereit ist, ignoriert die böse Aura, die als giftiger Brodem manche Orte umflort wie ein tödlicher Witwenschleier.
Das Halicon-Hochhaus ist so ein Ort. Einst erbaut, um mit seiner verspiegelten Plexiglasfront den hochtrabenden Plänen der in ihm arbeitenden Banker den Ausdruck von Stolz zu verleihen, ist nach dem Niedergang des Bankhauses nur noch zornige Arroganz verblieben.
Mein Bruder und ich hatten es uns als Spielplatz auserkoren. War es ein unbewusstes Spiel mit der Gefahr oder der Trotz gegen das elterliche Verbot, der uns diesen Ort als Spielplatz aussuchen ließ? Nirgendwo sonst konnten wir unserer Neigung zu gefährlichen Spielchen besser ausleben als hier. Ja, es war geradeso, als ob wir hier durch irgendetwas zu noch gefährlicheren Mutproben angestachelt würden. Auf einem Holzbrett auf dem Boden zu balancieren reichte nicht aus, es musste schon das Balancieren auf dem zwei Meter hohen, löchrigen Wellblechdach sein, welches den gemeinschaftlichen Fahrradständer vor Regen schützte. Oder ein Spaziergang auf dem Nebengebäude, das mit rissigem Eternit gedeckt war und jeden Moment einzubrechen drohte. Immer wagemutiger wurden wir, versuchten uns mit immer wilderen Taten zu überbieten und waren doch immer nur Getriebene von etwas anderem, das hier wohnte.
Heimlich kauften wir von unserem Taschengeld einen gewaltigen Dolch, wie er auch im Zirkus von Messerwerfern benutzt wurde. Ein grobes, wuchtiges, im Sonnenlicht blitzendes Ding, geschmiedet, um Aufmerksamkeit zu erheischen und geworfen zu werden.
Die Außenfassade war hierzu eine perfekte Zielscheibe. Mein Bruder und ich übten Zielwürfe – zuerst auf Fenster im Erdgeschoss. Der Dolch blieb zitternd im Glas stecken, das zwar knirschend in einem Spinnennetz aus Rissen splitterte, aber nie brach.
Wir steigerten uns von Tag zu Tag, von Woche zu Woche. Um den Dolch aus höher gelegenen Fenstern ziehen zu können, mussten wir ins Haus hineingehen. Dies gelang uns problemlos durch die zerbrochene und schief in den Angeln hängende Eingangstür. Im Dunkeln lief dann derjenige, der geworfen hatte, hoch in die leeren Büroetagen und öffnete eines der Fenster, um dann bequem den Dolch herauszuziehen.
Wir waren schlussendlich im letzten Stock angelangt. Der Weg dort hinauf erwies sich als besondere Mutprobe. Keiner von uns rannte hinauf, ein jeder kämpfte gegen den Unwillen an, sich nach oben zu begeben und den Showdolch aus dem Fenster zu ziehen. Dabei war die oberste Etage nicht anders als die übrigen Stockwerke. Aber irgendetwas war an der Aura dort oben ungewöhnlich.
Böser.
Gemeiner.
Hinterhältiger.
So als ob dort oben das faulige Herz des zerfallenden Hochhauses vor sich hin rottete und faserartige Gifttentakel über das Treppengeländer hinabschlängelte, wie eine aus dem Jenseits angeschwemmte riesige, stinkende Qualle, die nun in der Realität festsaß und zornentbrannt nach Mitteln und Wegen suchte, ihre Existenz aus der Monotonie der grauen Londoner Tage und der Langweile des Immergleichen zu befreien.
Der Weg zurück durch das leere und nur von einem weit entfernten Oberlicht düster beleuchtete Treppenhaus war stets unheimlich. Von überall hörte man Geräusche, deren Quellen feststellbar waren, und ein geisterhafter Wind fuhr einem in den Nacken. Manchmal meinte ich, dass mich hallende Schritte auf einer der Etagen über mir einholten, und beeilte mich schneller zu werden. Doch sie holten auf, egal wie schnell ich wurde. Da stolperte ich und fiel ... gottlob in die Arme meines Bruders, der schon – einer inneren Eingebung folgend – mir ins Haus gefolgt und entgegengelaufen war. Nicht auszudenken, was geschehen wäre, wenn er nicht hier gewesen wäre ...
Eines Tages war ich allein vor dem Hochhaus. Der Lattenzaun hinter mir schirmte mich gegen die Nebenstraße des Eastends ab. Arbeiter hatten ihn errichtet, um den geplanten Abriss der Öffentlichkeit anzuzeigen. Das Schild mit der Warnung an die Eltern, dass sie ihre Kinder nicht hier spielen lassen durften, war ebenfalls dort angebracht.
Mein Bruder lag daheim krank im Bett und wand sich in grauenhaften Fieberträumen. Er griff mit zittrigen Händen nach mir, wollte mich nicht gehen lassen, aber meine Mutter bestand darauf, dass ich das Haus verließ. Ich sollte nicht ebenfalls krank werden.
Ich hatte den Dolch mitgenommen. Eher lustlos warf ich einige Male gegen die Fassade. Nicht sehr hoch. Nur in den zweiten Stock.
Und dann trat das Mädchen aus dem Schatten des Wellblechs, das sich über dem gemeinschaftlichen Fahrradständer spannte.
Es trug ein weißes Kleid, lang bis zum Boden. Blonde Haare, deren Locken wild im Wind wehten, obgleich sich hinter dem Lattenzaun kaum ein Lüftchen regte. Blasses Gesicht, Augenhöhlen, schwarzen Schlünden gleich. Ein Strich als Mund.
Wortlos schritt es an mir vorbei auf das Hochhaus zu. Es wandte nicht den Kopf oder gab mir mit einem Laut zu verstehen, dass es irgendeine Notiz von mir nahm. Nein, es beachtete mich nicht. Ja, mehr noch – es schien nicht die Fähigkeit zu haben, irgendeine Existenz außer der eigenen wahrzunehmen. Mir kam es so vor, als laufe es umgeben von seinem eigenen Realitätskontinuum an mir vorbei und verschwand im Halicon-Hochhaus.
In diesem Moment spannte sich etwas in mir. Mein Rücken drückte sich durch, mein Kopf hob sich, der Blick fror nach vorne fest. Die Brustmuskeln verspannten sich so, dass mir das Atmen schwerfiel. Die Spannung erfasste auch meine Arme bis hin zu den Fingerspitzen – ich presste die Arme an den Körper und drückte sie in Richtung Boden, spreizte dabei die Finger weit, bis ich das Gefühl hatte, sie würden abbrechen.
Und da wusste ich: Genau so ist es immer ...
Derart verkrampft folgst du dem Mädchen ins Gebäude. Sie läuft stets mehrere Stufen voraus, ist schon auf dem ersten Absatz, als du ihr nachfolgst. Diesen Abstand holst du weder ein noch fällst du zurück. Eure Distanz ist stets dieselbe, wie gefangen von einem unsichtbaren Zugband, das sich zwischen euch straff spannt.
Rissiger Beton unter deinen Füßen. Ein Luftzug durch wirr gebrochene Fenster, am Boden ein Mosaik aus staubbedeckten Splittern. Du läufst daran vorbei, nimmst es kaum wahr. Aber da ist etwas anderes. Und das zieht dich magisch an.
Eine Melodie ist da. Ein Summen, das durchs Treppenhaus schwebt. Wunderschön. Du willst sie erreichen, möchtest sie mit Händen umschmeicheln, die Melodie. Du willst die Sängerin kennenlernen, mit ihr reden, mit ihr spielen, für immer ...
Deine Füße treten auf vergiftete Mäuse, eingeringelt im Todeskampf. Du siehst mit Farbe beschmierte Wände, seltsame Muster. Geringelte Zeichen, an die Mauer gesprayt von einem fremdartigen Kult?
Auf der nächsten Etage siehst du Plastikplanen, die vor den Fenstern hängen. Sie tanzen im Wind wie die Angehörigen einer bizarren Religion. Am Boden liegen Fliegen und Asseln. Hunderte regungslose Insektenleiber. Ab und an zuckt ein Flügel.
Und dann bist du auf dem obersten Stockwerk. Ein Fenster steht offen. Ein Schreibtisch direkt davor. Wind weht dir durchs Haar. Es ist warm und angenehm. Sommer. Vögel singen draußen vor dem Fenster. Du willst zu ihnen. Und du weißt, dass draußen auch die Sängerin der Melodie ist. Ein weiterer Grund für dich, dorthin zu wollen.
Du steigst auf den Schreibtisch, du spürst die rissige Oberfläche unter deinen blanken Füßen, fühlst, wie sich dein weißes Kleid darin leicht verfängt. Dann fühlst du unter deinen Sohlen das kalte Metall des Fensterrahmens. Unangenehm bohrt sich die Schiene in dein weiches Muskelfleisch. Aber diese Empfindung vergeht, weil du nur noch Seligkeit verspürst, als die Melodie wieder ertönt.
Draußen ...
Und du lehnst dich nach vorn.
Jemand lockt dich: Weiter, komm weiter ...
Und du folgst seinem Drängen ...
Noch weiter lehnst du dich aus dem Fenster.
Und das ist der Moment, in dem der Ort seinen Bann löst und dich freilässt.
Jener Moment, in dem du dich so weit aus dem Fenster gelehnt hast, dass du das Gleichgewicht verlierst und erkennst, dass du abstürzen wirst.
Panik schießt durch deine Eingeweide, strömt durch deine Adern. Und daran ergötzt sich das Etwas dieses Ortes. Davon erhält es Atzung, davon lebt es. Danach ist es süchtig und will mehr davon haben. Und mehr ... und immer mehr!
Mit deiner Angst, deiner kreatürlichen, ungebremsten Angst ernährst du es. Es liebt die Todesangst der Menschen, saugt sie gierig ein. Es lädt seine Batterien wieder auf, sodass es erneut das Phantom des weißen Mädchens erzeugen und andere Opfer damit wie mit einer Marionette hinauf in den obersten Stock locken kann.
Wieder und immer wieder.
So war es schon bei mir, als ich meinen kranken Bruder verließ, um auf der Abriss-Baustelle meinem eigenen Doppelgänger zu begegnen, und so wird es auch bei dir sein ...
KEIN BLICK ZURÜCK
Non, Rien de rien
Non, je ne regrette rien.
Ni le bien qu’on m’a fait
Ni le mal tout ça m 'est bien égal!
Non, Rien de rien
Non, je ne regrette rien.
Nein, gar nichts
Nein, ich bedaure nichts.
Nicht das Gute, das mir widerfahren ist
Nicht das Schlechte, all das ist mir egal!
Nein, gar nichts
Nein, ich bedauere nichts.
Edith Piaf, »Non, je ne regrette rien«, 1960
Durch die mit Leichengeruch geschwängerte Nachtluft schwebte Edith Piafs trotziger Gesang gleich einem Mantra in Dauerschleife. Das Lied ertönte aus Bernds altem Kassettenrekorder, der neben der Kaffeemaschine auf dem Aktenordnerschrank stand. Es war das Lieblingslied seiner Mutter gewesen. Seit ihrem Tod hatte es auch für ihn eine besondere Bedeutung. Das war auf den Tag drei Jahre her.
Bernd saß in dem kleinen Büro, kaute Kaugummi und blickte durch die Glasscheibe hinaus auf den düsteren Flur der Morgue, die in diesem Dämmerlicht einer halbdunklen Gebärmutter glich. Sein Spiegelbild starrte zurück: braunes Haar, das an den Schläfen schon zurückwich; dazu blaue Augen, tiefe Schatten darunter und eingefallene Wangen. Die vielen Nachtschichten forderten ihren Tribut.
Draußen vor dem Büro tröpfelte das Licht auf das Linoleum, schimmernd wie aus einem Eimer dahingegossen. Ganz am Ende des Flurs, jenseits der vielen Türen, floss ein Lichtschimmer in die Gegenrichtung auf das Büro zu. Er sickerte aus einer hohen Reihe von Glasbausteinen, welche vom Flur bis zur Decke reichte. Dahinter erhoben sich in einiger Entfernung die Leuchtmasten der Stadtautobahn und verstreuten ihr orangefarbenes Licht.
Bernd erhob sich schwerfällig. Es war Zeit für den stündlichen Rundgang. Sein weißer Pflegeroverall spiegelte sich in der Türglasscheibe. Bernd hatte keine Ahnung, warum die Krankenhausleitung darauf bestand. Wen sollte er denn hier im Leichenschauhaus pflegen?
Und dieser stündliche Rundgang diente auch nur dazu, dass man ihn gängelte, so mutmaßte Bernd. Dennoch war er gezwungen alle Räume der Morgue aufzusuchen, um sich dort elektronisch anzumelden. Dementsprechend genervt schlurfte Bernd jede Nacht durch die Morgue.
Bernd trat auf den Flur. Den Bewegungsmelder neben der Tür überklebte er mit seinem Kaugummi. Bernd hasste grelles Licht. Er liebte es, im Halbdunkel zu laufen. Die vielen Schatten verliehen dem Flur etwas Unheimliches. Sie entrückten ihn der Realität, verkleideten seine Profanität mit dem Mantel der Phantasie. War das da drüben vielleicht eine viel zu schlanke Gestalt, die am Türrahmen lehnte? Und da hinten – kauerte da nicht eine Bestie mit Katzenbuckel hinter dem Pflanzkübel? In der absoluten Gewissheit, dass dem nicht so war, überlief Bernd ein wohliger Schauer. Er war in Sicherheit, wie in einer halbdunklen Gebärmutter.
Er hob die Nase in die Luft und schnupperte. Die Techniker der Belüftungsanlage gaben ihr Bestes, um es durch beigemischte Aromen zu verdecken. Aber er konnte es dennoch riechen. Es roch nach toten Menschen hier. Klebrig legte sich der Geschmack auf die Zunge, bitzelte dort schwach wie alt gewordene Brause. Der Speichel sammelte sich im Mund, man wollte ihn vor Ekel nicht schlucken. Doch irgendwann war es so weit und dann schmeckte er bitter.
Bernd unterdrückte mühsam den Würgereiz, spuckte Schleim auf den Boden und schob sich einen weiteren Kaugummi in den Mund. Die Pfefferminze vertrieb den Formalingeschmack in der Mundhöhle.
Mit hängenden Schultern lief der Nachtwächter hinüber zum ersten Raum: dem Autopsie-OP. Um seinen Hals hing eine Plastikkarte. Bernd griff sich die Karte und zog sie durch den Scanner neben der Tür. Nun ließ sich die Tür öffnen.
Die Bewegungsmelder ließen die Neonröhren an der Decke aufblitzen. Sie flackerten kurz, dann stand ihr Licht und klatschte gegen die kahlen Kacheln und die Autopsietische aus Edelstahl mit angeflanschten Waschbecken. Zwei davon waren mit Rollen versehen.
Die gesamte rechte Wand diente der Aufbewahrung der Toten. Quadratische Klappen, wohinter sich ausziehbare Stahlböden auf Schienen befanden. Bernd hatte sie schon mal offen gesehen. Sie erinnerten ihn an Schubladen. Schubladen für tote Menschen.
Er strich mit den Fingerkuppen an ihnen entlang, während er zum Terminal an der gegenüberliegenden Wand lief. Er fühlte das kalte Metall. Es erregte ihn.
Der Nachtwächter zog die Karte durch den Scanner. Das Gerät piepte als Zeichen, dass es die Karte gelesen hatte.
Wie Bernd das Geräusch des Scanners hasste. Überlaut echote es in dem gekachelten Raum. Der Nachtwächter hatte in diesem Moment stets das Gefühl, dass die Toten sich in ihren dunklen Schlafzimmern unruhig drehten, gestört vom lauten Signal des Kartenscanners. Nervös beschleunigte er auf dem Rückweg seine Schritte. Ohne Vorkommnisse erreichte er die Tür und trat hinaus auf den Flur.
Als sie sich automatisch verriegelte, sperrte sie gleichzeitig das obszön grelle Neonlicht aus und Bernd stand wieder im Dunkeln. Erleichtert atmete er tief ein und aus. Dann wandte er sich dem nächsten Raum zu.
Aus den Augenwinkeln sah er die Gestalt und wandte den Kopf. Sie stand vor der Wand aus Glasbausteinen und rührte sich nicht.
Bernd zwinkerte ein paarmal, um sicherzugehen, dass er nicht halluzinierte. Aus dem Büro schwebte Edith Piafs trotziger Gesang und verbreitete sich fächerförmig im Flur bis hin zur schimmernden Wand aus Glasbausteinen.
Der Umriss war immer noch davor. Klein war er. Hochgezogene Schultern, der Kopf in schiefem Winkel nach vorn gebeugt. Die dürren Arme hingen kraftlos herab. Zwei rote Augen glommen im unsichtbaren Gesicht.
»Was machen Sie hier? Wie sind Sie hier hereingekommen?«
Das wollte Bernd fragen, aber es kam nur ein Krächzen aus seinem Mund. Der Grund dafür war, dass er die Gestalt zu erkennen glaubte. Nur aufgrund ihres Umrisses. Er war ihm vertraut. Schrecklich vertraut ...
Seine Selbstsicherheit fiel von ihm ab wie Schlacke. Bernd nässte sich zum ersten Mal seit Jahren wieder ein. Er fühlte, wie es warm und feucht im Schritt wurde, und schämte sich. Seine Augen weiteten sich, das Kinn zitterte, der Atem wurde ihm ruckweise aus den Lungen gezogen und kondensierte vor seinem offenen Mund.
In Panik machte er auf dem Absatz kehrt und rannte ins Büro. Dort verrammelte er die Tür mit dem Stuhl. Unter weinerlichem Gejammer kroch er unter den Tisch, über dem die Fensterscheiben auf den dunklen Flur blickten.
»Non, je ne regrette rien!«, sang Edith Piaf und Bernd wiederholte es auf Deutsch: »Nein, ich bereue nichts!«
Da war ein Kratzen über ihm. Ein Kratzen wie von Fingernägeln auf Glas. Finger, die an der Scheibe entlangstreiften. Jeder einzelne suchte ihn.
Plötzlich schlug etwas gegen die Bürotür, der Stuhl wurde umgeworfen, die Glühbirne explodierte und Splitter regneten herab. Schlagartig wurde es dunkel. Und nachdem das Klirren des Glases verklungen war, sang Edith Piaf weiter.
»Non, Rien de rien ...«
Bernd fühlte die Kälte, die hereingekommen war. Sie biss ihm in die Haut und ließ die Nase tropfen. In der Brust wurde ihm kalt und sein urinnasser Penis fühlte sich an wie ein Eiszapfen. Und gemeinsam mit dem Frost war etwas gekommen, das schrecklicher war als die Kälte. Es trat mit langsamen Schritten auf knirschende Glassplitter.
Bernds Zähne schlugen aufeinander. Er konnte nichts sehen, roch aber die Fäulnis, die von dem Ding ausging. Es hatte lange in einem feuchten Grab gelegen. Würmer krochen über Bernds Hände. Sie mussten aus dem fauligen Wesen gefallen sein. Er biss sich auf die Zunge, um nicht aufzuschreien.
»Nein, ich bereue nichts!«
Ein Leichenhemd rauschte und Bernd mutmaßte, dass sich das Wesen hinkniete und nun höchstens eine Armlänge vor ihm entfernt war. Der Gestank ließ ihn würgen. Er hielt die Luft an und dachte angestrengt nach: »Wieso sollte ich bereuen? Sie war doch krank. So sehr krank! Monatelang saß ich an ihrem Bett im Krankenhaus. Sie war regungslos, teilnahmslos. Mit keinem Zucken der Augäpfel unter den geschlossenen Lidern verriet sie mir, dass sie meine Stimme hörte. Das war nicht mehr sie – da waren nur piepsende Maschinen. Und Schläuche. Überall Schläuche. Die Ärzte gaben mir keine Hoffnung, dass sie je wieder erwachen würde.«
Bernd liefen Tränen über das Gesicht. Edith Piaf weinte mit ihm.
»Tag für Tag das ansehen zu müssen und niemanden zu haben, der meinen Schmerz teilt. Niemand, mit dem ich reden konnte, außer Ärzten und Krankenschwestern. Aber bei denen geht es nur um das Technische: Durch die künstliche Beatmung ist die Nase wund, wir müssen auf eine Atemmaske umstellen ... Es sammelt sich Wasser in der Lunge, wir müssen es abpumpen ... Bei der Magensonde hat sich Eiter gebildet, wir müssen es abschmieren ...
Das war doch menschenunwürdig! Und dann kam die Nacht, in der alle wegschauten: Ärzte, Schwestern und Pfleger. Ich habe es gespürt damals. Alle schauten weg. Ich blieb stundenlang mit ihr allein ...«
Ein hohles Stöhnen wehte den Gestank von feuchter Erde und Verwesung unter den Tisch. Bernds Brustkorb wurde von Weinkrämpfen geschüttelt. Rotz lief ihm in langen Schlieren aus der Nase.
»Und da hab ich sie angeschaut. Lange angeschaut. Und irgendwann hab ich ihr Gesicht nicht mehr wiedererkannt. Die Krankheit hat sie ausgezehrt. War schlimm anzuschauen. Das war der Moment, als sie mir fremd geworden ist.«
Es raschelte und das Ding kroch unter den Tisch. Bernd zuckte unkontrolliert, stieß sich mit den Füßen ab. Aber da war hinter ihm die Wand. Er konnte nicht mehr weiter zurück und schlug mit dem Kopf gegen die Tischplatte. Bernd sah im Geiste einen dürren Finger in weniger als einer Armlänge vor sich, der vor wunde Lippen gehalten wurde, wohinter faulig schwarze Zähne einen ungesunden Brodem ausdünsteten.
Bernd stammelte zwischen Schluchzern. »Aber, aber ich wollte doch nur dem Leid ein Ende setzen! Ich weiß bis heute nicht, wie meine Hand auf dein Gesicht kam. Glaub mir! Hab die Nase und den Mund zugehalten. Ganz fest. Ich dachte, es wär leicht ...«
Er fühlte zwei kalte Hände auf den seinen. Er schluchzte laut: »Aber wie hätte ich wissen können, dass du dich aufbäumst, dass du mit den Schultern zuckst, dass du die Augen aufreißt und mich voller Angst vorwurfsvoll anschaust? Dass du noch Leben in dir hast, das gelebt werden will?«
Bernds Kopf sank ihm auf die Brust und er weinte hemmungslos. Da fanden zwei Hände seine Brust, tasteten sich nach oben. Die Hände wischten die letzten Reste der Selbstsicherheit von seinem Gesicht wie Käseschmiere von der Haut eines frisch geborenen Säuglings ...
***
»Wie ist so etwas möglich?«
Der junge Polizeibeamte strich sich eine blonde Locke unter die Dienstmütze. Hinter ihm kniete sich jemand nieder. Ein Blitz tauchte das Büro in grelles Licht.
Der tote Nachtwächter war unter dem Tisch eingezwängt. Nach hinten verdrehte Augen, die Zunge hing ihm schwarz verfärbt seitlich aus dem Mund. Seine Hände waren um den Hals gekrallt. Die Finger im Nacken, die Daumen vorn auf dem Kehlkopf.
Ein zweiter Polizist, nur wenige Jahre älter, legte seinem Kollegen die Hand auf die Schulter. »Tja, es gibt die seltsamsten Mittel, um Selbstmord zu begehen. Aber ich gebe zu – das hier ist so ziemlich das Krasseste, was ich gesehen habe. Komm, wir rufen die Kripo!«
»Warte!« Der blonde Polizist hielt seinen Kollegen am Arm fest. »Schau dir mal das an!«
Zunächst wusste der ältere Polizist nicht, was er meinte. Doch dann sah er den Schatten und nahm die Taschenlampe zu Hilfe.
Unter den Daumen erkannte man auf dem Hals des Toten die violetten Abdrücke von zwei schmalen Händen ...
GESPENSTERSOMMER 1816
In einer dunklen und stürmischen Nacht
Als die Taucher die modrige Kiste aus den Tiefen des Genfer Sees holten, ahnten die Polizisten noch nicht, welch wertvollen Schatz sie da gehoben hatten. Die Kiste war ein Zufallsfund gewesen.
Eigentlich suchte man nach einem Selbstmörder, der mitten auf dem See von Bord gesprungen war und die Eigner der Segeljacht verstört zurückgelassen hatte, da sie zuschauen mussten, wie er mit erhobenen Händen ertrank.
Stattdessen also nun diese Kiste.
Beim Öffnen fand man ein gutes Dutzend, dick in mehrere Lagen Leder eingeschlagene Bücher. Die enge und großzügige Umwickelung hatte das Papier weitgehend vor dem zerstörerischen Wasser bewahrt, wozu auch das Wachs seinen Teil beigetragen hatte, welches die Klappe der Kiste – offensichtlich eine alte Seemannskiste aus dem 19. Jahrhundert – abgedichtet hatte.
Aber wie erstaunt waren die Behörden, als sie die geschwungene Schrift entziffert hatten. Es handelte sich bei den Büchern um nichts Geringeres als die Aufzeichnungen jener berühmten Schar junger Engländer, die im Jahr 1816 jenen denkwürdigen Sommer in der Villa Diodati verbracht hatten: Mary Godwin, Percy Shelley, Lord Byron, Claire Clermont und John Polidori.
In jenem Sommer waren zwei literarische Gestalten der unheimlichen Literatur entstanden, welche bis heute aus Büchern, Filmen und anderen Medien nicht mehr wegzudenken sind. Mary Godwin Shelleys Frankenstein und John Polidoris moderner Vampir, der in Form eines dandyhaften Gentlemans den Iren Bram Stoker zu Dracula inspirierte.
Da ich – in aller Bescheidenheit – als Experte auf dem Gebiet der Schwarzen Romantik gelte, wandten sich die Genfer Behörden durch einen Mittelsmann an mich. Der Kontakt kam über den Grafiker Björn Craig zustande. Er hatte während der Grafikausbildung ein Semester in Genf verbracht und mich dort aufgrund seiner Leidenschaft für die phantastische Literatur kennengelernt. Unter großen Auflagen erhielt ich Abschriften und Kopien der Originalmanuskripte.
Ich inspizierte die Tagebücher gründlich. Nach sorgfältigen Untersuchungen kam ich zu dem Schluss, dass ich sie für authentisch halte. Mir ist klar, dass es sich dabei um eine literarische Sensation handelt. Wir müssen umdenken: Nach über 200 Jahren wird die Geschichte dieser Nacht, als Frankenstein geboren wurde, im Jahr 2016 neu geschrieben werden müssen.
Ich präsentiere Ihnen nun die Tagebücher der illustren Reisegesellschaft, welche die Ereignisse des Sommers 1816 in chronologisch geordneter Reihenfolge wiedergeben.
Es wird manches Ihnen exzentrisch oder gar abstoßend vorkommen. Von daher seien Sie gewarnt. Die Lektüre ist nichts für schwache Nerven. Doch der literarisch-historisch Interessierte wird sich davon nicht abhalten lassen.
Markus K. Korb im August 2015
***
Notiz von Mary Shelley, 17.6.1816, nachts auf dem Genfer See
Ich schreibe dies mit schwerem Herzen, während mein geliebter Percy die Kiste mit einem Seil an die Tote bindet, so wie unser aller Schicksal mit dieser Tragödie verknüpft ist, welche sich in der Nacht in der Villa Diodati und dem angrenzenden Wald ereignet hat.
Es hätte niemals so weit kommen dürfen, doch Lord Byron, den ich bis heute Nacht bewundert hatte, hat gemeinsam mit John Polidori einen Plan ersonnen und in die Tat umgesetzt, der weitaus mehr Hybris enthält als alle Zeilen von Miltons Paradise Lost.
Das grausame Ergebnis liegt nun hier: eine Leiche, eingewickelt in einen Teppich aus der Villa Diodati und beschwert mit Steinen.
Im Osten beginnt schon der neue Tag heraufzuziehen. Merkwürdig, dass dies trotz der nächtlichen Ereignisse geschieht, trotz unserer Überheblichkeit und Arroganz dem Werk des Schöpfers gegenüber und seinem Willen. Denn wir haben uns versündigt, das ist mir nun klar. Ich, die Tochter eines Freigeistes und einer Frauenrechtlerin, fürchte die Kälte eines Gottes, an den ich nicht glaube? Wie paradox und dennoch ist es wahr.
Mein armes Söhnchen, William! Du warst doch nur wenige Monate alt und musstest schon solche Dinge erleben! Es zerreißt mir das Herz!
Wir müssen uns beeilen. Von daher nur wenige Zeilen noch.
Wir haben beschlossen all unsere Aufzeichnungen in die Kiste zu geben und diese gemeinsam mit der Toten an einer Stelle zu versenken, wo der See besonders tief ist. Möge man erst nach unserem Tod jene Schriften finden, die Auskunft über unsere Missetaten geben.
Einen heiligen Eid schworen wir uns, nichts über die grauenhaften Ereignisse dieser Nacht der Nachwelt zu berichten. Einzig und allein die Diskussionen, der Schreibwettbewerb und derlei Unverfängliches sollte überliefert werden.
Insgeheim sehne ich mich nach einer Beichte, daher habe ich durchgesetzt, dass wir unsere Aufzeichnungen nicht verbrennen, sondern versenken. Sollte man die Kiste irgendwann finden, dann möge die Nachwelt über uns richten!
Tagebuch Claire Clermont, 13. Juni 1816, 10 Uhr
Was für ein herrlicher Morgen!
Die Sonne scheint auf den See und lässt seine Oberfläche wie Diamanten glitzern. Heute werde ich meinen Augenstern wiedersehen. Meinen größten Schatz, meinen Gott – Lord Byron. Gestern Abend sind wir in Cologny angekommen. Percy hat das kleine Maison Chapuis gemietet. Gottlob konnte ich die beiden zu dieser Reise überreden. Ich freue mich, ich freue mich so sehr!
Nun schreibe ich auf dem Segelboot. Wir haben unser angemietetes Haus verlassen und uns durch eine Traube von Menschen durchgedrängelt, die am Ufer standen und mit Ferngläsern in Richtung Villa Diodati spähten. Sie wollten alle nur eines: Ihn sehen, Lord Byron. Die Urlauber am Genfer See wollten einen Blick auf das Monster werfen, das England wegen der Inzestgerüchte rund um ihn und seine Halbschwester Augusta fluchtartig hatte verlassen müssen. Er ist eine Berühmtheit. Jetzt sogar noch mehr! Und ich werde ihn mir holen!
Ich sitze mit Mary im schaukelnden Boot, Percy rudert. Die Villa am Ufer wird langsam immer größer. Das Gelände steigt steil zu ihr an. Wir werden einen kräftigen Fußmarsch hinauf machen dürfen!