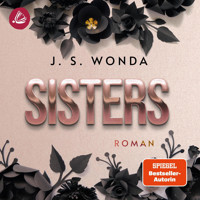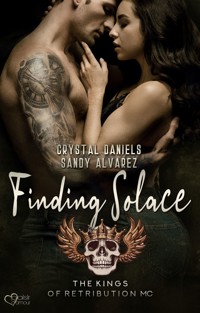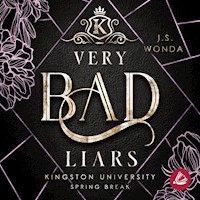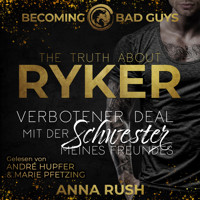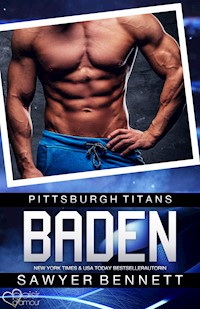3,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Er ist dominant und distanziert – aber schlägt sein Herz für sie? Der prickelnde Liebesroman »Hot Boss Kisses« von Kaila Kerr als eBook bei dotbooks. Für die junge Pariserin Lilou erfüllt sich ein Traum, als sie vom Herausgeber einer bekannten Modezeitschrift als Assistentin eingestellt wird. Doch ihr neuer Boss, der ebenso attraktive wie herrische Chefredakteur Mero, begegnet Lilou zunächst mit offener Feindseligkeit. Trotzdem gibt sie nicht auf und kommt ihrem dominanten Boss immer näher – bis er Lilou eines Abends in einen exklusiven Club entführt und sie erkennt, wie viel Lust sie erfahren kann, wenn sie sich ihm völlig hingibt. Und obwohl Mero geschworen hat, nie Gefühle ins Spiel zu bringen, spürt sie, wie das Eis um sein Herz langsam zu schmelzen beginnt ... Jetzt als eBook kaufen und genießen: Die Hot Romance »Hot Boss Kisses« von Kaila Kerr wird Fans der Bestseller von Vi Keeland und K. I. Lynn begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 408
Ähnliche
Über dieses Buch:
Für die junge Pariserin Lilou erfüllt sich ein Traum, als sie vom Herausgeber einer bekannten Modezeitschrift als Assistentin eingestellt wird. Doch ihr neuer Boss, der ebenso attraktive wie herrische Chefredakteur Mero, begegnet Lilou zunächst mit offener Feindseligkeit. Trotzdem gibt sie nicht auf und kommt ihrem dominanten Boss immer näher – bis er Lilou eines Abends in einen exklusiven Club entführt und sie erkennt, wie viel Lust sie erfahren kann, wenn sie sich ihm völlig hingibt. Und obwohl Mero geschworen hat, nie Gefühle ins Spiel zu bringen, spürt sie, wie das Eis um sein Herz langsam zu schmelzen beginnt ...
Über die Autorin:
Kaila Kerr ist das Pseudonym einer Autorin, die bereits namhafte Veröffentlichungen aufzuweisen hat, sich mit Kaila Kerr jedoch in neue Gefilde wagt.
***
eBook-Neuausgabe Februar 2024
Dieses Buch erschien bereits 2014 unter dem Titel »Nights in White Satin« bei Knaur.
Copyright © der Originalausgabe 2014 Knaur eBook. Ein Imprint der Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG, München.
Copyright © der überarbeiteten Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-98690-924-6
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Hot Boss Kisses«an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Kaila Kerr
Hot Boss Kisses
Roman
dotbooks.
Wer über gewisse Dinge den Verstand nicht verliert, der hat keinen zu verlieren.
Gotthold Ephraim Lessing
Nights in white satin, never reaching the end.
The Moody Blues
Prolog
I
Der Blick aus seinen dunklen Augen gleitet über meinen Körper, nimmt jede noch so kleine Feinheit auf, und ich weiß, dass er in diesem Spiel genau diese Feinheiten sucht, um sie für sich zu nutzen. Seine Hand liegt auf meinem Haar. Schwer und warm. Ich fühle mich sicher und beschützt, denn ich weiß, er wird nichts tun, was mir schadet. »Knie nieder«, befiehlt er mir, und ich gehorche. Einfach so. Niemals zuvor wäre ich einer solchen Aufforderung nachgekommen. Aber er befiehlt, und ich folge diesem Befehl, gehe vor ihm auf die Knie, empfange die seidene Augenbinde wie ein lang erwartetes Geschenk, berühre mit meinem Gesicht seine Beine, schließe voller Vertrauen meine Augen. Lasse den Moment auf mich wirken, denn ich weiß, dass dieser nur von kurzer Dauer sein wird.
Und richtig: Er löst sich von mir, geht um mich herum, lässt mich jedoch nicht unberührt. Immer in Kontakt, immer in sanfter Berührung. Er streicht mit seinem Finger an meiner Schulter entlang und hinterlässt eine warme Spur darauf. Mein Körper folgt dieser Berührung, und meine Arme gleiten wie von selbst auf meinen Rücken. Meine Hände umfassen sich wie eine Spange, und diese Berührung ist mein Ruhepol. Wie von Zauberhand geführt, spüre ich das raue Material des Seils, das er nun darum windet. Einmal, zweimal und noch einmal. Dann folgt der Ruck, und ich werde in diesem Spiel nur noch für ihn da sein. Nur sein. Zu seinem Vergnügen. Nur noch das tun, was er von mir verlangt. Mich fallen lassen in seine Arme, die mich auffangen. Seine Berührungen genießen, ohne nach dem Danach fragen zu müssen. Ich lege den Kopf in den Nacken, lasse mein Haar zurückfallen und schließe hinter meiner seidenen Maske die Augen. Er sieht nicht, wie ich diese Berührungen genieße. Aber er weiß es.
Er weiß alles. Über mich und meine Lust.
II
In der letzten oder vielleicht in der vorletzten Biegung der Loire, also kurz bevor dieser Fluss das Meer küsst und sich mit ihm vereinigt, da wo die Schiffe nur in der Mitte des Flusses fahren können, weil das Flussbett nur dort tief genug ist und sich die Kapitäne beinahe die Hand reichen könnten, wenn sie ihre Kähne aneinander vorbeilenken, in dieser Biegung also steht ein großes Anwesen.
Von Weitem sieht es aus wie ein Schmetterling, der gerade geschlüpft ist und seine Flügel ausbreitet. Wenn die Sonne an diesem Ort untergeht und scheinbar in der Loire versinkt, taucht sie dieses Anwesen in eine Mischung aus rotem und goldenem Licht. Dann glänzen die Seitenflügel des Hauses wie die hauchdünnen Flügel eines Seidenspinners.
Der Besitzer dieses Hauses hatte genau das im Sinn, als er seiner Frau dieses Anwesen genau hier schenkte. Es sollte ihre Traurigkeit, die sie immer mit sich trug, ein wenig mildern. Es sollte ihre Geschichte erzählen. Ihrer beider Geschichten. Sie hatten es nicht einfach, aber sie wollten ihre Herkunft nicht verleugnen. Diese beiden wollten zeigen, woher sie kamen, und ihr Zuhause sollte eine Verbindung zu ihren Wurzeln sein.
Weil sich hier zwei Familien, die unterschiedlicher nicht sein konnten, vereinigten, wurde die Suche nach einem Namen für dieses Anwesen ein schwieriges Unterfangen. Wie an der Loire üblich, sollte dieses Haus einen Namen bekommen, der seine Besitzer und deren Historie würdigte.
In vielen Nächten, in denen sie sich die Köpfe heißredeten, schrieben sie ihre Ideen auf, verwarfen sie wieder, lachten und stritten, bis sie sich irgendwann einig wurden.
Sie hatten den perfekten Namen für ihr neues, altes Zuhause gefunden.
La famille Saint-Mathieu dans la maison blanche en satin
Weil dieser Name aber viel zu lang war, um ihn jedes Mal auszusprechen, wurde er genau einmal verwendet. Er stand in großen Lettern über dem Eingang, in Stein gemeißelt. Denn so sollte diese Familie sein: unzerstörbar.
Ansonsten nannte man dieses Haus, das in der letzten oder vielleicht auch allerletzten Biegung der Loire von einem großen Garten umgeben lag, einfach nur das Manoir.
Teil 1
Kapitel 1: Lilou
Weißer Satin. Ich liebe weißen Satin. Ich liebe das Gefühl, wenn dieses leichte, luftige und seidige Gewebe meinen Körper umschmeichelt. Wenn es aus einem Mädchen, geboren in einem Pariser Vorort, eine Königin der Nacht macht. Zugegeben: Ich erlebe das erst seit ein paar Monaten, und ja, es hat etwas mit einem Mann zu tun. Er war es, der mir beinahe wie eine göttliche Erscheinung, in weißen Satin gekleidet, gegenübertrat, und mir wurde genau in diesem Moment bewusst, dass in meinem Leben etwas fehlte.
Es gab eine Zeit vor ihm. Ein Leben vor ihm. Bis zu dem Moment, an dem er in mein Leben trat – und dieser Augenblick gehörte nicht zu meinen rühmlichen –, war ich ein ganz normales Mädchen aus einem Pariser Vorort. Gerade mit meinem Studium fertig geworden, versuchte ich, mein erlerntes Wissen in mein Leben zu integrieren. Es fiel mir leicht, denn meine soziale Intelligenz wurde durch die Benotung meiner Leistungen an der Universität bestätigt. Und obwohl mein Privatleben keine »einzige wilde Party« war, hatte ich einen großen Freundeskreis, den ich hegte und pflegte. Ich mochte mein Leben so, wie es war, und dachte nicht, dass ich etwas vermissen würde. Ich hatte mir etwas aufgebaut, von dem ich wusste, dass es mir gehörte. Wie falsch ich lag, erkannte ich erst, als ich über meinen Tellerrand sah.
Dass der Arbeitsmarkt für Philosophen nicht besonders ergiebig ist, ist eine Tatsache, die einfach nicht von der Hand zu weisen ist. Aber warum hätte ich ein Studium der »Denker« absolvieren sollen, wenn ich nicht bereit war, genau das zu tun? Denken. Ich war begierig, Neues fernab der Universität und verstaubter Bücher kennenzulernen. Mir schwirrte der Kopf von diesen endlosen Diskussionen über das Wie, Warum und Weshalb und ob wir wirklich so leben wollten. Die klischeebehafteten Brillenträger in gestreiften Pullundern versperrten mir die Sicht auf die Welt, über die wir diskutierten. Ich wollte weg von diesem Einerlei der täglichen Theorie – zur Enttäuschung meiner Professoren, die gehofft hatten, mich in ebendiese Theorie einbinden und mich auf einen Doktortitel vorbereiten zu können. Aber mir war das zu viel. Zu viel der trockenen Substanz.
Vielleicht wollte ich auch endlich das richtige, wahre Leben erleben? Meine beste Freundin – Manon –, mit der ich mir ein Appartement in der Villa Madrid teile, behauptet steif und fest, ich wäre das hübscheste weiße Mädchen, das sie kennen würde. Die Gute. Sie selbst ist mit ihrer dunklen Haut, den langen pechschwarzen Locken und den wundervoll langen Beinen eine echte karibische Schönheit. Ihre dunklen Augen strahlen pure Lebensfreude und Weisheit aus. Sie kennt das Leben. Sie weiß, wie man damit umgeht. Deshalb mag ich sie so. Sie lebt nicht nach der Devise, wer für wen etwas tun kann. Sie schüttelt den Kopf und macht einfach. Herrgott, wenn alles so einfach wäre wie Manons Leben, dann gäbe es von allem Schlechten wesentlich weniger und von allem Guten so viel mehr. Manons sonniges Gemüt gibt mir die Möglichkeit, zu lernen, zu vergleichen. Das Schwere und Tragende meines Studiums für ein paar Augenblicke im Leben zu vergessen. Mich zurückzulehnen, zu schauen und einfach zu genießen. Mit Manon lernte ich das Lächeln; es öffnete mir Türen, was mir das Leben etwas einfacher machte. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Wie schön es sein kann, wenn man flirtend über den Campus der Uni läuft; wie befreiend es sein kann, wenn ein Lächeln zurückkommt. Mich auszuprobieren, zu entdecken, das waren – neben der Beschäftigung mit der Philosophie – die wichtigsten Erlebnisse während meines Studiums.
Der Tag, an dem ich ihn kennenlernte, veränderte jedoch alles. Danach war nichts mehr so, wie es einen Wimpernschlag vorher noch gewesen war. Das, was vorher wichtig schien, was mein Leben füllte, war nur noch eine Erinnerung. Ab der Sekunde bestimmte er mein Denken, mein Handeln, und als er mir an diesem Nachmittag zeigte, wozu ich fähig war, kam mir mein altes Leben wie ein Puzzlespiel vor, in dem ein wichtiges Teilchen gefehlt hatte.
In dem ich gefehlt hatte. Es war, als hätte ich geschauspielert, mir ein Leben innerhalb meines Daseins zurechtgezimmert, das nicht mir gehörte, das nicht meines war. Dass ich nicht war. Erst als er mir die Hand reichte, um mich zu führen, war ich vollständig, fügte sich das Puzzle zu einem Ganzen, und ich konnte meine Aura glänzen lassen. Er sorgte dafür, dass ich in vollkommen neuer Pracht erschien. Dass ich eine neue, bessere Lilou wurde, als ich sie kurz vorher noch war.
Ich liebe Paris. Bin hier geboren und aufgewachsen. Bin hier verwurzelt und weiß, dass es ein Geschenk ist, in dieser Stadt zu leben. Wenn mein Paris am frühen Morgen zu neuem, mit zaghaften Geräuschen erfüllten Leben erwacht, dann ist dies der spannendste Moment des Tages für mich. Das Gemisch aus Wind, Vögeln und den ersten startenden Motoren in einer Stadt im Licht der aufgehenden Sonne ist eine besondere Symphonie der Sinne. Wenn dann die Horden der Männer von der Stadtreinigung, anscheinend keinem Plan folgend, die breiten Straßen der Metropole sauber machen, damit sich die Stadt der Liebe und Mode von ihrer besten Seite zeigen kann, wenn die Menschen aus ihren Häusern treten, um den frühen Morgen zu begrüßen, wenn die Geschäftsleute die Türen ihrer Ladenlokale öffnen und ihre Karren mit den Waren vor die Tür schieben – dann schwebt durch diese Stadt etwas, wovon andere Städte nur träumen können: Flair. Savoir-vivre eben.
An solch klaren Morgen, wie es heute einer ist, der das Versprechen eines warmen Frühlingstags im Gepäck hat, werden die kleinen orange-grauen Elektromobile schon beinahe von etwas Romantischem umspielt. Das leise Geräusch der surrenden Motoren, das ferne Hupen der Autos, die im ersten Stau des Tages stehen, vermischt mit der noch frischen, kühlen Luft und einem Sonnenaufgang über den Dächern der Millionenstadt, der seinesgleichen sucht: Wer sich nicht spätestens jetzt in diese Stadt verliebt, der hat kein Herz. Das Summen eines Elektromotors lässt mich den Kopf heben. Einer der Fahrer lenkt seinen kleinen Reinigungswagen an mir vorbei und ruft mir eine anzügliche Bemerkung zu. Ich fühle mich geschmeichelt, doch für einen Augenblick senke ich meine Lider. Das macht frau so, wenn sie sich auf dieses Spiel der Männer der Tour de Propre einlässt. Das ist eine der ungeschriebenen Regeln des Flirtens in meiner Stadt. Ich weiß, dass ich heute besonders gut aussehe, denke ich und lächele innerlich. Abervielen Dank, dass du mir das noch mal bestätigst. Gerade heute ist mir diese Bestätigung wichtig. Denn ich weiß, dass der erste Eindruck zählt, und ich kann und will nichts dem Zufall überlassen. Beschwingt gehe ich weiter hinüber zur Metro-Station. In dem Bezirk, in dem ich wohne, ist es noch auffällig still. Wie in einem Film von Jacques Tati verlassen die Anwohner für gewöhnlich um diese Zeit ihr heimisches Terrain, grüßen kurz, steigen in ihre Autos oder marschieren im Gleichschritt der Berufstätigen hinüber zur Metro-Station Pont de Neuilly. Aber heute Morgen habe ich die Straße, in der die Villa Madrid liegt, ganz für mich allein. Ich genieße die frische Morgenluft, sehe mich an den Blumenranken satt, die über die hohen Mauern der Gärten in die Straße hineinwachsen, und versuche, meine Nervosität im Zaum zu halten.
Nach Jahren des Studiums ist es heute endlich so weit: Mein erster richtiger Job. Es ist nicht der, den ich mir ersehnt habe und auf den ich die Jahre mit meinem Studium hingearbeitet habe. Das ist ein Wermutstropfen. Ja, aber er ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und bis ich in meinem Fachgebiet unterkomme, ist es der grandioseste Job, den ich jemals bekommen kann. Der erste Tag. Das erste Mal die neuen Kollegen sehen. Den neuen Chef. Wow, denke ich und kann nicht sagen, wie oft ich in den vergangenen Tagen dieses »Wow« dachte, wenn ich auf meinen Vertrag sah. Endlich komme ich aus dem Trott der Sorbonne raus. Ich bleibe stehen, sauge die kühle Luft ein und muss erneut lächeln. Ich habe unverschämtes Glück, und ich will jede einzelne Sekunde dieses Glücks genießen.
Es beginnt mit dem Glück, dass ich die Stellenausschreibung zwischen all den Kleinanzeigen am Schwarzen Brett finde. Es ist ebenso Glück, dass ich diese Stelle bekommen habe. Auf meinem Weg zur Metro läuft der Film meiner Erlebnisse der letzten Wochen noch einmal vor meinem inneren Auge ab, weil ich immer noch nicht glauben kann, dass ich diejenige bin, die heute die Tür zu diesem Büro öffnen wird.
Meine Hände fühlten sich ein wenig feucht an, als ich den Zettel vom Schwarzen Brett entfernt hatte; wie ein Dieb sah ich mich immer wieder heimlich um, ob einer meiner Kommilitonen meinen schändlichen Raub bemerken würde. Nur eine Telefonnummer und zwei, drei Wörter, die die Tätigkeit beschrieben. Diese so simpel, dass ich nicht glauben konnte, dass dafür so viel gezahlt werden würde. Doch als ich hörte, um wen es sich handelte, der diese Stelle offerierte, begann ich zu glauben und zu verstehen. Vor Aufregung verschlug es mir an diesem Nachmittag schier die Sprache. Die angenehme, sehr tiefe und somit sehr beruhigende Stimme des Verlegers der L’indépendante half mir, mich zumindest so weit zu fassen, dass ich ihm kurz Rede und Antwort stehen konnte.
Ein paar Minuten später hatte ich einen Termin zu einem Vorstellungsgespräch fest ausgemacht, und meine Sinne drehten sich im Kreis. Immer noch hallte die angenehme Stimme in meinem Kopf wider, als ich noch vollkommen verwirrt auf das Display meines Handys starrte. Eine innere Unruhe befiel mich, weil in meinem Kopf gleich mehrere Fragen herumschwirrten, die dieses Gespräch aufgeworfen hatte. Zunächst einmal irritierte mich der Umstand, dass sich die L’indépendante verstecken wollte. Das Sprachrohr der Independent-Mode-Szene. Ich bin mir sicher, dass dieser Redaktion von herausragenden Absolventen berühmter Business-Schools die Türen eingerannt werden würden, wenn – ja, wenn – diese Zeitschrift auf der letzten Seite der Stellenanzeigen auch nur einen Einzeiler annoncieren würde. Stattdessen hing da ein kleiner Zettel mit Adresse und Telefonnummer sowie einem kurzen Kommentar über die zu besetzende Position zwischen all den kleinen Zetteln, auf denen Wohnungen und Studiengruppen gesucht werden?
Und warum sollte dieses Gespräch in einem Café, das ungefähr zwei Querstraßen von der Redaktion entfernt lag, stattfinden? Das ungute Gefühl, einem Fake aufgesessen zu sein, stieg in mir auf. Auch wenn ich mir nicht viel von dieser Anstellung versprach, was die eigentliche Arbeit anging, so wäre das mein erster richtiger, unverschämt viel Geld einbringender Job. Es wäre eine Katastrophe für mich, wenn sich das wirklich als Schwindel herausstellen würde. An diesem Tag war ich so nervös, dass ich das erste Mal in meinem Leben mit Magenschmerzen zu kämpfen hatte.
Ich bekam die Stelle, weil ich bereits Erfahrung aufweisen konnte. Dass mir das Irrenhaus der »La Zanzara« einmal behilflich sein würde, hätte ich nie erwartet. Gut, das ist eine Studentenzeitschrift, die nur peripher etwas mit Mode zu tun hat. Aber die Abläufe sind gleich – und die Hektik kurz vor Redaktionsschluss sowieso. »La Zanzara« ist das Sprachorgan der Studenten an der Sorbonne. Bissig, böse, politisch, und wenn in der Ausgabe nicht mindestens ein Aufruf zum Streik darin ist, dann ist die Ausgabe nicht zu gebrauchen. Für diese Aufrufe braucht es nicht viel: ein mieses Essen in der Mensa, überfüllte Papierkörbe vor der Aula. Es gibt immer etwas, worüber sich »Z« so sehr aufregen kann, dass man glaubt, ein erneuter Sturm auf die Bastille stünde bevor. Aber das, was ich dort gelernt habe, war für mich von unschätzbarem Wert. Es ist etwas anderes, kurz vor einer Prüfung hektisch zu werden oder der Titelstory nachzurennen und in Panik zu geraten. Ich habe gelernt, was es heißt, organisiert zu arbeiten und mich nicht von der Aufregung der anderen anstecken zu lassen. Einer muss der Fels in der Brandung sein, und der bin für gewöhnlich ich.
Auf dem Heimweg konnte ich meine Freude kaum verbergen. Auch wenn ich mehr als eine Stunde mit dem Verleger zusammengesessen hatte, fühlte sich das alles absolut irreal an. Selbst der Augenblick, in dem ich den Vertrag unterzeichnete – als ich dem sachten Kratzen des Füllfederhalters auf dem Papier meine volle Aufmerksamkeit schenkte –, war eher ein Traum als reales Erleben. So richtig konnte ich es erst glauben, als die Kopie des Vertrags auf unserem Küchentisch lag und Manon mich sachte in die Seite boxte. Da erst verstand ich, was ich getan habe, und wurde so richtig kribbelig. Bin ich derAufgabe denn überhaupt gewachsen, fragte ich mich. Kann ichdas? Ich rief mir meine Arbeit in der Redaktion der »Z« in Erinnerung und beruhigte mich ein wenig. Gut, dachte ich mehrfach, »La Zanzara« ist etwas vollkommen anderes als L’indépendante. Aber von der Theorie her würde ichdieser Aufgabe gewachsen sein. Basta.
Meinen Gedanken nachhängend, erreiche ich die Metro-Station. Leichtfüßig laufe ich die Stufen hinunter, schlängele mich durch die Menge der Menschen, die auf ihre U-Bahn warten, und lasse das Gewimmel auf dem Bahnsteig auf mich wirken. Jetzt gehörst du dazu, denke ich, und meine Aufregung wächst. Die Menschen, die auf die Linie 1 warten, bekommen von meiner freudigen Anspannung nichts mit, aber das ist mir egal.
Ich sehe in die Gesichter der Menschen. Würde ich auch bald so verschlafen hier stehen und wie in Trance in den Zug steigen, um meiner Arbeit nachzugehen? Nein, sage ich mir. Dazu wird es niekommen.
Der Zug der Linie 1 ist ausnahmsweise pünktlich. Als wäre es ein Zeichen, denn in all den Jahren, in denen ich mit dieser U-Bahn-Linie fahren musste, hatte das verfluchte Ding immer Verspätung. Ich besteige den Wagen, halte mich an einer der Stangen fest, weil ich es nicht wage, mich zu setzen, aus Angst, die Station zu verpassen, an der ich aussteigen muss. Was vollkommen blöd ist, denn ich kenne die Haltestelle seit Jahren. Die vorbeihuschenden Lichter der einzelnen Bahnhöfe verstärken meine Aufregung, je näher ich der Haltestelle Château-de-Vincennes komme. Von dort sind es nur noch ein paar Schritte hinüber zum Viaduc des Arts, in dem auf mehreren Etagen die Räume der Redaktion untergebracht sind. Meine Finger krallen sich um die kühle, glatte Metallstange. Meine Beine zittern ein wenig. Aber setzen kann ich mich nicht: Die Gefahr, mir meinen Lederrock zu ruinieren, weil ich mich versehentlich auf einen Kaugummi oder die Überreste eines schnellen Frühstücks setze, ist einfach zu groß. Nervös streiche ich über meine Kleidung. Die leichte Bluse unter meinem Leder-Blazer betont meine Brüste, und im Ausschnitt blinkt eine lange Kette mit einem großen blauen Stein daran. Modeschmuck. Ja. Aber von der teureren Sorte. Der zum Blazer passende Rock ist seitlich geschlitzt, bringt meine Beine gut zur Geltung. Bei meiner Körpergröße von – gutmütig – geschätzten ein Meter siebzig weiß ich, dass ich tricksen muss, damit die Beine besser zur Geltung kommen und zum Rest meines Körpers passen. Deshalb greife ich auf unauffällige Raffinesse zurück. Stiefel, die einen Ton heller sind als der Rest des Ensembles, komplettieren meinen Auftritt. Ich fühle mich gut in meinen Sachen. Sie sind bequem und elegant und zeugen von einer gewissen Affinität zur Modewelt.
Der erste Eindruck zählt. Wie oft habe ich mir diesen Grundsatz eingehämmert und ihn mir zu eigen gemacht? Der erste Blickkontakt; das erste Mal auf ein neues, vielleicht voreingenommenes Gegenüber zu treffen. Der erste Eindruck zählt. Ich bin so erwartungsvoll in diesen Tag gestartet, dass ich gar nicht auf die Idee komme, auf jemanden zu treffen, der nicht von mir begeistert ist. Eine absolute Fehlinterpretation der Situation.
Denn er hasst mich. Diese Aussage bringt es bereits nach dem ersten Augenkontakt auf den Punkt. Der Moment, in dem ich die Glastür zur obersten Etage aufstoße, mir einen Überblick verschaffe, hier und da ein kurzes, freundliches Lächeln denjenigen schenke, die mich beachten, ist mir unvergesslich. Die Klinke noch in der Hand, bekomme ich einen ersten Vorgeschmack auf das, was mich in den kommenden Wochen erwarten würde. Mero Saint-Mathieu; dieser Name wird sich auf ewig in mein Gehirn brennen, und in meinen ersten Tagen, die ich in der Redaktion verbringe, hauche ich diesen Namen voller Ehrfurcht, wenn ich mich denn traue, ihn überhaupt auszusprechen. Ich erkenne ihn sofort.
In dem lichtdurchfluteten Raum wirkt die Stelle, an der er steht, noch ein klein wenig heller – als würde er das Licht anziehen. Es gibt nicht einen Artikel über diese Zeitschrift, ohne dass sein Konterfei daneben abgebildet ist. Er ist der Shootingstar der Print-Szene. Er ist der unangefochtene König der Print-Medien. Es ist nicht übertrieben, wenn die Szene ihn Gott nennt und ihn auch so behandelt.
Hinter der Glastür zu meiner Rechten und Linken befindet sich ein langer Flur, der mit einem modernen, giftgrünen Teppich ausgelegt ist. Mir gegenüber liegt das offene Büro für die Redakteure und Freien. Schreibtische, die unter der Last unzähliger Papierstapel zusammenzubrechen drohen. Telefone, die unaufhörlich klingeln. Menschen, die sich gegenseitig anbrüllen. Und inmitten dieses Chaos steht er: groß, dunkelhaarig, entsetzlich lässig und auch ein wenig arrogant. Seine Locken wirft er beinahe bei fast jedem Wort nach hinten, und wenn er das nicht tut, dann fährt er mit seinen langen Fingern hindurch. Ich fühle mich erschlagen. Nicht vom Lärm. Nicht von diesen vielen Menschen, die anscheinend alle gleichzeitig reden. Nein – von ihm. Seine Haut schimmert so weich und zart, so anders als das, was ich in den nächsten Minuten zu hören bekomme.
»Was?«, brüllt er zu mir herüber. Ich erschrecke, zucke zusammen. Mieser Einstieg. Zu langsam reagiert, denke ich, richte mich so schnell wie möglich auf und sehe ihm in die Augen. Ein Fehler, wie ich im Nachhinein weiß, denn dieser Blick jagt mir einen gewaltigen Schauer über den Rücken. Ich fürchte mich vor ihm und gleichzeitig …
Aber nein, das kann nicht sein. Niemals würde ich so etwas tun.
»Lilou Monnier«, stelle ich mich vor, nachdem ich meine Stimme wiedergefunden habe.
»Na und?« In seiner Stimme liegt geschäftsmäßige Aggressivität. Wenn ich die Zeit hätte, würde ich dieses Verhalten mit dem Sexualverhalten in der Tierwelt vergleichen. Der Gorilla mit dem silbernen Rücken. Das Lächeln, das mir bei diesem Gedanken über das Gesicht huscht, ist kaum bemerkbar. Hoffe ich in diesem Augenblick zumindest. Dieses dominante Gehabe ist mir nicht ganz unbekannt; ich habe es nur nicht erwartet. Jetzt noch nicht.
»Ich bin die neue Assistentin«, erwidere ich, knöpfe meinen Blazer auf, stemme meine Hand in die Hüfte, und meine Reize blitzen gekonnt ungewollt hervor. Vor allem will ich ihm zeigen, dass er mit mir nicht so umspringen kann.
»Niemals.« Damit scheint für ihn das Gespräch beendet zu sein, denn er dreht sich zur Seite und lässt mich stehen, geht zur Tagesordnung über. Einfach so. Basta. Der König hat gesprochen, und ich darf offensichtlich froh sein, dass er mich nicht zur Guillotine führt und köpft.
Langsam trete ich einen Schritt auf ihn zu. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ich habe schließlich einen Vertrag. Und da kann sich diese männliche Diva querstellen: Ich werde ihn erfüllen, diesen Vertrag. »Ich fang heute hier an«, sage ich und sehe ihn provozierend an.
»Sind Sie schwer von Begriff? Niemals. Ich kann’s Ihnen auch gern buchstabieren«, blufft er mich an. Mittlerweile sind alle Geräusche verstummt, und Saint-Mathieu und meine Wenigkeit stehen im Mittelpunkt des allgemeinen Interesses. Ich fixiere ihn mit meinen Blicken. Trotzig, aber amüsiert. Wenn in diesem Augenblick auch nur einer der Anwesenden in mein Inneres hätte sehen können, dann wäre mein Schauspiel aufgeflogen. Ich kann nicht sagen, wie lange ich das hier noch aufrechterhalte, aber bis zu dem Moment, an dem ich heulend zusammenbreche, werde ich alles tun, um diesem arroganten Schnösel die Stirn zu bieten. Wie man mit solchen Leuten umgehen muss, weiß ich von »Zanzara«, denn dort hatte ich es mit der unguten Mischung aus »Studenten, die die Welt retten wollten« und »kleinen Egomanen, denen Papa das Studium finanziert« zu tun. Irgendwie bin ich im Training. Irgendwie. Bei »Zanzara« konnte ich mich an die Situation gewöhnen und mich in monatelanger Kleinstarbeit darauf einstellen, mit wem ich es zu tun hatte. Das hier, das ist eine ganz andere Kategorie. Ich zittere mittlerweile am ganzen Körper, hab ihn aber immer noch fest im Blick, und mein zuckersüßes Lächeln scheint ihn richtig zu ärgern. Allerdings bröckelt meine Fassade des Trotzes bedenklich. Ich hätte wenigstens frühstücken sollen, denke ich.
Meine Rettung aus dieser mehr als seltsamen und unangenehmen Situation erscheint in der Person des Herausgebers, der das Schauspiel aus einem der hinteren Räume verfolgen konnte. »Doch, Mero, wird sie. Guten Morgen, Mademoiselle Monnier.«
Emile Beaumont nickt mir freundlich lächelnd zu, und genauso freundlich erwidere ich diesen Gruß. Schließlich ist er das einzige bekannte Gesicht für mich. Mit ihm hatte ich mich in diesem Café getroffen, und nach dieser Szene eben kann ich mir auch ungefähr ausmalen, warum er diesen Ort für unser Gespräch gewählt hatte. Mero Saint-Mathieu kneift die Augen zusammen und sieht seinen Geldgeber wütend an. Der große Mann, mit dem kurzen, silbrigen Haar, dem freundlichen, aber strengen Lächeln im Gesicht, greift seinem Zögling an die Schulter und führt ihn in dessen Büro am Ende des Raums. Es ist ein Glaskäfig, der nach oben hin offen ist, sodass man fast jedes Wort hören kann. Mero geht hinter seinen Schreibtisch, während Beaumont davor stehen bleibt, die Hände in die Hosentaschen schiebt und aus dem Fenster hinunter auf die Straße sieht. Mir fällt das imposante Profil des Verlegers auf, das einen energischen, aber gerechten Menschen zeigt. So, wie man ihn von den Skulpturen im Louvre kennt. Ich lasse die beiden nicht aus den Augen, als ich mich einem Gespräch mit einem neuen Kollegen zuwende, bis zu dem Zeitpunkt, an dem Meros und meine Blicke sich treffen. Natürlich fühle ich mich ertappt und sehe zur Seite. Und dieses Gefühl, das ich vor ein paar Minuten schon einmal gespürt habe, das ist wieder da, und ich kämpfe gegen die aufsteigende Röte in meinem Gesicht und das Kribbeln in meinem Unterleib an. Ich hätte wirklich frühstückensollen, denke ich und mache die fehlende Nahrungszufuhr für dieses Kribbeln verantwortlich. Ganz nebenbei versuche ich so beiläufig demonstrativ wie möglich, dem Gespräch zu folgen.
Kapitel 2: Mero
Paris, Redaktionsbüro
»Tu das nie wieder«, zischte Mero Saint-Mathieu seinen beruflichen Ziehvater an, der sich vor dem Fenster positionierte, damit er die Wut des Jüngeren nicht zu sehen bekam, und hinunter auf die Straße sah. »Wage es nie wieder, mich vor meinen Leuten so zu bevormunden.«
Emile beugte sich nach vorn, und es schien, als würde er ein Lachen unterdrücken. »Ich habe dich nicht bevormundet. Ich habe dich davor bewahrt, dich zum Affen zu machen.«
Mero knurrte unwirsch, stieß seinen Stuhl zur Seite und setzte sich so heftig, dass das Leder der Sitzfläche laut knarzte. Das Geräusch verstärkte seine schlechte Laune nur noch mehr.
»Du wusstest, dass du einen Assistenten bekommst«, sagte Emile, ohne sich vom Anblick der Straße abzuwenden.
»Die Betonung liegt und lag auf Assistenten«, konterte Mero. Er sah aus dem Glaskäfig hinaus auf seine Mannschaft. Männer. Bis auf dieses Küken war hier nicht eine einzige Frau zu sehen. Das hatte nichts mit Sexismus zu tun, versuchte er, sich selbst einzureden, es hatte sich einfach so ergeben, und Mero empfand es als angenehm, mit dieser Truppe zu arbeiten. Nun, vielleicht war da doch so etwas wie eine latente sexistische Einstellung. Diese fiel aber – wenn überhaupt vorhanden – eher zuungunsten seiner männlichen Kollegen aus. Die Jungs waren einfach besser zu erziehen, wenn es darum ging, Abläufe zu etablieren. Frauen fragten ständig nach den Gründen. Deshalb hatte Mero alle weiblichen Mitarbeiter in die obere Etage, den künstlerischen Bereich, verbannt. Das System funktionierte hervorragend, und seitdem er – Mero – die Redaktion übernommen hatte, war die Auflage der Zeitschrift L’indépendante stetig gestiegen.
»Ich weiß«, fuhr Emile nach einer kleinen Pause fort, »du hältst mir gleich wieder einen Vortrag darüber, dass ich es dir zu verdanken habe, dass die Zeitschrift so gut läuft.« Mero wandte den Blick vom Großraumbüro ab und sah seinen Chef wütend an. »Ist es nicht so?«
»Ist es. In der Tat. Aber …« Mero unterbrach ihn erneut mit einem unwirschen Knurren.
»Schenk dir dein Aber. Die Sache läuft deshalb, weil ich sie so hinbekommen habe.« Nun drehte sich Emile herum, nahm die Hände aus den Hosentaschen, verschränkte sie hinter seinem Rücken und sah auf Mero hinab.
»Die Kosten explodieren. Das weißt du auch. Die letzten zwei Ausgaben habt ihr nur mit Mühe und Not pünktlich geschafft. Du fängst an, zu – sagen wir es mal so – zu großzügig zu werden. Das funktioniert auf Dauer nicht, und deshalb brauchst du jemanden, der dich kontrolliert, und das wird die bezaubernde Lilou sein.«
»Vergiss es.« Meros Proteste verklangen ungehört. Er wusste, dass er in dieser Hinsicht gegen Emile nicht ankam. Schließlich hatte er tatsächlich zugestimmt, dass ihm jemand zur Hand gehen sollte, und an diesem Tag, an dem das Gespräch stattgefunden hatte, war Mero die Idee, einen Assistenten zu bekommen, gar nicht so abwegig erschienen. Einen Assistenten, wie gesagt. Einen männlichen. Einer, der Eier in der Hose hatte, wenn es darauf ankam. Einer, der nicht mit seinem Hintern wedelte und die Gedanken der Jungs in Bahnen lenkte, die dem Zeitplan in der Redaktion in die Quere kamen.
»Du weißt, dass ich dir deine Eskapaden dieses Mal nicht durchgehen lassen kann«, sagte Emile, während er wieder aus dem Fenster sah. Lilou Monnier hatte alles, was man für die Position vor Meros Glastür brauchte. Sie war gebildet, hatte bereits Erfahrungen, und sie war hübsch. Mademoiselle Monnier war nicht mit den Models zu vergleichen, die sie in der oberen Etage für ihr Magazin abbildeten. Aber sie war ansehnlich; gepaart mit ihrem kumpelhaften Verhalten, das sie bei dem gemeinsamen Gespräch an den Tag gelegt hatte, passte sie hierher wie die berühmte Faust aufs Auge. »Du wirst dich mit ihr abfinden müssen, mein Lieber.« Emile versuchte es zum letzten Mal auf die väterliche Tour, obwohl er wusste, dass Mero auf stur geschaltet hatte.
»Eine Ausgabe«, sagte dieser jedoch zu Emiles Erstaunen. »Sie hat eine Ausgabe Zeit, sich zu beweisen.«
»Zwei!« Emile handelte. Er hatte ein Schlupfloch bei Mero entdeckt. Welches, wusste er nicht, aber solange es da war, musste er es nutzen.
»Zwei. Und sobald ich der Meinung bin, dass sie ›über‹ ist, geht sie.« Emile nickte und ging zur Glastür. »Trotzdem«, schickte Mero ihm hinterher, »mach das nie wieder.«
Mero sah dem großen schlanken Mann nach. Beobachtete ihn dabei, wie er sich mit dieser Person unterhielt, lachte und flirtete. Innerlich verdrehte er die Augen. Emile flirtete mit der jungen Frau, und dabei wusste doch jeder, dass er schwul war. Nur sie nicht. Amüsanter Gedanke. Warum er ausgerechnet eine Frau vor Meros Tür setzen wollte, war deshalb noch unverständlicher. Stand Emile doch bekennend auf knackige Männerärsche, wie er – meist nach dem Genuss von zu viel Alkohol – laut lachend beschwor.
Es war nicht einfach, eine heruntergewirtschaftete Redaktion wieder zu einer wirtschaftlich leistungsfähigen Angelegenheit zu machen. Als sich Emile bei Mero vor zwei Jahren erkundigte, ob er sich die Aufgabe zutrauen würde, hatte der junge Adelige sofort zugesagt. Zum Unverständnis der Szene. Wie konnte dieser aufstrebende Stern in der Redaktionswelt ein solch heruntergekommenes Indie-Magazin übernehmen wollen? Die Beflissenen in der Print-Szene waren sich einig: Das war Saint-Mathieus vorzeitiges Karriereende.
Aber Mero hatte sich durchgesetzt, und nun mit Mitte dreißig war er es, der anderen Leuten das vorzeitige Ende ihrer Karriere voraussagen konnte. Er lächelte böse bei dem Gedanken. Redakteure waren bei L’indépendante gekommen und wieder gegangen. Die Welt des bunten Papiers war nicht nur dort draußen am Zeitungsstand vergänglich. Auch diejenigen, die diese bunte Welt herstellten, waren nicht mehr als schöner Schein. Wirkliche Talente gab es selten. Mero hatte sie gefunden, sie bei anderen Zeitschriften abgeworben und zur L’indépendante geholt. Da konnte es schon einmal passieren, dass eine Exklusivklausel in den Verträgen etwas teurer wurde. Das wusste auch Emile. Und so, wie es schien, wollte Emile ihm – Mero – zwar nicht den Geldhahn zudrehen, sondern nur zusehen, dass genug von der leidigen finanziellen Notwendigkeit vorhanden war, um diese Talente in die richtigen Bahnen lenken zu können.
»Egal«, sagte Mero in den Raum hinein, und wie immer hallte das Gesagte metallisch verzerrt zurück. Er hasste diesen Glaskäfig. Aber das war modern, und die Zeitschrift war modern, also musste die Ausstattung des Büros auch modern sein.
Während er auf seinem Schreibtisch einige Unterlagen suchte, fiel sein Blick aus seinem Käfig hinaus auf die neue Mitarbeiterin. Sie war eindeutig zu hübsch für diesen Job. Gut, über ihre Körpergröße konnte man streiten. Mero war es gewohnt, von Frauen umgeben zu sein, die das Gardemaß von einem Meter achtzig entweder gerade erreichten oder weit überschritten. Augenhöhe, sozusagen. Er selbst war mit seinen ein Meter fünfundachtzig nicht gerade klein, und seine breiten Schultern ließen ihn massiger und alles in allem noch größer wirken. Hinzu kamen seine dunklen Locken, die er immer kinnlang trug. Er war kein Riese, aber er wirkte wie einer. Im Gegensatz zu diesen fast grobschlächtigen Körpermaßen sah sein Gesicht jungenhaft zart aus. Auch mit Mitte dreißig hatte er es noch nicht geschafft, einen anständigen Bartwuchs hinzubekommen. Sehr zum Leidwesen seines Onkels, eines echten Araberfürsten und im wahren Leben ein Anwalt, der immer schon der Meinung war, dass ein Mann ohne Bart kein richtiger Mann war. Mero lächelte, als er an seinen Onkel dachte. Dem würdest du gefallen, dachte er, während er Lilou beobachtete. Ihre Figur würde einem Orientalen Stielaugen wachsen lassen. Runde und feste Brüste, ein breiter, aber nicht ausladender, wohlgeformter Hintern auf Beinen, die männliche Hüften beim Sex fest umschlingen konnten. Genau darauf standen sie, die Orientalen. Kleiner Rassist, dachte er, bist doch selbst zur Hälfte einer.
Und genau da lag für ihn das Problem: Schon als Lilou Monnier das Büro betrat, hatte sie ihm gefallen. Etwas schüchtern, aber zielgerichtet hatte sie sich umgesehen, und als sich für einen Moment ihre Blicke trafen, wusste er, dass sich ihre Wege nicht nur hier in den Redaktionsräumen kreuzen würden. Etwas in ihren Bewegungen hatte ihm gesagt, dass das Spiel begonnen hatte. Diese bestimmte Kleinigkeit, die ihm niemals entging, wenn er Menschen kennenlernte, und die jeder Mensch in sich trug, sorgte dafür, dass sich weit hinten in seinem Kopf ein Plan manifestierte, der dafür sorgen würde, dass dieses Match nicht nur für ihn interessant werden würde. Und das Beste an der Sache, dachte er schmunzelnd und beinahe nachsichtig, als er noch einmal seinen Blick auf seine neue Assistentin intensivierte: Du hast keine Ahnung.
Kapitel 3: Lilou
Paris, Redaktionsbüro
Irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Definitiv bunter, schöner, fröhlicher. Aber das, was mir Mero Saint-Mathieu hier präsentiert, ist weitab – nein, es ist jenseits von Gut und Böse. Nachdem er anscheinend in der Diskussion um meine Person unterlegen ist, verdonnert er mich in den ersten Tagen dazu, Papierkram aufzuarbeiten. Eine letzte – oder besser gesagt – einzige Freundlichkeit lässt er mir an meinem ersten Tag zukommen, indem er mir die Damen aus der oberen Etage vorstellt, von der sich eine in ihrem Mitleid zu mir hinreißen lässt und mir die besagten ersten Tage zur Seite steht. Lola gehört zu den Best-Girls im kreativen Bereich. Sie ist Mädchen für alles: bringt Getränke, schneidet Sellerie, wenn die Modelle hungrig sind, schleppt Kleider und Schuhe, richtet Make-up, wenn der Make-up-Artist nicht in der Nähe ist. Schlicht und einfach – sie kann alles, und jetzt macht es ihr Spaß, sich auch einmal mit den langweiligen Dingen dieser Welt zu beschäftigen: Rechnungen. »Nehmen Sie Ihre neue beste Freundin und zeigen Sie ihr alles«, knurrt Mero, und Lola nimmt mich bei der Hand und führt mich zuerst in die Kaffeelounge.
»Er ist nicht immer so«, zwitscherte sie. Mein Glück, dass dieser Raum durch Milchglas auch optisch von den anderen Räumen abgetrennt ist. Ich atme laut aus und verdrehe die Augen.
»Nein, er ist für gewöhnlich schlimmer«, sagt eine andere Kollegin, Iná, die dann zur Bestätigung auch noch die Augen verdreht.
»Sei nicht so blöd. Mero ist okay. Streng, manchmal lauter als nötig … aber durchweg okay.«
»Das sagst du nur, weil er dich flachlegen soll.« Lola verdreht nun ihrerseits die Augen, zeigt der vorlauten Iná einen Stinkefinger und kümmert sich wieder um mich und unseren Kaffee. Allein für dieses Gebräu lohnt sich schon der Aufenthalt in dieser Hölle.
»Er ist als Chef wirklich in Ordnung. Aber unter Stress, na ja … da reagiert er ein wenig … seltsam.« Sie zwinkert mir zu. Mit beiden Händen schiebt sie ihre dunkelblonde Mähne hinter die Ohren, sucht dann aus einer Schublade eine Brille und setzt sie auf. Verständnislos sehe ich sie an.
»Für gewöhnlich trage ich Kontaktlinsen, weil ich blind wie ein Maulwurf bin, aber oben ist die Luft immer so trocken.« Sie lächelt peinlich berührt. »Das wissen alle außer Mero.« Ich lege einen Finger auf meinen Mund und verspreche zu schweigen.
Wenn ich Lola nicht neben mir hätte, dann wäre ich nach diesem ersten Tag schreiend davongelaufen. Mero entwickelt sich zu einem Ekel der besonderen Güte, und selbst Lola, die den Tag über die Flagge der Ehre für ihn hochhält, äußert sich am Abend, als wir die Redaktion verlassen haben und noch auf ein Glas Wein in die gegenüberliegende Brasserie einkehren, erstaunt über ihn. »Da läuft was im Hintergrund, was wir erst wieder kurz vor Torschluss zu hören bekommen. Dann, wenn alles zu spät ist.« Sie hat ihre Brille wieder aufgesetzt und studiert die Karte. »Ach, was soll’s: Ich nehme den Gallet mit Käse und Schinken. Fett ist nicht nur ein Geschmacksträger. Nervennahrung, sozusagen.« Ich schließe mich ihrer Wahl an, und während wir auf unser Essen warten, ist Lola sehr gesprächig, was das Thema »Mero Saint-Mathieu« angeht. Ich erfahre Dinge, die mir in diesem Moment ziemlich egal sind. Ich will sein Handeln nicht verstehen. Will diesen Mann nicht kennenlernen, deshalb höre ich auch nur mit halbem Ohr zu. Auch wenn es mir in dem Augenblick, als ich ihm heute Morgen versehentlich in die Augen sah, heiß und kalt den Rücken hinunterlief und ich mir die Frage stellte, was mich an einem Mann, der mich offensichtlich nicht will und mich nicht leiden kann, so erregt.
»Es sind seine Augen«, beschwört Lola mich. »Glaub es mir. Dieser Blick, wenn er dich mustert, der geht einem durch und durch.«
Amüsiert stelle ich fest, dass ich nicht das einzige Opfer seiner besonderen Fähigkeit bin. Lola hat augenscheinlich mehr für unseren gemeinsamen Chef übrig, als sie zugeben will.
Wir lassen den Tag mit unserem – wirklich guten – Essen und einem Glas Rotwein ausklingen. Lola tut mir gut, und wenn ich den Job nicht gebraucht hätte, und deshalb sowieso am nächsten Morgen brav dort erschienen wäre, dann wäre sie meine beste Ausrede gewesen, um am nächsten Tag wieder in der Redaktion aufzutauchen.
***
Müde lasse ich mich in meiner Wohnung, die ich mir mit meiner besten Freundin Manon teile, nach diesem ersten, fürchterlichen Tag auf die Couch fallen. Der Wein, obwohl ich nur ein Glas getrunken habe – im Gegensatz zu Lola, die sich eine ganze Flasche genehmigt hat –, beflügelt meinen Geist, aber mein Körper ist schlicht zu erschöpft, um noch mehr zu tun, als sich irgendwo hinzufläzen. Manon steht in der Tür, und ich lächle sie müde an. Diese Frau ist so schön, und ich wundere mich immer wieder, warum sie ausgerechnet mich als ihre beste Freundin ausgewählt hat. Ihre Haut schimmert im Halbdunkel des Lichts, das aus der Küche in unser Wohnzimmer fällt, wie heißer Kakao. Diese Frau hat einfach alles. Wunderschönes dunkles Haar, eine Figur, die andere Frauen vor Neid erblassen lässt, und Charme. Außerdem sieht sie auch noch nach einem Zehn-Stunden-Tag aus, als hätte man sie gerade aus einem Ei gepellt. Manchmal ist die Welt ungerecht.
»Du siehst so aus, als wäre dein erster Tag ein voller Erfolg gewesen«, spöttelt sie. Ich lasse meinen Kopf nach hinten sinken. »Erschieß mich bitte. Freiwillig geh ich da nicht mehr hin.«
»Doch, wirst du«, neckt sie mich, und ihre angenehm tiefe Stimme streichelt meine gepeinigte Seele. Stockend beginne ich, ihr von meinem ersten Tag und den kleinen, fiesen Sticheleien meines neuen Chefs zu berichten. »Da waren Rechnungen dabei, die vor Monaten hätten bezahlt werden müssen. Der hat die Papierkorb-Ordnung. Alles auf einen Haufen, und dann mal sehen, was zuerst runterfällt.« Ich stöhne. »Und das Schlimme: Mit jedem neuen Papierfetzen, den ich in der Hand halte, fällt ihm noch ein Spruch ein, der im Endeffekt gar nicht so blöd ist, doch passend platziert grässlich hervorragend auf mich passt.«
Manon streicht mir eine Strähne aus dem Gesicht. »Armes Mädchen.«
Ich nicke übertrieben. »Das kannst du laut sagen. Der Kerl spinnt: Ich bin kaum fünf Minuten da und schon für alles verantwortlich, was er in den letzten zwei Jahren verbockt hat.« Ich sinke auf ihren Schoß. »Was mach ich denn jetzt?« Wie immer, wenn ich in dieser Stimmung bin und mich an sie kuschele, kann ich das Lachen spüren, das Manon krampfhaft versucht zu unterdrücken, das aber doch irgendwie durch ihren Körper krabbelt und ans Tageslicht kommen will. »Miststück«, brumme ich und schließe für ein paar Minuten die Augen.
Kapitel 4: Mero
Paris, 7. Pariser Arrondissement, Appartement
Er mochte das Geräusch des Schlüssels im Türschloss seiner Wohnung im Rive Gauche, dem 7. Pariser Arrondissement. Das Klacken der einzelnen Zähne im historischen Schlüsselloch klang durch den ganzen Flur, war ein wenig unheimlich für jemanden, der es nicht kannte, aber für Mero bedeutete dieses Geräusch alles. Es sagte ihm – leise, aber unmissverständlich –, dass er es geschafft hatte und nicht mehr länger darum betteln musste, anerkannt zu werden. Hinter dieser Tür lag sein wirklicher Erfolg. Hinter dieser Tür lag das Sinnbild seines Lebens.
Mero öffnete die Tür einen Spaltbreit, und als er den fahlen Lichtstrahl im Flur sah, durchfuhr ihn ein Glücksgefühl. Am Abend in die Wohnung zurückzukommen, das war für ihn ziemlich nah an der Perfektion. Und wenn er wusste, dass das Licht im Flur angeschaltet war, dann war es wirklich perfekt. Leise trat er ein, legte seinen Schlüssel auf das kleine Brettchen neben der Tür und ging auf Zehenspitzen in die Küche. »Madame«, rief er, als er die Küchentür aufstieß, »wer sind Sie, und was tun Sie in meiner Küche?«
Die kleine ältere Dame mit dem grauen Dutt, die vor Schreck zusammenzuckte, sah sich um und lächelte mütterlich und nachsichtig zugleich. »Monsieur, das ist keine Küche, das ist ein Lagerraum für schmutziges Geschirr. Kennst du die Funktionsweise einer Spülmaschine? Wenn nicht, war meine Erziehung vollkommen umsonst.« Mero lachte, ging auf die kleine Frau zu und nahm sie so fest in den Arm, dass sie laut prustete. »Mero, du drückst mir die Luft ab«, rief sie außer Atem.
»Ach was, hab dich nicht so, Nounou.« Er hob sie gleich noch mal hoch. »Hey«, rief er, »die Bretagne hat dir gutgetan: Du hast zugenommen.«
»Natürlich hat sie das, und ich nehme immer zu, wenn ich dort bin. Das weißt du doch«, schalt Nounou ihn. »Du musst mich nicht noch dran erinnern.«
Mero küsste sie fest auf die Stirn. »Jaja«, sagte sie, »genug jetzt. Setz dich hin, das Essen ist gleich fertig.« Er ließ sie los und setzte sich gehorsam an den Tisch.
»Wie geht es deiner Bagage da unten?«, fragte er, während er sich ein Stück Tomate in den Mund schob.
Nounou rollte mit den Augen, dann lachte sie und winkte ab. »Das Volk wird nie erwachsen. Drei … kannst du das glauben? Drei uneheliche Kinder hat das Mädchen jetzt, und immer noch ist kein Mann in Sicht, der auf Dauer bleibt.« Sie warf theatralisch die Hände in die Luft, stöhnte ungläubig und schüttelte verständnislos den Kopf. Mero stimmte in ihr Lachen mit ein und spürte, wie gut es ihm tat, dass sein altes Kindermädchen wieder da war.
In all den Jahren, in denen er darum gekämpft hatte, sein Eigentum zurückzubekommen und seine Eltern zu rehabilitieren, stand Emma Dupont immer an seiner Seite. Sie hatte ihm in den schweren Stunden, in denen es ihm unmöglich schien, auch nur einen Tag weiterzumachen, die Hand gehalten, hatte ihn immer wieder ermutigt.
Aufgewachsen bei der Großmutter väterlicherseits, die ihn zwar liebte, aber die Eltern nicht ersetzen konnte, die er viel zu früh verloren hatte, war Emma Mutterersatz, Freundin und Ratgeberin. Immer. Als sie dann endlich in die wohlverdiente Rente gehen sollte und es Mero gelungen war, nicht nur den Namen seiner Familie wieder reinzuwaschen, sondern auch das Vermögen zurückzubekommen, und er ihr eine großzügige Pension zahlen konnte, da zeigte sie ihm deutlich den Vogel. »So weit kommt das noch, dass ich dich allein durch die Welt ziehen lasse. Von wegen«, hatte sie gesagt. Also war sie geblieben, bezog ein Zimmer in der Etagenwohnung und sorgte weiterhin für ihren Ziehsohn. Die Geschichte seiner Herkunft zu bewahren, das schweißte sie zusammen.
Kapitel 5: Lilou
Immer noch Paris
Ich leide wie ein Hund. Jeden Tag, jede verdammte Stunde. Mero Saint-Mathieu ist ein Mistkerl, wie er im Buche steht. Er lässt mich ständig spüren, dass ich hier nicht willkommen bin.
An meinem zweiten Tag rief er mich zu sich und stellte Regeln für unser »Miteinander« auf. An diesem denkwürdigen Morgen rauschte er an mir vorbei und winkte mir mit dem Zeigefinger, dass ich ihm in seinen Glaskäfig folgen sollte. Kaum hatte ich einen Schritt in sein Büro getan, hielt er mich auf. »Sie werden dieses Büro niemals betreten. Wenn Sie etwas wollen, bleiben Sie in der Tür stehen. Sie werden mir keinen Kaffee bringen, keinen Snack. Sie haben Verfügungsgewalt über Rechnungen bis zu zweitausend Euro. Alles andere zeichne ich ab. Machen Sie sich mit dem Ablaufplan für die nächste und übernächste Ausgabe vertraut. Pfuschen Sie ja nicht darin herum. Sie halten sich an die Abläufe; Sie sind verantwortlich für die Abläufe, wenn ich nicht da bin – und nur dann. Sie machen keine Termine für mich. Sie sind für mich nicht da. Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt. Wenn ich etwas will, dann werde ich auf Sie zukommen. Aber hoffen Sie nicht drauf.«
Nach dieser Ansprache schickte er mich hinaus, und als ich die Tür hinter mir schloss, brüllte er mir nach, was das sollte. Ich lehnte mich an das Glas, schob mich einen Zentimeter in den Raum hinein und sah ihn provozierend an. »Sie möchten in Ihrem eigenen Saft schmoren? Wer bin ich denn, dass ich Ihnen diesen Wunsch nicht erfüllen würde?« Mit diesem letzten Satz meinerseits für viele lange Tage schloss ich die Tür hinter mir und ließ ihn ziemlich verdutzt zurück.
Irgendwie hatte ich die Hoffnung, dass er mich in Ruhe lassen würde und ich meine Arbeit machen konnte. Weit gefehlt. Mero fand immer etwas, um mich zu stören oder um etwas zu bemängeln. Wenn ich es nicht besser wüsste, hätte ich Stein und Bein darauf schwören können, dass er mich verfolgte, damit er mir meine angeblichen Verfehlungen brühwarm vorhalten konnte.