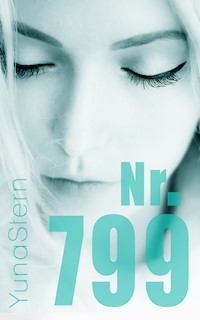Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Die Fortsetzung des Fantasyromans "I#mNotAWitch": Auch wenn sich Quinn Donovan für ein neues Leben in Freiheit entschieden hat, wird sie immer noch von den Problemen ihrer Vergangenheit heimgesucht. Sie muss zurück, um alles ein für alle Mal richtig zu stellen. Dabei stellt sie fest, dass sich in ihrer Heimatstadt Bethel so einiges verändert hat ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 394
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Yuna Stern
I#mNotAWitch
Teil 2
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Impressum neobooks
Kapitel 1
Ich hörte Jacks murmelnde Stimme hinter mir: »Ich verstehe nicht, das kann doch nicht ...« Und dann seufzte er und streichelte über meinen schweißnassen Nacken.
Ja, das konnte doch nicht wahr sein. Verdammt, ja. Ich hockte über der Kloschüssel, krallte mich an ihren verdreckten Rändern fest und zitterte.
»Du verträgst kein Blut«, stellte er fest und schüttelte den Kopf. »Wie kann das sein?«
Ich konnte ihm nicht antworten, die Übelkeit überschwemmte mich erneut. Ich röchelte, legte den Kopf zurück und schnappte nach Luft.
Mit jedem Blutverlust wurde ich schwächer. Seit Monaten schon.
»Wir finden eine Lösung, vertrau mir. Ich weiß, dass ...« Jacks tröstende Worte, so lieb sie auch gemeint waren, halfen mir nicht. Ich hob die Hand, woraufhin er sofort schwieg.
Mit heiserer Stimme bat ich ihn, den Raum zu verlassen. »Bitte«, wisperte ich. Ich brauchte einen Moment für mich alleine.
Sobald er endlich draußen war, lehnte ich mich zurück. Sah mich auf der Toilette der Waldhütte um, die wir im letzten Herbst entdeckt hatten.
Von der Decke hingen Spinnfäden, an denen verstorbene Insekten klebten. Der antiquiert grüne Fliesenboden war mit Flecken übersät. Und an der Wand neben der Duschkabine hatte sich Schimmel gebildet.
Ich vertrug kein Blut. Was bedeutete das? War das so eine Art Laktoseintoleranz bei Vampiren? Eine Sanguisintoleranz?
Fast war mir nach Lachen zumute. Es klang wie ein schlechter Scherz, den mir jemand spielen wollte.
Nachdem ich mir den Mund abgewischt hatte, stand ich schwankend auf. Humpelte zum Spiegel, der über dem Waschbecken hing, fuhr mit dem Handrücken über die Scheibe, um den Schmutz zu entfernen.
Noch immer nichts. Ich war noch immer nicht zu sehen. Irgendwie wartete ich darauf, dass sich das änderte. Ich fühlte mich gar nicht tot, nur anders. Als wäre mein Gehirn überhitzt oder so ähnlich. Das Denken fiel mir seit dem Tag meiner Verwandlung schwer.
Ein Klopfen an der Tür ließ mich aufschrecken.
»Quinn, ist alles in Ordnung?« Jacks besorgte Stimme bereitete mir Schuldgefühle. So hatte er sich unsere Reise in die Freiheit sicherlich nicht vorgestellt.
Ich kam mir vor wie überschüssiges Gepäck, das ihn bei der Jagd behinderte. „Mhm“, krächzte ich und rieb mir über die Stirn.
Nachdem ich mich zu ihm auf die Couch ins Wohnzimmer gesetzt hatte, starteten im Schwarz-Weiß-Fernseher die Nachrichten. Ich nahm die Worte des Sprechers gar nicht wahr, fixierte nur den Bildschirm. Ein Hurrikan kam auf die USA zu. Nebenbei merkte ich, wie Jack mich anstarrte.
»Du siehst blass aus«, flüsterte er.
Ich versuchte, zu grinsen. »Ah, ist das etwas Neues?« Vampire sahen schließlich – soweit ich wusste – immer so aus, als wären sie gerade aus ihrem Sarg gestiegen.
»Nein, so meine ich das nicht. Anders blass. Außerdem hast du abgenommen.«
»Jaja, die ideale Diätkur, ich wusste das schon immer ...«
Er nahm mir meine Lockerheit nicht ab. »Ich meine das ernst. Quinn, es geht dir nicht gut. Wir müssen irgendetwas tun. So kann es nicht weitergehen.«
Ich antwortete nicht und betrachtete ihn. Seine schulterlangen Haare hatte er vor einigen Wochen abgeschnitten, seine dunklen Augen blitzten mich voller Kummer an. Er wirkte angespannt, atmete hektisch ein und aus.
»Bitte, Quinn«, bat er. »Lass uns zu den O'Donoghues gehen. Sie werden dich untersuchen. Sie wissen, was sie tun.«
Eine Gruppe von Medizinervampiren. Das klang ein wenig furchteinflößend, wie ich fand.
»Wo leben sie noch mal?«, fragte ich und versuchte mir schnell eine Ausrede zu überlegen. Ich will nicht zu ihnen, weil ... ich Angst vor Spritzen, Operationen, Krankenhäusern habe?
Die O'Donoghues wohnten angeblich seit Jahrzehnten in einer verlassenen Hospizanlage im Süden von –
»Irland«, klärte mich Jack geduldig auf. »Bitte, Quinn. Ich kenne diese Leute.« Er zögerte, bevor er ergänzte: »Na ja, durch Isaiahs Erzählungen ... Sie sind überhaupt nicht gefährlich. Ernähren sich noch nicht einmal von Blut, stell dir das vor. Sie sollen so ein scheußlich bitteres Getränk aus Erde und Alkaloiden entwickelt haben, das sie seit geraumer Zeit einnehmen. Sie sind harmlos.«
Hm, das glaubte ich nicht so recht.
Aber, gut.
»Und du meinst wirklich, dass sie mir helfen können?«
Er seufzte und schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht, ich hoffe es. Ich will dich nicht verlieren, Quinn ... Besonders nicht nach alldem, was wir im letzten Jahr gemeinsam erlebt haben.«
Sobald er mich in seine Arme nahm, verkrampfte ich innerlich. All die Gefühle, die mich nach meiner Verwandlung für ihn heimgesucht hatten, waren wie weggefegt. Wieso also ...? Woher war diese Liebe damals gekommen? Hatte ich meine Gefühle für Aiden auf ihn projiziert? Hatte mein neuerworbenes Vampirgedächtnis mir einen Streich gespielt?
Ich wusste es nicht, dennoch lächelte ich Jack an, um ihn nicht zu enttäuschen. »Meinetwegen«, wisperte ich. »Wenn es sein muss ...«
»Ja, es muss sein«, bekräftigte er seine Worte mit einem raschen Nicken. »Wenn es dunkel wird, müssen wir uns auf den Weg machen.«
»In Ordnung.« Ich lehnte mich gegen das Zierkissen. Im folgenden Moment packte mich der Schwindel erneut. Oh, nein. Nicht noch einmal. Ich fluchte leise. Schloss die Augen. Sobald meine Stirn zu pochen begann, hörte ich alles.
Und zwar wirklich alles.
Auf der Landstraße raste ein Auto mit ratterndem Motor entlang, der Fahrer diskutierte am Telefon mit seiner Tochter über ihre nächste Theateraufführung. Auf dem Hügel der Pollinders grasten Kühe, ihre Arbeiter in der Scheune misteten den Stall aus und husteten. Und auf dem Kastanienbaum vor der Waldhütte zwitscherte eine Wanderdrossel zum sechzehnten Mal an diesem Tag dasselbe verfluchte Lied.
Ich hielt es nicht länger aus.
Diese Kräfte waren eine Gabe, ja, natürlich, doch gleichzeitig führten sie mich in den Wahnsinn. Überall hörte ich Stimmen, wild durcheinander. Ich vernahm Herzschläge, konnte sogar recht bald einschätzen, ob die dazugehörigen Personen an Herzproblemen litten ... oder vielleicht Verdauungsschwierigkeiten hatten, da ihr Magen unaufhörlich rumorte. Gelegentlich konnte ich sogar hören, wie das Blut gewisser Leute durch ihre Adern rauschte und pumpte. Und jedes Mal spürte ich dann genauestens, wie mich der Durst befiel.
Wie auch jetzt.
Ein Förster spazierte etwa zweihundert Meter von uns entfernt den Waldweg entlang. Er keuchte, roch nach Schweiß und Alkohol. Seinen Gestank nahm ich selbst von der Hütte aus wahr. Unter seinen Schuhen knackten, zerbrachen Äste.
»Nein«, flüsterte Jack und griff nach meinem Arm. »Es wird dir danach noch schlechter gehen, Quinn.«
Das wusste ich natürlich. Ich wollte diesem Mann auch nichts antun. Eigentlich nicht. Aber ... Es war so verlockend. Meine Instinkte rieten mir dazu, ihn anzugreifen, obwohl der Tag noch hell war.
Ich verschränkte die Arme vor der Brust, um meinen Körper unter Kontrolle zu bekommen. Drängte mich näher an Jack, der mir zur Beruhigung die Hand auf die Schulter legte. Er hielt mich so fest, dass ich mich nicht befreien konnte. So hockten wir dort auf der harten Couch, die angesichts ihres karierten Musters aus den Achtzigern zu stammen schien. Warteten darauf, dass der Mann verschwand.
Es schien eine Ewigkeit zu dauern.
Die Gardinen an den Fenstern ließen nur schmale Lichtstreifen durch, die sich auf den Holzboden legten. Sonst war alles kühl und finster in diesem Raum.
Der Förster entfernte sich immer weiter von uns, doch irgendwann hörte ich, wie sein Telefon klingelte. Da blieb er stehen.
Mein Durst nahm zu, kratzte an meiner Kehle, brachte mich zum Wimmern. Da ich all das Blut, das ich zuvor getrunken hatte, wieder ausgespuckt hatte, war mein Verlangen danach umso stärker. Trinken, die Leere in mir füllen, irgendetwas, das heiße Blut, ich konnte an nichts anderes mehr denken. Trinken, sofort, angreifen, seine Haut unter meinen Fingerkuppen spüren, wie sie zerreißt, und ...
Ich schloss die Augen und versuchte meine Gedanken wieder zu sortieren. Um das zu tun, hatte Jack mir einen Trick beigebracht.
»378 plus 723? Konzentrier dich darauf, Quinn.« Er strich mir über die Wange. Ich ließ meinen Kopf gegen seine Brust sinken, wiederholte seine Worte in meinen Gedanken.
Rechnen, um dem Durst zu entkommen. Mal klappte es besser, mal nicht so gut. Ich versuchte mich nur auf die Zahlen zu konzentrieren, doch an diesem Tag funktionierte es nicht.
Das Atmen des Försters. Sein Räuspern, während er an sein Handy ging. Mit seiner Schuhspitze schubste er einen Blätterhaufen an, das Rascheln verursachte Gänsehaut bei mir.
Zahlen.
300 – wie lauteten sie noch mal?
Nun ging der Mann weiter, er zog sich den Reißverschluss zu, ich hörte das Quietschen seiner Lederjacke. Er hatte eine tiefe Stimme, telefonierte schnell und legte hastig auf. »Gleich komm ich«, hatte er gesagt.
Jack schüttelte mich sanft. »Quinn, rechne.« Er nannte mir erneut seine Aufgabe: »378 plus 723?«
Normalerweise nahm er kompliziertere Zahlen, doch an diesem Tag waren selbst diese hier zu schwer für mich. Ich rechnete, versuchte mich von dem Förster abzulenken, nur mit Mühe, ich wandte mein Gesicht ab, kniff die Augen zusammen und dachte nach.
378 plus – erst einmal nur – 700 waren: 1078.
Okay. Und weiter – was passierte draußen? Ich hielt den Atem an. Ich roch Blut, frisches Blut. Oh, der Förster schien sich verletzt zu haben. Wie, warum?
Ich versuchte, mich aus Jacks Griff zu lösen.
»Nein, Quinn. Egal. Zähl weiter.«
Ja, rechnen. Es spielte keine Rolle, was im Wald passiert war. Mit dem Mann, dessen Blut nun auf die Erde tropfte.
Ich spürte, wie mir das Wasser im Mund zusammenlief. Meine Zunge fühlte sich trocken an, taub, als wäre ich kurz davor, zu verdursten.
Tausendachtund – wo war ich noch einmal? 1078. Blieben noch 23, die ich dazu addieren musste, dann wäre ich fertig. 78 plus 23 waren ... 78 plus 20 waren 98. Plus 3.
Ich stieß Jack beiseite, murmelte ein »Tschuldigung« und rannte los.
Ich hörte noch sein Fluchen hinter mir, dann war ich draußen.
Die Sonne tat mir nichts, sie kitzelte nur auf meiner Haut, noch spürte ich nicht, dass sie mich vernichten würde. Ich war noch nicht daran gewöhnt. Die Angst vor der Sonne hatte sich bei mir noch nicht entwickelt.
Einzig die Helligkeit blendete mich. Einen Moment lang schwankte ich, hielt mich an einem Baumstamm fest, dann kam mir der Geruch des Försters entgegen. Der Wind trug ihn zu mir, ich zitterte vor Aufregung und hechtete los, um ihn zu finden.
Klar zu denken war in solchen Momenten unmöglich. Ich war eine Sklavin meiner eigenen Triebe. Nur das war mir bewusst. Und doch genoss ich das. Irgendwie.
In nur wenigen Sekunden hatte ich ihn erreicht, beobachtete ihn von Weitem, verbarg mich zwischen den Bäumen. Nur einen Schluck. Den durfte ich mir gönnen. Musste ich.
Bevor ich aus meinem Versteck springen und mich zeigen konnte, tauchte Jack neben mir auf und riss mich zurück. Er presste mich auf den Boden, griff nach meinen Handgelenken und flüsterte: »Quinn, das geht so nicht. Wir müssen raus aus der Sonne. Komm schon. Du weißt, dass dich das Blut schwächt. Ich will nicht, dass es dir noch schlechter geht. Es tut mir leid.«
Ich schluchzte, wusste, dass er recht hatte, aber das Verlangen war zu stark.
»Komm, Quinn. Rechne. Lass los. Denk an etwas anderes.«
»Hallo, ist da jemand?« Die Stimme des Försters näherte sich uns. Seine Schritte wurden lauter. Der Geruch seiner Verletzung, seines frischen Blutes nahm zu.
Ich war kurz davor, aufzuschreien, ihn herzulocken, doch Jack schüttelte den Kopf und legte die Hand auf meinen Mund.
»Quinn, konzentrier dich endlich auf die Zahlen«, flehte er.
Ja, dachte ich. Ich versuche es ja, aber ich schaffe es nicht.
Wo war ich noch mal gewesen?
Plus 3? Plus 3. 98 plus 3. Hundert – ja – hunderteins. War das die Lösung? Nein. Ich musste die 1000 dazu addieren, und dann, ja.
Ich stöhnte. »1101.« ODER?
»Ja.« Jack lächelte, doch er ließ mich weiterhin nicht los. »Ja.«
Ich entspannte mich und legte meinen Kopf auf den Boden. Spürte die kalte Erde in meinen Haaren. Achtete nicht mehr auf den Förster, dessen Schritte sich wieder entfernten.
Jack hatte es mal wieder geschafft. Mit seinen bescheuerten Zahlen.
»Sehr gut, Quinn. Willst du aufstehen?«
Er sprang von mir weg und richtete sich auf. Klopfte sich die Blätter von seinen Knien.
»Ja, danke.« Ich traute mich nicht, ihn anzusehen. »Und ... tut mir leid. Du weißt schon, manchmal ...«
»Ach, Quinn. Das ist doch normal. Du bist gerade mal seit kurzer Zeit verwandelt. Da hat man sich noch nicht so sehr unter Kontrolle.« Er grinste und offenbarte seine Fangzähne. »Also, wenn ich dir ein Zeugnis ausstellen darf, du wirst immer besser in Mathe.«
»Ha. Ha«, sagte ich und verkniff mir ein Lächeln. Insbesondere an diesem Tag war ich überhaupt nicht gut darin gewesen.
Gemeinsam eilten wir zurück zur Waldhütte, um uns für den nächtlichen Aufbruch nach Irland vorzubereiten. Dabei wurde ich das Gefühl nicht los, dass wir beobachtet wurden.
Ich drehte mich vor der Tür noch einmal um, sah zurück.
Doch nur die verflixte Wanderdrossel war zu sehen, die in ihrem rot-schwarzen Federkleid umherhüpfte und sang. Ich hob einen Ast vom Boden auf und winkte ihr damit zu. »Hey, Piepmatz, wechsel mal den Kanal. Kannst du das?«
Ich vergaß das merkwürdige Gefühl, dass dort noch jemand war. Verschwand in der dunklen Sicherheit der Waldhütte, wo Jack gerade einen Koffer packte.
Kapitel 2
Cork, an der Südwestküste Irlands, empfing uns in der Nacht am River Lee mit einem Lichterspektakel, mit einer malerischen Häuserfassade, die sich im Wasser spiegelte. Trotz der späten Stunde waren noch Passanten in der Großstadt unterwegs. Auf der Brücke hasteten sie an uns vorbei. Die Eindrücke innerhalb dieser bevölkerungsreichen Stadt erschlugen mich: Von den Autoabgasen, die mir in der Nase juckten, bis zu den grellen Farben in der Nacht. Überall blinkte und leuchtete es. Studenten aus der UCC stolperten lachend aus einem Pub, Alkohol- und Nikotingestank umhüllte sie wie eine Wolke.
»Bald haben wir es geschafft«, murmelte Jack, der mich aufmerksam beobachtete. Ehrlich gesagt war mir seine stete Anwesenheit manchmal unangenehm. Insbesondere wenn er so besorgt war wie jetzt.
In der Nähe des Gefängnismuseums von Cork befand sich das Anwesen der O'Donoghues in einer abgelegenen Seitenstraße. Das verlassene Hospiz erstreckte sich über drei Etagen, die Fenster waren mit Brettern vernagelt. Die Vorderfront war mit Wildem Wein geschmückt, der sich einen Weg durch die Risse im Mauerwerk gebahnt hatte. Auf dem gepflasterten Hof wuchs Unkraut, der sich bis zu dem Maschendrahtzaun drängte, der das Grundstück von allen Seiten umgab. Darauf war ein schiefes, knallgelbes Aluminiumschild mit der Aufschrift »Achtung! Einsturzgefahr!« befestigt.
»Sieht nicht gerade einladend aus«, sagte ich. »Bist du dir sicher, dass sie hier wohnen?«
Jack, der die O'Donoghues nur durch die Geschichten Isaiahs kannte, zuckte mit den Schultern. »Nach alldem, was ich über sie gehört habe, eigentlich schon.«
»Also los.« Ich rang mich zu einem Lächeln durch und griff nach seiner Hand.
Wir warteten einen Moment lang, bis keine Autos mehr auf der Straße vorbeifuhren, dann setzten wir zum Sprung an. In hohem Bogen flogen wir über den Maschendrahtzaun hinweg und landeten direkt vor dem Eingang.
»Hm, manchmal hat es schon seine Vorteile, ein Vampir zu sein«, lachte ich.
»Das freut mich, dass du es so positiv siehst«, entgegnete er und klopfte an die massive Eichentür. »Dann wollen wir ja mal sehen, wer die O'Donoghues sind.«
Eine Weile tat sich nichts. Jack zupfte nervös an seinem Ärmel, lehnte sich mit seinem Ellbogen gegen den Türrahmen. »Hoffentlich sind sie da.«
Ich hingegen spürte eine gewisse Erleichterung. Ich wusste nicht, was mich an der Vorstellung dieser Vampirärzte so störte. Doch der Gedanke an sie bereitete mir Kopfschmerzen. „Vielleicht sind sie ja verreist“, überlegte ich laut. Den hoffnungsvollen Ton in meiner Stimme konnte ich nicht abschalten. Jack zog die Augenbrauen hoch. Genau in diesem Moment riss jemand die Tür auf.
Auf der Schwelle erschien ein Mann, der in seiner linken Hand eine Petroleumlampe trug. »Ja, bitte?«, fragte er. Alt sah er nicht aus, doch gekleidet, als ob er den Fünfzigern entflohen war. Wie ein Filmstar kaute er auf einer Zigarre im Mundwinkel herum, trug ein lässiges Hemd in Schlangenoptik und hatte streng mit Pomade zurückgekämmte, glänzende Haare.
Jack stellte uns mit knappen Worten vor.
Nach einer flüchtigen Stille nickte der Typ, bat uns herein. Im Foyer blieb er mit verschränkten Armen stehen, betrachtete mich mit gerunzelter Stirn. Hinter ihm befand sich ein Empfangstresen in Betonoptik aus vergangenen Zeiten, unter dem sich eine Ratte versteckte, wie ich an ihren Lauten erkannte. Darauf stapelten sich gebundene Bücher, die einen modrigen Geruch verströmten.
Ein Vampir war unser Gastgeber auf alle Fälle, sein Herz schlug nicht, Blut rauschte nicht durch seine Adern. Mit schräg gelegtem Kopf sagte er in meine Richtung: »So, du verträgst also kein Blut, Quinn. Woran meinst du, liegt das? Wann bist du verwandelt worden?«
»Wenn ich das wüsste, wäre ich mit Sicherheit nicht hier«, entgegnete ich. »Und verwandelt habe ich mich vor einigen Monaten.«
Jack fügte hinzu: »Davor war sie eine Hexe.«
Der Mann, der sich als Francis vorgestellt hatte, rümpfte die spitze Nase, wirkte leicht angewidert. »Eine Hexe, tja. Furchtbares Pack.« Nachdem er mich ein letztes Mal mit zusammengekniffenen Augen gemustert hatte, sagte er: »Folgt mir nach oben.«
Wir nickten. Er stolzierte los, führte uns eine Treppe hinauf in die erste Etage der Hospizanlage. An der Decke des Korridors hing eine flackernde Pendellampe, die den Fliesenboden beleuchtete, der mit abgelaufenen Zeitungen und leeren Flaschen zugemüllt war.
»Dagegen kann sie ja nichts«, meinte er, »dass sie mal eine Hexe war. Einige Straßen weiter, über dem Kiosk in der Victoria Street, haben wir auch ein derartiges Subjekt. Vermutlich um die dreihundert Jahre alt, sieht jedenfalls so aus. Grauslich, glaubt mir, die Murdock.« Er bog in den nächsten Gang ein. Das Licht schaltete sich automatisch ein. »Hier ist unser Untersuchungszimmer.« Francis öffnete die Tür und wartete, bis wir in den Raum eingetreten waren. Er stellte seine Petroleumlampe auf dem Boden ab und wies auf die Aluminiumstühle, die an der Wand standen. »Setzt euch bitte einen Moment lang. Ich hole meine Schwester. Sie wird euch sicher kennenlernen wollen.«
Mit einem lauten Knall ließ er die Tür hinter sich zufallen.
In der Mitte des Untersuchungszimmers stand eine Liege, die mit einem beigefarbenen Baumwolltuch zugedeckt war. In den Regalen dahinter sammelten sich Akten. Hier drinnen stank es nach Alkohol und Fäulnis.
Jack schien mit einem Mal nicht mehr ganz so zuversichtlich. »Das ist seltsam«, flüsterte er. »Isaiah hat mir immer erzählt, dass Francis ein Wissenschaftlertyp ist. Nie seinen Kittel ablegt. Trotz seiner Scharfsicht nicht aufgehört hat seine Brille zu tragen, an die er aus seiner Menschenzeit noch gewöhnt war. Dass er sich so verändert hat?«
»Jetzt ist er jedenfalls ein Klon von Gregory Peck«, stellte ich nüchtern fest. Ich unterdrückte das Zittern meiner Hände, indem ich meine Finger ineinander verknotete. Ja, ich musste zugeben: Ich hatte Angst.
Musste das wirklich sein, dass ich an diesem Ort behandelt wurde? Konnte die Ärztefamilie mir nicht einfach ihr Blutersatzdrink spendieren und mich gehen lassen?
Um mich abzulenken, grübelte ich weiter über Francis offenbare Veränderung nach, die in den letzten Jahren stattgefunden haben musste: »Vielleicht war er zu Beginn noch so, wie Isaiah ihn dir beschrieben hat. Total in seiner Arbeit vertieft und so. Doch nach all der Zeit hat er neue Interessen entwickelt: Autos, Zigarren, Mode. Das kann doch sein. Was meinst du?«
Er antwortete mir nicht und ließ sich auf einen der Wartestühle am hinteren Ende des Raumes sinken. Sein konzentrierter Blick verriet mir, dass ich ihn bei seinen Gedanken nicht stören durfte.
Also schlenderte ich zu den Regalen, sah mir die verstaubten Akten an. Sie waren mit römischen Jahreszahlen beschriftet. Über einem Waschbecken in der Nähe hing ein verdreckter Spiegel. Aus dem mit Seifenresten verstopften Abfluss krabbelten Fliegen und tummelten sich auf dem Wasserhahn.
Bevor ich zurück zu Jack gehen konnte, um mich neben ihn zu setzen, erklang ein Poltern. Die Tür wurde mit einem Mal weit aufgerissen.
Francis flog mit einer hageren Frau an seiner Seite in den Raum. Er verharrte vor dem Eingang und legte den Arm um sie. Daraufhin nahm er einen Zug von seiner Zigarre und atmete den Rauch durch seine Nase aus. Feierlich rief er: »Darf ich euch bekannt machen? Das ist meine ... Schwester.«
Das Gesicht seiner Schwester war so knochig, dass ihre Augen hervortraten. In ihrem grauen Kleid aus Spitze wirkte sie wie ein unterernährtes Model. Einzig ihre welligen, kupferblonden Haare schienen ihr ein wenig Gewicht zu verleihen.
Schief grinsend fügte Francis ihren Namen hinzu: »Felicia, die oh-Glückselige.«
Sie stieß ihn mit dem Ellbogen an und verdrehte die Augen. Im nächsten Moment richtete sie ihre Aufmerksamkeit auf mich: Sie stürmte zu mir und griff nach meinen Händen. »Bitte entschuldige ihn. Über die Jahre ist aus ihm ein Narr geworden. Vermutlich liegt es daran, dass er kein Blut mehr zu sich nimmt.« Ein heiseres Lachen entwich ihr.
Ich schüttelte den Kopf. »Ist schon okay. Er ist ... nett.«
»Wie gefällt dir Cork bisher? Ist diese Stadt nicht wundervoll? Ich muss sagen, dass ich ...«
Ehe sie weiterplappern konnte, warf Jack die Frage ein: »Ich habe gedacht, dass ihr einen weiteren Bruder habt? Finley?«
Seit ihrem Auftritt schien er noch misstrauischer geworden zu sein. Er stand von seinem Platz auf und krempelte seine Ärmel hoch, um seine Muskeln zu demonstrieren.
»Ohh, ja.« Felicia ließ mich abrupt los, warf ihrem Bruder einen Blick zu. Dann drehte sie sich mit dem Rücken zu uns um und lief zum Waschbecken, um von der Ablage eine Küchenrolle zu nehmen. Sie kehrte mit undurchdringlicher Miene zurück und breitete schweigend das Papier auf der Liege aus, ohne das dreckige Baumwolltuch vorher wegzunehmen.
Francis räusperte sich. »Sie mag nicht darüber sprechen«, erklärte er. »Was aus ihm geworden ist ...«
Sie seufzte theatralisch, richtete sich auf. Bat Jack und Francis das Untersuchungszimmer zu verlassen, damit sie alleine mit mir über meine Probleme mit der Blutzufuhr sprechen konnte.
»Nein.« Jack sträubte sich, schüttelte den Kopf. »Ist das in Ordnung für dich?«, fragte er so lautlos, dass nur ich ihn hören sollte, obwohl das bei solcher Gesellschaft natürlich unmöglich war. »Ich bleibe lieber«, fügte er mit fester Stimme hinzu. »Ich lasse sie nicht alleine.«
Leider ließ sich die Vampirärztin nicht von ihrem Vorhaben beirren. »Tut mir leid, ich möchte mit deiner Freundin persönlich reden. Vertrau mir bitte, es wird ihr nichts passieren.«
»Ist schon okay«, wiederholte ich. Offenbar fiel mir kein anderer Satz mehr ein. Die Aufregung hatte mir die Sprache verschlagen. »Geh.«
Jack sah mich weiterhin zweifelnd an, rührte sich nicht von der Stelle.
»Wir haben doch nicht extra den langen Weg hierher gemacht, damit ich das jetzt nicht mache«, murmelte ich. »Es muss sein. Hast du selbst gesagt.«
»Okay.« Er eilte zu mir, hauchte mir einen Kuss auf die Wange. »Bis gleich«, flüsterte er. »Und wenn ihr doch irgendetwas passiert, dann ...«
Ich unterbrach ihn, bevor er Felicia drohen konnte.
Bei der Tür drehte er sich noch einmal zu mir um. Ich gab ihm mit einem Lächeln zu verstehen, dass ich mich nicht fürchtete. Auch wenn das überhaupt nicht stimmte.
Sobald ich mit Felicia alleine im Untersuchungszimmer war, veränderte sich ihre Stimmung plötzlich. Die Trauer um den offenbaren Tod ihres Vampirbruders schwand genauso schnell, wie sie gekommen war. Mit einem neugierigen Leuchten im Blick bat sie mich zu der Liege.
Ich gehorchte ihr, auch wenn mir bei jedem Schritt der Gedanke durch den Kopf schoss: HAU AB.
»So, jetzt erzähl doch mal, Quinn. Weshalb genau bist du hier?«
Ich berichtete ihr davon, dass ich kein Blut bei mir behalten konnte. Und dass ich dadurch immer schwächer auf den Beinen wurde. »Unsere Reise nach Irland hat viel länger gedauert dadurch«, erklärte ich. »Immer wieder musste ich auf der Strecke Halt machen, weil ich nicht mehr konnte. Und ich wollte auch nicht, dass Jack mir hilft.« Ich erinnerte mich daran, dass er mir angeboten hatte, mich ein paar Meilen lang zu tragen. Doch das war für mich keine Option gewesen. Ich wollte es alleine schaffen.
»Ist es vielleicht so«, sie verzog den Mund, als ob ihr der Gedanke nicht behagte, »dass du von deinen – sagen-wir-mal – Moralvorstellungen von früher beeinflusst wirst? Verursacht das womöglich dieses Gefühl der Übelkeit?«
Ich dachte über ihre Theorie nach. Doch es war bei mir eher so: Eine Art krankhafte Allergie gegen das Bluttrinken selbst, es schmeckte mir noch nicht einmal, der Durst war dennoch da und bereitete mir Schmerzen. Also ein zwiespältiges Gefühl, was ich nicht selbst beeinflussen konnte. Einerseits trieb mich das Verlangen danach an, andererseits war ich extrem abgestoßen von der Flüssigkeit, die mich sozusagen beherrschte.
»Leg dich doch bitte einmal hin«, bat mich Felicia.
Musste das sein?
Sie schien mein Zaudern zu bemerken, denn sie ergänzte lächelnd: »Ich werde dir jedes Mal erklären, was ich tun werde. Hab keine Angst. Es wird schnell vorbei sein.«
Ich streckte meine Beine von mir, platzierte den Kopf auf der oberen Seite der Liege, an der ein Kissen aus Kunststoff angebracht war.
»Danke dir, Quinn.«
Ich ließ die nächsten Untersuchungen ohne Widerworte über mich ergehen.
Sie beugte sich über mich, überprüfte meine Fangzähne, leuchtete mir mit einer Taschenlampe, die an einem Schlüsselbund befestigt war, in die Augen. Mit einem Reflexhammer kontrollierte sie meine Reaktionen und gab gelegentlich so Laute wie »Aha« oder »Hm« von sich.
»Warte bitte.« Sie verschwand kurz und holte aus dem Nachbarraum eine Blutkonserve. Mit einer Nadel aus Silber, die etwa so lang war wie mein Unterarm, stach sie mir in die Vene. Führte mir den Inhalt der Blutkonserve per Infusion ein. Es tat überhaupt nicht weh, ich spürte nichts.
Anschließend kramte sie aus einem der Regale einen Block hervor, an dem ein Kugelschreiber befestigt war. Damit notierte sie ihre Beobachtungen, kritzelte mehrere Minuten lang irgendetwas nieder, bis sie mich irgendwann fragte: »Geht es dir jetzt besser? Verträgst du das Blut?«
Nein, es half alles nichts. Mal wieder spürte ich, wie mich der Brechreiz überwältigte. Zitternd drehte ich mich auf die Seite, zog die Beine an. Wünschte mir mit krächzender Stimme eine Decke. Es war plötzlich so kalt.
Ich schloss die Augen.
Die Gesichter meiner Familie erschienen hinter meinen Lidern. Abweisung spiegelte sich in ihren Blicken. Meine Mutter, die mich dafür verabscheute, was aus mir geworden war. Ich konnte mir schon denken, was sie von mir hielt, auch wenn ich sie nach meiner Verwandlung nicht mehr gesehen hatte. Savannah, Samuel und Phoebe: meine Geschwister.
Ich wollte es mir nicht eingestehen, nicht an sie denken, doch ja, verdammt, ich vermisste sie.
Während ich mich meinen Erinnerungen hingab, bemerkte ich erst einmal nicht, wie Felicia mit ihren Aufzeichnungen aufgehört hatte. Erst als ich ein Räuspern vernahm, blinzelte ich sie an.
Sie stand mit einem seltsamen Glanz in den Augen neben mir und lächelte. Schwerfällig hob ich den Kopf und bat darum, dass sie die Heizung aufdrehte. Oder irgendetwas tat, nur damit es nicht mehr so eisig kalt war. »Und eine Schüssel, Eimer ... oder ... Waschbecken.«
Sie nickte, half mir auf, stützte mich und führte mich hinüber zum Waschbecken. Nachdem ich all das Blut wieder ausgespuckt hatte, brachte sie mich zurück zu der Liege.
»Gift«, flüsterte sie. »Es wirkt wie Gift bei dir.«
»Wie meinst du das?« Meine Stimme hörte sich so weit entfernt an. Erneut fielen mir die Augen zu.
Eine Weile sagte sie nichts mehr, während ich schlief. Hatte sie mir etwa zusätzlich zur Blutkonserve ein Medikament zur Ruhigstellung verpasst? Auch wenn mich der Gedanke einen Moment lang beunruhigte, so dachte ich nicht länger darüber nach.
Es war angenehm, mich endlich einmal zurücklehnen zu können. Meine kräftig gewordenen Sehnen und Muskeln, die seit meiner Verwandlung derart angespannt waren, entspannen zu lassen. Zu ... träumen.
Aiden.
Irgendwann war er alles, was mich innerhalb dieser Sekunden beschäftigte. Nur noch er. Sein Lächeln, das ich vermutlich nie wiedersehen würde. Seine Umarmungen, die mir ein unwiederbringliches Gefühl von Sicherheit spendeten. Hitze stieg mir ins Gesicht, weil ich mich so schuldig fühlte.
Er hatte mich nur nicht verlieren wollen, deshalb hatte er es getan.
Warum hatte ich das nicht sofort begreifen können? Warum hatte ich solch eine Angst verspürt, als ich nach meiner Verwandlung in seiner Gegenwart war?
Es war nur ein Instinkt gewesen, verstand ich plötzlich. Mein Körper wehrte sich gegen das, was er mir angetan hatte. Die Schmerzen wollte er nicht erneut durchleben müssen. Es war eine Art Abwehrmechanismus, mit dem ich mich, ohne es damals wirklich zu begreifen, selbst zu schützen gedachte.
»Aiden«, flüsterte ich. Wo war er nur? Was tat er jetzt?
»Aiden«, wiederholte Felicia. »Wer ist das?«
Ohne wirklich bei Sinnen zu sein, erzählte ich ihr von ihm. Und dass ich ihn gemocht hatte. Sehr sogar.
»Und er?«
»Er hat mich getötet«, entgegnete ich. »Das ist alles.«
Danach schwieg sie eine Zeit lang. Und gab mir schließlich die Antwort zu der Frage, die ich ihr davor gestellt hatte: »Er wird dich immer wieder töten, Quinn. Indem er dich zu einem Vampir gemacht hat, hat er dir einen noch größeren Fluch bereitet. Denn Blut wirkt wie Gift bei dir. Irgendwann wird es dich zugrunde richten.«
Dass sie zum Schluss darüber lachte, das merkte ich nicht mehr.
Kapitel 3
Ich wachte in einem Nebenzimmer auf, aufgeschreckt durch Jacks laute Stimme, die aus dem Flur zu mir hereindrang. Er diskutierte mit Francis und Felicia darüber, dass sie mir ohne meine Einwilligung Medikamente verabreicht hatten.
Sie stritten das selbstverständlich ab.
Mit klarerem Kopf richtete ich mich auf, schlich zur Tür und lugte hinaus. Dort draußen stand er, mit fuchtelnden Armen und Flüchen auf den Lippen, die ich so nie bei ihm erwartet hätte. Sein Beschützerinstinkt machte ihn mal wieder zu meinem Verteidiger, ohne dass ich ihn darum gebeten hatte.
»Hör auf«, rief ich.
Er stockte und drehte sich zu mir um.
Hinter seinem Rücken trat Felicia hervor und marschierte auf mich zu. Mit in den Hüften gestemmten Händen blieb sie vor mir stehen. »Ich hoffe, dass es dir besser geht, Quinn.« Ihre Stimme klang kalt. Mit ihrem intensiven Blick fixierte sie mich, betrachtete mich von Kopf bis Fuß.
»Ja«, sagte ich. »Vielleicht.«
»Aus dem Weg.« Jack schob Felicias abgezehrten Körper mit der Hand zur Seite, drängte sich an ihr vorbei und kam zu mir ins Zimmer. Bevor er die Tür zuschlug, fauchte er den Vampirärzten zu: »Ihr bleibt draußen.«
Hier drinnen war es hell und sauber, im Gegensatz zu den restlichen Zimmern, die wir bisher in der Hospizanlage gesehen hatten. Ein Hochbett stand an der Wand, die Bettlaken darauf wirkten frisch bezogen. Auf der anderen Seite hing ein Bild, was Corks historische Gebäude in der Nacht darstellte. Es war nur in Blautönen gehalten, schien mit Aquarell gemalt worden zu sein. An der Decke hing eine Leuchtstoffröhre, die surrte. Einige Minuten lang war dies das einzige Geräusch im Zimmer.
Jack schlang seine Arme um mich, hielt mich so fest er konnte, ohne irgendwelche Worte über die letzten Stunden zu verlieren.
Ich ließ ihn gewähren, platzierte meine linke Wange auf seiner Schulter.
Ich lauschte auf die Schritte von Francis und Felicia, die sich allmählich entfernten. Nur ihr Wispern konnte ich hören, die ausgesprochenen Worte jedoch nicht näher identifizieren. Waren sie wütend?
Irgendwann, ich wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war, löste Jack sich von mir, strich mir über den Haaransatz und murmelte: »Verdammt, Quinn. Du hattest von Anfang an recht. Das sind ... Spinner. Ich glaube nicht, dass sie dir helfen können.« Er trat zurück mit undurchdringlichem Gesichtsausdruck.
»Du brauchst dir nicht so viele Sorgen zu machen«, begann ich leise, »wirklich, Jack. Du wirst mich nicht ewig beschützen können.« Ich musste es schließlich selbst lernen, wie ich mich verteidigen konnte.
Er stöhnte, wandte seinen Blick von mir ab. »Ich habe alles gehört«, sagte er und rieb sich über die Stirn, »was du über ihnerzählt hast.« Fassungslos schüttelte er den Kopf. »Quinn, nach alldem, was er dir angetan hat. Wie kannst du nur?«
Schuldbewusst zuckte ich zusammen. Öffnete den Mund, um zu antworten. Doch keinerlei Worte gelangten über meine Lippen. Ich zögerte, bevor ich zugab: »Ich kann es dir nicht erklären. Er ist einfach irgendwie ... immer noch da. Ich merke es hier.« Ich zeigte auf mein Herz. »Verstehst du das?« Gleichzeitig dachte ich nur: Was für ein romantischer Unsinn. Warum verletze ich ihn immer wieder?
»Nein. Nein, Quinn. Das tue ich nicht.«
Ich konnte ihm nicht mehr in die Augen sehen, senkte den Blick. Schämte mich so unendlich. Jack wirkte: Getroffen, wie von einem Pfeil. Mit schmerzverzerrter Miene huschte er vor mir davon, so als ob ich gefährlich war. Blieb vor einer Kommode stehen, die mit einem Schloss versehen war, drehte sein Gesicht weg. Verbarg seine Emotionen vor mir, leider nicht geschickt.
»Es tut mir leid«, sagte ich zum gefühlt hundertsten Mal. »Ich wünschte, es wäre anders.«
Vermutlich hatte ich diese Worte zu oft gesagt, denn sie schmeckten bitter, abgestanden. »Doch dagegen kann ich nichts tun, dass Aiden ...«
Jäh unterbrach er mich: »Bitte, sag seinen Namen nicht mehr ...« Und dann schlug Jack die Hände über dem Kopf zusammen und sank auf den Fliesenboden, mit dem Rücken zu mir. So als ob er sich nicht länger aufrecht halten konnte. »Er hat es schon immer gewusst«, raunte er, »von Anfang an, da hat er es mir angedroht, Quinn. Dass du irgendwann zu ihm zurückkehren wirst, weil er anders ist, nicht ... schwachist. So hat er es ausgedrückt. Er hat es mit solcher Sicherheit gesagt, dass ich ihn ausgelacht habe. Wie dumm von mir.«
Ich eilte zu ihm und fiel ebenfalls auf die Knie. Hob mit meiner Hand sein Kinn an, damit er mich direkt ansah. Eindringlich sagte ich ihm: »Du bist nicht schwach, Jack. Er hat gelogen. Ich ... ich verdiene dich überhaupt nicht. Noch nicht einmal als Freund, du bist so wertvoll.« Ich tröstete ihn mit einfallslosen Worten, die er sowieso nicht mehr hörte. Er war irgendwo anders, nicht präsent, starrte mich mit leeren Augen an, die mir vorkamen wie: Mit Regentropfen beschlagene Scheiben.
»Du wirst ihn nie vergessen«, sprach er mit gebrochener Stimme und stieß mich sanft weg. Das schien die Erkenntnis zu sein, die ihn von mir forttrieb, denn im nächsten Moment stand er ruckartig auf und wanderte zur Tür.
Dort blieb er noch einmal stehen und drehte sich zu mir um, ohne mich wirklich anzusehen. Er schien noch etwas sagen zu wollen. Doch irgendetwas hielt ihn davon ab, er überlegte es sich offenbar anders und verließ das Zimmer mit seinen letzten unausgesprochenen Worten noch in der Luft. Greifbar.
Ich blickte ihm hinterher und hasste mich dafür, dass ich alles zwischen uns zerstört hatte. Innerhalb weniger Minuten. Gab es überhaupt noch ein: uns?
Ich konnte nicht alleine bleiben, die Stille, wie sie mich mit einem Mal überfiel, ließ mich ungeduldig von einer Seite des Zimmers zur anderen wandern. Bis ich mich irgendwann dazu entschloss, einen Blick auf Cork zu werfen. Ja, ich wusste, dass das gefährlich war. Aber ich wollte nicht mehr eingesperrt sein. Mit meinen Gedanken und Jacks Enttäuschung, die innerhalb dieser vier Wände noch immer spürbar nachhallte.
Vermutlich war es keine gute Idee von mir: Doch ich öffnete das Fenster, montierte die Bretter ab, die eine Sicht nach draußen unmöglich machten.
All das, ohne vorher um Erlaubnis zu fragen, um einen Streit zwischen Jack und mir zu verhindern. Nach meiner Rückkehr wollte ich in Ruhe mit ihm reden. Ihn erneut um Entschuldigung bitten.
In diesem Moment jedoch wollte ich unbedingt nach draußen. Hinaus. Ich streckte den Kopf durch das Fenster, betrachtete die Umgebung.
Regenwolken hatten sich über Corks Himmel zusammengebraut. Es war kurz vor Sonnenaufgang, doch das störte mich nicht. Es versprach, ein düsterer Tag zu werden, da konnte ich mich in den Schatten verbergen.
Sobald ich mit einem sicheren Sprung auf dem Hof gelandet war, atmete ich erleichtert auf. Ich durchquerte den Hinterhof der Hospizanlage, kletterte über den Maschendrahtzaun. Zum ersten Mal seit meiner Verwandlung war ich alleine, ohne Jack, unterwegs.
Auf dem Bürgersteig sah ich noch einmal zurück, nur flüchtig, um mich nicht im letzten Moment anders zu entscheiden.
Und dann ging es los.
Wie im Rausch flog ich durch die Straßen, während mir die Regentropfen die Sicht benebelten. An Autos vorbei, deren Fahrer mich vermutlich für ein wildgewordenes Reh oder eine Illusion ihrer morgendlichen Müdigkeit hielten.
Ich kostete meine Kräfte aus, sprang auf Dächer, raste durch Vorgärten, erklomm Hochhäuser, wie eine Spinne, die ihr Netz durch die gesamte Stadt fädelte. Ich war so unvorsichtig, dass ich mir Jacks Predigt schon Wort für Wort ausmalen konnte. Sie beinhaltete die Worte: Falsch. Nicht richtig. Fehler. Und so weiter und so fort.
Doch gegen einen selbstständigen Ausflug von mir konnte selbst er nichts haben. Ach, was spielte ich mir vor ...
Einzig die Müdigkeit und der Durst, meine Blutarmut sozusagen, brachte mich irgendwann dazu: Anzuhalten.
Direkt vor einem irischen Pub, der »The Circle« hieß.
Davor tummelte sich eine Gruppe junger Leute, die sich gerade voneinander verabschiedeten. Sie bemerkten mich nicht, winkten einander zu, umarmten sich gegenseitig und riefen: »Bis dann.« Auf ihren Fahrrädern fuhren sie nacheinander davon.
Nur ein Junge blieb zurück, dessen Haare ungekämmt waren, mit einem Kaugummi im Mund und offensichtlich schmerzenden Schläfen, die er mit den Fingern massierte.
Sein Herz pochte so rasant, wie ein Kolibri, der mit den Flügeln schlug. Und er wirkte so ... unschuldig.
Als er mich bemerkte, verzogen sich seine Mundwinkel zu einem schüchternen Lächeln. Auf seiner Wange bildete sich ein Grübchen. Er wirkte ausgesprochen süß, ja, das Wort war wie für ihn geschaffen. Ich vermutete, dass er noch bei seinen Eltern wohnte. Und vielleicht gerade mit dem Studium begonnen hatte. Was wohl seine Fächer waren? Kunst? Philosophie?
Er grüßte mich mit einem knappen: »Hi.«
Sollte ich umkehren?
Ob es mein Jagdtrieb war, der mich so zu ihm führte? Meine Bedürfnisse ließen sich nicht länger unterdrücken. »Hi.«
In seinen blauen Augen leuchtete die Aufregung. Er schien von meinem Anblick fasziniert zu sein. Auch das war wohl meinen Kräften geschuldet. Ich fragte mich, was er sah? Eine jüngere Frau, mit leichenblasser Haut und feurigen Haaren, die sich zu einer Zeit an ihn drängte, in der seine Stadt noch schlief? Es schien ihm jedenfalls zu gefallen, dass ich mich zu ihm gesellt hatte.
»Ich heiße ...«
Ich unterbrach ihn schnell. Seinen Namen wollte ich nicht wissen. Sonst traute ich mich nicht, ihm ein wenig Blut abzuzapfen. »Du heißt ... Liam«, schlug ich vor. Dass meine Stimme dabei verführerisch klang, war nicht meine Absicht.
Er runzelte die Stirn und wirkte im ersten Moment verwirrt. Dann schien er zu begreifen. »Oh.« Die Verblüffung dauerte nicht lange. Er grinste und nickte. »Meinetwegen.« Nach kurzem Überlegen fügte er hinzu: »Und du bist ... Rose?«
»Ganz genau.« Ich tanzte auf ihn zu. Von meinem Durst dazu verleitet, griff ich nach seiner warmen Hand und führte sie an meine Wange.
Vermutlich würde ich all das aufgenommene Blut wieder ausspeien, doch ich wollte die Erfahrung machen, meine Grenzen austesten. Und selbst wenn es wie Gift auf mich wirkte, so konnte ich mich in der Gegenwart des Jungen nicht länger kontrollieren.
»Möchtest du etwas trinken?«
Ich schüttelte den Kopf, obwohl ich dachte: ja.
Ich dirigierte ihn in eine Seitengasse, direkt neben dem Pub, wo wir unter einem Vordach aus Holz Schutz vor dem Regen suchten. Daneben standen die Mülltonnen, die zur Gaststätte gehörten. Dem falschen Liam schien das nicht so angenehm zu sein. Er drehte sich mehrfach um, als ob er irgendetwas befürchtete, fragte mich leise: »Wirklich? Hier?«
Ich zuckte mit den Schultern. Hier würden keine Passanten vorbeikommen. Es war der perfekte Ort für einige Sekunden Zweisamkeit.
»Okay.« Mit entschlossener Miene, so als ob er sich selbst im Stillen Mut zugesprochen hatte, packte er meine Taille und hob mich hoch, drückte mich gegen die unverputzte Ziegelwand. Er schmiegte sich an mich, kam mit seinem Gesicht so nah heran, dass der Minzgeruch des Kaugummis den Gestank des Alkohols kaum noch übertünchte.
Wie musste ich weitermachen? Sollte ich ihn gewähren lassen? Oder direkt einen Biss in seinen Nacken wagen? Plötzlich fühlte ich mich wie ein unbedarftes Schulmädchen, das seine Unsicherheit zu überspielen versuchte.
Sobald ich seine Lippen spürte, so weich, als ob er sie regelmäßig mit Honig bestrich, war ich wie elektrisiert. Sein Kuss dauerte länger, als ich es geplant hatte. Ich ließ mich treiben, bis seine Hände zu meiner Hose wanderten. Da fiel es mir wieder ein. Mein hastig in den letzten Minuten zurechtgelegter Plan.
Ich musste ihn, so hatte ich durch Jacks Erzählungen gelernt, in dem Moment tiefster Ekstase erwischen. Damit sein fiebriges Verlangen ihn dazu veranlasste, nicht vor mir zu flüchten, wenn ich ihm meine wahre Gestalt offenbarte. Letztendlich ging es nur darum, ihn von mir abhängig zu machen, so dass er sich nach mehr Stunden mit mir verzehrte, danach wortwörtlich bettelte.
Auch wenn ich nicht vorhatte, ihn zu meinem persönlichen Blutlieferanten zu formen, so schoss mir dieser Gedanke kurz durch den Kopf. Doch natürlich musste das hier eine einmalige Sache bleiben, da ich seinen Lebenssaft ja nicht vertrug.
Er keuchte, knöpfte mir mit zittrigen Händen die Bluse auf, brauchte mehrere Anläufe, bis er es geschafft hatte. Teilweise wirkte er wirklich überfordert, so als ob er nicht genügend Erfahrung besaß. Wie auch ich, dachte ich.
Ich beugte mich über seine Schulter, mit meinem Mund streifte ich testweise seinen Nacken, suchte nach einer besonders passenden Stelle, wo es ihm hoffentlich nicht allzu wehtat. Er stöhnte, als ich ihn dort liebkoste. Seine Kräfte gaben nach. Er ließ mich auf den Backsteinboden sinken, interessierte sich nicht für den Regenschauer, der uns trotz unserer überdachten Ecke erreichte, fuhr sich durch die klatschnassen kurzgeschnittenen Haare, lächelte mit hellglänzenden Augen, in denen ich glaubte, ganz kurz mein Spiegelbild zu erkennen.
»Du bist so ... surreal«, flüsterte er.
Ich schlang meine Arme um seinen Nacken und zerrte ihn zu mir. Jetzt musste ich es tun. Es war der perfekte Moment: Seine Haut schmeckte nach Männerparfüm, ich tauchte meine Fangzähne darin ein, spürte wie das Hämmern seines Herzens unter meinen Fingerspitzen schneller wurde. Er verharrte einen Moment lang, so als ob er noch nicht verstand, was vor sich ging. Sobald sein Blut strömte, nahm ich einen langen, gierigen Schluck, sog es ein, obwohl der Geschmack abscheulich war, bis sein Körper sich entkrampfte.
Was ich tat, schien ihm Lust zu bereiten, denn er ließ sich davon nicht beirren. Im Gegenteil, seine Bewegungen wurden fahriger, seine Berührungen wurden fordernder.
Doch sobald mein Durst gestillt war, schob ich ihn sanft von mir.
Ich sah ihm an, dass es ihm anders ging, ungläubig blinzelte er mich an, flüsterte: »Bitte.«
»Vielleicht irgendwann anders«, log ich. Oder nie.
»Wann?« Seine Hände umfassten mein Gesicht. Er gab mir einen leidenschaftlichen Kuss, den ich ihm nicht verwehren konnte. »Ich brauche ...«, sagte er. Das Dich verflog mit dem Wind.
Ich antwortete ihm nicht und löste seine Finger vorsichtig, ließ ihn los.
»Ich muss gehen«, erklärte ich.
Er nickte und senkte den Kopf, wirkte so verwundet wie eine Möwe, auf die mitten im Flug geschossen worden war. Um ihn zu trösten, dafür hatte ich keine Zeit mehr. Sonst würden mich meine Schuldgefühle sicherlich wieder einholen.
Als ich mit zugeknöpfter Kleidung und zusammengebundenen Haaren aus der Seitengasse treten wollte, hielt er mich noch einmal auf. »Warte, bitte. Ich will dir noch sagen, wie ich wirklich heiße. Mein Name ist ...«
Ich hörte ihn nicht mehr und rannte davon.
Was hatte ich getan? All meine, so wie es Felicia ausgedrückt hatte, Moralvorstellungen über den Haufen geworfen. Ohne Begleitung losgezogen. Mit einem Fremden in der Seitengasse eines Pubs herumgemacht. Sein Blut(!!!) getrunken. Ich hoffte, dass Liam, nein, der Junge, mich wieder vergaß. Oder sich einbildete, dass er zu viel getrunken hatte.
Eine von Jacks Standpauken ... die hatte ich heute wahrlich verdient.
Als ich an einer Weggabelung vorbeikam, fiel mir ein Straßenschild auf: Victoria Street. Lebte dort nicht diese Hexe Murdock, von der Francis erzählt hatte?
Neugierde durchströmte meinen Körper. Also beschloss ich, einen Umweg zu nehmen.
Ich bremste meine Geschwindigkeit und passte sie den Fußgängern an. An den Autos wanderte ich vorbei, in denen die Fahrer darauf warteten, dass die Ampel für sie wieder auf Grün schaltete. Nachdem ich die Hauptstraße überquert hatte, hörte ich, wie mir der Schäferhund einer Passantin hinterherbellte. Er zerrte wohl an der Leine, denn ich hörte, wie sie ihn verärgert zurechtwies. Spürte er etwa, dass ich anderswar?
Auf dem Bürgersteig blieb ich einen Moment lang stehen, ließ meinen Blick über die Läden wandern.
Der Kiosk, von dem Francis gesprochen hatte, fiel überhaupt nicht auf, wirkte wie ein schattiger Fleck im Straßengebilde. Einzig das braun lackierte Aushängeschild aus Schmiedeeisen, was an der Mauerwand befestigt war, wies auf den Laden hin. Ich steuerte direkt darauf zu. Auf der Fußmatte vor dem Eingang stand in geschnörkelter Schrift: »Welcome«.
Sobald ich eintrat, klingelte ein Glöckchen, das an einem Faden am Türrahmen befestigt war.
Der Ladenbesitzer schien indischer Herkunft zu sein. Um seinen Kopf hatte er einen Turban gebunden, so stramm, dass seine Wangen dadurch aufgeplustert wirkten. Er grüßte mich mit einem höflichen: »Guten Morgen.« Und widmete sich wieder den Räucherstäbchen, die er gerade anzündete.
»Murdock?«, fragte ich, da ich annahm, dass er seine Nachbarin kannte.
Er nickte und zeigte mit dem Ringfinger zur Decke. »Durch die Hintertür«, erklärte er mir, »die Treppe hinauf, erster Stock, da ist ihre Wohnung.«
Ich bedankte mich für die Auskunft, hastete die Regale entlang, die mit exotischen Lebensmitteln vollbepackt waren. Durch die Hintertür gelangte ich zu einer Treppe, die ins erste Stock führte.
Oben im Flur schob ich einen Kinderwagen beiseite, der den Weg versperrte. Darin häuften sich leere Plastiktüten und zerknüllte Taschentücher. Vor einem Fenster lagen drei verrostete Fahrräder, deren Körbe ebenso mit Müll gefüllt waren.
Ich las mir die Klingelschilder aufmerksam durch, verharrte vor der dritten Tür links. Da war ihr Name, verblasst auf dem Papier, wohl vor langer Zeit mit einem tintenblauen Füller ausgefüllt. Auf dem Steinboden davor befand sich eine vertrocknete Dattelpalme, an ihren Blättern hingen Spinnfäden.
Ich hob die Hand, um zu klingeln. Und zögerte. Was würde sie sagen, wenn sie mich sah? Ich war schließlich keine Hexe mehr. Viel schlimmer: Jetzt gehörte ich gewissermaßen ihren Feinden an.
Doch bevor ich mich umentscheiden konnte, öffnete sich die Tür wie von selbst. Langsam und verzagt streckte die Hexe ihren Kopf heraus und musterte mich erst einmal. Dann rief sie: »Na, beiß mich der Teufel, wenn das nicht eine Donovan ist.«
Kapitel 4
Emilia Murdock zog mich hinein und schaltete das Licht im Flur an, murmelte: »Komm schon. Von draußen weht Wind herein. Das tut meinen alten Knochen gar nicht gut.« Sie schob mich zur Seite und trat die Tür mit ihrem grauen Hausschuh zu.