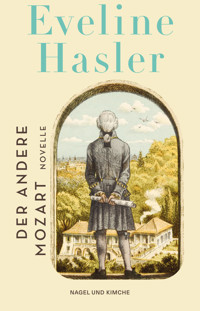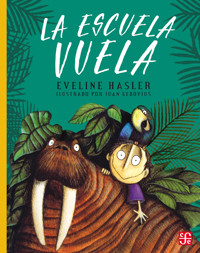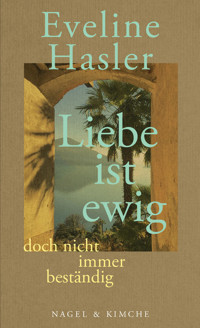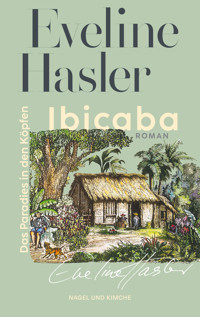
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Nagel & Kimche
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Hungerjahr 1855, als die Kartoffeln im Boden verfaulen und die einheimische Textilindustrie unter dem Druck der englischen Konkurrenz leidet, wandert eine Gruppe von 265 Menschen gemeinsam nach Brasilien aus. Aus Zürich, dem Aargau, Graubünden und dem Glarnerland brechen sie auf, um im vermeintlichen Paradies eine neue Heimat zu finden. Aufrüttelnd und spannend erzählt der Roman ein Stück unbekannter Auswanderungsgeschichte. Er beruht auf geschichtlichen Dokumenten, einem alten Wachstuchheft, das Eveline Hasler fand. Bildhaft bis ins Detail berichtet Hasler von Hunger und Elend, die nur wenige Generationen zurückliegen, aber auch von Utopien, die diesen Menschen Kraft gaben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Zum Buch:
Im Hungerjahr 1855, als die Kartoffeln im Boden verfaulen und die einheimische Textilindustrie unter dem Druck der englischen Konkurrenz leidet, wandert eine Gruppe von 265 Menschen gemeinsam nach Brasilien aus. Aus Zürich, dem Aargau, Graubünden und dem Glarnerland brechen sie auf, um im vermeintlichen Paradies eine neue Heimat zu finden. Aufrüttelnd und spannend erzählt der Roman ein Stück unbekannter Auswanderungsgeschichte. Er beruht auf geschichtlichen Dokumenten, einem alten Wachstuchheft, das Eveline Hasler fand. Bildhaft bis ins Detail berichtet Hasler von Hunger und Elend, die nur wenige Generationen zurückliegen, aber auch von Utopien, die diesen Menschen Kraft gaben.
Zur Autorin:
Eveline Hasler (geb. 1933 in Glarus) ist eine Schweizer Schriftstellerin. Sie studierte Psychologie und Geschichte an der Universität Freiburg und in Paris. Anschließend war sie als Lehrerin tätig. Sie verfasste Kinder- und Jugendbücher, Lyrik und erzählerische Werke für Erwachsene. 1994 erhielt sie für ihr literarisches Gesamtwerk den Droste-Preis. Ihre Bücher sind bisher in zwölf Sprachen übersetzt worden. Eveline Hasler ist Mitglied des Vereins Autorinnen und Autoren der Schweiz und des Deutschschweizer PEN-Zentrums. Ihr Vorlass befindet sich im Schweizerischen Literaturarchiv in Bern. Die Autorin lebt in Ronco sopra Ascona (Kanton Tessin).
Eveline Hasler
lbicaba
Das Paradies in den Köpfen
Roman
Ungekürzte, durchgesehene Ausgabe bei NAGEL UND KIMCHE
© 1985 Nagel & Kimche AG, Zürich
© für diese Ausgabe 2025
NAGEL UND KIMCHE
in der Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland
Valentinskamp 24 · 20354 Hamburg
Covergestaltung von wilhelm typo grafisch
Satz und E-Book-Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 9783312013890
www.nagel-kimche.ch
Jegliche nicht autorisierte Verwendung dieser Publikation zum Training generativer Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) ist ausdrücklich verboten. Die Rechte der Urheberin und des Verlags bleiben davon unberührt.
Ich wacht’ und ich träumte von der kühnen Fahrt auf der Zukunft Ozean!
Klopstock
1
Dieser Traum, Barbara, von der Veredelung des Menschen. Schau dir diese Fracht an, eine Arche Noah der Elenden: Ausgezehrte, von der Maschine Kaputtgemachte, Waisen, Witwen, Kranke. Ein Blödsinniger aus Matt, zwei Blinde aus dem Kanton Aargau, ein Lahmer aus dem Zürcher Oberland.
Säuglinge, viel zu viele Säuglinge und Kleinkinder. Immer sind die Bedürftigsten beladen mit einem Überfluss an Nachkommen. Warum? Wo die Natur bedroht ist, will sie sich, bevor sie eingeht, noch die Art erhalten. Bäume schlagen in Angsttrieben aus, bevor sie absterben. Der Fisch stösst seinen Laich aus, wenn der Angelhaken in seinem Schlund sitzt. Der ausgehungerte Mensch ist fruchtbar. Masslos … Davatz blickte auf die junge Frau, die, mit einer Flickarbeit im Schoss, ihm gegenübersass.
Er erwartete, dass sie etwas sagte, aber sie hielt den Kopf gebeugt, benetzte das Ende des Fadens mit den Lippen. Das rötlich blonde Haar im Nacken kräuselte sich.
Anna Barbara Simmen. Sie war vor einiger Zeit seine Schülerin gewesen in Fideris. Schon damals hatte ihn ihre Schweigsamkeit herausgefordert. Ihr dunkler Blick. Die breite, hinter dem Haarvorhang verdeckte Stirn. Er hatte sie manchmal angestarrt, als gäbe es an ihr etwas zu entdecken, ein weisser Fleck auf der Erdkarte, die an einer Holzrolle im Hintergrund der Schulstube hing; oft stand der Lehrer davor, die Hände auf dem Rücken verschränkt, mit versunkenem Blick.
Damals war Barbara eine Repetierschülerin von dreizehn gewesen, er ein Fünfundzwanzigjähriger, verlobt mit der Katharina Auer.
Durch die Glastüre im Hintergrund sah er die Matrosen hin- und herlaufen, er hörte das Knattern der Segel, das Girren der Seile. Das Schiff schwankte, und eine graue Fläche stieg zwischen den Masten auf.
Dieses Dahingleiten. Mal schneller, mal langsamer. Wie der Wind in die Segel griff. Sie der Zukunft entgegentrieb.
Noch lag sein Notizbuch offen vor ihm, in das er eingetragen hatte:
»Seit dem Beginn der Seereise am 17. April 1855: 48 Breitengrade durchsegelt in 22 Tagen, meist mit günstigem Nordost-Passatwind.«
Doch jetzt, auf dem siebten Grad nördlicher Breite, näherten sie sich den Kalmen, den berüchtigten Zonen der Windstille. Wochenlang konnte die Reise sich noch hinziehen bis Santos.
Vom Zwischendeck herauf drang Stimmengeschwirr. Die Türe des Steuermannstübchens wurde aufgerissen, die Füllung aus Milchglas klirrte: Vetter Lehrer …
Davatz starrte auf eine seiner Cousinen aus Fideris, ein hageres, vierzehnjähriges Mädchen mit struppigem schwarzem Haar. Über eine ihrer Wangen lief eine schmierige Spur, die knochigen Schultern zuckten.
Die Giger Anni, die vom Nachbarbett, hat meinen Schiffszwieback gegessen. Schon gestern hat sie meine Ration verschwinden lassen, obwohl sie sagt, sie könne den Zwieback nicht kauen, mit ihrem einzigen heilen Zahn! Sie hat auch dem Speich Alois in der Nacht die Schiffskiste aufgemacht und eine Speckseite herausgestohlen.
Davatz unterbrach den Redefluss mit einem zornigen: Genug!
Das Mädchen verstummte, blickte ihn ängstlich an. Wie oft muss ich dir sagen, Madlen, dass ich meine Ruhe will? Vormittags wenigstens. Im Stübchen des Steuermanns. Weshalb habe ich denn das Vorrecht, hier zu sitzen? Du weisst es doch?
Sie blickte auf ihre blossen Füsse, schnupfte:
Ihr müsst etwas aufschreiben, Vetter Lehrer …
Du weisst es also. Aufzeichnungen, ja. Auf Wunsch der Gemeinden Fanas, Schiers, Klosters, Fideris, Grüsch, Davos. Eine Beschreibung unserer Reise, zuhanden und zur Instruktion zukünftiger Auswanderer. Notizen, adressiert an den löblichen Kleinen Rat des Kantons Graubünden.
Er zeigte auf sein Wachstuchheft, das aufgeschlagen zwischen ihnen lag, eine leere Doppelseite, gierig auf Zahlen, Buchstaben. Versprach dann, später, im Lauf des Vormittags, mit Anna Giger zu reden.
Das Mädchen wischte mit dem Fingerknöchel das Feuchte unter der Nase weg, nickte. Verliess dann den Raum, ohne die Türe ganz zuzuziehen.
Ein Luftstoss fuhr herein, wirbelte die Blätter des Wachstuchhefts auf. Davatz ging schimpfend zur Tür. Stündlich könne er Streit schlichten, seufzte er, als er sich wieder setzte. Dabei brauche er seine Ruhe, so ein Bericht sei eine heikle Sache. Darum sei er auch froh, wenn sie ihm zuhöre. Sie, Anna Barbara Simmen, könne notfalls Vergessenes ergänzen. Mit seiner Frau, die seekrank in der Kajüte liege, sei wohl bis Santos nicht mehr zu rechnen …
Wieder hörte man Schreie, Kinder rannten über das Deck. Weder sein Wachstuchheft noch das Stübchen des Steuermanns vermochten ihn wirklich abzuschirmen.
Jeder war verfilzt mit jedem.
Sie gehörten, ob sie es wollten oder nicht, auf Gedeih und Verderb zusammen: 265 Auswanderer aus den Kantonen Graubünden, Glarus, Zürich, St. Gallen, Aargau, Freiburg …
Und neun in Hamburg Dazugestossene aus Preussen.
Im Bauch des Walfischs sitzen. Hoffen auf den Tag, an dem man an Land gespuckt wird. Die Anderswelt, Barbara.
Lass diese Leute erst einmal drüben sein. Boden unter den Füssen haben. Ein Dach über dem Kopf. Werkzeuge, Haustiere, Kaffeesträucher. Dinge, die man uns vertraglich zugesichert hat.
Etwas Neues wird in den Leuten aufkeimen, sobald sie befreit sind von der zehrenden Sorge um das Notwendigste.
In diesen Menschen, Vetter Davatz?
Er schaute sie an, sah, wie der Widerspruch ihre Oberlippe kräuselte.
In jedem Menschen steckt etwas Gutes, Barbara. Nur der Weg ist verschüttet, auf dem er gut sein will. Pestalozzis Glauben in die Ärmsten sollten wir haben. Kraft aufbringen für ein neues Stans, ein Ifferten, einen Neuenhof. Das wünsch ich mir. Mehr noch: Zellers Gläubigkeit. Er blickte auf die Meeresfläche, sagte: Du hättest die Kinder sehen sollen in der Rettungsanstalt Beuggen. In der Nähe von Basel steht sie, am Badischen Rheinufer. Wie sie uns gebracht worden sind: verwahrlost, eine wilde Horde. Unter Zellers Händen sind sie zu Menschen geworden.
Sie stichelte stumm an der Hose herum, die dem Heinrich gehörte, seinem Jüngsten.
Wie damals sass sie da, liess seinen Sätzen freien Lauf. Anna Barbara Simmen, hatte er sie in der Schule einmal aufgerufen, warum sagst du nichts?
Ich höre zu und denke, Lehrer Davatz.
Freilich, denken durfte sie. Aber andere Schüler lagen da wie ein offenes Buch. Sie glich einem Wasser, die Oberfläche nah, unter dem Spiegel eine Gegenwelt von Bergen, abgründigen Tälern.
Auf welche Überraschungen konnte man sich da gefasst machen? Sein Verdacht hatte sich bestätigt. Später. Als es passiert war mit dem Kind.
Er blätterte im Wachstuchheft zurück. Ärger zog seine Stirn zusammen. Sie solle, bat er sie, aufmerksam folgende Stelle anhören:
»Den 13. April früh morgens marschierten wir über die lange Rheinbrücke hinüber nach Deutz, um in dem dortigen Bahnhofe die Wagen zu besteigen, die uns in schnellem Fluge nach Hannover, nach Minden, brachten und dort den Dampfwagen überlieferten, mit welchen wir den 14. April, morgens Viertel nach drei Uhr, nach Haarburg, Hamburg gegenüber, kamen. Wie uns unser Herr Agent sagte, hätten wir am vorhergehenden Abende spätestens um 11 Uhr in Haarburg eintreffen und dort ein Nachtessen erhalten sollen; allein bei der wirklich sehr langsamen Fahrt dieses hannoverischen Zuges erreichten wir Haarburg erst am folgenden Morgen, sodass dann aus dem Nachtessen nichts wurde, und wir mit dem in Köln gekauften Proviant von da an bis nach Hamburg, wo wir am 14. April morgens 6 ½ Uhr mit einem Dampfschiffe anlangten, es aushalten mussten …«
Davatz hielt inne, fragte Barbara, ob es in Hamburg halb sieben oder Viertel vor sieben gewesen sei?
Eher halb sieben, sagte sie, unterdrückte ein Gähnen. Die Tür des Steuermannstübchens wurde nochmals aufgerissen. Margarete wirbelte herein, die zwölfjährige Davatz-Tochter: Der Heinrich ist fort!
Barbara warf das Flickzeug hin, schoss auf.
Du hast doch versprochen, auf die Kinder achtzugeben, schimpfte sie.
Margaretes breites, von dunklen Haarsträhnen umrahmtes Gesicht verzog sich.
Ich habe ja geschaut. Aber dann ist Heinrich plötzlich weg gewesen. Wenn er nur nicht ins Unterdeck gefallen ist wie der Huberbub!
Das jüngste der Huberkinder war auf der steilen Treppe ausgerutscht, ins Unterdeck auf eine Kiste gefallen. Jetzt lag es auf seinem Strohsack, zwischen Leben und Tod. Rosina Marti aus Engi hatte ihm einen Kopfverband gemacht, aber die Wunde nähen konnte sie nicht, und in den Kopf schauen konnte sie auch nicht, ein Schiff mit fast dreihundert Menschen ohne Arzt!
Barbara rennt aus dem Steuermannstübchen über das Deck. Im Nu hat sich ihr Rocksaum mit der Nässe der Planken vollgesogen. Unter dem Vordach der Kombüse stösst sie auf ein paar von den Fanaser Kindern, ihr fünfjähriger Sohn Jakob ist dabei.
Auf ihre Frage nach Heinrich meint Jakob: Vielleicht ganz hinten, bei den Salzfässern. Dort, wo’s verboten ist. Schon gestern hat er dorthin gewollt.
Dieser jüngste Davatzspross, drei Jahre alt, verhätschelt von den Schwestern. Seit seine Mutter seekrank in der Kajüte liegt, hält er Barbara oder Margarete in Trab. Zwischen den Fässern, hinter dem Kreuzmast, scheucht Barbara mit ihrem Suchen ein Liebespaar auf, einer der Krättlibuben mit einem Mädchen aus Serneus, beide noch nicht konfirmiert. In der Nähe beugen sich Matrosen über ein Segel.
Habt Ihr ein Kind gesehen? So gross etwa?
Barbara streckt flach die Hand aus, hält sie in Kniehöhe über den Boden.
Sie sucht eine Ratte, grinst einer der Matrosen. Davon gibt es genug, Mamsell. Kommt hinunter in den Schiffsraum, dort, wo es am dunkelsten ist! Ich will Euch eine zeigen! Er wiegt sich in den Hüften, spitzt die Lippen. Barbara, Zornröte in den Wangen, wendet sich ab. Im Weitergehen stolpert sie über einen Eimer, die Lauge schwappt über die Planken.
He, Mamsell!
Sie rappelt sich auf, rafft, um nirgends hängen zu bleiben, den Rock hoch. Der Wind treibt Seifenblasen schräg über das Deck hin, dünnwandig, in den Farben des Regenbogens.
Vor der Küche eine Schlange von Leuten mit Trinkgefässen. Jeden Morgen um neun wird nach der Bettnummer ein Glas Wasser ausgeteilt. Rosina Marti giesst der Gigerin aus Grüsch von der trüben Flüssigkeit ins Glas. Die Gigerin riecht daran.
Die reinste Gülle! Angewidert schüttelt sie den Kopf.
Wir mussten Essig beigeben, damit man es trinken kann, sagt Rosina, zuckt die Achseln. Das Wasser wird im Fass von Tag zu Tag trüber. Das soll immer so sein, wenn man in die heissen Zonen kommt, sagt der Kapitän.
Wenn nur das Pökelfleisch nicht so versalzen wäre, das macht einen Mordsdurst, meint der Nächste. Barbara ist sein Gesicht mit den weissen Bartstoppeln von klein auf vertraut. Peter Räs, Schuhmacher von Fanas. Mit seinem Rucksack ist er früher bis nach Fideris gekommen, hat Schuhe zum Flicken eingesammelt. Einer der ältesten Passagiere ist er, an die siebzig.
Ob er den jüngsten Davatz gesehen habe, den Heinrich? Schaut im Zwischendeck nach, rät er. Immer mehr Kinder treiben sich dort herum. Stehlen, was ihnen in die Finger kommt. Bis wir in Brasilien ankommen, sind es Wilde geworden! Dort können sie dann mit den Affen an den Bäumen turnen! Barbara hört noch auf der Treppe zum Zwischendeck sein hüstelndes Lachen.
Das Zwischendeck, ein dumpfer, mit gärenden Gerüchen erfüllter Keller. Durch die Luken fällt spärliches Licht in den vorderen Teil, wo man den ledigen Frauen Schlafplätze angewiesen hat. Der mittlere Teil, wo die Verheirateten liegen, ist dämmriger, der Hintergrund, den ledigen Männern vorbehalten, verschwindet im Dunkel.
Barbara drückt sich an den Schlafgestellen vorbei. Wie Obststeigen sehen sie aus, immer zwei Vierereinheiten übereinander. Die schmalen Gänge sind mit Kisten, Seesäcken verstellt, Barbara klettert über Hindernisse, blickt im Dunkel der Schlafnischen in fiebrige Augen, apathische Gesichter. Jetzt, morgens um halb zehn, halten sich hier nur Kranke auf.
Zwei Arme strecken sich ihr entgegen.
Die Frau Disch aus Haslen. Seit Hamburg liegt sie auf ihrem Strohsack.
Ein andermal, wehrt Barbara ab. Ich suche den Heinrich Davatz.
Den hab ich vorbeirennen sehen, sagt die Bettnachbarin, die ihrem kranken Kind einen Löffel Brei in den Mund schiebt. Auf dem Sack darüber erbricht sich eine alte Frau.
Wo? Wo ist er vorbeigerannt?
Die Frau zeigt mit dem Löffel in den hinteren Teil des Raums.
Zu den Untervazern?
Sie nickt. Dort hinten spielen sie Karten.
Die Dunkelheit dort sieht aus, als würde sie den, der sie betritt, nie mehr loslassen. Sicher, viele ehrliche, freundliche Leute sind in der Gruppe der Untervazer, das muss auch Davatz zugeben, aber sie werden von ihren verwahrlosten Dorfgenossen geplagt. Jenische, sagt Davatz, Kesselflicker. Die Gemeinden haben Vorschüsse bezahlt, um sie loszuwerden. Paravicini, der Agent, hat in Hamburg, wohin er die Auswanderer begleitet hat, erklärt: »Die sind dem Teufel vom Karren gefallen. Ich hätte sie nicht unter Vertrag nehmen sollen.«
Barbara geht schneller, ihr Rock streift die Pritschen. Mit jedem Schritt scheint ihr, die Bettgestelle rückten enger zusammen. Augen glimmen im Dunkel. Dort drüben auf dem Sack ein Unförmiger, als Barbara vorbeiwischt, teilt er sich in zwei, eine Frau, die sich der Umarmung eines Mannes entwindet. Ihr Rücken schimmert fahl.
Weiter hinten, im Schein einer Öllampe, spielen drei Männer Karten. Sie sitzen auf einem der oberen Gestelle, ihre Beine hängen über den Pritschenrand.
Auf dem untern Strohsack, hinter dem Vorhang aus baumelnden Beinen, hebt einer eine Flasche an den Mund. Jetzt hat er die Frau entdeckt, macht runde Augen, wischt mit der Hand über den Mund: Ein Besuch!
Die Kartenspieler schauen herunter. Barbara, starr vor Schreck, stammelt etwas von dem verlorenen Davatz-Kind.
Da schiebt der Mann auf der unteren Pritsche schnell ein Bein vor, sie fällt hin, spürt Schnapsatem im Nacken, zwei Hände fassen sie um die Taille.
Sie schreit, Männer und Frauen stürzen herbei. Lasst sie los, das kann Ärger geben, zetert einer der Untervazer. Sie gehört zur Davatz-Familie!
Nur eine Angeschlossene, sagt die Frau höhnisch. Der Davatz hat gleich zwei liederliche Frauenzimmer dabei, jede hat ein Uneheliches.
Und spielt die Unschuldige, grinst der Schnapsatmige. Er hat sie losgelassen, Barbara spürt das Knie surren, humpelnd macht sie sich davon, kann noch hören, wie die Frau sagt: die Simmen. Nicht mehr die Jüngste. Ende zwanzig wohl. Wird schauen müssen, wie sie in Brasilien unter die Haube kommt.
Nur fort aus der klebrigen Dunkelheit. Auf dem Deck, unter dem Fockmast, steht sie still, über ihr sitzt ein Matrose auf der Rahe. Da kommt Rosina Marti vom Wasserschöpfen. Seit Barbaras Zeit in Matt sind sie Freundinnen, haben zusammen im Auftrag der Gemeinde die Armensuppe gekocht. Trotz der Woche auf See sieht Rosina, eine kleine, dralle Person, immer noch rosig aus.
Was ist mit Heinrich?
Nicht gefunden. Barbara reibt das surrende Knie. Und in der Kajüte?
Rosina mit ihrem gesunden Menschenverstand! Nur neun der 265 Passagiere haben Kajütenplätze, Davatz hat vom Agenten drei geschenkt bekommen, wohl als Dank für die fünfzig mitgebrachten Fanaser.
Bequem gelegen sind sie nicht, im hinteren Teil des Schiffs, wo der Seegang empfindlich zu spüren ist. Alles eng, man kann sich kaum drehen, als Barbara hereinkommt, beugt sich Elisabeth Auer gerade über den Spucknapf. Auf der Pritsche daneben sitzt Heinrich rittlings auf seiner Mutter, sitzt einfach da und patscht mit der gepolsterten Hand auf den Bauch, kreischt vor Vergnügen, als er Barbara den Kopf schütteln und den Drohfinger machen sieht.
Plaggeist, stöhnt Katharina Davatz.
Neben ihr sitzt eine der Schwägerinnen aus Fanas, die sich täglich ein paarmal einfinden, um die Seekranke zu trösten.
Mir ist übel, dieser Blutandrang im Kopf, murmelt die Davatz.
Von Blutandrang ist nichts zu sehen. Ihr Gesicht verschwindet blass in den Rüschen der Haube.
Barbara lässt sich erschöpft auf dem Rand der Pritsche nieder. Erst jetzt ist Frau Davatz auf sie aufmerksam geworden. Wir liegen hier, und Ihr müsst Kinder hüten, Wasser holen, flicken, murmelt sie. Das tut mir leid, Ihr seid ja schliesslich nicht unser Dienstmädchen.
Aber eine Angeschlossene. Barbara zuckt die Schultern. Die Schwägerin nickt, lacht trocken: Ja, mitgegangen, mitgefangen!
2
Am späten Nachmittag standen Rosina Marti und Barbara an der Reling, die Kinder spielten im Hintergrund. Die Sonne legte schräge Lichtbalken über das Wasser, tauchte die Menschen, die auf Deck hin- und hergingen, in rötliches Licht. Am Horizont hatten sich querliegende Bänder von Gewitterwolken aufgetürmt, sie täuschten Berge vor, einen fremden Kontinent.
Du hättest dich nicht an die Davatz-Familie anschliessen sollen, sagte Rosina. Ist dir bewusst, dass nach dem Vertrag jeder für den andern haftet? Angenommen, Davatz, das Familienoberhaupt, stürbe, dann musst du mit deiner Arbeit der Frau helfen, die Kinder durchzubringen und die Schulden, den Reisevorschuss zu zahlen …
Barbara nickte, betrachtete die Freundin, deren Wangen im Abendlicht wie von innen erwärmt schienen.
Zugegeben, beim Agenten Paravicini habe ich es mit meinem Wunsch, allein zu stehen, leichter gehabt als du. Schliesslich bin ich Witwe, habe fünf zum Teil erwachsene Kinder, gehe auf die fünfzig zu …
Rosina Marti gehörte zu den wenigen, die immer noch standfest waren auf dem Schiff, seit Hamburg aufrecht, solid, rotbackig, immer bereit, bei der Krankenpflege, in der Küche zu helfen. Nichts schien sie ins Schwanken zu bringen auf ihren kurzen, stämmigen Beinen, weder die Überfahrt noch die Schicksalsschläge, die vorausgegangen waren: der Tod des ersten Mannes von fünf unmündigen Kindern weg, der Tod des zweiten schliesslich, der ihr die Auswanderungspläne, seine Kinder aus erster Ehe überlassen hatte …
Nicht nur Paravicini, auch Davatz habe ihr beigebracht, dass sie sich anschliessen müsse, erklärte Barbara. Im Schutze seiner Familie fahre sie besser. In Brasilien gelte, wie auch in Europa, eine Alleinstehende als Null, erst wenn man den Wert des Mannes davorstelle, gelange sie zu Ansehen.
Eine ledige Mutter sei vogelfrei! Als Angeschlossene, unter den Fittichen seiner Familie, geniesse sie die Behandlung eines ehrbaren Frauenzimmers.
Nachts im Zwischendeck liegt Barbara auf dem ihr zustehenden Viertel des Holzrostes, macht sich, die Hände unter die Brust gelegt, schmal zwischen Jakob, der sich krümmt im Schlaf, und der mit offenem Mund daliegenden Rosina.
Sie hasst die Nachtstunden, wo das Zwischendeck ein Keller ist, die Menschen wie Erdäpfel in ihren Steigen liegen und gärende Gerüche ausströmen, Gedanken, Träume wachsen, Keimlinge, die zaghaft zum Licht tasten …
Sie hasst, dass es nie still wird, immer das Stöhnen der Schlaflosen in der Luft. Flüsterworte. Tappende Schritte. Das Knarren des Schlafrostes dicht über ihrem Kopf unter den sich wälzenden Körpern von Rosinas halbwüchsigen Kindern.
Sie spürt die schlingernden Bewegungen des Schiffs, stellt sich vor: der Dreimaster, wie er mit seiner Fracht durch das Wasser pflügt.
Die Tücher der Segel füllen sich mit Nachtschwärze. Der Ozean spannt sich.
Auf der Landkarte in der Schulstube des Thomas Davatz war er eine mit blauen Strichen schraffierte Fläche gewesen.
Ihr Finger hatte sich langsam über den Papierozean geschoben, die Augen hatten den Seeweg auszumessen versucht: Hamburg – Santos. Als Schülerin hatte es sie beeindruckt, dass die Ozeane, wie Lehrer Davatz sagte, die Krümmung der Erdoberfläche mitmachten.
Warum floss das Wasser nicht ab, überflutete das Festland? Auch die Fische schwammen der Krümmung nach, pochten mit ihren Mäulern von unten her sanft an die Oberfläche.
Im Glarnerland hatte Barbara aus Büchern mehr von den Welten unter Wasser erfahren. Mit Peter Ackermann hatte sie die dicken Folianten mit den Kupfern angeschaut, in der Studierstube von Pfarrer Becker in Linthal. Wenn sie sich in die Betrachtung einer der Abbildungen versenkten, ruhte Peters schwärzlicher Finger auf dem Blatt. Es war, als gehöre er mit dem unförmigen Nagel, den Rissen und Kerben voll Maschinenfett und Druckerfarbe zu den Kuriositäten der Unterwasserwelt: ein Bestandteil der Korallenriffe, wie die Purpurschnecken, die Quallen.
Manchmal, beim Wenden der Seiten, blieb das Zwischenblatt kleben, dann beugte sich Peter zu dem Kupfer, blies in das Seidenpapier. Unter seinen Atemstössen belebten sich die Seepferde, Seesterne, Planktonschwärme. Muscheln gingen auf, bewegten Flimmerhaare in der Strömung. Sie spürte Peters Schulter an ihrer Schulter, nahm die Wärme seiner Wange auf, manchmal streifte eine Strähne seines Haars ihr Gesicht.
Barbara!
Sie zuckt zusammen, Rosina hat sie an der Schulter berührt.
Ich dachte, du schläfst?
Die Geräusche auf Deck halten mich wach, sagt Rosina. Mir scheint, es wird ein Gewitter geben. Ich mache es wie du, liege mit offenen Augen, denke.
An Brasilien?
Rosina seufzt: Wenn wir nur schon dort wären. Ich möchte meinen Kaffeeberg sehen, die Palmen, meine Blockhütte. Und du? Denkst an Ackermann?
Barbara nickt. Man kann den Umriss ihres Gesichts im rötlich düsteren Schein der Petrollampe erkennen.
Der hat bestimmt schon seine Schiffstruhe gepackt, fährt uns mit der Glarner Gruppe nach, sagt Rosina. Im September werden sie in Brasilien ankommen. Du wirst doch in Ibicaba mit ihm und dem Kind zusammenwohnen?
Davatz wird das kaum gestatten. Peter Ackermann hat im Glarnerland Frau und Kind, wenn wir zusammenlebten, sei das unmoralisch. Das neue Leben, hat Davatz gesagt, müsse ohne Sünde sein.
Rosina lacht. In Brasilien gibt es keinen Pfarrer. Keinen evangelischen, wenigstens. Da muss Davatz ein Auge zudrücken oder zwei … Du freust dich doch, dass Ackermann nachkommt?
Ich glaube schon.
Nach einer Pause fügt Barbara bei, vorstellen könne sie es sich nicht. Seit fünf Jahren habe sie gelernt, sich selbstständig durchzuschlagen; mit einer gemeinsamen Zukunft habe sie nicht mehr gerechnet.
Rosina schweigt. Barbara lauscht auf das Knarren der Planken, das Knacken der Mastbäume, das Sirren des Windes in der Takelage. Eine unruhige Nacht.
Von Peters Absicht, sich einer Glarner Auswanderergruppe anzuschliessen, hatte Barbara erst am Heiligen Abend erfahren.
Es war ein aussergewöhnlich lauer Tag gewesen, kaum Schnee auf den Feldern. Nach dem Einnachten hatte es geklopft, und weil sie in der Stube den Weihnachtsbaum schmückte, war Jakob an die Tür gegangen.
Mutter, komm!, hatte er gerufen und mit den Fäusten an die verriegelte Stubentür getrommelt, ein Mann ist draussen! Im schwachen Schein der Lampe stand Peter.
»Das ist der Vater, Jakob, hast du ihn nicht erkannt?«
Der Kleine schüttelte den Kopf, schaute ungläubig zu dem Mann auf. Das letzte Mal, im Sommer, hatte sich ihm sein Gesicht anders eingeprägt: lachend, braun gebrannt, mit hellem Haar. So hatte er das Bild bewahrt, unversehrt hatte es die Herbststürme und den ersten Schnee überdauert. Jetzt sah der Vater aus wie irgendein Fabrikarbeiter: abgezehrt, bleich, das Haar schmutzig gelb, strähnig.
Er könne in die Stube kommen, sagte Barbara, Frau Ellmer, die Vermieterin, feiere Weihnachten bei ihrer Tochter im Nachbardorf.
In der Stube stand ein Bäumchen, Watteflocken waren darauf gezupft, ein paar Kerzen aufgesteckt, am Boden standen Maria, Josef, das Kind in der Krippe. Die Krippe gehörte der Frau Kirchenvogt Ellmer. Jakob jauchzte, als er sie sah, klammerte sich, das Weihnachtsglück mit dem Vater in Zusammenhang bringend, an sein Hosenbein.
Peter griff gerührt in die Tasche, wickelte aus dem Nastuch eine hölzerne Kuh. Er habe sie für Jakob geschnitzt, nachts, nach den vierzehn Stunden in der Druckerei.
Während Jakob das Kühlein scheu betastete, mit dem Finger an die Spitzen der braun angemalten Hörner stupste, eröffnete Peter seinen Auswanderungsplan. Es sei ihm ernst. Ende Juni reise er ab. Auch für ihn komme es überraschend, einer aus Haslen habe den Mut verloren mitzugehen, da habe er in die Lücke springen können.
Wir sehen uns in Brasilien, Barbara! Er lachte in ihr erstauntes Gesicht.
Hast du denn auch einen Halbpachtvertrag gemacht für die Kaffeeplantage Ibicaba?, fragte sie.
Er nickte. Der Führer der Gruppe habe die Verträge mit dem Hauptagenten Paravicini abgeschlossen, die Auswandererblätter und andere Zeitungen seien ja seit Monaten voll mit Inseraten. Dort drüben wird alles anders sein, hatte er gesagt. Auch mit uns, Barbara.
Wieder eines dieser Versprechen, die das Blaue vom Himmel holten? Wie in Haslen, als er gesagt hatte, nach der Geburt des Kindes würden sie zusammen wohnen, eine Gemeinschaft sein, Vater, Mutter, Kind?
Auch damals war es Weihnachtszeit gewesen. In der Kirche unter der Kanzel, die Krippe. Maria, Josef, das Jesuskind. Diese Innigkeit in den dreien, im Schutze des Stalls.
Auch ihr hätte eine Höhle, eine elende Hütte genügt. Auf Stroh schlafen, warum nicht? Hauptsache, Peter und sie gehörten zusammen.
Dass Peter damals sein Versprechen nicht hatte einlösen können, hatte sie ihm nicht nachgetragen. Die Verhältnisse liessen es nicht zu. Da war der Vorarbeiter, der mit Entlassung drohte. Die Hausbesitzer, die ihnen kein Zimmer geben wollten: einem sündigen Paar. Die Schikanen der Leute, ihr Gerede.
In Brasilien wird alles anders. Freust du dich, Barbara? Er hatte sie an sich gedrückt, bis ihr der Atem wegblieb. Sie spürte, wie ihr Herz wieder seine alten, verrückten Sprünge machte. Er hielt sie eine Weile an sich gepresst, an den fadenscheinigen Loden seines Mantels, dem der Wirtshausdunst nach Tabak und Schnaps entströmte.
3
»In der Nacht vom 16. auf den 17. Mai stellte sich gegen Mitternacht plötzlich ein Gewitter mit sehr heftigem Regen und etwas Wind ein. Am Morgen lagen wir bei völliger Windstille bei dunkler, schwüler Luft (der Thermometer stand morgens auf +20 Grad, mittags auf +22 und abends auf +21 Grad Reaumur) und unter entsetzlichen Regenschauern auf der ganz ruhigen See unter dem 6. Grad nördlicher Breite …«
Davatz legte die Feder weg, blickte von seinem Wachstuchheft auf. Wie schon einige Male auf der Überfahrt befiel ihn ein fast schmerzhaftes Gefühl von Verlorenheit.
»Ihr rennt einer Utopie nach, Davatz«, hatte Pfarrer Seifert, ein Gegner der Auswanderung, noch im Februar aus dem Toggenburg geschrieben und den Psalm 37.3 zitiert: »Hoffe auf den Herrn und thue Gutes; bleibe im Lande und nähre dich redlich.«
Davatz hatte in der Bibliothek in Chur im Wörterbuch nachgeschlagen: Utopie kam vom griechischen U-topos, das hiess Nicht-Ort.
Ein Regenschauer wischte über das Bullauge, machte die Scheibe blind. Auch vom Deck aus hatte Davatz an diesem Morgen das Meer nicht gesehen, das Schiff schien stecken geblieben zu sein in wattigem Dunst.
Verloren im Nicht-Ort. Auf dem weissen Fleck zwischen Vergangenheit und Zukunft.
Das Auge findet keinen Halt mehr; die Imagination kann sich an nichts mehr entzünden.
War es nicht vermessen gewesen, dem Greif- und Sichtbaren den Rücken zu kehren?
Dieser geheime Drang nach Veränderung. Sein ganzes bisheriges Leben hatte er es gespürt, das Pochen, Kreisen der Gedanken, die nagende Ungeduld.
In Beuggen, in der Armenlehreranstalt, hatte es begonnen, dann war es stärker geworden im Lehramt in Freienstein, Fideris, zuletzt in Fanas.
Diese stumpfen Tage. Wie die Schulbänke zu dösen schienen in der schummrigen Wärme des Kachelofens. Im März, gegen Ende des Schuljahrs, war mit den grösseren Schülern kaum mehr etwas anzufangen.
Ein Zittern lief durch ihn, wenn er vorne an der Rechentabelle stand, ihre stumpfen Blicke sich auf seiner Gestalt vereinten. Ihm war, als schwände unter diesen Blicken seine Lebenskraft, frühzeitig müsse er, täglich so vor den Bänken stehend, verdorren.
Er drehte den Schülern den Rücken zu, schaute auf die Pestalozzische Einheitstabelle, der Stecken in seiner Hand tippte auf die oberste Zahl.
Cyprian, du!
Das Meerrohr federte.
In seinem Rücken rührte sich nichts.
Subtrahieren sollst du!
Jetzt ging ein Kichern los, Flüsterworte.
Davatz drehte sich um. Cyprian sass stumm in der vordersten Bank, der Kopf mit dem offenen Mund war zur Seite gefallen, die nackten Füsse, an denen Kuhmist klebte, schauten unter der Bank hervor.
Zornig liess der Lehrer sein Meerrohr auf die Tischplatte sausen.
Cyprian erwachte, kratzte seinen grindigen Kopf. Zwinkerblicke. Wie ein Maulwurf, flüsterte einer. Die andern lachten.
Wann bist du heute aufgestanden?
Um vier.
Und was hast du getan in der Früh?
Den Stall gemistet. Gemolken. Und Feuer gemacht, weil die Mutter …
Davatz winkte ab. Schon seit Langem hatte er sich vorgenommen, bei Rieder vorzusprechen. In der Armenkommission, deren Mitglied Davatz war, hatte es die Runde gemacht: Beim Rieder herrscht eine Lotterordnung, dass es Gott erbarm.
Auf dem Flur läutete Kollege Pollett die Schulglocke. Leben kam in die Schüler, nach dem Schulgebet drängten sie lärmend und einander stossend aus dem Zimmer. Davatz schloss hinter ihnen die Tür.
Mit einem Seufzer der Erleichterung setzte er sich an sein Katheder, diesmal vor leeren Bänken, Stösse von unkorrigierten Heften vor sich. Die Schatten der Häuser, gegenüber an der Dorfgasse, machten das Schulzimmer vorzeitig dämmrig. Vom Sägewerk hörte er das Geräusch der Sägeblätter, ein grelles Kreischen, das seinen Schulalltag begleitete. Er griff nach dem obersten Diktatheft, aber die Schrift, die aussah wie gestrickt, liederlich locker, mit tintigen Verdickungen, Blössen wie von Fallmaschen, verschwamm unter seinen Augen.
Eine jähe Angst hatte ihn gepackt, für immer hängen zu bleiben in dieser dämmrigen, wie von Spinnweben verhängten Schulstube. Ausgeliefert bis an sein Ende diesen ereignislosen Tagen.
Unbemerkt war seine Frau hereingekommen, die Hände reibend, hatte sie sich hinter den Stoss der unkorrigierten Hefte gestellt.
Sie wisse nicht, was kochen.
Wie immer, wenn sie dem Weinen nahe war, flatterten ihre Augenlider.
Kartoffeln, murmelte er abwesend.
Die faulten, sagte sie. Von den besseren hätten sie im Keller noch höchstens fünfzehn Kilo. Zudem sollte sie noch welche als Saatkartoffeln übrig lassen.
Dann also Mais …
Da schoss Zornröte in ihre Wangen. Der Türken sei, seit den schlechten Kartoffelernten, im Preis gestiegen, sagte sie heftig. Geld habe sie keines mehr in der Schublade, und anschreiben zu lassen gehöre sich nicht, habe er selbst gesagt.
Ob er nicht einen Brief schreiben könne an seinen Oheim Gasner in Chiavenna, der in Diensten stehe beim Landammann von Planta? In Chiavenna komme man billiger zu einem Sack Türkenmehl, man könne ihn ja dem Churer Boten mitgeben. So ein Brief brauche Zeit, sagte Davatz. Mit so einer Bitte könne man, wenn man sonst wenig miteinander korrespondiere, nicht einfach hereinplatzen.
Jaja, er wolle es tun, meinte er schliesslich, auf die Mundwinkel seiner Frau schauend, die jetzt wie die Augenlider zu zittern begannen. Als sie gegangen war, riss er eines der Fenster auf. In der Sägerei drehte sich das Wasserrad, die mechanisch betriebenen Sägeblätter fuhren zischend durch den Stamm. Eine Wolke von Holzmehl wehte herein, legte sich als weisslicher Belag auf das Nussbaumholz des Harmoniums. Davatz schloss das Fenster, holte aus seinem Pult einen Briefbogen hervor, begann:
»Lieber Oheim Jakob!
Es wäre hohe Zeit, dir wieder einmal zu schreiben, wenn ich auch kein besonderes Geschäft hätte, das mich dazu veranlasst: ich gestehe aber zum Voraus aufrichtig, dass mein Schreiben heute noch ausgeblieben wäre, wenn eben nicht ein besonderer Umstand mich dazu triebe.
Wie du weisst, bestehen die hiesigen Nahrungsmittel bei dem fortwährenden Fehlschlagen der Kartoffeln in Brot und andern Mahlzeiten, die gegenwärtig ziemlich theuer sind. Gerne hätte ich nun ein Quantum Mais oder Türken angeschafft für meinen ziemlich grossen Hausgebrauch. Der hiesige Türken ist aber gar schlecht, und nun auch theuer. Wenn es dir nicht zu viele Mühe macht, so wäre es mir sehr lieb, wenn du mir einen Sack Mais in Clewen kauftest und einem guten Fuhrmann nach Chur zum Herrn Ruggli in der Kupfergasse schicktest …«
Wieder das sägende Geräusch.
Schon war er ein Teil dieser modrigen Welt.
Dieses Gefühl zu ersticken; er konnte sich nicht konzentrieren, musste hinaus an die frische Luft.
Zum Rieder-Bauern wollte er, bevor der Vorsatz wieder vergessen war.
Auf der Gasse wurde er von der Räs aufgehalten. Warum ihre Katrin nie vorsingen dürfe? Es gehe dem Alphabet nach, sagte Davatz, die Katrin müsse sich noch gedulden.
Zwei Häuser weiter wurde er von Christian Isler angeredet, der ihn bat, ein Beschwerdeschreiben nach Chur aufzusetzen. Der Blitz habe seine Scheuer getroffen, die Versicherung, mit der er einen Vertrag abgeschlossen habe, wolle nicht zahlen. Davatz versprach, behilflich zu sein.
Endlich liess man ihn weitergehen.
Kaum ein Tag, an dem er nicht helfen und raten sollte. Ein Lastesel der Gemeinde.
Der Besuch beim Rieder-Bauern hatte wenig Erfolg. Rieder stand breitbeinig in Stiefeln vor dem Tenn, schichtete Mist auf. Cyprian sei der Älteste, müsse mithelfen. Ob der Lehrer glaube, auf einem Bauernhof, wo es mehr Steine auf den Äckern gebe als Kraut, erledige sich die Arbeit von alleine?
Seine Frau läge im Kindbett, habe vor drei Tagen geboren. Den ganzen Tag drehe sich alles darum, wie er die Mäuler stopfen könne …
Während Rieder sprach, hantierte er mit der Mistgabel weiter.
Davatz sagte, als Mitglied der Armenkommission werde er ein Wort für ihn einlegen. Schuhe werde er für die Kinder bekommen, ein paar Ellen Tuch …
Rieder murrte Unverständliches, sein Blick blieb nach unten, auf den immer grösser werdenden Misthaufen, gerichtet.
Noch hatte Davatz keine Lust, in die Dorfgasse einzutauchen, wo ein Haus dem andern das Licht nahm, er ging vor der Kirche das Treppchen hinunter zum Friedhof. Die Toten hatten, an der Flanke der Kirchmauer, den sonnigsten Platz im Dorf.
Von hier aus sah man Wiesen, Abhänge, ein Stück Talboden, bis dorthin, wo die Felswände der Klus den Blick versperrten. Durch einen Spalt zwischen den Wänden ahnte man die Ebene mit dem Rhein, schimmerten Ketten weit entfernter Berge.
Davatz blieb vor einem offenen Grab stehen.
Jörg, sein Schulkamerad. Ein Baum hatte ihn erschlagen, dabei war er erst neununddreissig gewesen, so alt wie Thomas Davatz. Diese kurze Spanne Zeit. Keine Luft zwischen den Stunden, den Tagen geht vorzeitig der Schnauf aus.
Hineingeboren in die Enge, stecken geblieben in der Spur.
4
An diesem Abend mochte Davatz nicht mehr korrigieren. Hinter Heften, Schulbüchern bewahrte er den kompletten Jahrgang 1853 des »Kolonist« auf, sorgfältig hatte er Nummer für Nummer der Auswandererzeitung gelesen, in aller Heimlichkeit, nach dem Korrigieren, im Lampenlicht.
Sein Blick blieb an der Titelvignette hängen, die, als einzige Illustration, Nummer für Nummer wiederkehrte: eine Blockhütte, Palmen, im Schatten eines exotischen Baums sitzend, der Kolonist. Feierabend. Im Rücken das Blockhaus auf eigenem Boden, die Seinen wohlgenährt, bekleidet.
Auswandern, ja. Solange er noch die Kraft hat.
Mit den Jahren wächst die Versuchung, einen Pakt zu schliessen mit dem, was ist.
Früher hatte er, wie viele andere, an Nordamerika gedacht. Dann aber häuften sich, anfangs der Fünfzigerjahre, schlechte Nachrichten: Inflation, Mittellose wurden in den Häfen zurückgewiesen, wer mit seinem Ersparten drüben ankam, wurde von Spekulanten übers Ohr gehauen.
Ins Nachbardorf war einer zurückgekehrt, dem hatte in New York ein Makler ein Grundstück in Wisconsin verkauft, im Katasterplan mit der Nummer 727 versehenes Ackerland, das sich zwischen den Feldern eines schwedischen und eines mecklenburgischen Farmers befand. Als das Greenhorn aus Grüsch nach vielen Tagreisen den bezeichneten Weiler erreichte, hatte sich das erstandene Grundstück 727 wie eine Fata Morgana in Luft aufgelöst, das Land des Schweden stiess an das des Deutschen, keine Handbreit dazwischen, das Geld war hin, der mittellose Grüscher wurde per Schub nach New York zurückgebracht und gezwungen, das nächste Schiff zu nehmen …
Wohin also, anfangs der Fünfzigerjahre, als die Dörfer durch den Kinderreichtum übervölkert sind, das Brot rar geworden ist, die Fabriken durch die Konkurrenz aus England fallieren?
Da reisst, wie durch ein Wunder, illuminiert von der Beredsamkeit der Auswandererblätter, der Vorhang über einem noch unbekannten Schauplatz auf: Küsten mit hohen Kokospalmen, schräg gestrichen vom Passatwind, üppige Fazendas: Brasilien.
Im »Kolonist« hatte Davatz zunächst über die Dona-Franziska-Kolonien des »Hamburger Colonisationsvereins« gelesen.
Später erschienen immer gezieltere und optimistischere Berichte über die Parceria- oder Halbpacht-Kolonien des Senators Vergueiro im Hinterland von São Paulo. Der Kolonist, bisher fast nur deutscher Herkunft, wird eingesetzt zum Anbau von Kaffee, der Ertrag gehört zur Hälfte dem Grossgrundbesitzer, zur Hälfte, nach Abzug einer kleinen Verkaufsprovision, dem Kolonisten … Reisekosten werden vorgeschossen, baldige Schuldenfreiheit in Aussicht gestellt.
Der Fazendeiro der Musterkolonie Ibicaba, Senator Vergueiro, gilt als ein Bewunderer der schweizerischen Demokratie. Der Philanthrop hege den Wunsch, heisst es im »Kolonist«, »seine Plantagen nicht mehr durch schwarze Sklaven, sondern durch freie Arme bebauen zu lassen«. Einer seiner Söhne lernte an der Landwirtschaftlichen Schule in Hofwil, Kanton Bern, ein anderer wurde in Preussen geschult. 1847 trafen die ersten Kolonisten, circa 450 Rheinländer und Holsteiner, auf der Fazenda »Ibicaba«, zu Deutsch »fetter Boden«, ein.
Warnungen hatte Davatz nicht in den Wind geschlagen. Aber konnte es ernster zu nehmende Zeugen geben als Perret-Gentil, den damaligen schweizerischen Generalkonsul in Rio de Janeiro? Er hatte Ibicaba zweimal besichtigt, in der Nummer vom 29. Mai 1853 zitierte »Der Kolonist« seinen Bericht:
»Ich habe beinahe alle Wohnungen der Kolonisten besucht, Männer und Frauen, Jungen und Mädchen befragt, und Alle gestehen einstimmig, dass sie glücklich und zufrieden sind, obgleich sie die Sehnsucht nach dem Vaterland noch nicht ganz verloren haben …Hinsichtlich des Zustandes der Kolonisten zwischen der Heimath und Brasilien neigt sich die Waagschale ganz zu Gunsten des neuen Wohnortes. Sie haben Lebensmittel in Fülle, stehen weder Kälte noch Elend aus, und wenn ihnen etwas fehlt, haben sie nur nach der Fazenda zu gehen, wo sie entweder Geld oder Lebensmittel bekommen …In der Küche merkt man keinen Mangel: Speckseiten, Schinken, Würste hängen überall umher …«
Und in der Dezembernummer:
»Ein Faktum ist bereits dieses, dass die 67 bettelarmen Hessen-Familien, die im Jahre 1847 als die Ersten auf Vorschüsse nach jenen Kolonien gelangten, dort als Pächter nicht bloss ihre Schulden schnell tilgten, sondern zu solchem Wohlstande kamen, dass seither 30 Familien weiter gezogen sind, und bedeutende Ländereien gekauft haben …«
Thomas!
Der Lehrer schreckte aus seinen Erinnerungen auf, seine Frau war in die Kombüse getreten, den Jüngsten im Arm.
Draussen hatte es aufgehört zu regnen, das Deck, das sich allmählich mit Menschen zu füllen begann, glänzte. Davatz fasste den Arm seiner Frau, führte sie vorsichtig bis zur Reling. Sie stand unsicher, hielt sich am Geländer fest, er blickte besorgt auf ihre weissen Wangen, den verhärmten Mund.
Ein jäher Schreck durchfuhr ihn, der Verdacht, sie könnte schwanger sein, das zehnte Mal.
Neun Kinder hatte sie ihm geboren, drei waren im Säuglingsalter gestorben, das letzte, ein Mädchen, ein paar Monate vor der Reise.
Die vielen Geburten, eine Hauptursache der Massenverarmung, hatte Pfarrer Becker in Linthal gesagt.
Davatz hatte seinen Jugendfreund – sie kannten sich seit Beckers Jahr an der Kantonsschule in Chur – im Glarnerland besucht. Im Studierzimmer hatte er den Freund vorgefunden, das aufgeschlagene Totenregister auf dem Tisch, ein junger Fabrikarbeiter meldete den Tod seiner Frau an.
Ein Säugling wimmerte im Arm des Vaters, fünf Kinder waren um ihn geschart, barfuss, dürftig gekleidet.
Wie alt war die Frau?, fragte Becker. Im Februar vierundzwanzig geworden. Und wann habt Ihr sie geheiratet?
Mit achtzehn.
Als der Mann draussen war mit den Halbwaisen, sagte Becker: Die dritte Frau in diesem Monat, die im Kindbett gestorben ist! Man heiratet früh, damit der Lohn nicht abgegeben werden muss. Tagsüber steht die junge Frau am Haspel, nachts wird der Haushalt versorgt, um vier wieder Tagwacht. Ein Kind nach dem andern. Die dumpfen Fabriksäle, das Rattern der Maschinen, die Monotonie. Das greift die Nerven an, weckt im Unmass den Geschlechtshunger.