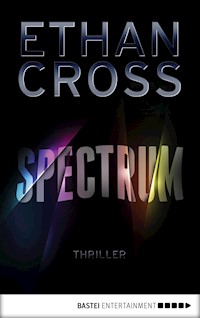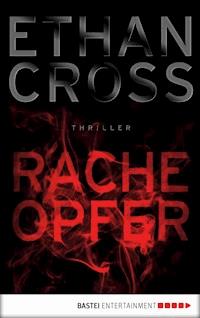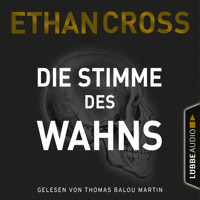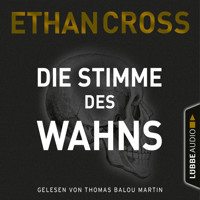9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Shepherd Thriller
- Sprache: Deutsch
Knallharte Action und psychologischer Nervenkitzel - Serienkiller Francis Ackerman junior ist zurück
Special Agent Marcus Williams und sein Bruder, der Serienkiller Francis Ackerman jr., verfolgen die blutige Spur mehrerer Auftragsmörder nach San Francisco. Dort stoßen sie auf einen besonders brutalen Killer namens Gladiator, der für ein mächtiges Verbrechersyndikat arbeitet. Die Ziele des Gladiators reichen jedoch weit über einfache Auftragsmorde hinaus: Er betrachtet sich als modernen Dschingis Khan und will dafür sorgen, dass er der Menschheit ewig im Gedächtnis bleibt. An eines hat der Gladiator dabei allerdings nicht gedacht: In seiner Arena des Todes stand er noch nie einem Gegner wie Ackerman gegenüber ...
Der 5. Band der fesselnden Thriller-Reihe aus der Feder von Bestseller-Autor Ethan Cross
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 608
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Kapitel 83
Kapitel 84
Kapitel 85
Kapitel 86
Kapitel 87
Kapitel 88
Kapitel 89
Kapitel 90
Kapitel 91
Kapitel 92
Kapitel 93
Kapitel 94
Kapitel 95
Kapitel 96
Kapitel 97
Kapitel 98
Kapitel 99
Kapitel 100
Kapitel 101
Kapitel 102
Kapitel 103
Kapitel 104
Kapitel 105
Kapitel 106
Kapitel 107
Kapitel 108
Kapitel 109
Kapitel 110
Kapitel 111
Kapitel 112
Kapitel 113
Kapitel 114
Kapitel 115
Kapitel 116
Kapitel 117
Kapitel 118
Kapitel 119
Kapitel 120
Kapitel 121
Über den Autor
Ethan Cross ist das Pseudonym eines amerikanischen Thriller-Autors. Nach einer Zeit als Musiker gelang es Ethan Cross, die Welt fiktiver Serienkiller um ein besonderes Exemplar zu bereichern: Francis Ackerman junior. Der gnadenlose Serienkiller erfreut sich seitdem großer Beliebtheit: Jeder Band der Reihe stand wochenlang auf der Spiegel-Bestsellerliste. Der Autor lebt mit seiner Frau und drei Kindern in Illinois.
Ethan Cross
ICH BIN DERHASS
Thriller
Aus dem amerikanischen Englisch vonDietmar Schmidt
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:Copyright © 2017 by Aaron BrownTitel der amerikanischen Originalausgabe: »Only the Strong«
Published in agreement with the author, c/o BAROR INTERNATIONAL, INC.,Armonk, New York, U.S.A.
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, KölnLektorat: Judith MandtTextredaktion: Wolfgang Neuhaus, OberhausenTitelillustration: © shutterstock/IgorskyUmschlaggestaltung: Massimo Peter-Bille
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-4923-8
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Kapitel 1
Francis Ackerman jr. wusste nicht, wie viel Blut er vergossen hatte und wie groß die Zerstörungen waren, die auf sein Konto gingen. Er erinnerte sich kaum an seine dunklen Jahre. Für ihn waren sie ein Nebel aus Blut, Schmerz und Tod. Er wusste nur eins: Sollte man im Jenseits wirklich ernten, was man auf Erden säte, standen ihm ewige Folterqualen bevor. Aber er fürchtete das Urteil nicht, das einst über ihn gesprochen würde. Oft, sehr oft hatte er in die Finsternis gestarrt und sich den Gestank von Schwefel vorgestellt, endlose Höllenqualen, Schreie, Heulen und Zähneklappern. Aber es ließ ihn kalt. Angst entzog sich seinem Verständnis wie die Sonne dem Mond.
Nicht dass Ackerman süchtig nach Schmerz und blind für jede Art von Furcht auf die Welt gekommen wäre – keineswegs. Sein eigener Vater hatte ihn jeder denkbaren Folter unterzogen, hatte ihn die traumatischen Erfahrungen der berüchtigtsten Mörder aus aller Welt durchleben lassen. Als nicht einmal das reichte, hatte er bei seinem Sohn chirurgisch jene Bereiche des Gehirns verstümmelt, in denen Angst und die primitive Kampf-oder-Flucht-Reaktion entstanden.
Es erfüllte Ackerman mit Stolz, was er trotz seiner unbestreitbaren Nachteile erreicht hatte. Er hatte seinen jüngeren Bruder Marcus wiedergefunden und durch ihn eine Familie erlangt. Seitdem hatte er mehreren Personen das Leben gerettet und zur Festnahme von acht Serienmördern beigetragen, jedenfalls seiner Zählung nach.
Nun sollte sein bisher größter Fang – ein Mann, der als »Demon« bekannt war und ein Netzwerk sadistischer Auftragskiller leitete – von Foxbury zum ADX Florence überstellt werden, einem Hochsicherheitsgefängnis und eine der sichersten Haftanstalten der Welt.
Eigentlich hätte Ackerman in besserer Stimmung sein müssen, aber er war nicht besonders stolz auf die Festnahme Demons; schließlich hatte er dieses Monstrum nicht in direktem Zweikampf zur Strecke gebracht. Außerdem war der Kampf zwischen ihnen erst dann vorbei, wenn einer von ihnen beiden nicht mehr atmete.
Aus dem hinteren Teil des kahlen Besprechungsraums, in dem es nach Zigarettenrauch und Waffenöl stank, beobachtete Ackerman seinen jüngeren Bruder. Special Agent Marcus Williams trug einen schwarzen Anzug und ein dunkelgraues Oberhemd, aber keine Krawatte: Er hatte geschworen, sich nie wieder einen Schlips umzubinden. Im Zentrum des Raumes saß das Team aus Strafverfolgungs- und Justizvollzugsbeamten auf mehreren Reihen von Klappstühlen; es sah aus wie ein mittelalterliches Inquisitionsgericht. Marcus erklärte den Versammelten den genauen Ablauf der Verlegung des wohl mörderischsten Sträflings der Welt.
Ackerman durfte an dieser Besprechung nicht unmittelbar teilnehmen, da er nur den Rang eines »Beraters« hatte. Doch er sah jetzt schon voraus, dass seine Fähigkeiten sehr bald wieder gebraucht wurden. Und welcher Trainer ließ seinen besten Spieler lange auf der Ersatzbank? Wäre Töten ein Sport gewesen – er wäre der Champ, der Meister aller Klassen. Bei diesem Gedanken musste er grinsen.
Der Plan seines Bruders war simpel, hatte aber seine Stärken: Drei Konvois sollten den Bereitstellungsraum in bestimmten zeitversetzten Abständen verlassen. Jede Kolonne bestand aus einem Späher in einer zivilen Limousine, der vorausfuhr, zwei Streifenwagen, dem gepanzerten Gefangenentransporter, zwei weiteren Streifenwagen als Nachhut und einem Hubschrauber zur Luftbeobachtung. Zusätzlich leitete die Staatspolizei den Verkehr um, sodass es auf ihrer Route keine unbeteiligten Zuschauer und potenziellen Bedrohungen gäbe. In den Panzerwagen in jedem der drei Konvois saß ein Mann, dessen Gesicht eine Kapuze verdeckte, sodass nicht einmal die Wachmannschaften wussten, welcher Konvoi den wahren Demon transportierte.
Marcus würde dem echten Gefangenen auf dem Beifahrersitz eines Staatspolizeiwagens folgen, während die anderen Mitglieder ihres Teams in den Nachhutfahrzeugen der Ablenkungen saßen. Ackerman und Special Agent Maggie Carlisle, Marcus’ Partnerin, würden im Überwachungshubschrauber von Marcus’ Kolonne sitzen – Ackerman in seiner Rolle als Berater, Maggie als seine Bewacherin. Er hatte Maggie ins Herz geschlossen und betrachtete sie als Mitglied der Familie, als »kleine Schwester«.
Marcus schloss nun die Einweisung ab und winkte Ackerman und Maggie zu sich. Gemeinsam gingen sie in die Ecke gegenüber der Tür, durch die die Beamten währenddessen den Raum verließen.
»Ihr beide fliegt die Strecke im Voraus ab, okay?«, sagte Marcus. »Ihr achtet auf Stellen, die sich für einen Hinterhalt eignen. Wenn es so weit ist, wird der zivile Pkw der Vorhut diese Stellen überprüfen, damit wir sicher sein können, dass dort keine Gefahr lauert.«
»Ich bin nach wie vor der Ansicht, dass wir diesen Irren auf andere Weise nach Florence überführen sollten«, erklärte Ackerman.
»Lass gut sein, Frank. Die Genehmigung zu bekommen war schwierig genug. Und mach dir keine Gedanken. Die Konvois werden nicht eine Sekunde anhalten, egal aus welchem Grund.«
Ackerman zuckte mit den Schultern. »Du bist der Boss, kleiner Bruder.«
»Nenn mich nicht so. Wenigstens nicht in der Öffentlichkeit.«
Ackerman grinste. »Du tust mir weh, kleiner Bruder.«
»Umso besser. Du genießt doch den Schmerz! Also, gern geschehen.«
Ackerman lächelte. »Wann soll ich mich verabschieden?«
»Hältst du das für eine gute Idee?«
»Ich habe nur gute Ideen.«
»Hört mit dem Unsinn auf«, drängte Maggie. »Wir müssen jetzt mit diesem Monster sprechen. Ich hätte nichts dagegen, ihm ins Gesicht zu spucken, ehe er weggeschleift wird.«
Marcus nickte. »Ja, wir müssen mit ihm reden. Ich hoffe immer noch, dass wir ihn zu dritt dazu bringen können, etwas zu verraten. Einen Hinweis auf seine Identität oder auf das Versteck seiner Kumpane. Behaltet das im Hinterkopf, wenn wir ihn besuchen.«
Ackermans Herz schlug schneller. Vorfreude überkam ihn bei dem Gedanken, einmal mehr diesem Monster gegenüberzutreten. Es war ein Gefühl ähnlich dem, das er dem Mädchen entgegengebracht hatte, das ihm die Unschuld genommen hatte – oder vielmehr das, was Ackerman als seine wahre Unschuld betrachtete, denn alle seine vorherigen sexuellen Begegnungen waren von Gewalt geprägt gewesen. Sie war eine junge Maya gewesen, die er auf der Straße nach Cancún mitgenommen hatte. Eine Zeit lang waren sie beide wie Bonnie und Clyde durchs Land gezogen, das berühmt-berüchtigte Gangsterpärchen aus den Dreißigerjahren. Jetzt pochte in Ackerman die gleiche Erregung, wie er sie damals empfunden hatte, als das Mädchen sein geblümtes Kleid von den Schultern rutschen ließ.
Marcus führte sie durch einen Korridor mit Betonwänden in einen Raum, der genauso roch, wie er riechen sollte: nach sechs Männern mit Repetiergewehren, die in voller Einsatzausrüstung in der Hitze Arizonas schmorten. Als sie näher kamen, befahl Marcus einem Wachmann, dem Gefangenen die Kapuze, die Riemen, die seinen Kopf fixierten, und die Bissschutzmaske abzunehmen.
Demon drehte augenblicklich den Kopf hin und her und öffnete den Mund, um die Kiefermuskeln zu strecken. Seine langen schwarzen Haare, von grauen Strähnen durchzogen, hingen ihm wirr in die zerfurchte Stirn. Das Gewebe über dem linken seiner brauenlosen, reptilienartigen Augen bestand aus verbranntem Gewebe, und die Narben zahlloser Stiche und Schnitte zogen sich kreuz und quer durch sein grässlich entstelltes Gesicht. Am meisten aber stach sein Glasgow-Grinsen hervor – eine Verstümmelung, die man dem Opfer beibrachte, indem man ihm die Mundwinkel zerschnitt und es dann folterte. Jedes Mal, wenn das Opfer schrie oder sich bewegte, rissen die Schnitte weiter auf.
Demons Glasgow-Grinsen reichte fast vom einen Kiefergelenk zum anderen, nur dass es bei ihm keine Karikatur eines Lächelns war, sondern eine grauenhafte Verstümmelung: Es sah aus, als hätte ihm jemand mit einer großen Axt den unteren Teil des Kopfes schräg abgetrennt.
Als Demon sprach, quoll seine Stimme mit dickem schottischem Akzent aus seinem entstellten Mund. »Auf Reisen bin ich normalerweise anderen Komfort gewöhnt. Machen Sie sich auf eine schlechte Bewertung bei Yelp gefasst.«
Marcus zog voller Abscheu die Lippen zurück. »Ich sage dem Weinkellner Bescheid, dass er Ihnen unseren besten Bordeaux bringen soll.«
»Sie haben bereits gesehen, wie ich töte, Agent Williams, aber das war rein geschäftlich. Die Schönheiten dessen, was ich zum privaten Vergnügen tue, kennen Sie nicht. Ich führe meine Kandidaten gern langsam und genüsslich durch jeden Kreis der Hölle.«
Marcus trat näher und flüsterte: »Wie gut, dass Sie Freude an so etwas haben. Denn genau dahin schicken wir Sie – in die Hölle.«
Demon kicherte. »Meinen Sie damit das Gefängnis? Oder gibt es einen Plan, mich ins Grab zu schicken?«
»Das können Sie sich aussuchen.«
Demon schüttelte den Kopf. Schwarze Haarsträhnen peitschten wie tintenfarbene Tentakel über seine Fratze. »Sie kennen sicher den Spruch ›Wer da sucht, der findet‹. Nun, in entgegengesetzter Richtung gilt das Gleiche. Wer den Teufel sucht wie Sie, den findet Satan … und jeden, der ihm wichtig ist, wenn Sie verstehen, was ich meine.«
Marcus setzte zu einer Antwort an, aber Ackerman hatte sich jetzt lange genug zurückgehalten; es wurde höchste Zeit für ihn, seine Dominanz zu beweisen. Ansatzlos schmetterte er Demon die Faust mitten ins Gesicht. Der Hinterkopf des Dunkelhaarigen krachte gegen den Stahlrohrrahmen seines Transportwagens. Doch Demon lachte nur auf und spuckte Blut.
»Wen immer mein Bruder Familie nennt«, sagte Ackerman, »gehört auch zu meiner Familie. Und ich kann jedem nur abraten, sich an etwas zu vergreifen, das mir gehört.«
Demon starrte ihn an. »Ich habe Ihnen schon einmal einen Ausweg angeboten, aber ich gebe Ihnen noch eine Chance. Ihr Team kann mich gehen lassen und mich vergessen. Beschließen Sie jedoch, sich mir zu widersetzen, verbrenne ich Ihre sogenannte Familie bei lebendigem Leib.«
Ackerman grinste. »Mann! Wenn ich Angst haben könnte, würde ich mir jetzt richtig beschissene Sorgen machen.«
Der Blick aus Demons wimpernlosen Augen schweifte von Maggie zu Marcus. »Ihr steht vor der folgenschwersten Entweder-oder-Entscheidung eures Lebens. Entweder der eine Weg oder der andere. Es gibt nichts dazwischen. Das ist wie die Entscheidung, gläubig zu sein oder nicht oder Kinder zu haben oder nicht. Entweder Sie lassen mich gehen, oder Sie müssen die Folgen tragen. Irgendwas dazwischen gibt es nicht.«
»Mir reicht’s jetzt«, sagte Maggie.
»Und es kam eine Wolke, die warf einen düsteren Schatten auf sie«, deklamierte Demon, »und eine Stimme fiel aus der Wolke und sprach: ›Dies ist das Gefäß meiner Rache, das ich hasse. Fürchtet ihn.‹«
Ackerman neigte den Kopf zur Seite. »Ich habe gehört, dass der Allmächtige ziemlich sauer ist, wenn jemand das Evangelium verdreht.«
»Ich bin mir nicht einmal sicher, ob ich überhaupt glaube«, flüsterte Demon. »Aber eines weiß ich, mein Junge. Ich werde Ihnen eine Führung durch die Hölle geben, und wenn Sie mich um das Brot der Gnade bitten, füttere ich Sie mit Rasierklingen.«
Ackerman gluckste vor Lachen. »Hört sich nach einem Heidenspaß an.«
Kapitel 2
Nach außen hin präsentierte sich die Shepherd Organization als eine Art Denkfabrik, die für das Justizministeriums arbeitete. Tatsächlich aber bestand ihre Aufgabe darin, Serienkiller zur Strecke zu bringen, unter Einsatz aller Mittel, selbst wenn dabei gegen das Gesetz verstoßen wurde.
Special Agent Marcus Williams, Teamchef bei der Shepherd Organization, legte seine Körperpanzerung an. Die Schutzweste war darauf ausgelegt, auch Hochleistungsgeschossen zu widerstehen. Er inspizierte sein M4A1-Sturmgewehr und überzeugte sich, dass es gereinigt, geölt, geladen und gesichert war. Ihn plagte die düstere Vorahnung, seine Waffe und die Körperpanzerung in den nächsten Stunden dringend zu brauchen. Er hatte schon mehrere Serienmörder gejagt – darunter seinen eigenen Bruder, den berüchtigten Francis Ackerman jr. –, aber einer Kreatur wie der, den sie alle nur als Demon kannten, war Marcus noch nie begegnet.
Er hatte Demon in der Nähe des Foxbury-Gefängnisses festgenommen, als dieser Psycho dem Anführer einer der gefährlichsten Banden der Welt zur Flucht verholfen hatte. Von Demons ehemaligem Schüler Dmitri Zolotov, dem Judas-Killer, der mittlerweile zur Hölle gefahren war, hatte Marcus erfahren, dass Demon, der gebürtige Schotte mit dem entstellten Gesicht, aus dem Abschaum des Abschaums der Verbrecherwelt ein Netzwerk aufgebaut hatte. Indem er den Psychopathen, den Hasserfüllten und Rachsüchtigen Richtung und Ziele vorgab, hatte er eine gewinnträchtige Organisation geschaffen, die seinen Einfluss sowohl in Bezug auf Macht als auch auf Reichweite immer mehr vergrößerte.
Für Fälle wie diesen war die Shepherd Organization ins Leben gerufen worden; für solche Arbeit war Marcus geboren.
Ackerman hatte ihm prophezeit, ein Mann mit Demons Fähigkeiten und Verbindungen werde nicht lange in Gewahrsam bleiben. Erreicht hatte er damit nur, dass Marcus sich bei Demons Transport und Einlieferung noch stärker einschaltete als vorgesehen. Schließlich hatte Marcus persönlich diesen Irren festgenommen, dessen krimineller Einfluss sich wie Krebs im Unterleib der Gesellschaft ausbreitete – und er hatte nicht die Absicht, sich seinen Fang wieder aus den Fingern gleiten zu lassen.
Nun wartete er in dem einen langen dunklen Tunnel zwischen Demons Zelle und dem gepanzerten Transporter, der das Verbrechergenie zum Hochsicherheitsgefängnis ADX Florence bringen würde – eine Art modernes Verlies, umgeben von Ödland, in dem die gefährlichsten Terroristen der Welt, einschließlich al-Quaida-Mitgliedern, einsaßen; außerdem Gestalten wie der »Unabomber« Theodore Kaczynski und zentrale Figuren des organisierten Verbrechens.
Einer der Häftlinge besaß eine sehr persönliche Verbindung zu Marcus und Ackerman: Er war ihr Vater, der als »Thomas White« bekannte Massenmörder. Sein wahrer Name lautete Francis Ackerman senior, aber diese Information hielt die Shepherd Organization geheim; stattdessen ließ sie zu, dass dieser Killer den letzten Falschnamen, den er sich gegeben hatte, weiterhin benutzte. Selbst Marcus hatte sich daran gewöhnt, seinen leiblichen Vater mit diesem Namen zu bezeichnen. Auf diese Weise konnte er sich leichter von dem Wahnsinnigen distanzieren, der ihn und Francis als Versuchskaninchen missbraucht hatte – und später Dylan, Marcus’ Sohn.
Marcus hatte nicht die Absicht, seinen Vater zu besuchen, wenn er Demon in Florence einlieferte. Seit der Festnahme hatte er kein Wort mehr mit Ackerman senior gesprochen. Damals hatte der Irre versucht, in Kansas City eine Konzerthalle voller Schulkinder in die Luft zu sprengen. Vorher hatte er Marcus monatelang in einem tiefen Erdbunker festgehalten und gefoltert. Wenn seine Gebete erhört wurden, würde es Marcus erspart bleiben, seinem leiblichen Vater jemals wieder in die Augen blicken zu müssen. Sein Bruder empfand es anders, obwohl er vom eigenen Vater noch viel Schlimmeres hatte erdulden müssen. Ackerman junior war sogar so weit gegangen, Besuchszeit bei ihrem Vater zu beantragen, obwohl der Director der Shepherd Organization solche Vorstöße in die düstere Geisteswelt des Thomas White nur widerwillig duldete.
Marcus hätte gern gewusst, ob sein Bruder ihn mittlerweile übertraf, was Willenskraft und Selbstkontrolle anging. Er selbst konnte die Gegenwart des Mannes, dem er seine Existenz verdankte, keine Sekunde ertragen. Schon oft hatte er sich den brutalen Tod seines Vaters ausgemalt. Er wusste nicht, wie Ackerman diesem Ungeheuer in die Augen blicken konnte, dem er so viel Schmerz und Leid verdankte. Wahrscheinlich lag es an seiner absoluten Furchtlosigkeit.
Als die Wachleute Demon nun durch den langen Korridor aus Stahlbeton führten, packte Marcus sein Sturmgewehr so fest, dass die Knöchel weiß hervortraten. Er musste das Verlangen niederkämpfen, das Leben dieses entstellten Verbrechergenies hier und jetzt zu beenden. Beinahe wünschte er sich, er hätte Demon in den Katakomben unter dem Foxbury-Gefängnis getötet, als er die Gelegenheit dazu hatte.
Demon grinste und spitzte die Lippen wie zum Kuss.
Marcus packte ihn bei der Kehle. »Wenn Sie irgendwas versuchen, fangen Sie sich eine Kugel. Ich hoffe aufrichtig, dass Sie einen Fluchtversuch machen, denn für mich gäbe es keinen tröstlicheren Anblick als Ihren Kadaver auf dem Stahltisch im Leichenschauhaus!«
Demon zitierte Nietzsche: »›Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehen, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird. Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein.‹«
Marcus schaute den Chef der Wachleute an. »Schaffen Sie mir diese Kreatur aus den Augen.«
Die Männer luden Demon in den gepanzerten Gefangenentransporter, und Marcus setzte sich auf den Beifahrersitz des Streifenwagens der Nachhut. Er hatte für den schlimmsten Fall geplant und versucht, sämtliche Möglichkeiten einzukalkulieren, aber eine dunkle Eingebung flüsterte ihm zu, dass es nicht reichen würde.
Die Kolonne verließ am frühen Morgen Arizona; es war vorgesehen, kurz vor Mitternacht im Hochsicherheitsgefängnis ADX Florence einzutreffen. Doch Marcus hatte den Verantwortlichen in Florence eine erheblich spätere Ankunftszeit mitgeteilt. Der verfrühte Aufbruch war nur ein weiterer Versuch, möglichen Befreiungsaktionen zuvorzukommen. Demon besaß die nötigen Mittel, um eine dramatische Flucht zu inszenieren; jede Gegenmaßnahme, die Marcus sich auszudenken vermochte, konnte von der Gegenseite gekontert werden. Er musste hoffen, dass er einen Schritt weiter gedacht hatte als der unsichtbare Gegner.
Die ersten elfeinhalb Stunden ihrer Reise verliefen ohne Zwischenfall.
Marcus konnte auf der Fahrt kaum die Augen offen halten. Die Landschaft Colorados, die an den Fenstern vorüberglitt, bot tagsüber vermutlich einen schönen Anblick, aber jetzt, in der Nacht, sah man kaum mehr als undeutliche Umrisse und hin und wieder die aufblitzenden Augen eines Tieres, das in die Scheinwerferkegel der Kolonnenfahrzeuge geriet. Ein paar Mal nickte Marcus für wenige Sekunden ein. Immer wieder überraschte es ihn, wie leicht er wegdämmerte, obwohl er sich dagegen wehrte. Doch er war jedes Mal sofort wieder hellwach. Seine Hand ruhte auf dem Griff seiner Pistole. Er versuchte, sich zu entspannen, während er gleichzeitig verhindern musste, dass ihm die Augen so schnell zufielen wie die Fallgitter einer Burg.
Der kleine, stämmige Mann am Lenkrad, ein ziemlich farbloser Bursche der State Police, war auch keine Hilfe. Er hatte seit ihrer Abfahrt kaum so viele Wörter gesprochen, wie man brauchte, um einen vollständigen Satz zu bilden. Marcus behagte dieses Schweigen nicht. Solche stillen Augenblicke ließen ihm zu viel Zeit zum Nachdenken über Fragen, deren Antworten er gar nicht erst wissen wollte.
Aus dem Funkgerät des Streifenwagens drang eine knisternde Stimme. »Command, hier Overwatch-Zwo. Ungefähr zwanzig Meilen vor Ihnen parkt ein Pkw auf Ihrer Strecke.«
Ehe Marcus antworten konnte, meldete sich der Spähwagen. »10–4. Hier Forward-Zwo. Nähern uns Pkw zum Abfangen.«
Die Sekunden schleppten sich dahin, während Marcus wartete, dass der Scout die Stelle des möglichen Hinterhalts erreichte. Vor Aufregung schlug ihm das Herz bis zum Hals. Endlich meldete sich der dienstälteste Beamte im Scoutfahrzeug: »Wie es scheint, ist der Wagen liegengeblieben. Ein Mann und eine Frau stehen daneben und winken mich heran.«
Marcus packte das Mikrofon. »Forward-Zwo: Zugriff! Nehmen Sie die Leute vorsorglich fest! Befragen Sie sie, sobald sie in Gewahrsam sind.«
»Nun ja, Sir, sie scheinen Todesängste auszustehen. Wenn sie wirklich liegengeblieben sind, sind sie schon ’ne ganze Weile hier, ohne dass jemand vorbeigefahren ist. Sie …«
»Das ist ein Befehl. Nehmen Sie die Leute fest. Entschuldigen können Sie sich, sobald die Stelle gesichert ist.«
»Roger, Command.«
Ein Augenblick verstrich; dann fragte Marcus: »Overwatch, sehen Sie sie?«
»Positiv. Die Verdächtigen wurden überwältigt.«
Nach kurzer Pause meldete sich ein Cop aus dem Scoutwagen: »Command, auf dem Rücksitz ist ein neun Monate altes Baby. Ein Mädchen. Was sollen wir mit der Kleinen machen? Handschellen passen der ja nicht.«
Marcus knirschte mit den Zähnen und atmete tief durch, ehe er antwortete. »Keine Handschellen erforderlich. Aber lassen Sie den Hund am Kindersitz nach Sprengstoff schnüffeln. Vergessen Sie niemals, mit was für Gegnern wir es zu tun haben. Sie würden die ganze Familie niedermetzeln und sich mit deren Blut eine Kriegsbemalung machen, wenn sie ihrem Ziel dadurch auch nur einen Millimeter näher kämen. Seien Sie niemals unaufmerksam – keine Sekunde.«
»Roger, Command.«
»Noch etwas«, fügte Marcus hinzu. »Mir ist es egal, ob Ihre Großmutter oder Ihre kleine Schwester da mitten auf der Fahrbahn sitzt. Wir halten für nichts und niemand an!«
Kapitel 3
Corin Campbell sah das Totenkopfgesicht jetzt überall, wohin sie ging. Zuerst hatte sie es für einen Streich irgendwelcher Jugendlicher gehalten, die sich in Facebook-Konten hackten und die Leute veralberten. Inzwischen aber hatte sie das Gesicht im wirklichen Leben gesehen.
Zumindest glaubte sie das. Vielleicht war sie aber auch total durchgeknallt, wie ihre Schwester schon seit Jahren behauptete. Corin war sich nicht mehr sicher. Es schien, als wäre eine albtraumhafte Kreatur aus einem Slasherfilm zum Leben erwacht und würde nun jede ihrer Bewegungen verfolgen, Tag und Nacht, um in einem unbewachten Augenblick zuzuschlagen. Die Angst lähmte Corin beinahe, und sie gehörte bestimmt nicht zu den Menschen, die sich schnell fürchteten.
Zuerst war das Totenkopfgesicht im Hintergrund einiger ihrer Selfies auf Facebook und Instagram aufgetaucht, meist bei Gruppenaufnahmen, auf denen Corin und die anderen eine Straße entlanggingen oder vor irgendeiner Kneipe standen.
Auf dem neusten Foto aber lauerte die Gestalt direkt vor ihrem Fenster.
Corin war sich fast sicher, dass der Totenschädel nicht auf den Fotos gewesen war, als sie die Bilder gepostet hatte. Das Erscheinen der Albtraumgestalt konnte ganz simpel auf ein gehacktes Konto zurückzuführen sein – einen Teenager-Hacker mit einem MacBook Pro und grundlegenden Photoshop-Kenntnissen.
Nur konnte Corin das leider nicht mit Sicherheit sagen. Sie hatte nach Hinweisen auf Fotobearbeitung suchen lassen und als Rückmeldung von einem Computerreparaturshop die Mitteilung erhalten: »Die Fotos scheinen manipuliert zu sein, aber der Befund ist nicht eindeutig.« Na toll. Corin hatte noch immer nicht herausgefunden, was genau das heißen sollte. Wie die Antwort eines Politikers: viele Worte, nichts dahinter.
Gestern aber hatte sie die Totenkopffratze in einem vorüberfahrenden Auto gesehen und dann bei einem Mann, der auf der anderen Straßenseite in einem Türeingang stand. Es musste eine Ausgeburt ihrer überreizten Fantasie sein – was sonst? Schlafmangel wegen ihres Studiums hatte sich mit einem miesen Scherz in den sozialen Netzwerken zusammengetan und attackierte nun ihr Unterbewusstsein, bis sie kurz vor dem Delirium stand.
Wenigstens war sie nicht als Einzige betroffen. Eine simple Google-Suche offenbarte, dass im Nordwesten der USA noch mehrere andere Frauen gehackt worden waren. Der Fall hatte fast schon den Status einer modernen Legende erreicht. »Skullface«, wie der Mann mit der Totenschädelmaske von jemandem im Internet genannt worden war, hatte sich bei den anderen Horror- und Sagengestalten des digitalen Zeitalters eingereiht, bei »Slenderman« beispielsweise oder den »Shadow People«.
Bei ihren Recherchen war Corin auf Behauptungen gestoßen, andere Hacking-Opfer seien verschwunden, hatte diese Meldungen aber als Fake abgetan – so wie die falschen Nachrichten über den Tod irgendwelcher Promis, die in den sozialen Netzwerken ständig auftauchten. Aber wenn es diesen Skullface wirklich gab, überlegte Corin immer wieder, war seine Botschaft unmissverständlich: Er beobachtete sie, und er würde sie sich holen.
Die Totenkopfmaske auf den Fotos, von denen Corin hoffte, dass sie manipuliert wären, bestand aus blutbespritztem Metall. Die Knochenstruktur des Schädels stammte allerdings nicht von einem Menschen. Sie erinnerte mehr an einen Dämon oder ein ausgestorbenes Raubtier, einen T-Rex vielleicht. Oder eine Mischung aus beidem. Die Reißzähne sahen gar nicht wie Zähne aus, eher wie lange, gezackte Metallfetzen, während der Mund an eine Wunde erinnerte, missgestalt und leicht aufwärtsgebogen zu einem sadistischen Grinsen.
Sollte diese Fratze tatsächlich existieren, war sie offensichtlich eine Art Maske. Und Halloweenkostüme jagten Corin keine Angst ein. Aber Typen, die sie stalkten und dabei so etwas trugen – die schon.
Sie hatte überlegt, sich an die Polizei zu wenden, doch ohne Beweise außer ein paar »nicht eindeutig manipulierten Fotos« wären die Cops eher ein Hemmschuh als eine Hilfe. Corin konnte selbst auf sich aufpassen. Das tat sie schon ihr Leben lang. Und wenn dieser Verrückte mit der Maske sie für ein leichtes Opfer hielt, stand ihm eine böse Überraschung bevor.
Als Corin nach dem letzten Seminar dieses Tages das Gebäude auf dem Campus der San Francisco University verließ, an der sie studierte, sah sie auf dem langen Weg durch das dunkle Parkhaus, in dem ihr Wagen stand, hinter jeder Ecke Skullface. Kaum hatte sie die Bilder verscheucht, hörte sie die Schritte hinter sich auf dem Beton.
Jemand folgte ihr. Sollte sie sich umdrehen? Sich ihrem Verfolger zuwenden? Angreifen? Zum Auto rennen? Schreien?
Corin versuchte, sich ungezwungen zu bewegen, schob die Hand in die Jackentasche und umfasste den Griff ihres Springmessers. Sie konnte die Waffe blitzschnell ziehen und die Klinge mit einer Daumenbewegung hervorschnellen lassen.
Angespannt lauschte sie, während die Schritte näher kamen, und spielte jede Bewegung im Kopf durch.
Ducken, drehen, Messer ziehen, zutreten …
Der Rhythmus der Schritte wurde schneller. Sie kamen jetzt rasch näher.
»Hey!«, rief eine Männerstimme.
Er rannte auf Corin zu. Doch er unterschätzte sie – was sie nicht überraschte. Selbst ihr Verlobter nannte sie »Maus«, wofür sie ihm manchmal den Hals hätte umdrehen können. Sicher, Corin war zierlich und hatte ihre bronzefarbene Haut und das dunkle Haar von ihrer brasilianischen Mutter geerbt, aber dass sie nur eins vierundsechzig groß war, machte sie noch lange nicht wehrlos. Das aber wussten nur Corin und Samantha, ihre Schwester.
Wieder rief der Mann: »Hey!«
Dann hatte er sie erreicht.
Corin fuhr zu dem Angreifer herum, riss das Messer aus der Tasche, trat in Leistenhöhe zu und rammte den Fuß in die Weichteile des Mannes. Der krümmte sich vor Schmerz und stürzte auf die Knie. Mit zwei blitzschnellen Schritten war Corin bei ihm und hielt ihm die Klinge an die Kehle, während er qualvoll keuchte.
Corin bemühte sich, ruhig zu atmen, als sie ihrem Verfolger ins Gesicht blickte.
Er hieß Michael.
Sie kannte ihn aus dem Buchhaltungsseminar, aus dem sie gerade kam. Neben Michaels Füßen lag ihr Handy auf dem Boden. Offenbar hatte er es bei ihrem Angriff fallen gelassen.
Corin kam sich unsäglich dumm vor. Der arme Kerl hatte ihr bloß ihr Handy bringen wollen, und sie führte sich auf wie Jason Bourne.
»Tut mir leid.« Sie klappte das Messer am Oberschenkel zusammen und schob es in die Tasche zurück.
»Dein … Handy«, keuchte Michael, als sie ihm aufhalf.
»Ich hab’s gesehen. Danke. Aber als Frau kann man heutzutage ja nicht vorsichtig genug sein, oder?«
»Ich glaube, ich muss mich übergeben.«
Corin verzog gequält das Gesicht. »Ja. Was machen deine Eier?« Die werden doch wieder, oder?«
Kapitel 4
Ungefähr eine Stunde nach dem Zwischenfall flog der Hubschrauber über eine wohlhabende Vorstadt hinweg. Aus Ackermans Kopfhörern drang Maggies gedämpfte Stimme: »Irgendwas Interessantes in den Akten, die ich dir gegeben habe?«
Ackerman hatte sich bereits gefragt, wie lange es dauern würde, bis Maggie ihn darauf ansprach. Die Akten befassten sich mit der Entführung ihres Bruders durch einen Serientäter, der als »The Taker« bekannt war. Doch Ackerman wollte abwarten, bis Demon in sicherer Verwahrung war, ehe er dieses Thema anschnitt, weil es zur Ablenkung führen konnte, wo Konzentration wichtiger war als alles andere.
»Ich sag’s dir später.«
»Was sagst du mir später?« Maggie beugte sich zu ihm vor und packte seinen Arm, sah ihm in die Augen. »Hast du irgendwas gefunden?«
»Vielleicht. Aber weil ich weiß, wie leicht ihr Normalos euch ablenken lasst …«
Maggie quetschte ihm den Arm. Ihre Nasenflügel bebten, und auf ihrem Gesicht lag ein angespannter Ausdruck.
Ackerman verdrehte die Augen. »Okay, wenn du darauf bestehst. Wie konnte ich auch glauben, dass der laufende Einsatz wichtiger ist als ein zwanzig Jahre alter Fall mit kalter Fährte? Wie auch immer – als ich ein paar Polizeiberichte durchsah, fiel mir auf, dass dein Vater immer wieder Sätze von sich gab wie: ›Die haben mir meinen Sohn weggenommen‹ und ›Wieso sind Sie nicht auf der Suche nach denen?‹ Er bezog sich dabei immer auf Entführer in der Mehrzahl.«
»Mein Vater ist kein glaubwürdiger Zeuge. Er war vermutlich viel zu sehr neben der Spur, um irgendwas gesehen zu haben.«
»Wie es aussieht, hatte die Polizei den gleichen Eindruck. Die haben sich so sehr auf deinen Vater als Verdächtigen eingeschossen, dass es ihnen den Blick auf den Fall verstellt hat. Und wir wissen ja mit Sicherheit, dass dein Vater nicht der Täter war – habe ich recht, kleine Schwester?«
»Worauf willst du hinaus?«
»Die Sicht der Polizei, was die Aussagen deines Vaters angeht, hat die Vernehmung der Nachbarn beeinflusst, ohne dass die Ermittler sich dessen bewusst gewesen wären. Ein Detective war so zuvorkommend, seine Befragungen auf einer Audiokassette aufzunehmen. Hast du eine Ahnung, wie schwer sich heutzutage ein Walkman auftreiben lässt?«
Maggie packte ihn wieder beim Arm, und diesmal bohrte sie ihm die Fingernägel in die Haut. Der Schmerz sandte ein wohliges Gefühl der Ekstase durch Ackermans Körper, und er zog rasch den Arm weg. »Ich möchte dich bitten, darauf zu verzichten, mir auf diese Weise deine Wertschätzung zu zeigen, okay? Ich finde es unpassend, wenn man bedenkt, was uns verwandtschaftlich verbindet.«
Maggie lehnte sich zurück, fletschte die Zähne und schloss die Augen. Ackerman las an den Bewegungen ihrer Lippen ab, dass sie lautlos von eins bis zehn zählte. Verirrte blonde Haarsträhnen wehten ihr ins Gesicht. Offenbar hatte er sie irgendwie verärgert, ohne dass es seine Absicht gewesen wäre und ohne dass er wusste, woran es gelegen hatte.
Schließlich fragte Maggie: »Würdest du es mir bitte einfach sagen? Was hast du entdeckt?«
»Na also. War das so schwer? Ihr habt auf dem Land am Ende einer Sackgasse gewohnt, die von einer Durchgangsstraße abzweigt. Im Norden und Süden gibt es vielbefahrene Strecken. Wahrscheinlich kam es häufig vor, dass jemand versehentlich in eure Straße einbog und im Rückwärtsgang wieder rausfuhr. Die Entführung ereignete sich an einem Samstag, und alle eure Nachbarn – bis auf einen – waren zu Hause. Es war ein schöner Tag. Die Chancen stehen gut, dass einige von denen im Freien gewesen sind und das Fahrzeug gesehen haben.«
»Okay, klasse. Red weiter!«
Ackerman senkte die Stimme zu einem Flüstern. »Wenn du den Mund lange genug zumachst, dass du hören kannst, was ich zu sagen habe, könntest du in der Zeit dein Gehirn einschalten, um die gleichen Schlussfolgerungen zu ziehen wie ich. Anderenfalls lass mich diesen Quatsch zu Ende erzählen, okay? Vielleicht gelingt mir das sogar rechtzeitig, sodass wir uns wieder unserer eigentlichen Aufgabe zuwenden können.«
»Tut mir leid. Erzähl bitte weiter.« Maggie hielt die Augen geschlossen.
»Na also.« Ackerman grinste und fuhr fort: »Die Ermittler haben eure Nachbarn gefragt, ob sie irgendwas Verdächtiges oder Ungewöhnliches gesehen hätten. Sie fragten allerdings nicht, ob den Leuten während der Entführung vorbeifahrende Autos aufgefallen waren, was die Schilderung deines Vaters bestätigt hätte.«
Er sah in Maggies Augen, dass die Rädchen in ihrem Kopf in Schwung gekommen waren. Sie lehnte sich zurück, richtete den Blick auf die Fahrzugkolonne.
Ackerman tat das Gleiche, froh, seine Aufmerksamkeit wieder Dingen von unmittelbarer Bedeutung zuwenden zu können.
Kapitel 5
Von oben sah das Hochsicherheitsgefängnis Florence wie eine Marskolonie aus, die man durch ein Teleskop betrachtete. Die Gebäude schienen am Boden zu kauern, als würden sie sich vor dem ungehinderten Ansturm des Windes verstecken. Ackerman beobachtete aus der Hubschrauberkanzel, wie die Kolonne auf das Gefängnisgelände rollte und dem gewundenen Weg zu dem Betonbunker folgte, der Demons neues Zuhause werden sollte. Die Fahrzeuge bremsten in Wellen ab; es sah aus wie die Buckel, die über eine kriechende Raupe hinweglaufen.
Schließlich stiegen die Staatspolizisten der Vorhut aus den Streifenwagen und schwärmten aus, um den Transporter zu sichern. Marcus hatte den Männern immer wieder eingeschärft, dass sie erst auf der Rückfahrt in ihrer Wachsamkeit nachlassen durften. Der Panzerwagen hielt vor einem Stahltor an der Seite eines gedrungenen Gebäudes; die Wagen der Nachhut stoppten hinter ihm. Bewaffnete Gefängniswärter öffneten die Torflügel, durch die Demon ins Innere gebracht werden sollte. Dann nahmen die Staatspolizisten Aufstellung und öffneten das Heck des Panzerwagens.
Selbst aus hundert Meter Höhe erkannte Ackerman, dass etwas nicht stimmte.
Die winzigen Gestalten hatten ein paar Sekunden lang vollkommen still dagestanden, ehe sie ihre Aufmerksamkeit nach außen richteten. Ein weiterer kleiner Punkt bewegte sich schnell auf den Transporter zu. Ackerman vermutete, dass es sich um seinen Bruder handelte.
Bei dem Gedanken an Marcus rieb Ackerman sich unwillkürlich den Nacken. Die hohen Tiere hielten ihn, Ackerman, für eine zu große Gefahr, als dass man ihn ohne Leine in die freie Wildbahn entlassen konnte. Deshalb hatte man ihm für den Fall der Fälle einen Chip in die Wirbelsäule implantiert, der auf ein Satellitensignal hin eine kleine Sprengladung zünden würde. Die Explosion würde ausreichen, ihm ein Loch ins zentrale Nervensystem zu reißen. Man hatte ihm klargemacht, dass nur speziell eingewiesene Ärzte den Chip entfernen konnten. Und wenn er versuchte, das Signal zu blockieren, würde der Chip nach einer genau festgelegten Zeit die Detonation selbsttätig auslösen.
Doch ungeachtet der ständigen Gefahr durch den Chip fürchtete Ackerman sich nicht vor der Herausforderung. Außerdem war er nicht gänzlich überzeugt von der Existenz dieses Ortungschips. Er glaubte nicht daran, dass seine Überwacher tatsächlich die Möglichkeit besaßen, seine Wirbelsäule in die Luft zu jagen. Gewissheit hatte er allerdings nicht.
Im nächsten Moment drang Marcus’ Stimme aus dem Kopfhörer, durchsetzt von Rauschen und Knistern, das sich wie eine wütende Schmeißfliege anhörte. »Er ist leer! Demon ist weg! Verdammt, er ist aus einem fahrenden Panzerwagen verschwunden!«
Ackerman sprach den Piloten an. »Bringen Sie mich nach unten.«
»Aber … wir haben keine Freigabe.«
»Um Verzeihung zu bitten ist immer leichter, als um Erlaubnis zu fragen. Und jetzt landen Sie schon, sonst werfe ich Sie raus und übernehme das selbst. Das ist keine leere Drohung. Also los.«
Der Pilot runzelte die Stirn. »Haben Sie überhaupt einen Flugschein?«
Ackerman lachte auf. »Ich habe fünftausend Flugstunden. Und jetzt landen Sie das Ding.«
Maggie mischte sich ein. »Tun Sie lieber, was er sagt. Sofort.«
Kapitel 6
Am meisten genoss der Gladiator, die Frauen während der letzten paar Tage zu beobachten, bevor er sie sich holte. Er betrachtete diese Phase als die »Heimsuchung« des Opfers, weil er stets im Hintergrund blieb, beobachtete und lauerte wie ein hungriger Poltergeist. Oh, wie sehr er die bedeutungsschwangere Vorfreude genoss, die dem Hauptereignis voranging! In vieler Hinsicht betrieb er Kampfsport genauso wie die Jagd: Er reagierte auf einen Gegner, falls nötig, aber wann immer möglich, übernahm er selbst die Initiative, indem er eine Falle stellte und wartete.
Auch wenn Corin Campbell nicht in sein normales Beuteschema passte, war sie an diesem Abend seine Gegnerin. Normalerweise waren seine Opfer körperlich einschüchternder als die zierliche Studentin. Dennoch kannte der Gladiator keine moralischen Einwände, einem schwächeren Geschöpf etwas zuleide zu tun. Er hielt nichts von Moral und Ethik. Wie Nietzsche gesagt hatte, war die Furcht die Mutter der Moral, und auf einen Gegner, der seiner Furcht würdig gewesen wäre, musste der Gladiator erst noch treffen.
Corin würde sich nicht allzu heftig wehren, im Unterschied zu seinen bevorzugten Opfern, aber sie war aus anderen Gründen etwas Besonderes – und diesem Umstand verdankte sie es, ausgewählt worden zu sein.
Jetzt, da er im Wandschrank ihres Gästezimmers stand und die Totenkopfmaske trug, die er als sein wahres Gesicht betrachtete, wuchs die Erregung des Gladiators.
Ob Corin die gespannte Erwartung ebenfalls wahrnahm? Er war ihr während der letzten Tage gefolgt und hatte sie immer wieder einen Blick auf Skullface erhaschen lassen, eine aus dem Internet stammende Bezeichnung, die ihm nicht sonderlich zusagte. Er wollte, dass sie spürte, wie er ihr näher kam, immer näher, unaufhaltsam – ein fleischgewordener Albtraum, der sie auf Schritt und Tritt verfolgte, Tag und Nacht, rund um die Uhr.
Der Gladiator hatte hart daran gearbeitet, die eigene Legende ins Leben zu rufen und aufzubauen, wenigstens in hundert Meilen Umkreis um San Francisco.
Begonnen hatte er, indem er die Facebook-Konten mehrerer Frauen in seinem Jagdgebiet hackte. Dann manipulierte er ihre Fotos und fügte die Fratze des Todes in den Hintergrund ein. Dadurch war er zwar zu einem regelmäßigen Gesprächsthema unter jungen Frauen zwischen zwanzig und fünfundzwanzig geworden, aber sie hielten es nur für einen albernen Streich. Ein gehacktes Konto war heutzutage, im digitalen Zeitalter, so unausweichlich wie die Grippe und kein Grund, in Panik zu verfallen.
Doch Fotos allein genügten nicht, um eine Legende zu schaffen und sich selbst im kollektiven Unterbewusstsein der breiten Öffentlichkeit zu verankern.
Deshalb gingen nach einiger Zeit seltsame Geschichten über die digitalen Nachrichtenleitungen: Angeblich verschwanden Hacking-Opfer spurlos, lösten sich in Luft auf, als hätte der schwarze Mann sie in sein finsteres Reich entführt. Tatsächlich unterschied sich diese düstere Darstellung nicht allzu sehr von dem, was den Vermissten in Wirklichkeit zugestoßen war.
Es war das Gleiche, was nun auch Corin Campbell widerfahren sollte.
Kapitel 7
Marcus kniff die Augen zusammen, als ihm Staub und Schottersplitter ins Gesicht flogen. Winzige Steinfragmente, vom Hubschrauber aufgewirbelt, bohrten sich ihm in die Haut, als hätte er in ein Hornissennest gestochen. Immer wieder überraschte ihn die Kraft, die Rotorblätter selbst auf größere Entfernung noch entfalteten.
Ackerman und Maggie sprangen aus der Hubschrauberkabine, duckten sich unter den wirbelnden Rotoren und eilten auf ihn zu.
»Zeig mir den Transporter!«, rief Ackerman.
»Wieso? Demon ist weg! Ich muss wissen, wo er jetzt ist. Oder wohin er unterwegs ist.« Marcus musste brüllen, um die Rotorblätter zu übertönen. »Warum willst du in den Transporter schauen?«
»Weil er noch drin sein könnte.« Ackerman erreichte den Panzerwagen und spähte hinein. »Hat schon jemand nachgesehen?«
»Na klar. Meine Leute haben sich jeden Quadratzentimeter angeschaut. Demon ist nicht in dem Wagen! Aber okay, wir zerlegen ihn in seine Einzelteile, damit wir ganz sicher sein können.«
»Hast du die Fahrer überprüft?«
»Ja. Zuerst, bevor sie mit dem Gefangenen losgefahren sind, und dann noch einmal hier. Sie sagen, dass es ihr Fahrzeug ist. Es wurde nicht ausgetauscht oder so was.«
Einer von Marcus’ Männern kam herbeigerannt: »Sir, wir bringen den Transporter jetzt rein. Sollen das die beiden Fahrer machen?«
»Nein, jemand anders. Halten Sie die beiden Fahrer in Gewahrsam und unter Bewachung, bis wir wissen, was hier los ist.«
Maggie fluchte leise. »Was ist mit der Kamera im Heck? Wurde Demon während der Fahrt denn nicht beobachtet?«
»Wenn es nach der Kamera geht, ist er immer noch drin«, sagte Marcus. »Die Videoübertragung wurde manipuliert. Frag mich bloß nicht, wie.«
Ackerman legte den Kopf auf die Seite wie ein neugieriger junger Hund und blickte in das leere Fahrzeug. Das Heck des Transporters bestand aus grauen Stahlplatten, und zwei unbequeme Bänke zogen sich an den Seiten entlang. Bis auf die Hecktüren gab es keinen Ausgang, nicht einmal ein Fenster. In Anbetracht der Tatsache, dass Marcus und die Beamten, die ihn begleiteten, nicht bemerkt hatten, wie die Hecktüren sich öffneten und der Gefangene auf die Strickleiter eines wartenden Hubschraubers sprang, stellte sich die Frage, wie er entkommen konnte, ohne mehr zurückzulassen als seine leeren Handschellen.
Marcus überkamen Schuldgefühle. Während der Fahrt war er ein paar Mal eingedöst. Vielleicht hatte er die Flucht verpasst, obwohl sie sich vor seinen Augen abspielte. Er ballte die Fäuste so fest, dass ihm die Fingernägel in die Handflächen drangen.
Unvermittelt begann Ackerman zu lachen. Es fing als leises Kichern an, schwoll an und wurde zu einem schallenden Gelächter aus vollem Halse. Er brauchte einen Moment, um die Fassung wiederzuerlangen. »Ein Rätsel um einen verschlossenen Raum«, sagte er glucksend. »Ist das nicht Wahnsinn?«
Marcus beherrschte sich und knallte mehrmals hintereinander wütend die Hecktür des Panzerwagens zu, statt sich auf seinen Bruder zu stürzen. Jedes Mal zerriss das metallische Klirren und Scheppern die Stille.
»Daran ist überhaupt nichts Komisches!«, fuhr er Ackerman an.
Der grinste. »Oh Mann. Du scheinst das persönlich zu nehmen.«
»Wir erfahren vielleicht nie, wie viele unschuldige Menschen dieser Mistkerl auf dem nicht vorhandenen Gewissen hat. Ihn wegzusperren hätte das einzige Gute sein können, das wir bewirken können, du und ich – der einzige Grund für unsere verdammte Existenz!«
Ackerman schüttelte den Kopf. »Kaum. Nur eine Strophe in unserem großen Heldenlied.«
»Sag mir einfach, wo dieser Irre steckt. Komm schon, Frank. Du bist der Entfesselungskünstler. Wo sollen wir suchen?«
Ackerman schien längere Zeit darüber nachzudenken. »Ich hab keine Ahnung.«
Marcus beugte sich zu ihm vor. Die Zähne zusammengebissen, zischte er ihm ins Gesicht: »Du bist doch immer darauf aus, aller Welt zu zeigen, wie toll du bist. Eine bessere Gelegenheit bekommst du nie wieder.«
»Spiel bloß nicht mit meiner Eitelkeit, kleiner Bruder. Das gehört sich nicht. Und es spielt im Moment auch keine Rolle. Wenn Demon nicht noch in Foxbury ist, was ich sehr bezweifle, ist er längst verschwunden.«
»Und wie soll er das angestellt haben? Wenn du irgendeine Idee hast, sag es mir. Jetzt sofort. Bitte! Zumal du es doch genauso dringend wissen willst wie ich, oder irre ich mich?«
Ackerman hob den Blick zum Himmel. »Nein, tust du nicht. Okay, wenn du darauf bestehst. Dann müssen wir halt eine kleine Spritztour machen.«
Kapitel 8
Corin Campbell ging es derzeit nur um zweierlei: ihr Wissen zu vergrößern und ihre Lebensqualität zu steigern. Zumindest waren diese beiden Ziele die einzigen, für die Corin sich im Augenblick interessierte.
Blake, ihr Verlobter, langweilte sie in letzter Zeit zu Tode. Sie begriff einfach nicht, woran das lag. Doch über diese Frage musste sie später nachgrübeln. Für heute war sie mit ihren geistigen Kräften ziemlich am Ende.
Corin hielt mit ihrem Subaru vor dem Haus, in dem sich die Eigentumswohnung befand, die sie und Blake gemeinsam besaßen, und parkte auf der Stellfläche, die zur Wohnung gehörte. Sie bot nur Platz für ein Auto, aber Blake bestand darauf, dass Corin sie nutzte. Immer wieder machte er solche netten kleinen Gesten. Es war schwer, ihn nicht zu mögen. Und sie mochte ihn ja auch. Sie fragte sich nur, ob Blake, der angehende Mediziner, wirklich der Mann war, mit dem sie den Rest ihres Lebens verbringen wollte.
Corins Zweifel, was Blake betraf, ließen sich nur schwer fassen. Auf dem Papier sah er wie ein toller Fang aus. Trotzdem fehlte in letzter Zeit etwas. Irgendein Funke war erloschen – oder er hatte von Anfang an nie gezündet.
Die Gedanken an Blake nahmen Corins ganze Aufmerksamkeit in Anspruch, als sie das Haus betrat und die Treppe zu ihrer Wohnung hinaufstieg. Sie hatte drei Zimmer, aber alle waren kleiner, als es praktisch gewesen wäre, sodass Corin sich bisweilen ein bisschen eingeengt fühlte.
Kaum hatte sie die Tür geöffnet, blieb sie wie angewurzelt stehen.
Sie merkte sofort, dass etwas nicht stimmte. Sie konnte irgendwas Fremdes in ihrer Wohnung spüren. Eine … Aura. Beinahe so, als bemerkte sie eine Veränderung des Raum-Zeit-Gefüges oder irgend so etwas Esoterisches.
Sie zückte das Messer, das sie immer bei sich trug, und ließ die Klinge herausschnappen, ehe sie den Schlüssel im Schloss drehte und die Wohnung betrat. Ohne das Licht einzuschalten, drückte Corin die Tür hinter sich zu, blieb auf der Schwelle stehen und wartete, das Messer in der Hand.
Ein paar Sekunden lang lauschte sie auf einen Einbrecher, aber in der unaufhörlichen Geräuschkulisse der Stadt fiel es schwer, zwischen dem Lachen der Yuppies, die in der Bar um die Ecke ihre Drinks nahmen, untermalt von lauter Musik, und den Geräuschen eines Stalkers zu unterscheiden.
Dreißig Sekunden vergingen.
Nichts geschah.
Corin knipste das Licht ein.
In einem Schuhkarton von Wohnung zu Hause zu sein erleichterte die Suche nach einem Einbrecher ungemein: Man brauchte nur von links nach rechts zu blicken und hatte die gesamte Wohnung gesehen. Corin schaute ins Schlaf- und Gästezimmer, überprüfte die winzige Küche und die Essecke. Alles okay.
Sollte sie einen Schritt weitergehen?
Mit einem Mal flüsterte eine Stimme, die sehr nach ihrer Schwester Samantha klang: Mach dich nicht lächerlich. Du bist nervös wegen eines blöden Streichs und eines Scherzartikels? Quatsch! Wahrscheinlich sollen dadurch bloß Werbeeinnahmen mit irgendeiner Fake-Website erzielt werden. Es ist genau das Gleiche wie mit den Falschmeldungen über tote Promis.
Trotzdem rührte Corin sich nicht von der Stelle.
Sollte sie in die Wandschränke schauen?
Samanthas Stimme in ihrem Kopf sagte: Und wo noch? Unter dem Küchentisch? Lächerlich!
Wenn doch Blake da wäre! Er hätte mit Freuden die Wohnung für sie durchsucht. Und wenn der Typ mit der Totenkopfmaske tatsächlich irgendwo im Dunkeln lauerte, wäre Blake ihm als Erster zum Opfer gefallen und hätte ihr durch seinen Tod eine Fluchtchance verschafft.
So kann man es natürlich auch sehen, spottete Samantha.
Corin wartete noch ein paar Atemzüge lang und steckte das Klappmesser dann entschlossen in die Tasche. Sie war nicht mehr bereit, irrationalen Ängsten nachzugeben, und schalt sich eine Närrin. Wütend auf sich selbst, warf sie Schlüssel und Handtasche auf den Küchentisch.
Aber so einfach war es nicht.
Wieder verlangte die leise Stimme in ihrem Hinterkopf: Sieh in die Wandschränke.
Das Totenschädelgesicht trat ihr vor Augen.
Corin zückte ihr Handy und versuchte, ihr Twitter-Konto abzurufen, um zu sehen, ob alles okay war.
Ihr Unterbewusstsein flüsterte: Bring es einfach hinter dich. Das ist so, als würdest du ein Pflaster abreißen.
»Na schön«, sagte sie laut.
Erneut zückte sie das Messer, ließ wieder die Klinge herausschnellen. Dann ging sie ins Schlafzimmer und riss die Schranktür auf, bereit, Skullface das Messer in die Brust zu stoßen.
Niemand sprang sie an.
Sie stocherte in den dunklen Tiefen des Schranks, entdeckte aber kein Lebenszeichen.
Gott sei Dank.
Auf Zehenspitzen bewegte sie sich zum Wandschrank im Gästezimmer.
Auch hier riss sie die Tür auf, das Messer erhoben und bereit, es in jede Fratze zu stoßen, die sie aus dem Dunkeln angrinste.
Nichts.
Sie öffnete die Falttür.
In diesem Moment warf sich eine dunkle Masse auf sie.
Kapitel 9
Ackerman saß mit geschlossenen Augen da. Seine Füße und Hände waren mit einer Kette verbunden, die wiederum an einer Stahlstange befestigt war, die sich über die Bank des gepanzerten Transporters spannte. Ackerman spürte Marcus’ ungeduldigen Blick auf sich ruhen, empfand aber im Gegensatz zu seinem Bruder, der auf der gegenüberliegenden Bank saß, keinerlei Ungeduld. Demon war längst verschwunden, das spürte er. Kein Grund zur Eile.
Von Hast hielt Ackerman sowieso nichts. Jeder Augenblick sollte genossen werden, ob es nun eine Sekunde der Qual war, eine winzige Zeitspanne der Wonne oder ein Augenblick voller Leid und Lust. Herauszufinden, wie Demon entkommen konnte, dauerte nun mal eine Weile. Punkt, Ende, aus.
»Wehe, du verschwendest hier meine Zeit, Frank«, sagte Marcus in die Stille hinein.
»Wäre ich in einer ähnlichen Lage wie Demon, würde ich zuhören und alles genau analysieren«, entgegnete Ackerman. »Aber ich war immer ein Einzelspieler. Wäre ich an Demons Stelle, käme es bei meiner Flucht darauf an, dass ich einen unentdeckten Fehler im System finde – eine Schwachstelle. Bei Demon sieht das vollkommen anders aus. Ihm stehen wegen seines Netzwerks aus Psychopathen nahezu unbegrenzte Mittel und eine komplette Mordagentur zur Verfügung. Deshalb hätte ich erwartet, dass er die Sache groß angelegt und blutig durchzieht. So viel Feuerkraft braucht man nämlich gar nicht, um die Kolonne auszuschalten.«
»Demons Psycho-Kumpels wussten aber nicht, in welcher Kolonne er tatsächlich mitfährt.«
»Glaubst du wirklich? Solche Informationen sind schwer geheim zu halten. Aber es spielt sowieso keine Rolle. Die Kolonne wurde nicht überfallen. Demon hat beschlossen, sich vor unserer Nase in Luft aufzulösen. Als wäre er ein Wesen mit übernatürlicher Macht, das wir niemals gegen seinen Willen festhalten könnten. Das nennt man wohl psychologische Kriegführung.«
»Wenn du Demons Mittel hättest, wie würdest du deine Flucht durchziehen?«, fragte Marcus.
»Ich würde betrügen. Mit gezinkten Karten spielen. Ich würde das Spielfeld so vorbereiten, dass mein Sieg im Voraus feststeht.«
»Du meinst, der Wagen wurde sabotiert? Die Fahrer haben ausgesagt, dass es der gleiche Wagen ist, mit dem sie jeden Tag unterwegs sind, und dass sie ihn kennen wie ihre Westentaschen.«
»Demons Leute haben sich den Wagen wahrscheinlich vorgenommen, während er abgestellt war«, meinte Ackerman.
Marcus schüttelte den Kopf. »Wie denn? Die Transporter werden in einem gesicherten Bereich geparkt und rund um die Uhr überwacht. Da schleicht sich niemand mit einem Schneidbrenner rein und fährt als blinder Passagier mit in die Stadt.«
»Vielleicht haben sie das Fahrzeug nachgebaut und irgendwann ausgetauscht. Das würde zwar eine Menge an Aufklärung und Vorbereitung erfordern, wäre aber machbar. Die Einzelheiten müssten gar nicht so genau stimmen. Man müsste nur die wesentlichen Schwächen des Fahrzeugs nachahmen, und die Affenhirne der beiden Fahrer würden sich den Rest einfach dazudenken.«
Marcus grinste. Sein Bruder legte mal wieder seine typische Herablassung gegenüber »Normalos« an den Tag. »Okay, mal angenommen, sie konnten die Fahrzeuge wirklich austauschen oder verändern … Das wäre ja schon eine Spur.«
Ackerman schüttelte den Kopf. »Nein. Das wäre eine Sackgasse. Eine Verschwendung von Zeit und Mitteln.«
Marcus neigte den Kopf zur Seite und ließ die Halswirbel knacken – eine Eigenart, die Ackerman schon mehrmals bei seinem Bruder beobachtet hatte und die jedes Mal erkennen ließ, dass Marcus in den Wut-und-Kampf-Modus schaltete. »Angenommen, der Transporter ist manipuliert worden, damit Demon entkommen kann«, sagte er. »Welche Veränderungen wären nötig?«
Ackerman lächelte. »Ich glaube, du könntest auf dem Gebiet besser sein als ich, Bruderherz. Mach einfach die Augen zu. Was sieht dein wunderbarer Verstand? Zerleg alles in seine Elemente. Finde heraus, was nicht dazugehört. Was ergibt keinen Sinn? Was ist beschädigt?«
Marcus schloss die Augen zwar nicht, doch Ackerman merkte ihm an, dass er fieberhaft nachdachte und nach Schwachstellen suchte. Im nächsten Moment packte Marcus die Stange, an der Ackermans Handschellen befestigt waren, und versuchte sie zu drehen und nach oben und unten zu verrücken. Nach einigen Versuchen löste sie sich aus ihren Halterungen. Ackerman konnte die Kette herausnehmen und sich ungehindert in der Kabine bewegen.
Er lachte. »Gute Arbeit.«
»Damit käme Demon aber nur von der Bank weg«, meinte Marcus. »Er müsste noch die Schlösser der Handschellen öffnen. Aber du hattest recht, Frank – ich habe ein ungewöhnliches Rasseln und Scharren gehört. Außerdem habe ich ein paar Einzelheiten entdeckt, die nicht passen. Wie diese Schraube hier.«
Marcus bückte sich, packte den Kopf einer unauffälligen Schraube zwischen Daumen und Zeigefinger und zog sie heraus, nur dass es keine Schraube war, sondern ein Schlüssel. Er reichte ihn Ackerman. »Du hattest recht. Das bestätigt wohl deinen Verdacht, dass der Transporter manipuliert wurde. Aber wie konnte Demon aus dem Laderaum entkommen, ohne dass wir es bemerkt haben?«
Ackerman schloss sich mit dem getarnten Schlüssel die Hand- und Fußschellen auf. »Setz dich mal auf die andere Seite.«
Marcus ging zur gegenüberliegenden Stahlbank und nahm Platz. Ackerman ließ sich auf Knie und Hände nieder und drückte mit den Handflächen immer wieder auf den Stahlboden.
»Das haben wir auch schon getan«, sagte Marcus. »Da sind keine versteckten Fluchtluken.«
»Aber ihr habt es nicht gecheckt, während das Fahrzeug in Bewegung war. Der Mechanismus ist garantiert darauf ausgelegt, einer genauen Inspektion standzuhalten.«
Marcus lehnte sich zurück, kniff die Augen zusammen und nickte. »Und eine genaue Inspektion hätten wir immer nur am stehenden Fahrzeug durchgeführt.«
»Eben.« Ackerman fuhr mit der Hand über den Stahl und tastete nach einem Schalter. In Situationen wie diesen blickte er beinahe liebevoll auf die vielen Tage zurück, die er in Gefängniszellen und Kerkern verbracht hatte. Er verabscheute es, wie ein Tier eingesperrt zu sein; deshalb hatte es ihm immer wieder großes Vergnügen bereitet, daraus zu entkommen.
An dem Ende der Bank, das an die Fahrerkabine grenzte, wurde Ackermans Tasten vom Klicken eines Schlosses belohnt, das sich öffnete. Er grinste, drückte von unten gegen die Bank und konnte sie nun mit Leichtigkeit nach oben klappen; sie war an der Seitenwand gelagert. Die verborgene Luke öffnete sich zum Radkasten und zum Chassis des Transporters.
Ackerman betrachtete eine Zeit lang den verborgenen Öffnungsmechanismus und klappte die Bank dann wieder herunter. Die Fahrgeräusche wurden schlagartig leiser.
Ackerman nahm wieder Platz und lächelte Marcus an. »Alles mitbekommen?«
Marcus konnte es kaum glauben. »Verdammt, ja«, sagte er, »jetzt hat er Zugang zum Chassis. Aber er kommt trotzdem nicht weg, solange die Kolonne rollt und zwei weitere Fahrzeuge diesem Transporter in kurzem Abstand folgen.«
»Doch. Wir sind in der Dunkelheit losgefahren und waren alle müde. Er hat im Gebirge eine Serpentine abgewartet. Als der Transporter abbremste, um die scharfe Kurve zu nehmen, hat er sich raus in die Freiheit gerollt.«
Marcus schlug gegen die Trennwand zur Fahrerkabine und rief Maggie zu, sofort umzukehren. »Gute Arbeit«, wandte er sich dann an seinen Bruder. »Wir suchen alle Serpentinen auf unserer Route ab und verstärken dort die Fahndung.«
Ackerman seufzte. »Ich habe dir gesagt, dass eine Suche nach einem Irren wie Demon sinnlos ist. Du scheinst zu übersehen, dass er keinen Kontakt zu seinen Leuten hatte. Dennoch kam alles, wie es kam – und er wusste es. Er wusste genau, wie seine Helfer seine Flucht bewerkstelligen würden. Vermutlich hat er den Plan selbst entworfen. Glaubst du ernsthaft, ein Mann mit seinen Mitteln hätte nicht für einen Fluchtwagen gesorgt? Oder einen Hubschrauber? Vergiss nicht, dass wir es mit einem Killer zu tun haben, der genauso talentiert ist wie ich und außerdem über nahezu unbegrenzte Ressourcen verfügt. Denk mal darüber nach, was ich in meinen dunklen Jahren mit Demons Macht und seinen Mitteln hätte anstellen können. Er ist uns bereits fünf Schritte voraus. Höchstwahrscheinlich ist er uns schon durch die Netze geschlüpft und weit außerhalb unseres Zugriffs.«
»So leicht gebe ich nicht auf!«, rief Marcus entschlossen. »Und wenn er uns zehn Schritte voraus wäre, wir holen ihn trotzdem ein. Also, wie können wir ihn fangen?«
»Unser verstorbener Freund Dmitri Zolotov alias Judas hat uns seine Tagebücher und einen vorgezeichneten Weg hinterlassen«, entgegnete Ackerman. »Wieso?«
»Weil er uns als Werkzeug seiner Rache gegen seinen Lehrer benutzen wollte. Er schreibt klipp und klar, dass Demons Dateien sich im Besitz eines anderen Killers befinden, den er erwähnt – des Gladiators. Aber die Spuren führten zu nichts. Wir wissen nicht, wo wir diesen Gladiator finden, von dem Judas in den Tagebüchern spricht.«
»Weil wir etwas übersehen. Judas’ große Show ist noch nicht vorbei. Vergiss nicht, dass Zolotov in der Welt des Theaters aufgewachsen ist. Wir sind vielleicht nicht mal am Ende des ersten Akts.«
Marcus fuhr sich durch die braunen Haare. »Wir haben die Tagebücher tausendmal gelesen. Und trauen können wir Judas sowieso nicht. Ihm ging es nur um Betrug, den Beweis seiner Überlegenheit und seine Weigerung, jemals einem anderen Menschen zu vertrauen.«
»Aber das ist es ja gerade. Judas spielt nicht gegen uns. Er spielt mit uns – gegen Demon! Er will, dass wir gewinnen. Den Tod seiner großen Liebe zu rächen ist eine verdammt persönliche Vendetta.« Ackerman spielte damit auf den Verrat an, der alles in Gang gesetzt hatte: Demons Mord an Judas’ zukünftiger Frau.
»Das mag ja sein, aber Judas interessiert mich im Moment nicht. Demon darf nicht davonkommen. Wir werden ihn einkreisen. Er hat nur ein paar Stunden Vorsprung.«
Ackerman seufzte. »Das ist Zeitverschwendung, Kleiner. Wir müssen uns auf Judas’ Spiel einlassen. Unser Weg zu Demons Mordnetz und seinen Dateien führt über den Gladiator.«
»Dann finde Gladiator. Bis dahin jage ich diesen schottischen Mistkerl bis ans Ende der Welt.«
Ackerman lächelte. »Wie immer, Brüderchen, ist deine störrische Entschlossenheit überaus herzerwärmend und zugleich so ärgerlich, wie in einen Hundehaufen zu treten.«
Kapitel 10
Der Gladiator lauschte auf Corins Schritte in der stillen Wohnung. Er hörte, wie sie den ersten Schrank öffnete. Dann näherte sie sich dem Gästezimmer …
Seine Falle schnappte zu.
Corin schrie vor Angst auf. Im nächsten Moment stieß sie unverständliche Schimpfwörter hervor.
In seinem Versteck, hinter seiner Totenkopfmaske, grinste der Gladiator.
Im letzten Moment hatte er eine Planänderung beschlossen und sich gesagt, dass seine kleine Ablenkung im Wandschrank Corins Wachsamkeit mindern würde – was für ihn selbst das prickelnde Erlebnis verlängerte und gleichzeitig bewirkte, dass die Frau umso leichter zu überwältigen wäre.
Perfekt!
Also hatte er sich zum Wandschrank im Gästezimmer geschlichen und Corins Bügelbrett aufrecht in den Schrank gestellt – so, dass es der nächsten Person, die die Tür beiseiteschob, entgegenstürzte.
Ihm war klar gewesen, dass Corin in die Wandschränke schauen würde. Schließlich hatte sie es an zwei Abenden zuvor genauso gehalten. Der Gladiator grinste. Er war jetzt in ihrem Kopf, war ihr persönliches Schreckgespenst. Jedes Geräusch, das sie hörte, wurde zu seinen Schritten, seinem Flüstern, seinem Atmen. Sie konnte spüren, wie er sich ihr näherte.
Nachdem er seine Falle ausgelegt hatte, war er ins Bad geschlichen und in die Duschtasse gestiegen. Jetzt stand er im Dunkeln hinter dem Vorhang und wartete ab, dass Corin ihre gewohnte abendliche Routine fortsetzte und sich unter die Dusche stellte, ehe sie zu Bett ging.
Er hörte, wie sie Schubladen öffnete und Wäsche herausholte. Sie kam ins Badezimmer, griff hinter den Duschvorhang …
Er stand am anderen Ende der Duschkabine und vermied jeden Laut, hielt sogar den Atem an. Er beobachtete, wie sie den Hebel der Mischbatterie betätigte, die Wassertemperatur prüfte und auf Dusche umstellte. Wasser, zuerst kalt, dann rasch wärmer, prasselte auf seine Stiefel und seine Jeans; dennoch bewegte er keinen Muskel.
Kapitel 11
Ackerman war soeben vom Heck des manipulierten Gefangenentransporters gesprungen, als ein Mann in schwarzem Anzug sich an ihm vorbeidrängte, Marcus abfing und ihm ein Handfunkgerät hinhielt. Der Mann schnaufte, als er sagte: »Es hat sich etwas entwickelt.«
Marcus griff sich das Funkgerät. »Hier Special Agent Williams. Erstatten Sie Lagebericht.«
Eine tiefe Stimme drang knisternd aus dem Lautsprecher. »Agent Williams, hier spricht Gefängnisdirektor Polly. Ich brauche Sie und Ihr Team sofort am Westtor.«
»Was ist passiert?«
»Jemand ist hier angekommen und hat namentlich nach Ihnen verlangt.«
Marcus schaute zu seinem Bruder und zog die Schultern hoch. Ackerman riss ihm das Funkgerät aus der Hand und fragte: »War die Person zu Fuß oder in einem Fahrzeug?«
»Sie ist mit einer schwarzen Stretchlimousine vorgefahren.«
Ackerman schlug das Herz plötzlich bis zum Hals. Erregung erfasste ihn. Es war lange her, dass ihn etwas wirklich überrascht hatte. Selbst bei der Untersuchung des Gefangenentransporters hatte er mit dem gerechnet, was er vorfand. Jetzt aber schienen sie alle auf unbekanntes Terrain vorzudringen. Doch anders als sonst verspürte er bei diesem Gedanken kein angenehmes Prickeln, sondern ein eisiges Schaudern, das ihn zittern ließ. Er hatte nicht die leiseste Ahnung, wie er diese Empfindung einordnen sollte.
»Sag unserer Fahrerin, sie soll uns sofort hinbringen«, wandte er sich an Marcus. »Ich möchte unseren Gast nicht warten lassen.«
»Wer ist es denn?«
Ackerman stieg wieder in den Transporter. »Finden wir’s heraus.«
Zwei Minuten später hielt das gepanzerte Fahrzeug vor der westlichen Sicherheitsschleuse des Bundesgefängnisses Florence. Marcus hatte den Rest des Teams über Funk verständigt und ans Westtor bestellt – auch die Staatspolizisten, die bei dem verpfuschten Gefangenentransport dabei gewesen waren. Die meisten waren bereits eingetroffen und knieten nun in Deckung hinter ihren Fahrzeugen, die Waffen im Anschlag – entschlossene Männer, bereit, einen Sturmangriff zurückzuschlagen. Ackerman konnte das Waffenöl und das Testosteron beinahe auf der Zunge schmecken.
Marcus drückte die Sprechtaste des Funkgeräts. »Öffnen Sie das Tor. Lassen Sie die Besucher rein.«
Das hohe Stahltor schob sich in die Wand aus armiertem Beton, und eine lange schwarze Limousine rollte hindurch. Hinter der Luxuskarosse und ihren Insassen fuhr das Tor klirrend wieder zu.