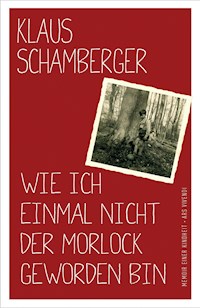Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ars vivendi Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn exhibitionistische "Brunskartler" Yuccapalmen fluten und vom Frühschoppen beseelte Hausmänner in Festgänsen verschwinden, kann dies nur eines bedeuten: Der Spezi ist wieder unterwegs! Seit Jahrzehnten lässt sich Klaus Schamberger von realen Gerichtsfällen aus der Region zu humoristischen Kabinettstücken inspirieren. Seine bis 2012 unter dem Titel Ich bitte um Milde in der Abendzeitung publizierte Reihe ist Kult. Nun legt der beliebte Kolumnist, Schriftsteller und Frankenkenner zahlreiche neue Glossen vor, die unvergleichlich witzig, herrlich skurril und gewohnt lakonisch die charmanten Abgründe des Menschlichen offenbaren. Ein bestsellerverdächtiges Lesevergnügen!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 199
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Klaus Schamberger
Ich bitte um Milde
60 neue Gerichtsglossen
ars vivendi
Vollständige eBook-Ausgabe der im ars vivendi verlag erschienenen Originalausgabe (1. Auflage Februar 2017)
© 2017 by ars vivendi verlag GmbH & Co. KG, Bauhof 1, 90556 Cadolzburg
Alle Rechte vorbehalten
www.arsvivendi.com
Umschlaggestaltung: Karin Roth,
nach einem Motiv von Toni Burghart
Datenkonvertierung eBook: ars vivendi verlag
eISBN 978-3-86913-838-1
Inhalt
Gerlinde, die Dackel-Schamanin
Der laufende Gartenteich
Das Cappuccino-Attentat
Der Heimatforscher
Der Schweinauer Gaggerlaskrieg
Gefüllte Manteltaschen
Der Kacktus-Kapo
Die Warnhose
Ein Wildschwein auf Rädern
Ehegattensplittern
Im Dunkel der Hose
Fahrradkettenreaktion
Kunst an der Hauswand
Der Ladenausbrecher
Der Rentner mit dem Bienenstich
Zivilcourage
10.000 Euro für Evelyn
Heinzi, das Nacktgespenst
Im Schwitzkasten nach Schweinau
Ware Freundschaft (ohne h)
Der verzauberte Bräutigam
Die Katze, die Amseln und der Wind
Die Wanderteilprothese
Rufmord am Klingelschild
Die Krämpfe mit dem Wadenkrampf
Der Motorhaubentaucher
Der verschaukelte Chef
Der Wafflbeck
Wie man am langsamsten in die Obere Schmiedgasse kommt
Mundraub im Parkhaus
Bier verleiht Flügel
Die singende Anhängerkupplung
Der Mann mit dem Schweinebauch
Kann ein Presssack in Gärung übergehen?
Höflichkeit ist eine Zier
Der Bierflaschenzug
Was kann ich für Sie tun?
Der frisch panierte Jogger
Rentner-Schnalzing und Käskoung-Jumping
Mittelfränkischer Hochbrunsrekord
Kürbis-Skandal am Flachweiher
Küsse in der Nacht
Der fliegende Rentner im Omnibus
Die Eierschlacht am Gartenzaun
Die rothaarige Landlust
Der röhrende Kassenwart
Der brüllende Presssack
Helmut, der Schnapsschnorrer
Heinzi, der verdreckte Ermittler
Die Müllwachtel
Geheimkot in der Damenhandtasche
Zwei Schnepfen, ein Chef und kein Geld
Richard, der Irrläufer
Der Chef im Nagelstudio
Ein Gummihut steht immer gut
Die geflutete Yucca-Palme
Advent im Glühweindelta
Weihnachtsglühschoppen
Die Weihnachtsgans
Ein ungesundes neues Jahr
Der Autor
Gerlinde, die Dackel-Schamanin
In unruhigen Zeiten, in denen täglich neue Neuerungen den Menschen erschrecken, haben Schamanen aller Art gern Hochkonjunktur. Die Geschäfte von Wünschelrutengängern, Mondkalenderherstellern, Jenseitsbotschaftern, Pflanzenbesprechern und anderen staatlich ungeprüften Mysteriologen blühen im Schein ihrer Räucherkerzenfunzeln, dass es eine Freude ist. Für den Dackelinhaber Max L. ist es aber überhaupt keine Freude gewesen, wie es vor zwei Monaten geklingelt hat und die Nebenerwerbs-Tierflüsterin Gerlinde K. vor der Wohnungstür gestanden ist.
Frau Gerlinde K., in der Telepathie zwischen Mensch und Tier durch intensives Eigenstudium außerordentlich bewandert, spricht örtliches Hochdeutsch mit zarter Muggenhofer Färbung. »Kuden Apent«, hat sie damals in etwa dem Max an der Tür gewünscht, »ich komme weken ten Dermin weecher Ihrenen Gustl.« Hat heißen sollen: Sie wünscht einen guten Abend und möchte sich jetzt absprachegemäß um den Dackel vom Max, welcher Gustl heißt, kümmern. Seelisch. Denn der Gustl hat Depressionen und frisst seit drei Tagen nichts mehr.
»Ja, des hob doch iich nedd gwissd, Herr Richter«, äußerte sich jetzt der Max auf der Anklagebank des Amtsgerichts, »dass däi Frau mid unsern Gustl dellefonisch odder wäi blaudern hodd wolln. Des hobbi erschd schbeeder erfoohrn, dass däi des mid meiner Frau ausgmachd g’habd hodd. Und mei Frau is in dera Wochn affern dreitägichn Ausfluuch mid der Kirch gween und hodd mer nix gsachd von Gustl seiner Kommunisdadorin odder wäi des hassd.« Gemeint war vermutlich Kommunikatorin, in dem Fall Dackelbesprecherin. Und so hat sich damals ungefähr folgendes Zwiegespräch ergeben. Der Max: »Wos wolln Sie vo mein Gustl!?« Die Dackelpsychotherapeutin Gerlinde K.: »Ihnen Ihr Kustl hat tebressive Monumente. Ich mechte als Erschdes in seiner Vergangenheit forschen, in seinen vorheriken Lepen. Ich wente die enerketische Medoote an. Sie gestatten?« Und schon hat es sich die Gerlinde selber gestattet: Den ermatteten Gustl in seinem Körbchen aufgesucht, ihm tief in die müden Augen geblickt und leise auf ihn eingeredet. »Hapen Sie ihn in letzter Zeit ankeprülld oter umbflädich peschimbft?«, hat die Gerlinde den Gebieter vom Gustl gefragt. »Des gäihd Ihner einen Scheißdreeg oo! Iich brüll mein Dackl oo, wenn iich will! Dou frooch i doch nedd dich bläide Henner vuurher!«
Das etwa halbstündige Gespräch mit dem Gustl, erinnerte sich die Dackelsprachendolmetscherin jetzt vor Gericht, sei an sich sehr zufriedenstellend verlaufen. Sie wäre dem Ursprung der Nahrungsverweigerung tiefenpsychologisch schon noch auf den Grund gekommen. Das Gespräch mit Herrn Max L. habe sich jedoch immer unersprießlicher entwickelt. »Bradzn wech vo mein Gustl!« – »Bläide Heigeing, bläide! Woher wassdn du ibberhabbs mei Adress!?« – »Schau edzer, dassdi schwingsd, mid dein Bsichologie-Gschmorgl!« … so in etwa die Einwände vom Max gegen die energetische Therapie. »Ich pidde um äußerste Ruhe edzerd! Ich spreche mit Ihrenen Tackel«, hat die Gerlinde nach Art der abgeklärten, tief in ihrer Lehre ruhenden Wissenschaftlerin gelassen reagiert. Und hat sich weitere 10 bis 15 Minuten mit dem Gustl telepathisch unterhalten. Dann hat sie sich feierlich erhoben und dem Max mitgeteilt, dass ihr Patient morgen wieder frisst, er habe es ihr zugesichert, und dass sie jetzt gemäß Dackelplauderinnungsabkommen 90 Euro Honorar erhält. Und zwar in bar.
»Wassd, wosd du edzer in bar gräigsd!?«, hat daraufhin der Max gebrüllt, »du gräigsd edzer gleich in bar vull anne aff die Waffl, dassd middn Schwanz wedelst, wennsd an häsd!« Und zusätzlich hat er noch unter Beweis gestellt, dass er ebenfalls die Dackelsprache beherrscht. »Gustl! Gib Laut!«, hat er befohlen. Und kurz danach: »Gustl! Fass!« Folgsam hat der Gustl erst keuchhustenartig gebellt und dann die Gerlinde, für einen depressiven Dackel sehr kräftig, ins Bein gebissen. Danach hat der Max die Dackel-Schamanin in hohem Bogen aus der Wohnung geschmissen. Wegen Beleidigung, Anstiftung eines Dackels zur Körperverletzung und Honorarzahlungsverweigerung wurde Herr Max L. zu einer Geldstrafe von 3.000 Euro verurteilt. »Mit Ihrenen Tackel«, ließ Frau Gerlinde K. den Angeklagten nach der Verhandlung wissen, »rete ich kein Wort mehr, dass Sie es wissen tennen.« – »Des«, antwortete der Max, »soong S’ am besdn mein Gustl selber. Tiefentelefonisch.«
Der laufende Gartenteich
Kenner von Gartenteichen wissen, dass ihre Goldfisch-Ozeane infolge eines Loches im PVC durchaus einmal auslaufen können. Dass aber ein ungefähr zwei mal drei Meter großer Gartenteich, beziehungsweise ein Regenwasserbecken, laufen kann, gehört zu den eher ganz seltenen Naturschauspielen. Einen der wenigen Augenzeugenberichte über einen laufenden und zwischendurch sogar singenden Gartenteich durften jetzt die zwei Heim- und Wasserwerker Helmut R. und Richard K. vor dem Amtsgericht zum Besten geben. Wobei der Richard nur wegen Beihilfe angeklagt war.
Als Haupttäter galt Herr Helmut R., der in einer gut sortierten Baustoffhandlung das damals noch ruhende Wasserbecken zum Sonderpreis von 199 Euro erstanden hatte. Eigentlich hätte es zu ihm nach Hause geliefert werden sollen, aber der Lkw der Baustoffhandlung war gerade unterwegs. »Ich hädds«, sagte er jetzt vor Gericht, »erschd drei Dooch schbeeder gräichd, nä. Obber ich hobs glei hoom wolln. Wall, der Richard is ja derbei gween, dass mers ba mir in Garddn gleich an Ort und Stelle sedzn kenner, nä. Und nou hommer gsachd, des bissla Garddndeich demmer aff mein Dachständer vom Auto draff, nä.«
Allerdings ist das Wasserbecken fast größer als das Auto gewesen. Also hat der Helmut hin und her überlegt, wie man den Sofort-Transport dennoch bewältigen kann. »Wassd wos«, hat er dem Richard vorgeschlagen, »des droong mer zu zweid hamm. Weit is ja nedd, nä.« Und weil das Becken am Rand ziemlich scharfkantig gewesen ist, hat sich der Helmut für den auch in afrikanischen Ländern gängigen Kopftransport entschieden. Er und sein Helfer haben sich je eine zusammengelegte Decke aufs Haupt gesetzt, sind unter das umgedrehte Wasserbecken geschlüpft und dann im Gleichschritt abmarschiert. Auf ihnen hat ein Gartenteich von ungefähr 60 Kilogramm gelegen, vor ihnen ein Heimweg von knapp fünf Kilometern.
»Bläid woor hald bloß«, sagte der Helmut, »dass mir dou drinner in den Wasserbeckn nedd vill gseeng hom, nä.« Nur anhand der Pflasterung unter sich haben sie Gehsteige von Autostraßen unterscheiden können. Zudem hat sich unter dem laufenden Wasserbecken schon nach einer halben Stunde derartig die Hitze gestaut, dass die beiden Teichträger kurz einmal einkehren haben müssen. »Drei, vier Seidla jeder«, meinte der Helmut, »wer mer scho g’habd hom, nä. Und nou hommer unser abgschdellds Wasserbeckn widder naafgschdemmd und sin weidergloffn.«
Einigen Passanten hat sich danach ein wunderbares Schauspiel geboten: Ein zwei mal drei Meter großes Wasserbecken, auf vier leicht torkelnden Füßen dahinschwebend und aus seinem Inneren schöne alte Bundeswehr-Marschlieder dumpf tönend. Unter anderem hat man aus dem Klangbecken brüllen hören »Ein Heller und ein Ba-a-tzen, die waren beide mein« oder »Die blauen Dragoner, sie reiten mit klingendem Spiel durch das Tor« oder den wunderbaren Schwachsinn-Song »Es braust unser Panzer im Sturmwind dahin«.
Beinahe hätten die zwei blauen Dragoner in ihrem laufenden grünen PVC-Panzer ihr Ziel erreicht. »Obber nou«, sagte der Helmut, »is der Richard vuur mir gschdolberd, ich bin über ihn drübergfluung, und nocherdla hodds an Drimmer Schlooch dou, und nou wass i nix mehr.« Der Trümmer Schlag hat daher gerührt, dass alle zwei blauen Dragoner samt ihrem Wasserbecken auf eine gut befahrene Straße geflogen sind, wo sie der Autofahrer Dieter F. gerammt hat.
Wegen Trunkenheit im Wasserbecken und Gefährdung des Straßenverkehrs ist der Gartenteichträger Helmut R. zu sechs Monaten Führerscheinentzug und 1.800 Euro Geldstrafe und sein Beiträger Richard K. zu 800 Euro verurteilt worden. Die Reparaturkosten in Höhe von 3.000 Euro für die Kühlerhaube des Autos von Herrn Dieter F. müssen beide ebenfalls erstatten. Trotz seines demolierten Autos hatte der Dieter aber durchaus Verständnis für seine zwei Unfallgegner. »Schuld«, sagte er zu ihnen nach der Verhandlung, »schuld is eingli der Verkehrsfunk. Wall wenn däi Schloufhaum im Radio gmeld häddn ›Vorsicht Autofahrer, in der Höfener Straße kommt Ihnen ein Geistergartenteich entgegen‹, nou wär ibberhabbs nix bassierd.«
Das Cappuccino-Attentat
Nicht selten müssen von einem Amtsgericht außerordentlich befremdliche Fragen geklärt werden, für die es dann auch noch zu allem Überfluss keinerlei Präzedenzfälle gibt. Wie etwa in der Strafsache Frau Nicole F. gegen Herrn Armin W., wo das Problem daraus bestand: Muss man durch den Ärmel eines Mantels, bevor man in ihn mit seinem Arm mehr oder weniger schwungvoll hineinschlüpft, zunächst durchschauen, ob eventuell jemand davor steht? Zum Beispiel eine Tasse Cappuccino.
Im deutschen Strafrecht kommen ein Mantelärmel und die Gefahren, die an seinem Ausgang lauern können, jedenfalls nirgendwo vor. Deswegen hat sich der Armin für vollkommen unschuldig gehalten. Er ist an einem sonnendurchfluteten Vormittag an einem innerstädtischen Gehsteig-Café vorbeiflaniert und hat in sich den Wunsch verspürt, ein Häfala Bier zu sich zu nehmen. In der Sonne und im Sitzen. Allerdings sind nur Plätze im Schatten oder zum Stehen frei gewesen.
»Und nou hob ich obber gseeng«, äußerte sich der Armin jetzt auf der Anklagebank, »dass däi Frau dou grood ihr Handdaschn eiräumt und der Bladz woohrscheins glei frei wird.« Von »gleich« kann natürlich keine Rede sein, wenn eine Frau beginnt, ihre Handtasche einzuräumen. Der Armin ist damals seitlich hinter der ihren Handtascheninhalt sorgfältig sortierenden Nicole gestanden. Außer sehr viel Zeit ist dabei dem Armin langsam auch die Geduld vergangen. Mit den Worten »Dou werd glei frei, gell?«, und »Ich ward scho nu aweng« hat er seinen Mantel ausgezogen und ihn am Tisch seitlich abgelegt. Worauf die Nicole gedröhnt hat: »Dou werd ieberhabbds nedd frei!«, sodann ihren Handtascheninhalt teilweise wieder ausgepackt und dem vorbeieilenden Ober nachgerufen hat: »Nu an Kabudschino!« Und dem Armin hat sie bedeutet: »Edzer hock i im Schaddn, gänger S’ aus der Sunner!«
Während eines sich sodann ergebenden kleinen Wortwechsels über Höflichkeit, Umgangston und mutwilliger Kaffeepausenverlängerung hat der Armin dann aber doch wieder zu seinem Mantel gegriffen. »Ja, und nocherdla binni hald«, sagte der Armin vor Gericht, »widder in mein Mandl neigschlubfd. Sunsd hobbi nix gmachd.«
»Ner fraali«, entgegnete die Nicole. »›Sunsd hobi nix gmachd! Sunsd hobbi nix gmachd!‹ Dassi fei nedd lach! Der hodd ganz genau gseeng, wosser sunsd nu gmachd hodd!« Und zwar ist der Armin in den rechten Ärmel seines Mantels derart wuchtig hineingeschlüpft, dass am anderen Ärmelende seine Hand, beziehungsweise Faust, förmlich herausgeschnalzt ist: Erstens in die vom Ober gerade dargebrachte Tasse Cappuccino hinein, zweitens auf die Brille von der Nicole und drittens auf ihre Nase. »Mei Brilln«, sagte die Nicole, »hodds in zwei Deile zerdebberd, aus der Noosn is mer es Bloud rausgschossn, der haaße Kaffee is mer in mei Bluusn neigloffn, und am Kubf hobbi ein Sahnehäubchen g’habd!« Sogar die Sanitäter seien damals alarmiert worden.
Herr Armin W. blieb aber dabei, dass er an der Garnierung der Nicole mit einem Sahnehäubchen unschuldig ist: »Ich hob mi mid mein rechdn Arm erschd aweng im Ärml verwerrdld g’habd. Und wäi ich nou endlich durchkummer bin durchn Ärml, woors hald a bissala hefdich, gell.«
Und dass im Augenblick des gelungenen Durchstoßes durch den Mantelärmel der Ober mit dem Cappuccino erschienen ist, da könne er wirklich nichts dafür. »Odder häddi erschd durch mein Ärml durchschauer solln?« Die eher rhetorische Frage beantwortete sich der Armin gleich selber: »Des hädd ja aa nix gnidzd. Wall an meine Händ hobbi kanne Aung, Herr Richter.«
Nach eingehender Beratung mit sich selber ist der Richter zwar auch zu der Überzeugung gelangt, dass man durch einen Mantelärmel hindurch nur in den seltensten Fällen freie Sicht hat, dass man ihn aber im Fall des hier erwiesenen Vorsatzes durchaus als eine Art Kanonenrohr oder Ärmelkanal benützen kann. Für den folgenschweren Schnalzerer aus dem Mantel wurde Herr Armin W. zu einer Geldstrafe von 1.200 Euro verurteilt, ein Schmerzensgeld wegen des heißen Cappuccino und der blutenden Nase und Schadensersatz für die Brille noch nicht gerechnet. »Des Sahnehäubchen«, komplettierte der Armin das Urteil, »aff dera ihrn bläidn Kubf hom S’ vergessn. Odder kost des nix?« Es kostete eine Ordnungsstrafe von 300 Euro.
Der Heimatforscher
Wer behauptet, Jugendliche und Heranwachsende würden heutzutage nicht mehr lesen, hat keine Ahnung oder kommt wenig unter modisch gekleidete Menschen. Denn noch nie ist so viel gelesen worden wie heute. Und zwar auf Unterhemden. Unlesbare Unterhemden, beziehungsweise T-Shirts, gibt es überhaupt nicht mehr, alle sind mit teilweise gravierender Lektüre bedruckt. Unter den vielen Milliarden Aufschriften befinden sich so extrem bedenkenswerte Aphorismen wie etwa: »Bier formte diesen Körper«. Oder »Sauf mich schön!«, »I like Knöchelsulze«, »Das Leben ist kein Ponyhof«, »My Home is my Kassel«, »Durch Deutschland muss ein Rucksack gehen!«, »I like Muggenhof«. Oder ganz einfach, aber auch nicht schlecht: »Jack Wolfskin«.
Eine an das scheinbar ewige Überleben gemahnende Unterhemden-Aufschrift hat es jetzt infolge einer sich aus ihr ergebenden Diskussion sogar bis zur Würdigung durch ein Amtsgericht gebracht. Das vermutlich mit Hilfe von zehn Kästen Bier und unter langem, vollkommen hirnzellenfreiem Nachdenken ersonnene Druckwerk hat gelautet: »Die BRD ist mir gleich, meine Heimat ist das Deutsche Reich«.
Träger dieses interessanten Unterhemdenplakats ist der Schriftenmaler Karlheinz H. gewesen, der an einem Samstag derart informativ an einer Supermarktkasse angestanden ist. Die Schlange vor der Kasse ist ziemlich lang gewesen, und so hat der hinter Herrn Karlheinz H. wartende Arnold B. viel Zeit gehabt, die in altgermanischer Runzelschrift gehaltene Inschrift in aller gebotenen Besonnenheit zu studieren. Schließlich hat er seinem Vordermann sanft auf die Schulter getippt: »Sie wern obber aa froh sei, wenn S’ amol gschdorm sin, odder?« Der Herr H. daraufhin: »Wos is?« – »Ner ja, weecher den Deutschen Reich, wou aff Ihrn Hemmerd draffsteht. Wall des hodds ja aa scho lang wechbfiffn, des Deutsche Reich. Und wenn des Ihr Heimat is – nou sin S’ ja erschd in Ihrer Heimat, wenn S’ Ihnen auch wechbfeifd, odder?«
Sprachlich feinziseliert hat der geistige Bewohner des Deutschen Reichs geantwortet: »Hald dei Maul, Oorschluuch!« Und hat zur Abrundung seines geistigen Höhenflugs noch hinzugefügt: »Solche Oorschlecher wie du sin fräihers nach Dachau kummer.« Das Gespräch ist damit aber noch nicht beendet gewesen, denn der Arnold hat auf den Hinweis mit Dachau schon wieder eine dringende Frage gehabt: »Sin Sie gwiss aus Dachau?«
Die Antwort »Hald edzer endlich dei Maul, Oorschluuch!« hat den Hintermann aber nicht vollständig zufriedengestellt. »Edzer numol mid Ihrn Deutschen Reich«, hat er die am T-Shirt veröffentlichte Heimatfrage wieder aufgenommen, »wos fiir a Reich maanern Sie eingli? Des von Karl dem Großen? Odder von Pippin dem Blöden? Odder maaner Sie Reichenschwand? Odder Unterreichenbach?« Noch einmal hat der Schriftenmaler Karlheinz H. argumentativ alles gegeben: »Hald edzer dei Maul, Oorschluuch, hobbi gsachd!!«
Worauf der nach dem Ursprung des am Unterhemd verewigten Deutschen Reichs forschende Arnold B. unglücklicherweise ebenfalls zur schriftlichen Dokumentation seiner Meinung übergegangen ist: Mit einem Filzstift hat er ein paar Buchstaben auf ein geschwind dem Wühltisch entnommenes weißes Unterhemd gekritzelt und es dem Karlheinz H. hingehalten: »Sin S’ suu gut und zieng S’ des über Ihr Hemmerd driiber. Bevuur dass mer schlecht wird.«
Erst hat der Karlheinz das geschenkte T-Shirt mit den Worten »Lou mer mei Rouh, Oorschluuch!« nicht annehmen wollen, es dann aber doch ausgebreitet und gelesen. In großen Buchstaben ist seine eventuelle ideologische Heimat draufgestanden: »Nazionalarschlochismus«.
Und jetzt hätte der Verfasser des Textes nicht nur wegen schriftlicher Beleidigung verurteilt werden sollen, sondern auch wegen des damals an der Supermarktkasse vorgeschlagenen Verwendungszweckes für das ursprüngliche T-Shirt. »Mit dem«, soll er zum Karlheinz gesagt haben, »kenner Sie sich in Zukumbfd weecher mir in Oorsch auswischn. Nou kummd Braun zu Braun.« Das hohe Gericht wog aber die von beiden Seiten erhobenen Oorschluuch-Vorwürfe sorgfältig ab und sprach den Heimatforscher Arnold B. frei.
Der Schweinauer Gaggerlaskrieg
Jammerschad, dass der Baron auf und zu Guttenberg die Bundeswehrpflicht abgeschafft hat. Sonst hätte die Hausfrau Anita M. demnächst in die Streitkräfte eintreten können. Als Wehrmagd und höchstwahrscheinlich zielsicherste Eierhandgranatenwerferin Deutschlands. Ihr Truppenübungsplatz wird so aber der zweite Stock eines Mietshauses in Schweinau bleiben müssen. Und ihr persönlicher Talib die ebenfalls schon seit vielen Jahren als Hausfrau dienende Margit D. Die ersten Kampfhandlungen im Schweinauer Eierkrieg haben vor einigen Monaten begonnen, und zwar damit, dass Frau Anita M. und ihr Mann als neue Mieter eingezogen sind, auf demselben Stockwerk wie die Margit.
»Däi hom si«, sagte die als Opfer und Zeugin geladene Margit D., »nichd amol ba uns vuurgschdelld. Obber kaum woorns a Wochn neber uns, schellds fräih ummer Achder, ich gäih naus, schdäihd eine wildfremde Frau vuur mir und froochd mi, obs leihweise zwaa Gaggerla hoom kennd. Ihre Henner, hodds gsachd, häddn den Fräih nunni gleechd. Und nou hodds gscheid lachn mäin iiber ihrn bläidn Witz.«
Die Margit hat damals nicht recht lachen können, ihrer neuen Nachbarin aber dann die zwei Frühstückseier ausgehändigt, mit den Worten »Wiedersehn machd Freude, gell!« Einige Tage später ist die Anita wieder vorstellig geworden, erneut mit der Bitte um einige Leih-Eier. Und so ist es dann wochenlang weitergegangen: Ob sie, die Anita, sich gschwind nur ein paar Hundert Gramm Mehl ausleihen könne, drei Schäufala Zucker und immer wieder Eier. »Aamol hobbis scho gfrouchd«, sagte die Margit, »ob sie dou driimer in ihrer Wohnung eine Bfannerkoung-Fabrigg aafgmachd hodd, odder wos. Und dou derbei hobbi ihr zeichd, wos i alles scho aafgschrieb’n hob: Ein Kilo Mehl, a halbs Kilo Zucker, nou hoddser si vo mein Moo nu drei Bäggla Zigareddn gleihd, und insgesamd dreißich Eier. Woohrscheins hodd däi vuurher in der Leyer Schdrass gwohnd.«
Wie dann das Eier-Darlehen sich auf etwa vierzig Stück angehäuft hat, ist die Margit bei ihrer Nachbarin vorstellig geworden. »Also suwos Gewöhnlichs«, äußerte sich die angeklagte Anita jetzt vor Gericht, »suwos hobbi in mein ganz Leb’n nunni g’heerd. Dass sie mir ab soford wos scheißd, hodds mi oobrülld, wenni schbeedesdns am andern Dooch nedd meine Schuldn zoohl und alles zusammen, die Gaggerla, Zucker, Mehl, Zigareddn, widder zrigg bring. Und wenn i ka Geld hob zum Eikaafn, nou soll i mer mei bläids Maul an die Diischkandn hiihauer odder Fensderkidd fressn. Und warum iich ibberhabbs suvill Eier brauch, obs vielleichd mei Moo dringend nöödich hodd. Im ganzn Haus hodd mer des Gschrei g’heerd, Herr Richter.« – »Also so einen Ton«, fügte sie vornehm und in original hiesigem Hochdeutsch noch hinzu, »pin ich fei nicht kewöhnt, Herr Vorsitzenter! Tas is nicht unser Nifoo!«
Gleich am andern Tag habe sie die rückständigen Eier, Mehl, Zucker und Zigaretten retourniert. »Alles zusammen«, sagte sie, »wie es tie Nachparin bferlangt hat.« In der Form hat es die Nachbarin aber nicht bferlangt: vierzig Eier, bereits aufgeschlagen, in einem Putzeimer, alles gut vermengt mit Zucker, Mehl, sowie den Tabakbröseln von drei Packungen Zigaretten. »Und den Aamer vull mid den ganzn zammgrührdn Dreeg«, schluchzte die Margit auf der Zeugenbank, »hodds mer nou übern Kubf driibergschüdd. Und derzou hodds gsachd, dassi, wenni mein Gschmarrikubf zammds den Lebberi in die Bfanner neidou, nou konn i an Kaiserschmarrn draus machn. Tas is auch nicht mein Nifoo, Herr Richter!«
Die Putzeimerattacke ist aber erst der Auftakt zum Schweinauer Eierkrieg gewesen. Wie nämlich der Ehemann der Margit, Herr Helmut D., nach dem Überfall auf seine Frau der Anita in die Nachbarwohnung nachgerannt ist, hat es ihn auch erwischt. »Wäivill rohe Eier däi Furie aff mich gschmissn hodd, wassi nedd genau«, sagte er aus. »Ich wass blouß nu, dass mi mid an Gaggerla middn ins Gsichd droffn hodd, ans is im Drebbnhaus am Fensder roogloffn und drei odder vier hodds in unser Wohnung neibrelld. Vull aff unser neie Dabeedn draff.« Wegen Eierhandgranatenwurf, Putzeimerüberstülpung mit rohem Kaiserschmarrn und vorsätzlicher Tapetenaufweichung ist die sonst sehr vornehme Frau Anita M. zu zwei Monaten mit Bewährung und einer Geldbuße von 800 Euro verurteilt worden.
Gefüllte Manteltaschen
In allen menschlichen Gemeinschaften gibt es selbst ernannte Mittelpunkte, strahlende Lichtgestalten mit einer Aura wie überirdische Wesen. Sie haben die schönsten Autos, die teuersten Kleidungsstücke, das höchste Jahresgehalt, eine Bodenhaftung wie ein Heißluftballon, die besten Krankheiten, und wenn jemand in ihrem Kreis was weiß, wissen sie es wie aus der Pistole kluggeschissen wesentlich besser.
Zu diesen Nobilitäten aus eigenen Gnaden gehört der seit einigen Jahren schon emeritierte Maßschneider Heinz F. Einmal im Monat hält er in einem kleinen Gasthaus Hof und erklärt dort anlässlich eines Gläsleins Mineralwasser einigen Untertanen dann immer die Welt. Sein Erscheinen wird meist mit dem Jubelruf untermalt: »Edzer kummd des Rimbviech scho widder!« Erbittertster Widersacher in der kleinen Weltbesprechungsgemeinde ist der ebenfalls schon im Ruhestand befindliche Reinhold H., ein ehemaliger Metzger, der es vor drei Monaten geschafft hat, dass der Oberklugscheißer den Stammtisch nicht mehr mit seinen Weisheiten beglückt. Allerdings mit drastischen Mitteln. Ihretwegen ist der Reinhold vor Gericht gestanden.
An jenem Spätnachmittag der alles andere als ruchlosen Tat ist der Heinz am Stammtisch aufgetaucht wie frisch aus dem Hochglanzprospekt von Karl Lagerfeld entsprungen: Tailliertes Kaschmirmäntelchen, seidengefüttert, Pelzkragen, golden schimmernde Applikationen, den allwissenden Kopf mit einem Nerzmützchen bedeckt. »Hobbi mer in Mailand machen loun«, hat er seinen am Lachkrampf zu ersticken drohenden Kameraden erklärt, »Hodd mi zehn Riesen kost. Reines Kaschmir. Obber woohrscheins wissd ihr nedd, wos Kaschmir is.« Im Lauf seines weiteren Monologs hat er nicht nur dargelegt, was Kaschmir ist, sondern auch dessen geografische Lage, die Welt im Fernen Osten, die Politik im Nahen Osten. Und weiters hat er wissen lassen, dass die 10.000 Euro Kaschmirmantelkosten für ihn ein Pappenstiel sind. Jetzt muss man nur noch wissen, dass es an diesem Tag Schlachtschüssel gegeben hat im Gasthaus, unter anderem mit Blut- und Leberwurst.
Der Reinhold ist während des Vortrags vom Heinz austreten gegangen. Und bei seiner Rückkehr hat er den Heinz zu seinem Reichtum beglückwünscht: »Des is nedd schlechd, dass fiir dich zehadausnd Euro ein Babbnschdiel sin. Wall, ich glaab, dei Kaschmirmandl brennd.« Tatsächlich hat es aus dem kostbaren Mantel an der Garderobe ein bisschen herausgedampft. Blitzschnell ist der Heinz aufgesprungen, hat in die nerzbesetzte Manteltasche gegriffen – und ist dann vor Entsetzen erstarrt: Von seiner Hand ist ein dunkelrot, bräunlich, grau gesprenkelter, frisch dampfender, undefinierbar duftender Brei herabgetropft. »Wer woor des!!?«, hat der Heinz, inzwischen auch an der anderen Hand dunkelrot und grau triefend, gebrüllt. »Wos fiir a Sau hodd mir in meine Mandldaschn neigschissn!!?«