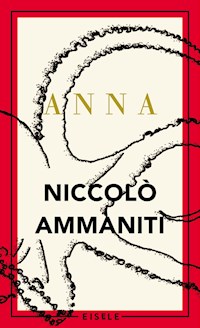10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eisele eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Süditalien in den späten 70ern: Es ist ein drückender, flimmernder Sommer, in dem sich das Leben des neunjährigen Michele für immer verändert. Auf einem der Streifzüge durchs Dorf entdeckt er mit seinen Freunden ein altes, verfallenes Haus – in das Michele allein einsteigen soll. Was als Mutprobe beginnt, wird für den Jungen im Laufe des Sommers zum Albtraum, denn in dem Haus findet er einen am Fuß gefesselten, verwahrlosten Jungen. Michele behält seine Entdeckung für sich, füttert und pflegt den Jungen. Doch nach und nach stellt sich heraus, dass nicht nur er im Dorf ein Geheimnis zu haben scheint …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 271
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Das Buch
Ein heißer Sommer in Süditalien: In einem verfallenen Haus findet der neunjährige Michele einen Jungen, der allein und verwahrlost in einem abgedeckten Erdloch kauert. Von diesem Moment an verändert sich Micheles Leben auf dramatische Weise, denn als er herausfindet, dass der Junge wahrscheinlich entführt worden ist, nimmt er sich seiner an und beschließt, ihm zu helfen, obwohl er sich damit selbst in große Gefahr begibt ...
Der Autor
NICCOLÒ AMMANITI, geboren 1966 in Rom, ist einer der erfolgreichsten und renommiertesten Autoren italienischer Sprache. Seine Bücher wurden von international herausragenden Regisseuren für das Kino verfilmt und seine Werke in 44 Sprachen übersetzt. Jetzt erscheint Ammanitis Weltbestseller Ich habe keine Angst, für den er den Premio Viareggio gewann, sowie der 1999 erstmals auf Deutsch veröffentlichte Roman Fort von hier in einer neuen Ausgabe im Eisele Verlag, zeitgleich mit seinem neuen Bestseller Intimleben. Er lebt mit seiner Frau in Rom.
NICCOLÒ AMMANITI
Ich habe keine Angst
ROMAN
AUS DEM ITALIENISCHEN VON ULRICH HARTMANN
Besuchen Sie uns im Internet: www.eisele-verlag.de
ISBN 978-3-96161-180-5
Die Originalausgabe »Io non ho paura« erschien 2001 bei Arnoldo Mondadori, Mailand.
Die Rechte an der Nutzung der deutschen Übersetzung von Ulrich Hartmann liegen beim Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH.
Taschenbuchausgabe
1. Auflage Juli 2023
© 2001 Niccolò Ammaniti
© 2023 der deutschsprachigen Ausgabe
Julia Eisele Verlags GmbH, München
© der deutschen Übersetzung: Goldmann Verlag, München 2004
Umschlaggestaltung: FAVORITBUERO, München
Umschlagmotiv: © Christine McKechnie/Bridgeman Images
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Inhalt
Über das Buch / Über den Autor
Titel
Impressum
Widmung
Zitat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Dank
EMPFEHLUNGEN
Orientierungsmarken
Cover
Inhalt
Textbeginn
Dieses Buch ist meiner Schwester Luisa gewidmet, die mir mit der Nera gefolgt ist, ihren kleinen silbernen Stern an die Jacke gesteckt.
Er verstand nur dies. Ins Dunkel gefallen zu sein. Und in dem Augenblick, als er begriff, wurde es unbegreiflich.
Jack London
1.
Ich war kurz davor, Salvatore zu überholen, als ich meine Schwester heulen hörte. Ich drehte mich um und sah sie verschwinden, verschluckt vom Korn, das den Hügel bedeckte.
Ich hätte sie nicht mitnehmen dürfen. Mama würde mich schwer dafür büßen lassen.
Ich blieb stehen. Mir lief der Schweiß. Ich holte Luft und rief nach ihr: »Maria? Maria?«
Ein leidendes Stimmchen antwortete: »Michele!« »Hast du dir wehgetan?«
»Ja, komm.«
»Wo hast du dir wehgetan?«
»Am Bein.«
Sie schwindelte, sie war müde. Geh weiter, sagte ich mir. Und wenn sie sich wirklich wehgetan hatte?
Wo waren die anderen?
Ich sah ihre Schneisen im Korn. Sie kletterten langsam, nebeneinander, wie die Finger einer Hand, zum Gipfel des Hügels hinauf, hinterließen eine Spur umgeknickter Halme.
In jenem Jahr stand das Korn hoch. Im Spätfrühling hatte es viel geregnet, und Mitte Juni waren die Pflanzen üppiger denn je. Sie wuchsen dicht, waren über und über mit Ähren beladen und warteten nur darauf, geerntet zu werden.
Alles war mit Korn bedeckt. Die niedrigen Hügel folgten aufeinander wie Wellen eines goldenen Ozeans. Bis zum Horizont nur Korn, Himmel, Grillen, Sonne und Hitze.
Ich hatte keine Vorstellung davon, welche Hitze herrschte, ein Neunjähriger versteht nicht viel von Celsiusgraden, doch ich wusste, dass es nicht normal war.
Dieser verdammte Sommer 1978 blieb als einer der heißesten des Jahrhunderts in Erinnerung. Die Hitze drang in die Steine ein, ließ die Erde zerbröckeln, verbrannte die Pflanzen, tötete die Tiere und erfüllte die Häuser mit Glut. Die Tomaten im Garten waren ohne Saft, die Zucchini klein und hart. Die Sonne nahm einem den Atem, die Kraft, die Lust, zu spielen, alles. Und auch in der Nacht meinte man, vor Hitze umzukommen.
In Acqua Traverse gingen die Erwachsenen nicht vor sechs Uhr abends aus dem Haus. Sie verkrochen sich drinnen, die Fensterläden geschlossen. Nur wir wagten uns hinaus auf das sengend heiße, verlassene Land.
Meine Schwester Maria war fünf Jahre alt und folgte mir mit der Beharrlichkeit eines Hündchens, das man aus dem Tierheim geholt hat.
»Ich will das Gleiche tun wie du«, sagte sie immer. Und Mama gab ihr Recht.
»Bist du der große Bruder oder nicht?« Da half nichts, ich musste sie mitschleppen.
Niemand war stehen geblieben, um ihr zu helfen. Normal. Es war ein Wettkampf.
»Geradeaus, den Hügel hoch. Keine Kurven. Es ist verboten, hintereinander zu gehen. Es ist verboten, stehen zu bleiben. Wer als Letzter oben ist, muss was zur Strafe tun.« Der Totenkopf hatte entschieden und mir ein Zugeständnis gemacht: »In Ordnung, deine Schwester zählt nicht. Sie ist zu klein.«
»Ich bin nicht zu klein!«, hatte meine Schwester Maria protestiert. »Ich will auch mitmachen!« Und dann war sie gefallen.
Verflixt, ich war Dritter.
Erster war Antonio. Wie immer.
Antonio Natale, genannt der Totenkopf. Warum wir ihn den Totenkopf nannten, weiß ich nicht mehr. Vielleicht, weil er sich einmal einen Totenkopf auf den Arm gepappt hatte, eines von diesen Abziehbildchen, die man im Tabakladen kaufen konnte und anfeuchten musste, damit sie klebten. Der Totenkopf war der Älteste der Bande. Zwölf Jahre. Und er war der Anführer. Er hatte gern das Sagen, und wenn man nicht gehorchte, wurde er böse. Er war keine Leuchte, doch er war groß, stark und mutig. Und er kletterte diesen Hügel hoch, als würde er nach oben gezogen.
Zweiter war Salvatore.
Salvatore Scardaccione war neun, genauso alt wie ich. Wir waren im selben Jahrgang. Er war mein bester Freund. Salvatore war größer als ich. Ein Einzelgänger. Manchmal kam er mit uns, doch oft kümmerte er sich um seine eigenen Sachen. Er war schlauer als der Totenkopf, er hätte ihn ganz leicht absetzen können, aber es interessierte ihn nicht, Anführer zu werden. Sein Vater, der Advokat Scardaccione, war ein wichtiger Mann in Rom. Und er hatte eine Menge Geld in der Schweiz. Das erzählte man sich.
Dann kam ich, Michele. Michele Amitrano. Und auch diesmal war ich Dritter. Der Aufstieg war gut gelaufen, aber wegen meiner Schwester saß ich jetzt fest.
Ich war mir noch nicht klar darüber, ob ich umkehren oder sie dalassen sollte, als ich auf den vierten Platz zurückfiel. Von der anderen Seite hatte mich Remo Marzano überholt, diese Flasche. Und wenn ich nicht sofort weiterkletterte, würde mich auch noch Barbara Mura hinter sich lassen.
Das wäre furchtbar. Überholt von einem Mädchen. Einem dicken Mädchen.
Barbara Mura kletterte auf allen vieren, wie eine wild gewordene Sau. Verschwitzt und verdreckt.
»Was ist, gehst du nicht zu deiner kleinen Schwester? Hast du sie nicht gehört? Sie hat sich wehgetan, die Arme«, grunzte sie glücklich. Dieses eine Mal wäre sie nicht die Letzte.
»Ich gehe ja schon Und dich schlage ich trotzdem.« Ich konnte nicht einfach so aufgeben.
Ich machte kehrt und lief wieder nach unten, wirbelte mit den Armen durch die Luft und stieß ein Geheul aus wie ein Sioux. Die Ledersandalen rutschten über das Korn. Ein paar Mal setzte ich mich auf den Hintern.
Ich sah sie nicht. »Maria! Maria! Wo steckst du?« »Michele …«
Na also, da war sie ja. Klein und unglücklich. Sie saß in einem Kreis umgeknickter Halme. Mit einer Hand massierte sie sich den Knöchel, mit der anderen hielt sie ihre Brille fest. Ihre Haare klebten an der Stirn, und die Augen glänzten. Als sie mich sah, verzog sie den Mund und blies sich auf wie ein Truthahn.
»Michele …?«
»Maria, wegen dir hab ich verloren! Ich hatte dir doch gesagt, du sollst nicht mitkommen, verflixt noch mal.« Ich setzte mich hin. »Was ist passiert?«
»Ich bin gestolpert. Ich hab mir am Fuß wehgetan und …« Sie riss den Mund auf, kniff die Augen zusammen, wackelte mit dem Kopf und fing an zu wimmern. »Die Brille! Die Brille ist kaputtgegangen!«
Ich hätte ihr am liebsten eine Ohrfeige verpasst. Es war das dritte Mal in diesen Ferien, dass sie die Brille kaputtgemacht hatte. Und wem gab Mama die Schuld?
»Du musst auf deine Schwester Acht geben, du bist der große Bruder.«
»Mama, ich …«
»Kein Mama ich. Du hast immer noch nicht verstanden, dass das Geld nicht auf der Straße herumliegt. Das nächste Mal, wenn die Brille kaputtgeht, kannst du dich auf was gefasst machen …«
Die Brille war in der Mitte zerbrochen, wo sie schon geklebt gewesen war. Jetzt konnte man sie wegwerfen. Meine Schwester heulte immer noch.
»Mama … Sie wird bestimmt böse … Was sollen wir tun?«
»Was wir tun sollen? Wir machen sie mit Klebstreifen wieder ganz. Steh auf, los.«
»Die Brille sieht hässlich aus mit Klebstreifen. Ganz hässlich. Gefällt mir nicht.«
Ich steckte mir die Brille in die Tasche. Ohne konnte Maria nicht viel sehen. Sie schielte, und der Doktor hatte gesagt, sie müsse operiert werden, solange sie noch klein sei. »Das ist doch nicht so schlimm. Steh auf.«
Sie hörte auf zu weinen und fing an, die Nase hochzuziehen. »Mir tut der Fuß weh.«
»Wo?« Ich dachte immer noch an die anderen, sie waren bestimmt schon seit einer Stunde oben auf dem Hügel. Ich war der Letzte. Ich hoffte nur, dass der Totenkopf sich keine allzu harte Strafe für mich ausdachte. Einmal hatte er mich gezwungen, durch Brennnesseln zu laufen, bloß weil ich verloren hatte.
»Wo tut es dir weh?«
»Da.« Sie zeigte mir den Knöchel.
»Du hast ihn dir verstaucht. Das ist nichts. Geht gleich vorbei.«
Ich schnürte ihr den Turnschuh auf und zog ihn ganz vorsichtig aus. Wie es ein Doktor gemacht hätte.
»Ist es jetzt besser?«
»Ein bisschen. Gehen wir nach Hause? Ich habe solchen Durst. Und Mama …«
Sie hatte Recht. Wir waren zu weit von zu Hause weg. Und schon viel zu lange. Es war längst Zeit fürs Mittagessen, und Mama stand bestimmt am Fenster und hielt nach uns Ausschau.
Ich sah schwarz für die Rückkehr nach Hause.
Doch wer hätte sich das ein paar Stunden vorher denken können?
An jenem Morgen hatten wir die Fahrräder genommen.
Normalerweise drehten wir zwei kleine Runden, um die Häuser, bis an den Rand der Felder und zum ausgetrockneten Bach, kehrten dann zurück und machten Wettkämpfe.
Mein Fahrrad war ein altes Eisen, mit geflicktem Sattel, und so hoch, dass ich mich biegen und krümmen musste, um auf den Boden zu kommen.
Alle nannten mein Fahrrad »Schrottesel«. Salvatore sagte, es sei ein Gebirgsjägerrad. Aber mir gefiel es, es war das Rad meines Vaters.
Wenn wir nicht Rad fuhren, waren wir auf der Straße und spielten Ball, »Fahnenraub« und »Ochs vorm Berg«, oder wir blieben unter dem Dach des Schuppens und taten nichts Besonderes.
Wir konnten machen, was wir wollten. Es kamen keine Autos vorbei. Es gab nichts, das gefährlich war. Und die Erwachsenen verkrochen sich in den Häusern, wie Kröten, die das Ende der Hitze abwarteten.
Die Zeit verging langsam. Am Ende des Sommers konnten wir es kaum erwarten, dass die Schule wieder anfing.
An jenem Morgen hatten wir über Melichettis Schweine gesprochen.
Wir sprachen unter uns oft über Melichettis Schweine. Es hieß, dass der alte Melichetti sie abrichtete, Hühner zu zerfleischen, manchmal sogar Kaninchen und Katzen, die er auf der Straße auflas.
Der Totenkopf spuckte einen Strahl weißen Speichel aus. »Bis jetzt habe ich euch das nie erzählt. Weil ich es nicht sagen konnte. Aber jetzt sage ich es euch: Die Schweine haben den Dackel von Melichettis Tochter gefressen.«
Alle riefen wie aus einem Mund: »Nein, das ist nicht wahr!«
»Es ist wahr. Ich schwöre es euch beim Herzen der Madonna. Lebendig. Bei lebendigem Leib.«
»Das ist unmöglich!«
Was für Bestien mussten das sein, wenn sie sogar einen Rassehund fraßen?
Der Totenkopf nickte. »Melichetti hat ihnen den Dackel in den Pferch geworfen. Der Dackel hat versucht zu entkommen, Dackel sind schlau, aber Melichettis Schweine sind noch schlauer. Sie haben ihn nicht entwischen lassen. Zerfleischt in zwei Sekunden.« Dann fügte er hinzu: »Schlimmer als Wildschweine.«
Barbara fragte ihn: »Und warum hat er ihnen den Dackel vorgeworfen?«
Der Totenkopf dachte kurz darüber nach. »Er hat ins Haus gepisst. Und wenn du da drinnen landest, fett wie du bist, nagen sie dich bis auf die Knochen ab.«
Maria stand auf. »Ist Melichetti verrückt?«
Der Totenkopf spuckte noch einmal auf den Boden. »Verrückter als seine Schweine.«
Wir waren still und dachten an Melichettis Tochter, die einen so bösen Vater hatte. Keiner von uns wusste, wie sie hieß, doch sie war deshalb bekannt, weil sie um ein Bein herum eine Art eisernen Panzer trug.
»Wir können hin und sie uns ansehen!«, platzte ich heraus.
»Eine Expedition!«, rief Barbara.
»Es ist sehr weit bis zum Hof von Melichetti. Da brauchen wir lange«, brummte Salvatore.
»Ach Quatsch, es ist ganz nah, los …« Der Totenkopf stieg auf sein Fahrrad. Er ließ keine Gelegenheit aus, sich gegen Salvatore durchzusetzen.
Mir kam eine Idee. »Warum nehmen wir nicht ein Huhn aus dem Stall von Remo mit? Und wenn wir dann da sind, werfen wir es in den Pferch und sehen zu, wie die Schweine es zerfleischen.«
»Stark!« Der Totenkopf stimmte zu.
»Mein Vater bringt mich um, wenn wir ein Huhn aus dem Stall holen«, jammerte Remo.
Nichts zu machen, die Idee war klasse.
Wir gingen in den Hühnerhof, suchten das magerste Huhn mit dem schäbigsten Gefieder aus und steckten es in einen Sack.
Dann fuhren wir los, alle sechs und das Huhn, um Melichettis berühmte Schweine zu sehen, radelten durch die Kornfelder. Und wie wir so in die Pedale traten, stieg die Sonne am Himmel immer höher und brachte alles zum Glühen.
Salvatore hatte Recht, es war sehr weit bis zu Melichettis Hof. Als wir ankamen, hatten wir furchtbaren Durst und heiße Köpfe.
Melichetti saß in einem alten Schaukelstuhl unter einem schiefen Schirm und hatte eine Sonnenbrille auf der Nase.
Das Gut sah verfallen aus, das Dach war behelfsmäßig mit Blech und Teer geflickt. Auf dem Hof lag ein Haufen Müll: Traktorreifen, eine verrostete Bianchina, durchgesessene Stühle, ein Tisch ohne Beine. An einem mit Efeu bewachsenen Holzpfahl hingen von Regen und Sonne verwitterte Kuhschädel. Und ein kleinerer Schädel ohne Hörner. Wer weiß, von was für einem Tier der stammte.
Ein Köter, nur Haut und Knochen, bellte an der Kette.
Hinten waren Baracken aus Blech und die Schweinepferche, am Rande einer jener Schluchten, die bei uns gravine heißen.
Es sind enge, lang gezogene Canyons, die das Wasser in den Stein gegraben hat. Weiße Nadeln, Felsen und spitze Zähne ragen von der toten Erde hoch ins Licht. Im Inneren wachsen häufig schiefe Olivenbäume, Baumerdbeeren und Mäusedorn, und es gibt Höhlen, wo die Hirten ihre Schafe hinbringen.
Melichetti wirkte wie eine Mumie. Die runzlige Haut hing an ihm herunter, und er war haarlos bis auf ein weißes Büschel, das ihm mitten auf der Brust wuchs. Um den Hals hatte er eine orthopädische Halskrause, die mit grünen Gummibändern verschlossen war, dazu trug er ein Paar kurze schwarze Hosen und braune Plastiklatschen.
Er sah uns auf unseren Rädern kommen, regte sich aber nicht. Wir mussten ihm wie eine Fata Morgana erscheinen. Auf dieser Straße kam nie jemand vorbei, höchstens einmal ein paar Lastwagen mit Heu.
Es roch nach Pisse. Und es gab Millionen von Pferdebremsen. Melichetti störten sie nicht. Sie setzten sich auf seinen Kopf und um die Augen herum, wie bei Kühen. Nur wenn sie auf seinem Mund landeten, schnaubte er.
Der Totenkopf trat vor. »Wir haben Durst, Signore. Hätten Sie ein bisschen Wasser für uns?«
Ich machte mir Sorgen, denn einer wie Melichetti konnte auf dich schießen, dich den Schweinen vorwerfen oder dir vergiftetes Wasser zu trinken geben. Papa hatte mir von einem in Amerika erzählt, der einen Teich mit Krokodilen besaß, und wenn einer anhielt, um ihn um eine Auskunft zu bitten, ließ er ihn ins Haus kommen, verpasste ihm einen Schlag auf den Kopf und warf ihn den Krokodilen zum Fraß vor. Und als die Polizei gekommen war, hatte er sich nicht ins Gefängnis bringen, sondern von den Krokodilen zerfleischen lassen. Melichetti konnte sehr gut auch so einer sein.
Der Alte schob die Brille hoch. »Was macht ihr hier, Kinder? Seid ihr nicht ein bisschen weit weg von zu Hause?«
»Signor Melichetti, stimmt es, dass Sie Ihren Dackel den Schweinen zu fressen gegeben haben?«, platzte Barbara heraus.
Ich dachte, ich müsste sterben. Der Totenkopf drehte sich um und schleuderte ihr einen hasserfüllten Blick zu. Salvatore versetzte ihr einen Tritt ans Schienbein.
Melichetti fing an zu lachen und bekam einen Hustenanfall, dass er fast erstickt wäre. Als er sich wieder gefasst hatte, sagte er: »Wer erzählt dir denn solch ein dummes Zeug, Mädchen?«
Barbara zeigte auf den Totenkopf. »Der da!«
Der Totenkopf lief rot an, senkte den Blick und betrachtete seine Schuhe.
Ich wusste, warum Barbara das gesagt hatte.
Ein paar Tage zuvor hatten wir einen Wettkampf gemacht, wer am weitesten Steine werfen könnte, und Barbara hatte verloren. Der Totenkopf hatte sie gezwungen, sich die Bluse aufzuknöpfen und uns ihren Busen zu zeigen. Barbara war elf Jahre alt. Sie hatte ein klein wenig Brust, einen Ansatz, nur eine Ahnung von dem Busen, den sie in ein paar Jahren haben würde. Sie hatte sich geweigert. »Wenn du es nicht machst, nehmen wir dich nicht wieder mit«, hatte der Totenkopf ihr gedroht. Ich hatte mich schlecht gefühlt, das war einfach nicht in Ordnung. Ich konnte Barbara nicht leiden, sie versuchte einen reinzulegen, wann immer es ging. Aber ihren Busen zeigen, nein, das schien mir zu viel.
Der Totenkopf hatte beschlossen: »Entweder du zeigst uns deine Titten, oder du gehst.«
Und Barbara hatte sich still gefügt und ihre Bluse aufgeknöpft.
Ich konnte nicht anders, ich musste ihren Busen anschauen. Es war der erste, den ich in meinem Leben sah, ausgenommen der von Mama. Vielleicht hatte ich einmal, als sie die Nacht bei uns verbrachte, den meiner Cousine Evelina gesehen, die zehn Jahre älter war als ich. Jedenfalls hatte ich schon eine gewisse Vorstellung von einem Busen, der mir gefiel, und der von Barbara gefiel mir überhaupt nicht. Ihre Brüste sahen aus wie Weichkäse, Hautfalten, nicht viel anders als die Fettröllchen auf ihrem Bauch.
Barbara war über diese Geschichte noch nicht hinweg, und jetzt wollte sie ihre Rechnung mit dem Totenkopf begleichen.
»Du erzählst also überall herum, ich hätte meinen Dackel den Schweinen zu fressen gegeben.« Melichetti kratzte sich die Brust. »Augusto, so hieß der Hund. Wie der römische Kaiser. Er war dreizehn Jahre alt, als er starb. Ein Hühnchenknochen ist ihm in der Kehle stecken geblieben. Er hat ein anständiges Begräbnis bekommen, mit einem richtigen Grab.« Er zeigte mit dem Finger auf den Totenkopf. »Du, Junge, könnte ich wetten, bist der Älteste, stimmt’s?«
Der Totenkopf antwortete nicht.
»Du darfst nie Lügen erzählen. Und du darfst den Namen von anderen nicht in den Schmutz ziehen. Du musst die Wahrheit sagen, vor allem denen, die kleiner sind als du. Die Wahrheit, immer. Den Menschen, dem lieben Gott und dir selber, hast du verstanden?« Er war wie ein Priester, der einem eine Predigt hält.
»Hat er denn auch nicht ins Haus gepinkelt?«, hakte Barbara nach.
Melichetti versuchte den Kopf zu schütteln, doch die Halskrause hinderte ihn daran. »Er war ein gut erzogener Hund, ein großer Mäusejäger. Friede seiner Seele.« Er zeigte auf den Brunnentrog. »Wenn ihr Durst habt, da unten ist Wasser. Das beste in der ganzen Gegend. Und das ist kein dummes Geschwätz.«
Wir tranken, bis wir fast platzten. Das Wasser war frisch und gut. Dann fingen wir an, damit herumzuspritzen und den Kopf unter das Rohr zu halten.
Der Totenkopf sagte, Melichetti wäre ein Scheißkerl. Und er wüsste mit Sicherheit, dass der verrückte Alte seinen Dackel den Schweinen zu fressen gegeben hätte.
Er starrte Barbara an. »Das wirst du mir büßen.« Dann ging er brummend weg und setzte sich allein auf die andere Seite der Straße.
Salvatore, Remo und ich machten uns daran, Kaulquappen zu fangen. Meine Schwester und Barbara hockten sich auf den Rand des Brunnentrogs und hielten die Füße ins Wasser.
Nach ein paar Minuten kam der Totenkopf ganz aufgeregt zurück.
»Seht mal! Seht mal, wie groß!«
Wir drehten uns um. »Was?«
»Dahinten …«
Es war ein Hügel.
Er sah aus wie ein Panettone. Ein enormer Kuchen, den ein Riese in die Ebene gesetzt hatte. Er erhob sich ein paar Kilometer vor uns. Ein gewaltiger goldener Berg. Das Korn bedeckte ihn wie ein Fell. Es gab keinen Baum, keinen Wipfel, nichts Unvollkommenes, das seine Form störte. Die Luft um ihn herum flimmerte. Die anderen Hügel dahinter schienen Zwerge, verglichen mit dieser gigantischen Kuppel.
Wer weiß, wieso ihn bis zu diesem Augenblick keiner von uns bemerkt hatte. Wir hatten ihn gesehen, doch ohne ihn wirklich zu sehen. Vielleicht weil er mit der Landschaft um ihn herum eins war. Vielleicht weil wir alle die Augen auf die Straße gerichtet hatten, um den Hof Melichettis nicht zu verpassen.
»Los, wir klettern rauf.« Der Totenkopf zeigte auf den Hügel. »Wir klettern auf diesen Berg.«
Ich sagte: »Wer weiß, was da oben ist.«
Es musste ein unglaublicher Ort sein, vielleicht bewohnt von irgendeinem eigenartigen Tier. So hoch hinauf war noch nie einer von uns geklettert.
Salvatore schützte sich mit der Hand vor der Sonne und musterte den Gipfel. »Ich wette, dass man von da oben das Meer sieht. Ja, wir müssen ihn besteigen.«
Wir sahen ihn schweigend an.
Das war ein Abenteuer, etwas anderes als die Schweine von Melichetti.
»Und auf dem Gipfel hissen wir unsere Fahne. Dann weiß jeder, der hochklettert, dass wir zuerst da waren«, sagte ich.
»Was für eine Fahne? Wir haben keine Fahne«, sagte Salvatore.
»Wir nehmen das Huhn.«
Der Totenkopf griff nach dem Sack mit dem Huhn und wirbelte ihn durch die Luft. »Genau! Wir drehen ihm den Hals um, in den Arsch kriegt es einen Stock geschoben, und den rammen wir in die Erde. Dann bleibt das Skelett übrig. Ich bringe das Huhn hoch.«
Ein gepfähltes Huhn könnte man für ein Hexenzeichen halten.
Doch der Totenkopf hatte jetzt Oberwasser. »Geradeaus, den Hügel hoch. Keine Kurven. Es ist verboten, hintereinander zu gehen. Es ist verboten, stehen zu bleiben. Wer als Letzter oben ist, muss was zur Strafe tun.«
Wir waren sprachlos.
Ein Wettkampf! Warum?
Es war klar. Um sich an Barbara zu rächen. Sie würde als Letzte hochkommen und büßen müssen.
Mir fiel meine Schwester ein. Ich sagte, dass sie zu klein sei, um mitzumachen, und dass es nicht gelte, sie würde verlieren.
Barbara machte mit dem Finger ein Zeichen, das nein bedeutete. Sie hatte verstanden, dass der Totenkopf ihr eine kleine Überraschung bereiten wollte.
»Was hat das damit zu tun? Wettkampf ist Wettkampf. Sie ist mitgekommen. Dann muss sie eben unten warten.«
Das ging nicht. Ich konnte Maria nicht zurücklassen. Die Geschichte mit den Krokodilen ging mir immer noch durch den Kopf. Melichetti war freundlich gewesen, doch man konnte ihm nicht allzusehr vertrauen. Wenn er sie umbrachte, was sollte ich dann Mama erzählen?
»Wenn meine Schwester dableibt, bleibe ich auch.«
Maria mischte sich selbst ein. »Ich bin nicht zu klein! Ich will auch mitmachen.«
»Du bist still!«
Der Totenkopf hatte ein Lösung. Sie konnte mitkommen, zählte aber nicht beim Wettkampf.
Wir warfen die Räder hinter den Brunnentrog und brachen auf.
Deshalb also war ich auf diesem Hügel.
Ich zog Maria den Schuh wieder an.
»Kannst du laufen?«
»Nein, es tut zu weh.«
»Warte.« Ich blies ihr zweimal aufs Bein. Dann griff ich mit den Händen in die glühend heiße Erde. Ich nahm ein bisschen, spuckte darauf und verschmierte sie auf ihrem Knöchel. »So geht es vorbei.« Ich wusste, dass es nicht funktionierte. Erde war gut bei Bienenstichen und Nesseln, nicht bei Verstauchungen, aber vielleicht fiel sie darauf herein. »Geht’s besser?«
Sie wischte sich mit dem Arm die Nase ab. »Ein bisschen.«
»Kannst du laufen?«
»Ja.«
Ich nahm sie bei der Hand. »Los, dann lass uns gehen, wir sind die Letzten.«
Wir wandten uns dem Gipfel zu. Alle fünf Minuten musste Maria sich hinsetzen, um ihr Bein auszuruhen. Zum Glück kam ein bisschen Wind auf. Dadurch wurde es besser: ein Rascheln im Korn, einem Luftholen gleich. Plötzlich meinte ich ein Tier zu sehen, das an uns vorbeilief. Schwarz, schnell, still. Ein Wolf? Es gab keine Wölfe bei uns in der Gegend. Vielleicht ein Fuchs oder ein Hund.
Der Aufstieg war steil und schien kein Ende zu nehmen. Ich hatte immer nur Korn vor Augen, doch als ich endlich einen schmalen Streifen Himmel sah, verstand ich, dass es nicht mehr weit sein konnte, dass gleich der Gipfel kommen musste, und ohne es richtig zu merken, waren wir oben.
Es gab dort wirklich nichts Besonderes. Der Gipfel war mit Korn bedeckt, wie alles Übrige. Unter den Füßen hatten wir die gleiche rote, verbrannte Erde. Über dem Kopf die gleiche sengende Sonne.
Ich betrachtete den Horizont. Ein milchiger Dunst verschleierte alles. Das Meer war nicht zu sehen. Man erkannte jedoch die anderen, niedrigeren Hügel und Melichettis Hof mit seinen Schweinepferchen und der Schlucht, und man sah die weiße Straße, die die Felder durchschnitt, diese lange Straße, auf der wir mit den Rädern gefahren waren, um hierher zu kommen. Und man konnte die Ortschaft ausmachen, wo wir wohnten, winzig klein sah sie aus. Acqua Traverse. Vier Häuschen und eine alte Landvilla, verstreut im Korn. Lucignano, das Nachbardorf, lag im Nebel verborgen.
Meine Schwester sagte: »Ich will auch gucken. Lass mich gucken.«
Ich hob sie auf meine Schultern, auch wenn ich mich vor Anstrengung kaum auf den Beinen halten konnte. Wer weiß, was sie ohne Brille sah.
»Wo sind die anderen?«
Wo sie durchgegangen waren, war die Ordnung der Ähren zerstört, viele Halme waren geknickt und einige abgebrochen. Wir folgten den Spuren, die auf die andere Seite des Hügels führten.
Maria umklammerte meine Hand und grub mir ihre Nägel ins Fleisch. »Wie eklig!«
Ich drehte mich um.
Sie hatten es getan. Sie hatten das Huhn aufgespießt. Es steckte auf der Spitze eines Stocks, mit baumelnden Füßen und gespreizten Flügeln. Als hätte es sich, bevor es den Geist aufgab, seinen Henkern ergeben. Der Kopf hing an einer Seite herunter, wie ein scheußliches, bluttriefendes Anhängsel. Aus dem halb geöffneten Schnabel sickerten rote Tropfen. Und die Brust war von der Spitze des Stocks durchbohrt. Ein Schwarm metallisch schimmernder Fliegen surrte um das Huhn herum und drängte sich auf den Augen und dem Blut.
Mir lief ein Schauder den Rücken hinunter.
Wir setzten den Weg fort, und nachdem wir die Kuppe des Hügels hinter uns gelassen hatten, ging es wieder nach unten.
Wo zum Teufel waren die anderen geblieben? Warum waren sie dort hinuntergegangen?
Nach weiteren zwanzig Metern entdeckten wir es.
Der Hügel war nicht rund. Hinten verlor er seine absolut perfekte Form. Er ging in eine Art Buckel über, der in sanften Windungen nach unten führte, um schließlich in der Ebene auszulaufen. In der Mitte lag ein enges Tal, umschlossen und nur von hier oben oder von einem Flugzeug aus zu sehen.
Es wäre kinderleicht gewesen, diesen Hügel aus Ton zu formen. Man musste nur eine Kugel machen. Sie in zwei Teile teilen. Eine Hälfte auf den Tisch legen. Aus der anderen Hälfte eine Wurst rollen, eine Art dicken Wurm, den man hinten anklebte und dabei in der Mitte eine kleine Mulde ließ.
Das Seltsame war, dass in dieser verborgenen Mulde Bäume wuchsen. Geschützt vor Wind und Sonne stand dort ein Eichenwäldchen. Und ein verlassenes Haus mit eingebrochenem Dach, die Ziegel braun und die Balken dunkel, tauchte zwischen dem grünen Blattwerk auf.
Wir gingen einen Pfad hinunter und gelangten in das kleine Tal.
Es war das Letzte, was ich erwartet hätte. Bäume. Schatten. Frische.
Man hörte keine Grillen mehr, sondern Vogelgezwitscher. Da waren violette Alpenveilchen. Teppiche aus grünem Efeu. Und ein guter Duft. Man bekam Lust, sich einen schönen Platz unter einem Baum zu suchen und ein Schläfchen zu halten.
Plötzlich tauchte Salvatore auf, wie ein Gespenst. »Hast du gesehen? Stark!«
»Sehr stark!«, antwortete ich und sah mich um. Vielleicht gab es einen Bach, aus dem man trinken konnte.
»Wieso hast du so lange gebraucht? Ich dachte schon, du hast kehrtgemacht.«
»Nein, meiner Schwester hat der Fuß so wehgetan, deshalb … Ich habe Durst. Ich muss was trinken.«
Salvatore zog eine Flasche aus dem Rucksack. »Viel ist nicht mehr drin.«
Wir teilten es brüderlich mit Maria. Es reichte gerade einmal, um sich die Lippen anzufeuchten.
»Wer hat den Wettkampf gewonnen?« Ich machte mir Sorgen wegen der Strafe. Ich war todmüde und hoffte, der Totenkopf könnte mir dieses eine Mal die Strafe erlassen oder sie auf einen anderen Tag verschieben.
»Der Totenkopf.«
»Und du?«
»Zweiter. Vor Remo.«
»Barbara?«
»Letzte. Wie üblich.«
»Und wen erwischt es?«
»Der Totenkopf sagt: Barbara. Aber Barbara sagt, du bist dran, weil du als Letzter gekommen bist.«
»Und nun?«
»Ich weiß nicht, ich bin weg, um eine Runde zu drehen. Ich hab genug von diesem Spiel.«
Wir wandten uns dem Haus zu.
Es war ein Wunder, dass es noch stand. Es erhob sich in der Mitte eines erdigen, von den Ästen der Eichen überdachten Platzes. Tiefe Risse durchzogen es von den Fundamenten bis zum Dach. Von dem Gebälk waren nur Reste geblieben. Ein knotiger Feigenbaum hatte die Treppe überwachsen, die zum Balkon führte. Seine Wurzeln hatten die Steinstufen aufgerissen und das Geländer weggedrückt. Oben gab es noch eine alte, durch und durch morsche Tür, deren blaue Farbe von der Sonne abgebröckelt war. In der Mitte des Baus öffnete sich ein großer Bogen in einen Raum mit gewölbter Decke. Ein Stall. Verrostete Streben und Holzpfosten hielten die Decke, die an vielen Stellen heruntergebrochen war. Auf der Erde lag trockener Mist, Asche, Berge von Kacheln und Schutt. Die Mauern hatten einen großen Teil vom Putz verloren, und die ohne Mörtel aufeinander geschichteten Steine kamen zum Vorschein.
Der Totenkopf saß auf einem Wasserkasten. Er warf Steine gegen einen rostigen Kanister und beobachtete uns. »Da bist du ja endlich.« Und damit es kein Missverständnis gab, fügte er hinzu: »Dieser Platz gehört mir.«
»Wieso gehört er dir?«
»Er gehört mir. Ich habe ihn als Erster entdeckt. Die Sachen gehören dem, der sie findet.«
Ich wurde nach vorn gestoßen und wäre fast der Länge nach hingeschlagen. Ich drehte mich um.
Barbara, hochrot, das T-Shirt schmutzig, die Haare wirr, schubste mich weiter, offenbar bereit, sich zu prügeln. »Du bist dran. Du bist als Letzter gekommen. Du hast verloren!«
Ich ballte meine Fäuste vor der Brust. »Ich bin umgekehrt. Sonst wäre ich Dritter geworden. Das weißt du.«
»Was hat das damit zu tun? Du hast verloren!«
»Wer hat verloren?«, fragte ich den Totenkopf. »Sie oder ich?«
Er ließ sich viel Zeit für die Antwort und zeigte dann auf Barbara.
»Hast du gesehn? Hast du gesehn?« Ich liebte den Totenkopf.
Barbara stampfte auf den Boden. »Das ist nicht gerecht! Das ist nicht gerecht! Immer ich! Warum immer ich?«
Ich wusste es nicht. Aber ich wusste, dass es immer einer ist, der das ganze Unglück abbekommt. Und damals war es die dicke Barbara Mura, sie war das Lamm, das die Sünden hinwegnahm.
Sie tat mir Leid, doch ich war froh, nicht an ihrer Stelle zu sein.
Barbara benahm sich wie ein wutschnaubendes Nashorn.
»Dann stimmen wir ab! Er kann nicht alles allein entscheiden.«
Auch nach zweiundzwanzig Jahren habe ich noch nicht verstanden, wie sie uns ertragen konnte. Es muss aus Angst gewesen sein, allein zu bleiben.
»In Ordnung. Stimmen wir ab«, lenkte der Totenkopf ein. »Ich sage, du hast verloren.«
»Ich auch«, ließ sich Remo hören.
»Ich auch«, bekräftigte ich.
»Ich auch«, wiederholte Maria wie ein Papagei.
Wir sahen Salvatore an. Niemand durfte sich enthalten, wenn es eine Abstimmung gab. Das war die Regel.
»Ich auch«, sagte Salvatore, fast flüsternd.
»Siehst du? Fünf zu eins. Du hast verloren. Du bist dran«, entschied der Totenkopf.
Barbara kniff die Lippen zusammen und ballte die Fäuste, ich sah, dass sie so etwas wie einen Tennisball runterschluckte. Sie ließ den Kopf hängen, aber sie weinte nicht.
Ich hatte Achtung vor ihr.
»Was … muss ich tun?«, stammelte sie.
Der Totenkopf massierte sich das Kinn. Seine verdorbene Fantasie machte sich an die Arbeit.
Er zögerte einen Augenblick. »Du musst sie … du musst sie zeigen … Du musst sie allen zeigen.«
Barbara schwankte. »Was muss ich euch zeigen?«
»Neulich hast du uns die Titten gezeigt.« Er wandte sich uns zu. »Dieses Mal zeigt sie uns ihre Möse. Ihre haarige Möse. Du ziehst die Unterhose runter und zeigst sie uns.« Er fing höhnisch zu lachen an und erwartete, dass wir das Gleiche tun würden, doch da hatte er sich getäuscht. Wir waren erstarrt, als wäre unversehens ein Wind vom Nordpol durchs Tal gefegt.
Es war eine übertriebene Strafe. Niemand von uns hatte Lust, Barbaras Möse zu sehen. Es war auch für uns eine Strafe. Mir zog sich der Magen zusammen. Ich wünschte mir, weit weg zu sein. Das hatte etwas Schmutziges, etwas … Ich weiß es nicht. Ja, etwas Gemeines. Und mir war es nicht recht, dass meine Schwester dabei war.
»Das kannst du vergessen«, sagte Barbara und schüttelte den Kopf. »Es ist mir egal, ob du mich schlägst.«