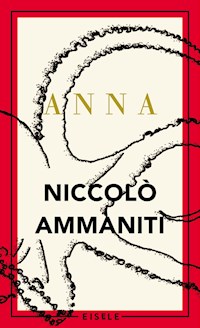19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eisele eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Nummer 1-Bestseller aus Italien Ein blendend unterhaltender Roman über unsere heutige Zeit Maria Cristina Palma führt ein scheinbar perfektes Leben, sie ist schön, reich, berühmt, die Welt dreht sich um sie. Dann bekommt sie eines Tages ein Video auf ihr Handy, das alles verändert. Es gibt ein Geheimnis in ihrer Vergangenheit, das keinesfalls an die Öffentlichkeit dringen darf. In dem Versuch, dieses Video geheim zu halten, dreht Maria Cristina fast durch. Und setzt in ihrer Panik eine Kette von Ereignissen in Gang, die sie selbst am allermeisten überraschen ... Der gefürchtete Blick der anderen auf uns, die Inszenierung unseres Lebens, die Heuchelei des Ganzen, unsere Sehnsucht nach Zugehörigkeit und Liebe – mit Ironie, Scharfsicht und überraschenden Plot-Twists inszeniert Ammaniti den Menschen in seiner ganzen Lächerlichkeit und Grandiosität und entwirft dabei ein ebenso sezierendes wie brillant unterhaltendes Portrait unserer heutigen Welt. "Eine göttliche Komödie über Rom, la grande bellezza und die waschechte Vita." Berliner Morgenpost
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Das Buch
Nach außen scheint alles perfekt. Maria Cristina Palma ist schön, reich, berühmt – und die Frau des italienischen Ministerpräsidenten. Eines Tages bekommt sie ein Video auf ihr Handy geschickt, das keinesfalls an die Öffentlichkeit gelangen darf. In dem Versuch, es geheim zu halten, setzt Maria Cristina eine Kette von Ereignissen in Gang, die sie an die Grenzen ihrer Existenz bringen. Und die Chance zu einer großen Veränderung in sich tragen.
Der Autor
NICCOLÒ AMMANITI, geboren 1966 in Rom, ist einer der erfolgreichsten und international renommiertesten Autoren italienischer Sprache. Sein Weltbestseller Ich habe keine Angst gewann den Premio Viareggio, sein Roman Wie es Gott gefällt den Premio Strega. All seine Bücher wurden von international herausragenden Regisseuren für das Kino verfilmt. Auch Ammaniti selbst ist als Regisseur tätig. Er machte Furore mit der TV-Serie Ein Wunder, für die er auch das Drehbuch schrieb. Seinen dystopischen Roman Anna verfilmte er als Mehrteiler fürs Fernsehen. Nach längerer Schreibpause erscheint nun endlich sein neuer Roman Intimleben. Niccolò Ammanitis Werke wurden in 44 Sprachen übersetzt. Er lebt mit seiner Frau in Rom.
NiccolÒ Ammaniti
Intimleben
Roman
Aus dem Italienischen von Verena von Koskull
Besuchen Sie uns im Internet:
www.eisele-verlag.de
ISBN 978-3-96161-181-2
Die Originalausgabe »La vita intima«
erschien 2023 bei Giulio Einaudi Editore, Turin.
© 2023 Julia Eisele Verlags GmbH, München
© 2023 by Niccolò Ammaniti
First Italian edition Giulio Einaudi editore
Umschlaggestaltung: FAVORITBUERO, München
Umschlagillustration: ©plainpicture/Jasmin Sander
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Inhalt
Über das Buch / Über den Autor
Titel
Impressum
Zitate
I. Mittwoch, 21. Februar
II. Donnerstag, 22. Februar
III. Freitag, 23. Februar
IV. Samstag, 24. Februar
V. Sonntag, 25. Februar
VI. Montag, 26. Februar
VII. Dienstag, 27. Februar
VIII. Eine Woche später
IX. Zwei Jahre später
Ende
EMPFEHLUNGEN
Orientierungsmarken
Cover
Inhalt
Textbeginn
Wenn du einen Freund willst, dann zähme mich!
Antoine de Saint-Exupéry, Der kleine Prinz
Zücke mich nicht ohne Grund. Führe mich nicht ohne Tapferkeit.
Inschrift auf dem Schwert der von Temistocle Guerrazzi erschaffenen Statue des Giovanni de’ Medici
I.
Mittwoch, 21. Februar
1.
Diese Geschichte beginnt an einem Mittwoch des vergangenen Jahrzehnts, es ist morgens um Viertel nach neun, und Maria Cristina Palma macht gerade Gymnastik. Sie ist beim bulgarischen Squat, einer Übung zur Stärkung der Oberschenkel und Gesäßmuskeln. Das eine Bein zurückgelegt, das andere nach vorn gestellt, beugt sie das Knie und starrt durch die Verandafenster in die trübe Wolkendecke. Der Feinstaub, der die Römer wochenlang zu eingeschränkten Fahrverboten mit alternierenden Nummernschildern zwang, hat sich mit dem Regen gelegt. Es ist warm in der Wohnung, doch jenseits der Doppelfenster zur Terrasse hat die nächtliche Kälte die Palmfarne und die kahle Pergola mit Raureif bedeckt. Durch die Geländerstreben ist der von Autos verstopfte Lungotevere zu erahnen, und dahinter, verschwommen im ungesunden Hauptstadtdunst, die plumpe Silhouette der Engelsburg. Das Penthouse, das Maria Cristina bewohnt, ist eines jener unerreichbaren Paradiese, von dem die meisten Menschen nicht einmal zu träumen wagen. Über dreihundert Quadratmeter in einem neoklassizistischen Wohnhaus ganz in der Nähe der Piazza Navona, vor der Tür ein Mannschaftswagen der Polizei, der Tag und Nacht Wache schiebt.
Ihr Personal Trainer, Mirco Tonik, ein Riesenbaby aus Francavilla al Mare, erzählt ihr gerade, dass er den Geburtstag seines irischen Verlobten Michael Carmichael, der Gebrauchsanweisungen für Drucker und Router übersetzt, in einem veganen Restaurant in seinem Stadtviertel Pigneto gefeiert hat. Während der Trainer von einer göttlichen Auberginen-Parmigiana schwärmt, zieht er eine Scheibe von der Langhantel, wodurch das Gegengewicht auf der anderen Seite, fünf Kilo reinstes Gusseisen, von der Stange rutscht und auf dem rechten großen Zeh der Frau landet, die einen so heftigen Schmerzensschrei ausstößt, dass das Pärchen Unzertrennliche im Emaillekäfig über den Zimmerfarnen verstummt. Der Wintergarten samt den Pfeilblättern in ihren azurblauen Töpfen, der Kentiapalme und den hängenden Trieben der Efeutute auf den Regalen wummert ihr entgegen wie ein Spezialeffekt eines schlechten Films.
Mirco Tonik, dem dämmert, welchen Bockmist er gebaut hat, schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, tänzelt von einem Fuß auf den anderen und ruft seinen Schöpfer an: »Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott. Was habe ich getan.«
Maria Cristina zittert vor Schmerz. Sie muss ihn einfach nur wegatmen.
Im Gegensatz zu seelischen Schmerzen neigt die Erinnerung an körperliche Blessuren dazu, mit der Zeit zu verblassen, und nach ein paar Jahren sind die Qualen eines gezogenen Zahns oder einer Blinddarmentzündung so gut wie vergessen. Fünfzehn Jahre sind vergangen, seit Maria Cristinas Ex-Mann, der bekannte Schriftsteller Andrea Cerri, ihr vor dem Hotel Locarno einen Finger in der Tür eines Golf Cabrio einklemmte. Damals war sie in die Notaufnahme des Fatebenefratelli-Krankenhauses gefahren, wo man ihr den letzten Hautfetzen durchtrennt hatte, an dem ein blutiger Klumpen aus Fleisch und Fingernagel hing. Glücklicherweise wurde der heutige Aufprall durch das Oberleder des Schuhs gedämpft.
»Wie geht es dir? Tut es weh?«, stammelt der Personal Trainer und presst sich eine Hand an die Brust.
Mit angehaltenem Atem macht Maria Cristina ihm ein Zeichen, sich zu beruhigen.
In diesem Augenblick gibt es auf der ganzen Welt oder zumindest im ersten Bezirk Roms wohl niemanden, dem Beruhigung ferner läge als Mirco Tonik. Von den sechzehn Milliarden großen Zehen, die über die Erde wandeln, ist der von ihm gequetschte einer der Kostbarsten.
Maria Cristina Palmas Füße, Schuhgröße neununddreißig, im Ayurveda das Maß der Harmonie, sind griechische Füße, deren zweiter Zeh wie bei der Venus von Milo eine Spur länger ist als der große. In der Medizin wird dieses Phänomen zu Ehren des amerikanischen Orthopäden Dudley J. Morton, der es zum ersten Mal beschrieb, »Morton-Zeh« genannt. Nur zehn Prozent der Weltbevölkerung haben ihn, und seine Verbreitung ist uneinheitlich. In den skandinavischen Ländern kommt er gar nicht vor, während er es beim japanischen Inselvolk der Ainu auf fast neunzig Prozent bringt. Wie bei der Barbie ist Maria Cristinas Fußgewölbe so perfekt, dass es nie den Boden berührt und seine Haut daher glatt und zart bleibt. Laut der Podomantie genannten Fußlesekunst deuten die anmutig schlanken Zehen auf Ehrgeiz und Entschlossenheit hin. Tippt man bei Google »Maria Cristina Palma Füße« ein, erscheinen unzählige Fotos. Teilansichten und Großaufnahmen, mit Schuhen und ohne. Zusammen mit Selena Gomez ist Maria Cristina die Königin des Fußfetischisten-Portals WikiFeet.
Davon abgesehen weiß Mirco Tonik sehr genau, wer der Ehemann der Frau ist, deren Zeh er lädiert hat: Domenico Mascagni, der italienische Ministerpräsident. Die wenigen Male, die er ihm in der Wohnung begegnet ist, konnte er ihm vor Angst nicht in die Augen sehen. Er ist ein mächtiger Mann und Spross einer alten Anwalts-Dynastie, die Industrien gerettet, ganze Staaten und internationale Holdings vertreten hat. Es heißt, einer seiner Vorfahren, ein gewisser Tancredi Mascagni, habe auf Durchreise in England an der Abfassung der Magna Carta mitgewirkt.
Schon sieht sich der Personal Trainer notleidend vor den Pizzerien im Stadtzentrum stehen und für ein bisschen Klimpergeld die Panflöte spielen (das Einzige, was er außer Fitnesstraining beherrscht). Michael hat es ihm hundertmal gesagt. »Nimm jetzt ein bisschen Geld in die Hand, dann musst du später keins rausschmeißen. Schließ eine Versicherung ab.« Aber er ist nun mal knauserig, und nun wird er seinen kärglichen Besitz (eine Einzimmerwohnung im Pigneto, seinen Anteil an einem Dammuso auf Pantelleria und einen klapprigen Motorroller) verkaufen müssen, um die Rekonstruktion des sublimen Zehengliedes zu bezahlen. Mirco »Tonik« Belluccio wird als der Mann in Erinnerung bleiben, der Maria Cristina Palmas großem Onkel den Garaus machte. Er braucht Luft. Er reißt die Fenstertür auf, stürzt an die Brüstung und haspelt in seinem ungeschliffenen abruzzesischen Zungenschlag: »Jetzt bring ich mich um. Jetzt bring ich mich um.«
Unter der Terrasse der Mascagnis befindet sich eine weitere, und dort läuft ein nicht besonders freundlich aussehender Deutscher Schäferhund herum. Mirco dreht um, steckt den Kopf in das von Papyrusgras bewachsene Wasserbecken, klatscht sich das Haar an den Schädel und kehrt in die Wohnung zurück.
Maria Cristina hat sich den Schuh ausgezogen, kauert auf der Bank und betrachtet ihren geschwollenen roten Zeh.
Der Trainer fällt auf der Matte vor seiner Königin auf die Knie. »Ich bin zu jedweder Strafe bereit. Körperlich, wenn möglich. Letzter Wunsch, ein paar Tropfen Xanax.«
»Im Bad.«
Der Flehende blickt auf. »Du verschonst mich? Wenn du mir verzeihst, trainiere ich dich das ganze Jahr umsonst.«
»Auf dem Bord unter dem Spiegel.«
Ungläubig ob der zuteil gewordenen Gnade, hastet Mirco Tonik davon, um sich eine ordentliche Dosis Alprazolam reinzupfeifen.
Professor Angelo Zurlo, der von Maria Cristina Palmas persönlicher Assistentin Caterina Gamberini telefonisch konsultierte Chefchirurg der Orthopädie am Gemelli-Krankenhaus, versichert, neuesten klinischen Erkenntnissen zufolge sei es ratsam, den verletzten Zeh weiter zu belasten, da »die angeregte Durchblutung des Nagelbettes Hämatomen vorbeugt, die zum Ausfall des Nagels führen«. Also kein Krankenhaus, eine gehörige Dosis Entzündungshemmer und, wenn möglich, offene und möglichst flache Schuhe.
Die Nachricht macht die Frau des Premiers wieder munter, die bereits fürchtete, das Fest im Ruderklub Circolo Canottieri Aniene sausen lassen zu müssen. Dior hat ihr ein neues Kleid zugeschickt, das sie zum Geburtstag von Igor Rossi Brogi, dem Präsidenten des Nationalverbandes italienischer Hoteliers Anai, zur Schau tragen will.
Hätte der Professor Maria Cristina verordnet, den Fuß ruhigzustellen und zu Hause zu bleiben, könnte ich diese Geschichte nicht erzählen. Ganz sicher bin ich mir da allerdings nicht. Denn Geschichten, erst recht die bedeutenden, schicksalsverändernden, sind reißende Ströme, die schwer zu bändigen sind. Lässt man sie auf ein Hindernis stoßen, umfließen sie es und suchen sich einen neuen Weg. Außerdem gefällt mir die Idee, dass diese Geschichte mit einem Schmerzensschrei beginnt.
Der just geschehene Unfall hilft jedenfalls anschaulich dabei, sich von Maria Cristina Palma, der Hauptfigur dieses Romans, ein genaueres Bild zu machen.
Wenn ihr ein Leid geschieht, sorgt sie sich um diejenigen, die es ihr zugefügt haben. Alles Schlimme, das ihr vom Leben auferlegt wird, kleinzureden und so ihre Mitmenschen zu beschwichtigen, ist eine ihrer hervorstechendsten Eigenschaften. Mit elf Jahren hatte sie einmal in der Villa in Mondello eine Rauferei zwischen der hauseigenen Tigerkatze Nello und Tante Vittorias Pudel Tolo zu schlichten versucht. Die Katze war wie ein getigerter Dämon durchs Zimmer gesprungen, hatte ihr die Krallen ins kindliche Fleisch geschlagen, sich an ihr hochgehangelt wie an einem Baumstamm und war dann im Flur verschwunden. Das Mädchen war in den Garten gegangen. Dort befanden sich ihre Mutter, die Tante, die weiß livrierten Diener, die Cousins mit den Schwimmflügeln, ihr Bruder auf dem Sprungbrett. Der Pool zuckte in gleißendem Azur, in den Pinien zirpten die Zikaden, und sie hatte, ungelenk auf ihren langen Fohlenbeinen, zerschunden wie der Heilige Bartholomäus und mit zwei nutzlosen blauen Stoffdreiecken auf der knochigen Brust, vor ihrem Teller mit den gefüllten Zucchini Platz genommen, die Serviette auf die Knie gelegt, sich ein Glas Wasser eingeschenkt und es unter dem Gekreisch sämtlicher Anwesender ausgetrunken.
2.
Zwölf Stunden nach dem Unfall ist Maria Cristina Palma im Circolo Canottieri Aniene, um Igor Rossi Brogis Geburtstag zu feiern.
Was für ein unverzeihlicher Fehler, nicht zu Hause geblieben zu sein. Den ganzen Tag über hat der große Zeh sie gequält, und jetzt, mitsamt den anderen Zehen in den Tom-Ford-Schuh gezwängt, pocht er wie ein zweites Herz. Hätte sie Professor Zurlos klugen Rat befolgt und flache Sandalen angezogen, wäre ihr diese sinnlose Qual erspart geblieben, doch dann hätte sie die gesamte Abendgarderobe überdenken müssen.
Zum Glück läuft die Party. Der Saal wimmelt vor Hoteliers, die im lärmenden Durcheinander aus Stimmen, klapperndem Besteck und Gelächter angeregt aufeinander einreden. Ein trübseliger Pianist spielt schüchterne Jazzklänge.
»Auf geht’s«, murmelt Maria Cristina zu sich selbst. Mit einem Schluck leert sie das Weinglas mit Ribolla Gialla, stellt es auf der Armlehne des Sessels ab, steht auf, weicht den Tabletts der Kellner aus und überholt eine Schlange von Damen, die für Artischocken nach jüdischer Art anstehen. Als sie deren Blicke auf sich spürt, vollführt sie eine Pirouette. Sie ist bezaubernd in ihrem schulter- und rückenfreien Dior-Kleid mit dem fast bis zum Slip hinaufzüngelnden Seitenschlitz, der den weiten Rock aus Rot und Puderrosa aufspringen lässt.
Wo ist wohl ihr Mann?
Die Sicherheitsleute haben sich an den Türen postiert. Die Assistenten des Premierministers, keiner älter als dreißig, lümmeln wie eine Horde Teenager bei der elterlichen Party mit Rigatoni all’amatriciana auf den Knien auf einer kleinen Couch.
Da ist er.
Umringt von Hoteliers, steht er am Ende des Saals, die Hände in den Hosentaschen, mit himmelwärts gerichtetem grimmigem Blick, wie immer, wenn er sich etwas sehr Wichtiges oder sehr Langweiliges anhören muss.
Mit ihren ein Meter neunzig, wenn man ihre Absätze mitrechnet, durchbricht Maria Cristina die kleine Menschentraube, reckt den Arm und legt ihm die Hand auf die Schulter.
Der Premier mustert sie, um sich klarzuwerden, ob die Angelegenheit ernst ist. Er lebt in ständiger Erwartung ernster Angelegenheiten. Aber seine Frau ist eine Sphinx. »Entschuldigt mich einen Moment«, sagt er an das Grüppchen gewandt und schiebt hinterher: »Aber das ist ein wertvoller Aspekt, den sollten wir nicht unterschätzen …«
»Ich entführe ihn Ihnen kurz«, fügt sie mit einem Lächeln hinzu.
Das Grüppchen teils glatzköpfiger, teils gefärbter Sechzigjähriger in ihren spacken dunkelblauen Anzügen mit den engen Hosen, unter denen die durchweg unbestrumpften, alterskahlen Fesseln aus den dick besohlten Schuhen hervorlugen, lächelt zurück und entblößt die mit Pfeffersprenkeln der Amatriciana übersäten Zahnblenden. Wie bei einem Tiroler Volkstanz weichen sie synchron einen Schritt zurück und starren sie an, als stünden sie vor einem Schlangenmenschen, der sich in einen Koffer kringelt. Sie versuchen, die lebende Maria Cristina Palma mit dem im Hippocampus – dem für Erinnerungen zuständigen Hirnareal – abgespeicherten Bildmaterial (Videos, Modestrecken, Paparazzifotos, Familienschnappschüsse et cetera) zu vergleichen. Sie scannen ihren Mund, den Hals, die Hüften, den (hundertprozentig gemachten) Busen, die überlangen Beine, die aus dem Kleid hervorschauen und in einem Paar schwindelerregender High Heels enden. Sie versuchen sich klarzuwerden, ob sie wirklich die schönste Frau der Welt ist. Und sie sagen sich, ja, schön ist sie, geben wir dem Kaiser, was dem Kaiser gebührt, aber nicht so schön, wie alle behaupten. Nichts im Vergleich zu einer Monica Bellucci oder einer Emily Ratajkowski oder Tausenden anderen. Apart, elegant, keine Frage, mit einer für ihre zweiundvierzig Jahre rasanten Figur, ein echter Knaller, aber nichts, worüber man den Kopf verlieren müsste. Trotzdem ist es ein verdammtes Rätsel, wie dieser Schnösel von Mascagni an so ein geiles Gerät kommen konnte.
Es gibt eine Antwort.
Auf die gewohnte Tour.
Geld und Macht.
An dieser Stelle sei angemerkt, dass eine bedeutende, von einer Universität in Louisiana in Zusammenarbeit mit dem Center of Advanced Study of Body and Facial Plastic Surgery in Carmel (CA) durchgeführte Studie Maria Cristina Palma ein Jahr vor Beginn dieser Geschichte zur schönsten Frau der Welt erklärt hat.
Zunächst fand die Studie keine große Beachtung. Solche Nachrichten, die allenfalls dazu taugen, neben Werbeanzeigen für Nahrungsergänzungsmittel und günstige Kredite am unteren Rand einer Website aufzupoppen, gibt es täglich hundertfach. Doch aufgrund stochastischer Verkettungen, die nur Meteorologen und Mathematiker durchschauen, zog die Nachricht nach und nach immer weitere Kreise und ging schließlich, um ein von mir verhasstes Wort zu verwenden, viral. Gefüttert von den sozialen Netzwerken, löste sie einen patriotischen Jubel aus, wie ihn sonst nur die siegreiche Fußballnationalmannschaft erntet. Aus Italien schwappte die Nachricht über den großen Teich zurück, verbreitete sich rund um den Globus und besiegelte die Überlegenheit der mediterranen Schönheit und also unserer Kochkunst, unserer Landschaft und unserer jahrtausendealten Kultur.
Maria Cristina Palmas Gesichtsoval hat göttliche Proportionen, das Verhältnis der Vertikalen, Horizontalen und Diagonalen entspricht der mathematischen Formel des Goldenen Schnitts. Die hohen Wangenknochen und die Nase, die von vorne so anders aussieht als im Profil, harmonieren perfekt mit den schmalen Lippen, die weiße, gerade Zähne umrahmen. Die perfekt geschwungenen, natürlich dichten Augenbrauen weisen den Weg zu den Augen, deren Farbe unergründlich ist. Je nach Lichteinfall sind sie grau, grün, von goldenen Sprenkeln durchzogen oder gelb, als hätte man sie einem Fuchs gestohlen. Die majestätische Haltung, die Proportionen der Gliedmaßen, die schmalen Fesseln, die bereits erwähnten Füße, die Haut, die so zart ist wie das Blütenblatt einer Hundsrose, sind die Inkarnation ewiger Schönheit, die Künstler sämtlicher Epochen, von Phidias bis Picasso, in ihren Bann schlug.
Doch schon bald verwandelte sich die Siegesfreude für unsere Protagonistin in einen Albtraum. Von Journalisten belagert, von Fans umringt, von Sendungen aller Art angefragt, von Filmagenten verfolgt und von Hassern verlacht, beleidigt und verachtet, musste sie sich monatelang in ihrem Haus auf dem Land verbarrikadieren. Jedes Bild von ihr wurde veröffentlicht: Sie beim Stabweitsprung während der Juniorleichtathletik-Europameisterschaften, sie auf dem Laufsteg in Paris, sie gerettet aus dem brennenden Auto, in dem ihr erster Mann ums Leben gekommen war.
Sofort hielten die rechten Parteien und später auch die vom jäh im Rampenlicht stehenden Paar entnervten Regierungsverbündeten Domenico Mascagni vor, er benutze seine Frau als goldenen Kerzenleuchter, um sein dürftiges politisches Format dahinter zu verstecken. Eine solche Zurschaustellung sei eine Beleidigung für alle hässlichen, arbeitenden, an Krankheiten leidenden Frauen. Maria Cristina Palma sei ein hohles, mit Nichts gefülltes Gefäß, ein billiger Rattenfängertrick.
Am hartnäckigsten hält sich das Gerücht, seine Frau habe mehrere Millionen Euro dafür bekommen (Schwarzgeld von Parteikonten), eine gescheiterte Ehe aufrechtzuerhalten. In Wirklichkeit seien sie gar kein Paar. Irene, die zehnjährige Tochter, sei aus Kalkül entstanden, womöglich aus der Retorte, schließlich hätten die beiden keinen Sex und würden zu Hause kein Wort miteinander wechseln. Es gibt Belege, Unterlagen, alte Interviews. Und Grundschulkameradinnen, Cousins, Ex-Freunde, Anwälte und angebliche Freunde bestätigen nur zu gerne, dass Signora Palma über Leichen geht. Sie ist ein Golem, von Experten am Reißbrett entwickelt und von der Raupe, Mascagnis Social-Media-Manager, darauf programmiert, das Inbild der perfekten Premiersgattin abzugeben. Schön und stumm. Ihre Schüchternheit, das verhaltene Auftreten, die Jas und Neins und geflüsterten Ich weiß nicht sind eindeutige Beweise, dass sie trist, unglücklich und das Opfer ihres Mannes ist. Manche behaupten allerdings auch, sie sei der kriminelle Kopf der Bande und habe das ganze Universum gevögelt, um so weit zu kommen. TV- und Radioformate wurden entwickelt, Investigativjournalisten von der Leine gelassen, um im Leben von »Maria Tristina« herumzustochern, dem ehemaligen Model aus Palermo, das ein Dasein zwischen Privileg und Tragödie führt.
In den Buchhandlungen kursiert eine unautorisierte Biografie mit dem Titel Geschichte eines südlichen Sterns. Auf kaum hundert bebilderten Seiten liefert der berühmte Journalist Manlio Calzini einen kompakten Gesamtüberblick. Maria Cristinas Mutter, Teresa Sangermano, aus reichem sizilianischem Hause, heiratet nach einer gemeinsamen Hüttenübernachtung auf den Tofane den friaulischen Bergsteiger Bebo Palma. Die beiden bekommen einen Jungen, Alessio, und fünf Jahre später Maria Cristina. Als Teresa schwer an Krebs erkrankt, brennt ihr Mann mit einer französischen Dokumentarfilmerin durch, lässt die Familie sitzen und zieht nach Nepal. Maria Cristina ist zwölf, als Teresa stirbt. Acht Jahre später kommt Alessio bei einem Tauchunglück in Griechenland ums Leben. Eine Zeitlang bleibt die junge Frau, die ihre Sportkarriere verletzungsbedingt an den Nagel hängt und zur Mode wechselt, von Schicksalsschlägen verschont. Sie wird das offizielle Gesicht einer bekannten Unterwäschemarke. Mit siebenundzwanzig heiratet sie den zwanzig Jahre älteren Schriftsteller Andrea Cerri (laut Eingeweihten die einzige wahre Liebe ihres Lebens). Nach zwei Jahren Ehe kommt er bei einem Autounfall ums Leben, von dem sie partielle Verbrennungen davonträgt. Mit zweiunddreißig heiratet sie Domenico Mascagni, und im selben Jahr wird ein Mädchen geboren, Irene.
Weil aber dieses glückliche Ereignis nicht ausreicht, um ein von Unglücksfällen überschattetes Leben vergessen zu machen, verpasst man ihr den Spitznamen Maria Tristina.
Während die Blicke der Hoteliers noch immer an ihrem Hintern kleben, zieht Maria Cristina ihren Mann zur Fensterfront der Terrasse. Die Bodyguards schirmen sie ab, um sie vor der Neugier der Gäste zu schützen.
»Lass uns bitte kurz rausgehen …«, sagt sie und versucht die Fenstertür zu öffnen. »Du hast gesagt, die Party wäre lustig und es würde ein Feuerwerk geben.«
»Offenbar hat die Stadtverwaltung die Genehmigung verweigert.«
»Mir tut der Zeh weh. Ich will nach Hause.«
»Jetzt?«
»Ja. Jetzt.« Sie schmiegt sich an ihn und flüstert ihm ins Ohr. »Ich habe getrunken.«
Er sieht sie besorgt an. »Wie viel?«
»Ein bisschen. Ich hatte gehofft, das würde den Schmerz vertreiben.«
Maria Cristina ist nicht abstinent, hin und wieder gönnt sie sich ein Glas, aber nicht mehr, sonst wird sie betrunken. Gott hat sie reich mit Schönheit beschenkt, aber vergessen, sie mit Alkoholdehydrogenasen auszustatten, den Enzymen zum Alkoholabbau.
Domenico macht einem Bodyguard ein Zeichen, das Fenster zu öffnen, nimmt seine Frau beim Handgelenk und führt sie nach draußen.
Auf der Terrasse ist es kalt. Der Geruch des Nachmittagsregens hängt noch in der Luft, und durch den hauchzarten Stoff spürt Maria Cristina die prickelnde Kälte auf der Haut. Während sie mit unsicheren Schritten auf das Geländer zusteuert, schlüpft Domenico aus seinem Jackett und legt es ihr um die Schultern. Durch den Laubteppich auf dem Boden schimmern die türkisfarbenen Fliesen wie kleine Seen. Zusammengeschoben in einer Ecke stehen Tische, Stapel von Stühlen und eine Reihe Heizpilze aus Edelstahl, in dem sich die Lichter von Roma Nord spiegeln. Der Premier stellt sich neben seine Frau, sein hellblaues Hemd hat dunkle Flecken unter den Achseln. Sie versucht ihn zu umarmen, doch er streckt die Hand nach der Jacketttasche aus, kramt nach Zigaretten, rückt zwei Schritte von ihr ab und zündet sich eine an. »Warum?«, fragt er.
Maria Cristina bewegt ruckartig den Kopf, als wollte sie sich Heu aus dem Haar schütteln. »Warum was?«
»Warum hast du getrunken? Wäre ein Entzündungshemmer nicht besser gewesen?«
»Ich hab schon zwei genommen.« Sie wendet ihm den Rücken zu und starrt auf die Ruderkähne und den geschwollenen Tiber, der gegen die trostlosen Uferdämme drängt. Eine braune Brühe schiebt sich träge vorbei, in großen, glitzernden Wirbeln, die Äste, Plastiktüten und dunkle Klumpen Treibgut mit sich tragen.
»Hast du was gegessen?«
»Nur Salat. Das ist alles so fettig. Die frittieren sogar den Gorgonzola. Und fürs Protokoll, ich bin nicht betrunken, ich bin beschwipst. Am liebsten würde ich den Zeh ins kalte Wasser halten.«
Domenico tritt neben sie, nimmt einen langen Zug, die aufglimmende Glut wirft einen rötlichen Schimmer auf seine glänzende Stirn, wie Buschwerk überschatten die Brauen seine Augenhöhlen. Abwesend starrt er auf den Fluss, hält den Rauch zurück und denkt an Gott weiß was.
Maria Cristina ist das gewohnt. Seit er Premierminister wurde, ist das so.
Schon vorher haben sie sich nur selten gesehen, doch inzwischen sehen sie sich gar nicht mehr. Wenn er spät nach Hause kommt, liegt sie schon im Bett. Seit ein paar Wochen ist er noch schweigsamer und einsilbiger als sonst. Die Umfragen. Seit Amtsantritt waren die Beliebtheitswerte für seine Person und seine Regierung noch nie so schlecht. Aber vielleicht steckt noch mehr dahinter.
Tatsächlich ist Maria Cristina das ziemlich egal. Sie hasst Politik. Am Tag seiner Ernennung durch den Präsidenten der Republik hat sie Domenico nur um einen Gefallen gebeten, nämlich den, nicht mit ihr darüber zu diskutieren. Sie unterstützt ihn, wenn es nötig oder amüsant ist. Und heute Abend ist es weder nötig noch amüsant.
»Bleib noch ein bisschen«, sagt er und reißt sich aus seinen Gedanken. Er nimmt einen letzten Zug, drückt den Stummel unter einer Schuhsole aus, dreht sich um, um sicherzugehen, dass niemand ihn beobachtet, und schnipst ihn von der Terrasse.
Schnurrend wie ein Kätzchen reibt Maria Cristina ihre Nase an seinem Nacken, überrascht über die enthemmende Wirkung des Alkohols. »Ach komm, ich warte zu Hause auf dich.« Sie spürt, wie er sich verkrampft und die Muskeln anspannt, und weicht gekränkt zurück.
Domenico nimmt sein Jackett wieder an sich. »Nein. Die müssen uns noch mit der Geburtstagstorte fotografieren. Ich hab’s Brogi versprochen.«
Maria Cristina versucht es in ernsterem Ton. »Kannst du das nicht alleine machen?«
»Nein, er will ein Foto mit dir und seiner Frau.«
»Pff … Ich hasse dich.«
»Hör mal, jetzt suchst du dir ein ruhiges Eckchen, wir sagen Caterina, sie soll dir die Leute vom Hals halten, dann machen wir diese Fotos und gehen nach Hause«, sagt Domenico und wendet sich zum Gehen in Richtung Festsaal.
»Wie nervig.« Maria Cristina grätscht die Beine, stemmt die Füße auf den Boden, umklammert das Geländer, lehnt sich zurück und wirft mit leicht geöffneten Lippen den Kopf in den Nacken: Das glatte Haar fällt als seidig braune Kaskade herab, während sich der Ruderklub Aniene, der Nationalverband italienischer Hoteliers, die Artischocken nach jüdischer Art und Roms Norden um sie zu drehen beginnen.
Ja, sie ist betrunken.
Mit einem Mantel in der Hand taucht Caterina auf der Terrasse auf.
Die Frau des Premiers zu sein, hat unter anderem den Vorteil, dass man ihr einen Schutzengel zur Seite gestellt hat, ohne den sie nicht mehr auskommt. Caterina Gamberini aus Turin, dreißig Jahre, rote Krausmähne und ein von Sommersprossen gesprenkeltes Mondgesicht. Das einzige Problem an ihr: Sie zieht sich schlecht an. An diesem Abend trägt sie einen dunkelblauen Herrenanzug und eine weiße kragenlose Krankenschwesternbluse.
Maria Cristina klammert sich an sie. »Cate, umarme mich.«
Verdattert lässt sich die Assistentin von ihr drücken.
Normalerweise vermeidet Maria Cristina zwischenmenschliche Nähe, gibt nur selten die Hand und hält bei Wangenküssen einen Zentimeter Sicherheitsabstand, doch der Ribolla in ihren Adern hat ihre Abwehr eingerannt, und wie ein liebesbedürftiger Welpe sucht sie Körperkontakt, um sich einen Vorrat für nüchterne Zeiten anzulegen.
Caterina versucht, sie nach drinnen zu ziehen. »Na komm, hier draußen erfriert man ja.« Sie will ihr den Mantel überstreifen, doch Maria Cristina wehrt ab und kehrt schwankend in den Saal zurück.
Ein Praktikant mit kohlschwarzem Pony und kardinalrotem Rollkragenpulli fragt sie, ob sie irgendetwas brauche.
»Ein Glas Weißwein, Schätzchen«, antwortet Maria Cristina und hockt sich in eine dunkle Ecke, die Hände auf den Knien und sauer auf ihren Mann.
Der Praktikant reicht ihr den Wein.
»Danke.« Sie lächelt ihn an. »Ich habe vergessen, wie du heißt.«
»Maurilio.«
»Maurilio? Ungewöhnlicher Name. Wo kommt der her?« In einem Schluck leert sie das halbe Glas.
Der junge Mann klärt sie auf, der Name bedeute auf Griechisch dunkel und stamme aus dem römischen Mauretanien, dem heutigen Marokko.
»Aber du bist nicht dunkel. Du bist sogar ziemlich blass.«
»Ja, ich habe einen hellen Teint …«, sagt Maurilio und setzt hinzu: »Aber wer Serena heißt, ist ja auch nicht unbedingt heiter. Oder?«
»Und wer Lupo heißt, ist ja auch kein Wolf.« Maria Cristina verfällt in ein tiefes, männliches Lachen, das gar nicht zu ihr passt. Sie leert das Glas, fährt sich mit dem Handrücken über den Mund und mustert den Praktikanten. »Bringst du mir noch eins?«
Um sich die Beziehungen zwischen den Tierarten auf der Erde zu veranschaulichen, skizzierte der große englische Naturforscher Charles Darwin in seinen Aufzeichnungen einen Stammbaum. Ganz oben, auf dem höchsten Ast, erheben sich in all ihrer Überheblichkeit die menschlichen Wesen. Gleich darunter kommen die Affen, dann die anderen Säuger zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Seitlich, auf gesonderten Zweigen, sitzen Vögel, Reptilien und Amphibien. So geht es immer weiter abwärts bis zu den primitivsten Organismen. Unterhalb des Stammes, zwischen den bis zu den Anfängen des Lebens hinabreichenden Wurzeln, finden sich die Schwämme. Diese Meereslebewesen führen ein recht langweiliges Dasein. An die Klippen geklammert, bringen sie ihre Zeit damit zu, auf der Suche nach Nährstoffen und Sauerstoff das Wasser zu filtern. Ähnlich wie ihre Cousinen, die Pfahlmuscheln, doch im Gegensatz zu ihnen denken sie nicht darüber nach, weil sie kein Nervensystem haben. Der wahre Triumph der Schwämme kommt nach ihrem Tod. Ihre elastischen, saugstarken Skelette haben den Menschen jahrhundertelang bei der Körperpflege und der Reinigung des Geschirrs geholfen. Zu ihrem Glück oder Unglück sind sie mit dem Aufkommen synthetischer Materialien in Vergessenheit geraten. Heute steht ihr Name für ein Stück Schaumstoff.
Die in einem scharlachroten Samtsessel gestrandete Maria Cristina ist die Evolutionsstufen bis weit unter die Wirbel- und Weichtiere hinuntergepurzelt, dorthin, wo keine kognitiven Fähigkeiten mehr vorhanden sind, und hat sich in einen alkoholtriefenden Schwamm verwandelt. Stumpfsinnig starrt sie auf das Ölgemälde einer Fuchsjagd und atmet die verbrauchte Luft, die nach Bratenfett und Schweinefleisch sauer-scharf riecht.
Jenseits eines Schutzwalls aus Sofas wimmelt das von Caterina angewiesene Team Leute ab, die ein Selfie mit dem #exmodel, der #fraudespremiers, dem #schönenmiststück posten wollen. Die Stimmen der Gäste wabern in Wellen heran, überlagern und vermischen sich zu einem übelkeitserregenden Allerlei. Die einzige Stimme, die deutlich daraus hervorklingt, ist das grelle Organ ihrer Assistentin. »Sie kann jetzt nicht. Sie ist müde. Sagen Sie mir einfach, wie Sie heißen … geben Sie mir Ihre E-Mail. Nein … Nicht doch … Ich muss mich entschuldigen.«
In einem dieser alkoholischen Geistesblitze, in denen uns ebenso erschütternde wie flüchtige Wahrheiten aufgehen, wird Maria Cristina klar, dass sie die Turiner Bulldogge, die sie gerade vor den Fieslingen verteidigt, wahnsinnig gernhat. Sie sollte ihr etwas schenken. Eine schöne Reise an einen exotischen Ort, an dem sie sich erholen kann. Mit wem? Sie weiß nicht einmal, ob sie einen Freund hat. Aber wie sollte sie, schließlich tut sie nichts anderes, als das Leben ihrer Chefin zu organisieren und ihr zu erklären, was sie zu tun hat, für sie gibt es weder Sonntage noch Weihnachten oder Ostern. Und erst die Jungs vom Begleitschutz! Die Praktikanten! Marina, Domenicos Sekretärin! Sie zerfließt vor Dankbarkeit für diese wunderbaren Menschen, die sich um sie kümmern. Es wäre schön, sie und ihre Familien zu einem Picknick auf dem Land einzuladen. Am Ostermontag. Aber wer weiß, ob Domenico am Ostermontag noch Premierminister ist.
»Entschuldigen Sie … Entschuldigung … Wo wollen Sie hin? Ich habe Nein gesagt!« Caterinas Rufe holen sie in die Wirklichkeit zurück. Die Assistentin wirft sich einer untersetzten Inderin in den Weg, die es geschafft hat, den Schutzwall zu durchbrechen.
Maria Cristina betrachtet den Schuh, in dem ihr Zeh gefangen ist. Wie gern würde sie ihn befreien. Außerdem muss sie dringend pinkeln. Doch irgendetwas geht vor sich. Das Licht im Saal wurde gedimmt und der Pianist durch einen angegrauten DJ ersetzt, der mit der unvermeidlichen Achtziger-Leier losgelegt hat.
Die Gelegenheit, um aufs Klo zu rennen. Sie steht auf, streicht klammheimlich an der Wand entlang und stiehlt sich von Caterina, den Sicherheitsleuten und der Schar von Bewunderern weg. Mit gesenktem Kopf wischt sie am DJ-Pult vorbei, wo derweil die Hoteliers auf der Tanzfläche ausflippen: Die Frauen in der Mitte, die Männer drum herum, gereckte Fäuste und Pirouetten vor einem Boxenturm, aus dem Howard Jones’ Frage schallt, was Liebe sei.
Vor der Tür zum Flur steht ein Wachmann und telefoniert. »Wie war das jetzt, sind die Dim Sum gebraten oder gedämpft? Perfekt. Dann sechs. Die mit Gemüse. Und Krabbenchips, wenn die nicht so oll sind wie letztes Mal …«
Maria Cristina nickt ihm einverständig zu, und er hebt die Hand. Sie durchquert den langen, schummrigen Flur, ihre Absätze klappern über die glänzenden Marmorfliesen, Farbton feuchter Sand. An den Wänden hängen von kleinen Votivbirnen angestrahlte Schwarzweißfotografien von Ruderern, die neben ihren Kähnen posieren. In einer Vitrine reihen sich Pokale, Medaillen, kleine Bronzestatuen aneinander.
Drei Gäste, zwei Männer und eine Frau, mit hochgeschlagenen Mantelkrägen und der kernigen Entschlossenheit von Leuten, die draußen in der Kälte eine rauchen waren, mustern sie. Sie deutet ein Lächeln an.
»Signora Palma, dürfen wir ein Foto mit Ihnen machen?«, fragt ein magerer Typ mit einem Wust grauer Haare, die ihm anarchisch vom Kopf abstehen.
Sie hofft auf sein Mitgefühl. »Ich muss auf die Toilette …«
»Nur ganz kurz. Wir beeilen uns.« Der Typ zückt das Handy, alle drei schmeißen sich an sie heran. Während sich die Schnappschusssalve entlädt, steht Maria Cristina stocksteif und mit einem Lächeln da, das sie seit ihrem Eintreffen nicht loswird. Schließlich kann sie sich losmachen und findet die Klos. Männer links. Frauen rechts. Sie stößt die schwere Mahagonitür auf, die das Fest beim Zugleiten mit einem Luftsog verschluckt und durch das Plätschern einer defekten Toilettenspülung ersetzt. Triumphierend ballt sie die Faust.
Die Toilette ist geräumig und sauber und duftet nach Lavendel. Fast hätte man Lust, hier zu überwintern. Der Spiegel über der schwarzen Marmorfläche mit den eingelassenen Waschbecken und den goldenen Wasserhähnen wirft das Bild dreier dunkler Toilettenkabinen zurück. Sie öffnet die erste und schließt sich darin ein. Auch die Klobrille ist makellos. Achtlos rafft sie den Rock hoch und setzt sich. Der Wein hat sie kein bisschen fröhlich gemacht, da ist nur eine an Schwermut grenzende Mattigkeit. Ihr Kopf fühlt sich an wie Granit, und kaum schließt sie die Augen, dreht sich wieder alles. Der Urinstrahl gesellt sich zum Plätschern der Spülung. Sie zieht den Schuh aus. Um sich besser zu fühlen, müsste sie sich zwei Finger in den Hals stecken und den im Wein schwimmenden Fenchel-Orangen-Salat loswerden.
»Hier ist sie nicht«, ertönt eine jugendliche Stimme im Toilettenvorraum.
»Sie ist verschwunden, kannst du’s fassen? Ohne mir was zu sagen. Und ich stehe da wie blöd.« Die zweite Stimme gehört Caterina. Sie erkennt den piemontesischen Einschlag.
»Sie kann doch nicht einfach gegangen sein, oder?«
»Ach, was. Sie wird schon irgendwo sein. Sie ist betrunken.«
Eine der beiden dreht einen Wasserhahn auf.
»Also jetzt sag noch mal … Wie machst du deine Pizza?«, fragt die jugendliche Stimme.
»Mit Bierhefe und Mehlsorten für lange Gehzeiten.«
»Und wie lange lässt du den Teig gehen?«
Das muss eine Praktikantin sein.
»Mindestens achtundvierzig Stunden. Manchmal auch achtundsechzig.«
»Drei Tage?«
»Klar! Meine Marinara ist der Hammer.«
Beim Gedanken an Knoblauch verzieht Maria Cristina angewidert das Gesicht. Sie hatte keine Ahnung, dass Caterina auch Pizza backen kann. Vielleicht sollte sie ihr einen kleinen Backofen schenken.
»Die musst du mich mal probieren lassen.«
»Sicher. Aber dafür kriege ich einen Kuss von dir.«
Wie ein kleines Mädchen reißt Maria Cristina den Mund auf und schlägt die Hand davor.
»Wann?«
»Jetzt. Nicht erst, wenn ich dir die Pizza mache.«
Man hört Schmatzgeräusche, dann das Saugen von Lippen.
Neiiin, Caterina Gamberini ist lesbisch. Wer hätte das geahnt? Maria Cristina schlüpft wieder in den Schuh, glättet sich den Rock, stützt sich halb gebückt an den Wänden ab und klettert auf die Kloschüssel. Weil sie nichts sehen kann, stellt sie sich auf Zehenspitzen: Ein gleißender Schmerz fährt ihr vom großen Zeh bis in die Wade und lässt sie fast ohnmächtig werden. Sie verbeißt sich einen Schrei, kauert sich wieder auf die Kloschüssel und wartet mit ersticktem Atem, dass der Schmerz nachlässt.
»Gehen wir sie suchen«, sagt die unbekannte Stimme.
»Ja. Ich muss mich nur schnell wieder in Ordnung bringen, ich sehe aus wie eine Irre«, antwortet Caterina.
»Durfte sie schon mal bei dir kosten?«
»Waaas?«
Die andere prustet los. »Die Pizza, blöde Kuh. Was dachtest du denn?«
»Quatsch. Die hat sämtliche Kohlehydrate aus dem Haus verbannt. Nur Gemüse und Tee. Wenn die ein Stück Brot sieht, dreht die durch. Ich glaube, die hat in ihrem ganzen Leben noch keine Pizza gegessen.«
»Ihr Leben ist scheiße, willst du damit sagen.«
»So scheiße, wie ein Leben sein kann, wenn man alles hat und die Natur einen mit diesem Aussehen beschenkt hat.«
»Und dann macht ihr Mann so was … Weiß sie davon?«
»Ich glaube schon. Aber sie würde es niemals zugeben.«
»Und was ist mit ihr?«
»Ach, Quatsch. Die ist immer allein. Sieht niemanden. Ihr bester Freund ist so ein unsägliches Faktotum, das in der Wohnung herumgeistert. Ehrlich gesagt, tut sie mir leid. Sie ist kein Arsch. Aber ist schon übel, wenn man so gar nichts mitkriegt. Sie ist so unfähig, so unbedarft …« Sie hält kurz inne, um ein passenderes Adjektiv zu finden. »Sie ist oberflächlich.«
»Oberflächlich?«
»Ja. Aber jetzt lass uns gehen.«
Die beiden verlassen die Toilette, und Maria Cristina bleibt mit ihrem Fuß in den Händen zurück.
Fünf Minuten später kommt Maria Cristina aus der Klokabine, in der sie nicht aufhören konnte zu heulen, ihr Lippenstift ist verschmiert und die Schminke zerlaufen, sie spritzt sich Wasser in die geröteten Augen und bringt ihr Haar so gut es geht in Ordnung.
Die Toilettentür fliegt auf, und die Inderin kommt herein, die vorhin im Saal versucht hat, zu ihr durchzudringen. Sie trägt einen gewickelten Sari aus smaragdgrüner Seide und darunter ein gelbes T-Shirt. Von ihrer Schulter baumelt an einer klobigen goldfarbenen Kette eine Bottega-Veneta-Tasche. Auf dem Kopf thront ein Panettone aus schillernden Haaren. Sie ist undefinierbaren Alters und sehr klein.
»Signora Palma. Es ist mir eine Ehre, Sie zu treffen. Ich heiße Stefania Subramaniam. Ich habe vorhin versucht, Ihnen Hallo zu sagen, aber man hat mich nicht durchgelassen.« Sie hat die zerdehnte Sprechweise der südlichen Stadtteile.
Maria Cristina stammelt etwas, ihr sitzt ein Kloß im Hals.
Das Weiblein kommt auf sie zu. »Färben Sie sich die Haare?«
Die Frage ist so direkt und unpassend, dass Maria Cristina nickt.
»Die machen einen lausigen Job!« die Inderin setzt sich eine rotgerahmte Brille auf und begutachtet mit wachem Blick ihre Strähnen. »Welche Farbe benutzen Sie?«
Genau das passiert, wenn man sich nicht von der Security begleiten lässt. Zuerst findet man heraus, dass man seiner Assistentin leidtut, und dann wird man auf dem Klo von einer Verrückten abgemurkst, die einem womöglich die klotzige Kette ihrer Handtasche um den Hals wickelt.
»Keine Ahnung … Die sucht der Friseur aus.« Sie weicht zurück Richtung Tür.
Die Inderin wackelt mit ihrem kleinen, dicken Zeigefinger. »Das ist ein Fehler.«
Maria Cristina ballt die Hände. »Was denn?«
»In den Haaren sammeln sich Toxine, Giftstoffe aus der Luft, chemische Substanzen, die sie auf die Felder spritzen. Sie sind die schönste Frau der Welt, Sie müssen Ihre Haare pfleglich behandeln.« Sie hat den gütigen Ton einer Mutter. »Wie ich sehe, sind sie ein bisschen herausgewachsen.«
Maria Cristina tritt an den Spiegel. Eine hauchdünne, kaum sichtbare silberne Linie säumt den Haaransatz an ihren Schläfen. Wenn sie etwas aus der Haut fahren lässt, dann ist es der Ansatz, eine unverzeihliche Schlampigkeit. »Gütiger Himmel, wie grauenhaft. Morgen gehe ich zum Färben, ich schwör’s bei Gott. Zum Glück ist es dunkel, hoffentlich sieht’s keiner.«
»Sie werden es sehen.« Die Inderin hat nicht einen Funken Mitleid. Sie öffnet ihre Tasche und steckt eine Hand hinein. »Und sie werden sagen, dass Sie sich vernachlässigen.«
Maria Cristina schließt die Augen, jetzt erschießt sie sie, ganz bestimmt, doch als sie sie wieder öffnet, hält die Frau ein Mascarabürstchen wie einen Zauberstab in die Höhe. »Darf ich? Ich lasse das Grau in einer Sekunde verschwinden.«
Maria Cristina überlegt kurz. »Na schön.«
»Aber nicht hier.« Die Inderin deutet zu den Toilettenkabinen. »Was, wenn jemand reinkommt und uns sieht.«
»Stimmt.«
Plötzlich zu Komplizinnen geworden, schließen sich die beiden in einer Kabine ein. Doch es gibt ein Größenproblem. Entweder muss sich Maria Cristina hinunterbeugen oder die andere auf die Kloschüssel steigen. Schließlich geht die Frau des Premiers, leicht angeekelt vom Kontakt mit dem Boden, auf die Knie. Jetzt, auf gleicher Höhe, fällt ihr auf, dass die Frau die runden, gelblich geränderten Augen eines Nachtvogels hat, viel zu groß für das Gesicht. Die Pupillen, schwarz wie Turmaline, strahlen die uralte Seligkeit eines Gurus aus. Sie erinnert sie an Amma, die berühmte Heilsbringerin, die ihre Anhänger umarmt. Jedes Jahr pilgern Tausende Menschen aus aller Welt nach Indien, um sich vom Liebesstrom, den Amma über die Bedürftigen ausgießt, mitreißen zu lassen. Auch Maria Cristina ist bis nach Chennai gereist, um sich nach Andreas Tod von der Heiligen umarmen zu lassen.
»Heb das Kinn«, sagt Stefania Subramaniam, und als hätte jemand den Stöpsel gezogen, schluchzt Maria Cristina mit zusammengepressten Lippen los. »Was hast du, Schätzchen?«, fragt die Inderin.
Maria Cristina schüttelt den Kopf. »Nichts.«
Die Inderin streichelt ihr die Stirn. »Und warum weinst du dann?«
Sie senkt den Kopf und zieht die Nase hoch. »Weil ich meiner Assistentin leidtue, sie findet mich oberflächlich. Und ich glaube, mein Mann betrügt mich mit der Staatssekretärin für Öffentliche Verwaltung.«
»Schließ die Augen.«
Maria Cristina gehorcht und spürt die Spitze des Bürstchens an ihrem Haaransatz. »Jetzt kümmern wir uns um Lippenstift und Make-up und machen dir das Haar zurecht«, tröstet Stefania Subramaniam sie und holt ein Necessaire mit allem Nötigen heraus. »Na bitte. Perfekt. Männer und Assistentinnen haben keine Ahnung.«
Maria Cristina umarmt sie, das Herz voller Dankbarkeit. Sie steht auf und zieht sich das Kleid zurecht.
Die Inderin holt ein Gläschen mit einer zähen, dunklen Flüssigkeit aus der Tasche. »Das ist ein natürliches Färbemittel, da ist nichts Giftiges drin. Ich habe es selbst gemacht. Verwende es sparsam.« Sie reicht es ihr. »Ich habe einen Friseursalon in der Via di Casal Bertone. Wenn du mal vorbeikommen willst …«
Die Frau des Premiers legt sich die Hand aufs Herz. »Ich versuch’s. Versprochen. Danke, danke, danke.« Und ganz gegen ihre Gewohnheiten drückt sie ihr zwei Küsse auf die Wangen.
Mit dem Gläschen Färbemittel in der Hand macht sich Maria Cristina auf den Rückweg zum Saal, der vor Musik und Lichtern pulsiert.
Plötzlich ertönt hinter ihr eine Stimme.
»Bohnenstange. Bohnenstange. He, Bohnenstange, bleib stehen.«
Sie dreht sich um, ein Mann kommt auf sie zu.
»Warte.«
Sie deutet auf sich. »Reden Sie mit mir?«
»Mit wem sonst? Es gibt nur eine Bohnenstange. Ich weiß, dass du jetzt berühmt bist, aber für mich bleibst du die alte Bohnenstange.«
Das muss einer vom Chateaubriand sein, da hatte sie diesen Spitznamen weg, weil sie die Längste und Dünnste vom ganzen Gymnasium war, und ehrlich gesagt war ihr das nicht unlieb. In Rom wird jeder so angequatscht, auch wenn man gar nicht dünn oder sogar fett ist: Bohnenstange, haste mal ’ne Kippe?
Die Jahre an der Oberschule, die Piazza Euclide, der Circeo, das Eisessen im Park der Villa Balestra, die zickigen Freundinnen, die stinkreichen Sackgesichter, die sie in ihren Porsches herumkutschierten, all das ist unmerklich mit der Zeit verblasst. Doch so sehr man die Vergangenheit auch vergisst, vergisst sie einen bekanntlich nie. Ihre alten Mitschüler sind die reinste Plage, wie Pilze sprießen sie aus dem Boden und beklagen sich allesamt, sie jetzt, da sie berühmt sei, nicht mehr mit dem Arsch anzugucken.
Aber bitte nicht jetzt, sie hat keine Lust, sich alte Kamellen über Skiwochen und Schulverweise anzuhören und so zu tun, als würde sie sich erinnern, sie will nur nach Hause.
Unterdessen hat der Typ sie eingeholt. Sie mustert ihn genauer. Völlige Leere. Sie trifft so unendlich viele Menschen, dass ihr Hirn aus Platzgründen eine wöchentliche Säuberung durchführt.
Aber irgendetwas …
Übrigens, und das ist ungewöhnlich, überragt er sie, er hat die Statur eines Volleyballspielers. Geheimratsecken stehlen sich ins aschfarbene Haar, das ihm fast bis zu den Schultern reicht und erkennen lässt, dass er sich mit dem Älterwerden schwertut. Besonders faszinierend ist die weiße Tolle, die ein Auge verdeckt und ihm etwas Finsteres à la Captain Harlock verleiht. Er hat ein spitzes Kinn und einen etwas ungepflegten Bart, dessen strohblonde Stoppeln neben dem vollen, etwas blassen Mund teilweise ins Graue übergehen. Er trägt ein verwaschenes hellblaues Leinenhemd und eine blau-weiß gestreifte Strickkrawatte, die lose unter dem aufgeknöpften Kragen baumelt. Das dunkelblaue Jackett aus grober Baumwolle vervollständigt das Bild des Junggebliebenen, der das Leben nicht allzu ernst nimmt. Pi mal Daumen ist er um die Fünfzig. Alles in allem ein hübscher Kerl. Noch immer wiegt er ungläubig den Kopf, als wären sie zwei Freunde, die sich nach Jahren am Flughafen wiederbegegnen.
»Ich will ehrlich sein«, sagt Maria Cristina. »Mein Gedächtnis ist nicht besonders gut, und außerdem habe ich getrunken, also nimm’s mir nicht übel, aber ich erinnere mich nicht an dich. Tut mir leid. Ich habe keine Ahnung, wer zum Scheißdreck du bist.«
Hat sie wirklich Scheißdreck gesagt?
Er prustet los. »Ich wusste es, du hast dich kein bisschen verändert. Pass auf, ich gebe dir ein paar Tipps.«
»Nein. Verschone mich. Keine Tipps. Es war ein anstrengender Tag. Ich muss zu meinem Mann, um mit der Frau des Oberhoteliers die Torte anzuschneiden. Entschuldige. Das nächste Mal.« Sie wendet sich zum Gehen und fühlt sich schäbig, aber im Recht, zwei Gefühle, mit deren Gleichzeitigkeit sie zu leben gelernt hat, seit sie sich in der Welt der Politik bewegt.
»Nasquira.«
Maria Cristina zögert.
»Nasquira.«
Sie bleibt stehen.
»Nasquira. Du erinnerst dich, stimmt’s?«
Laut einigen Studien zeichnet das Gedächtnis unser Leben auf zwei verschiedenen Bändern auf. Das erste ist für das Kurzzeitgedächtnis zuständig und merkt sich Dinge, die uns helfen, uns in der Gegenwart zurechtzufinden (wo sind die Schlüssel, in welcher Schublade liegt das Aspirin, welche Hausnummer hat der Zahnarzt), und vergeht, wie es entstanden ist. Das zweite, das für das Langzeitgedächtnis, verwahrt die tiefgreifenden, wesentlichen Dinge, die uns berühren, uns zu Individuen machen und mit Gefühlen verknüpft sind: das freudige Schwanzwedeln unseres Hundes, der Tod eines geliebten Menschen. Diese beiden Erinnerungskategorien werden in unterschiedlichen Teilen unseres Gehirns verarbeitet. Im Hippocampus speichern wir Passwörter, in der Hirnrinde prägen wir uns den ersten Kuss ein.
Der Name Nasquira hat sich in Maria Cristina Palmas Hirnrinde eingebrannt. Es ist der Name einer Swan 60, einer wunderschönen Segeljacht, auf der sie mit ihrem Bruder kurz vor seinem Tod unterwegs war.
Jetzt weiß sie, wer der Typ ist.
»Nicola Sarti«, sagt sie und dreht sich um.
»Ciao, Bohnenstange.«
Im letzten Sommer seines Lebens hatte Alessio Maria Cristina auf einen Segeltörn mit seinen Freunden mitgenommen. Acht ältere, göttergleich schöne Jungs mit Segelfimmel. Keine Mädchen, lautete der Pakt. Abgeschleppt wird unterwegs. Einzige Ausnahme: die von allen verteidigte und umworbene Bohnenstange.
Nach drei Wochen war sie in Lipari von Bord gegangen, um nach Courmayeur zu den Großeltern zu fahren. Die anderen hatten ihre Fahrt über die Ägäis fortgesetzt, wo ihr Bruder beim Gerätetauchen ums Leben kam.
»Oh Gott, wie schön, dich zu sehen«, sagt sie gerührt. »Wie geht es dir?«
Ausgerechnet während dieser Ferien hatte sie ein kurzes Abenteuer mit Nicola Sarti, doch nach der Tragödie hatte sie ihn aus den Augen verloren.
Er tritt dicht an sie heran und raunt: »Jetzt sehr gut.«
Maria Cristina umarmt ihn und schließt die Augen. Es ist, als würde ein Kraftfeld sie umschließen und das Fest, die Menschen, die Geräusche mit einem Schlag verschwinden lassen. »Verzeih, aber nach Alessios Tod wollte ich seine Freunde nicht mehr sehen, es ging mir zu dreckig.«
Er drückt sie fest und lange an sich, mit der Innigkeit eines nahestehenden Menschen. »Das verstehe ich. Ist doch klar.«
»Es tut gut, dich zu sehen, Nicola.«
»Und mir erst.«
Durch den Wein, den sie intus hat, traut sie sich zu fragen: »Warst du auf dem Boot, als Alessio …?«
Nicola Sarti drückt sie weiter an sich. »Ja.«
Maria Cristina seufzt. »Ich war nicht bei der Beerdigung. Mein Großvater …«
»Schon gut. Lass uns das Schöne in Erinnerung behalten und daran denken, wie lustig wir es bis dahin hatten.«
Maria Cristina macht sich los und streicht sich das Haar zurecht. »Stimmt. Weißt du, dass ich dich total heiß fand?«
»Wem sagst du das. Ich war schwer verknallt. War nicht leicht, dich zu vergessen.«
Sie versucht heiter zu klingen. »Ich hatte vom ersten Tag an ein Auge auf dich geworfen.«
Das stimmt nicht. Gian Marco Meroldi hat ihr besser gefallen, aber kaum waren sie in Panarea an Land gegangen, hatte sich der Arsch eine kleine Schwedin geangelt. Inzwischen ist Meroldi ein Fettsack in der Vorstandsetage der RAI und Nicola Sarti ein geiler Typ. Manchmal ist das Leben gerecht.
Er macht einen Schritt zurück und sieht sie bewundernd an. »Und jetzt? Schau dich an!«
Maria Cristina hebt die Arme und vollführt eine halbe Drehung. »Frau des Premierministers. Hättest du das gedacht?«
»Nein. Wenn ich mir überlege, wie du warst.«
Sie hebt eine Augenbraue. »Wie war ich denn?«
»Na ja, durchgeknallt.«
Maria Cristina macht ein verständnisloses Gesicht. »Wir waren alle durchgeknallt. Und jung. Was treibst du eigentlich hier?«
»Ich habe eine 5-Sterne-Hotelkette. Auf Sardinien und im Trentino. Gerade bin ich dabei, ein Resort aufzumachen, Le Cupole, in der Nähe von Pomezia. Spa. Gourmetessen. Alles, was gerade angesagt ist.«
Schweigend sehen sie einander an, in Gedanken bei der Segelreise. Maria Cristina kommen die sternklaren Nächte an Deck in den Sinn, das Schleppnetzfischen, die Vulkanbesteigung auf Stromboli.
Die Musik im Saal verebbt, die Lichter gehen wieder an und brechen den Zauber.
»Wir müssen uns sehen«, sagt sie kurzerhand.
»Wann immer du willst.« Nicola Sarti zeigt auf das Schraubglas in Maria Cristinas Hand. »Was ist das? Brombeermarmelade?«
Sie prustet los. »Nein, Haarfärbemittel. Das hat mir so eine Art Guru-Friseurin geschenkt.«
»Da, dein Lachen. Genau wie früher.«
Eine Stimme am Mikrofon bittet um Aufmerksamkeit. Die Torte kommt.
»Entschuldige, ich muss los, ich bin dran …«
Er zuckt die Achseln. »Na los. Geh ruhig. Ist schon okay. Aber wenn du kannst, komm in mein Resort … auch mit deinem Mann. Versprich es mir.«
»Mit meinem Mann dürfte es schwierig werden. Aber ich komme ganz bestimmt.« Jetzt sollte sie ihm ihre Nummer geben, doch so einfach ist das nicht, zuerst muss sie die Security informieren.
So ein Mist. Das war’s dann wohl.
Unsicher, wie sie sich verhalten soll, küsst sie ihn nicht, sondern drückt ihm die Hand, während Caterina angehastet kommt, um sie zu Igor Rossi Brogi zu zerren, der gerade seine siebzig beschissenen Kerzen ausbläst.
3.
Es nahm kein Ende. Aber jetzt sitzt Maria Cristina im Auto nach Hause. Sie fühlt sich eklig. Die Sahne und das Baiser der Torte gären im Wein. Sie würde gern wegdämmern, doch kaum schließt sie die Augen, stürzt sie in einen Strudel. Die Straßenbeleuchtung der Via Olimpica malt gelbe Striemen auf die regenverschlierten Fenster. Sie zieht sich den Schuh aus und massiert ihren Fuß, während der Fahrer in raschem Tempo den roten Rücklichtern des Begleitschutzes folgt.
Domenico, die Kopfstütze im Nacken, ist eingedöst. Es ist nicht zu ertragen, er kann überall schlafen, ihm reichen ein paar Minuten, und schon ist er wieder frisch. Einmal, während des G8-Gipfels, war er plötzlich verschwunden. Helle Panik. Die Leiter des Sicherheitsdienstes in Alarmbereitschaft. Schließlich fand man ihn in einer Abstellkammer, schnarchend auf einem Stuhl. Maria Cristina braucht zum Einschlafen Ohrstöpsel und eine Augenmaske, muss die Fensterläden schließen und sich die Zunge mit Benzodiazepinen betäuben.
»Tut’s weh?«, fragt er.
»Ein bisschen. Aber du hattest recht, ich habe mich amüsiert.« Die Episode mit Caterina auf dem Klo lässt sie aus. »Zuerst habe ich eine Art indischen Guru getroffen … Nein, eigentlich war sie eine Friseurin aus Casal Bertone, die mir den Haaransatz kaschiert hat. Und dann Nicola, den ich seit dem Segeltörn mit Alessio nicht mehr gesehen hatte. Nicola Sarti. Kennst du ihn?«
Teilnahmslos hebt Domenico ein Augenlid. »Nie gehört.«
»Er hat eine Hotelkette. Ich hatte ihn total vergessen, dabei hatte ich sogar was mit ihm. Ich glaube, mit meinem Gedächtnis ist wirklich was nicht in Ordnung.«
Spöttisch schüttelt er den Kopf. »Das liegt nicht am Gedächtnis, sondern daran, dass du mit zu vielen Typen was hattest.«
Sie versetzt ihm einen kleinen Tritt gegen das Schienbein. »Blödmann. Er ist nett. Alessio hatte mir gesteckt, dass er auf mich steht.«
»War er denn nicht eifersüchtig? Du warst seine kleine Schwester.«