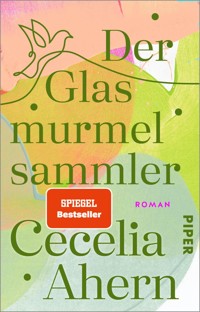9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie immer schafft es Cecelia Ahern mit ihrer Geschichte mitten ins Herz zu treffen Nach dem Tod des Vaters ändert sich Tamaras Leben komplett, und sie muss zu merkwürdigen Verwandten aufs Land ziehen. Ihre Mutter ist vor Trauer kaum ansprechbar, und Tamara fühlt sich völlig alleingelassen an diesem abgelegenen Ort. Nur ein Bücherbus und der charmante Fahrer Marcus sorgen hin und wieder für etwas Abwechslung. Dort findet Tamara ein seltsames Buch in einem Ledereinband: ein Tagebuch, in dem ihr eigenes Leben aufgeschrieben ist. Und zwar immer der nächste Tag! Es führt Tamara zu den verborgenen Geheimnissen ihrer Familie und hilft ihr, den Weg zur Liebe und Zukunft zu finden. »In diesem modernen Märchen wechseln realistische Momente mit magischen, lustige mit traurigen ab – alle gespickt mit Denkanstößen für das eigene Leben.« freundin »Eine wunderschöne Geschichte!« Welt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Ich schreib dir morgen wieder« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© 2009 Greenlight Go Limited Company
Titel der englischen Originalausgabe:
»The Book of Tomorrow«, Harper Collins, London 2009
© der deutschsprachigen Ausgabe:
Piper Verlag GmbH, München 2023
© für die deutsche Übersetzung von Christine Strüh:
S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2011
Die Übersetzung erschien erstmals 2011 im Krüger Verlag, einem Verlag der S. Fischer Verlag GmbH
Covergestaltung: FAVORITBUERO
Covermotiv: Claire Desjardins
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence, München mit abavo vlow, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem E-Book hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen und übernimmt dafür keine Haftung. Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
1
Knospenfeld
2
Zwei Fliegen
3
Der Neuanfang fängt an
4
Der Elefant im Zimmer
5
Grève
6
Der Bücherbus
7
Ich will
8
Der geheime Garten
9
Ein langer Abschied
10
Die Himmelsleiter
11
Wo Rauch ist …
12
Das Menetekel
13
Spektakel im Schloss
14
Ein Uhr
15
Dinge in der Speisekammer
16
Totale Abstraktion
17
Besessen
18
Ruhe in Frieden
19
Fegefeuer
20
Die Hausfrau, die Speisekammer und das Kakaopulver
21
K steht für … Känguru
22
Dunkelkammer
23
Brotkrumen
24
Träume von toten Menschen
25
Das kleine Mädchen
26
Was wir heute gelernt haben
Dank
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
1
Knospenfeld
Von einer Geschichte geht bei jedem Erzählen etwas verloren, sagt man. Wenn das stimmt, ist meine Geschichte noch vollständig, denn ich erzähle sie zum ersten Mal.
Bestimmt werden manche Leute skeptisch reagieren, und wenn ich nicht alles selbst erlebt hätte, würde es mir vermutlich genauso gehen.
Viele jedoch werden kein Problem damit haben, meine Geschichte zu glauben, und zwar aus dem einfachen Grund, weil sich ihr Bewusstsein irgendwann geöffnet hat, weil sie im wahrsten Sinn des Wortes aufgeschlossen sind, so, als hätte ein Schlüssel etwas in ihnen aufgesperrt – wobei der Schlüssel alles sein kann, was den Betreffenden dazu bringt, an etwas zu glauben. Entweder sind diese Menschen schon so geboren, oder sie wurden als Babys, solange das Bewusstsein noch einer Knospe ähnelt, so umsorgt, dass die Blüte sich langsam öffnen und Schritt für Schritt darauf vorbereiten konnte, sich irgendwann an der Essenz des Lebens selbst zu nähren. Solche Menschen wachsen, ganz gleich, ob das Schicksal ihnen Sonnenschein oder Regen beschert, sie wachsen und gedeihen, sie entwickeln sich, und ihr Bewusstsein ist so weit und frei, dass sie achtsam und aufnahmebereit durchs Leben gehen, das Licht im Dunkeln sehen, die verborgenen Chancen in jeder Sackgasse erkennen, den Erfolg schmecken in dem, was andere für Versagen halten, und hinterfragen, was andere als unabänderlich hinnehmen. Sie sind weniger abgestumpft, weniger zynisch als die Mehrheit. Nicht so leicht bereit, die Flinte ins Korn zu werfen. Bei manchen Menschen öffnet sich das Bewusstsein auch erst später im Leben, durch eine Tragödie oder ein großes Glück, denn beides kann als Schlüssel wirken, der die bis dahin fest verschlossene Alleswisserkiste aufschließt. Dann springt der Deckel auf, das Unbekannte wird akzeptiert, sture Logik und Scheuklappendenken werden über Bord geworfen.
Doch dann gibt es auch diejenigen, deren Bewusstsein wie ein Büschel von Halmen ist, die zwar Knospen treiben, wenn der Mensch etwas Neues lernt – eine Knospe für jede neue Information –, aber diese Knospen öffnen sich nicht, sie blühen niemals auf. Solche Menschen kennen Großbuchstaben und Punkte, aber keine Fragezeichen und keine Leerstellen …
Zu diesen Menschen gehörten auch meine Eltern. Zu denen, die immer alles wissen. Zu der Art, die gern Sprüche von sich geben wie: »Das hab ich ja noch nie gehört, wie kommst du denn darauf? Dafür gibt’s keinerlei Beweise, also mach dich nicht lächerlich.« Auch mal um die Ecke zu denken, kam für sie nicht infrage, und sie hatten den Kopf zwar voller bunter, hübsch gepflegter und auch wohlriechender Knospen, aber sie gingen nicht auf, sodass sie leicht und anmutig im Wind tanzen konnten, sondern verharrten aufrecht, stocksteif und nüchtern – und blieben Knospen bis zum Tag ihres Todes.
Na ja, meine Mutter ist ja eigentlich gar nicht tot.
Noch nicht. Nicht im medizinischen Sinn zumindest, aber obwohl sie nicht tot ist – lebendig ist sie ganz sicher auch nicht. Sie ähnelt eher einer wandelnden Leiche, die hin und wieder einen Laut von sich gibt, als wollte sie überprüfen, ob sie noch lebt. Aus der Ferne denkt man, alles ist in Ordnung mit ihr. Aber von Nahem sieht man, dass ihr grellrosa Lippenstift verwischt ist und ihre Augen müde und seelenlos in die Gegend starren – ein bisschen wie diese TV-Kulissenhäuser auf dem Studiogelände, nur Fassade, nichts dahinter. So wandert sie im Haus herum, von einem Zimmer zum anderen, in einem Bademantel mit flappenden Glockenärmeln, wie eine nachdenkliche Südstaatenschönheit in einer Kolonialvilla aus Vom Winde verweht. Ihr Geschlender wirkt von außen graziös und schwanengleich, doch unter der Oberfläche sieht es ganz anders aus, denn dort brodelt es, dort ringt sie verzweifelt um Fassung und strengt sich an, den Kopf nicht sinken zu lassen. Aber das panische Lächeln, mit dem sie uns gelegentlich anblitzt, damit wir wissen, dass sie noch da ist, überzeugt keinen von uns.
Oh, ich mache ihr keine Vorwürfe. Sie nimmt sich ja nicht aus Bosheit den Luxus heraus, sich einfach so in sich selbst zurückzuziehen und es den anderen zu überlassen, die Sauerei auszubaden und zu retten, was aus dem Scherbenhaufen unseres Lebens noch zu retten ist.
Aber jetzt seid ihr wahrscheinlich alle etwas verwirrt, weil ich noch gar nicht richtig angefangen habe zu erzählen.
Also: Mein Name ist Tamara Goodwin. Goodwin. Eine dieser grässlichen Wortkombinationen, die ich zutiefst verachte. Entweder man gewinnt oder man verliert. Aber ein »good win« – ein guter Gewinn? Das ist wie »schmerzlicher Verlust«, »warme Sonne« oder »endgültig tot«. Zwei Wörter, die völlig unnütz zusammengepackt werden, um etwas auszudrücken, was man genauso gut mit einem einzigen Wort hätte sagen können. Manchmal lasse ich einfach eine Silbe weg, wenn mich jemand nach meinem Namen fragt, und nenne mich Tamara Good. Was ein bisschen ironisch ist, weil ich nie ein sonderlich guter Mensch gewesen bin. Oder ich behaupte, ich heiße Tamara Win, eine ironische Anspielung darauf, dass das Glück mir zurzeit gar nicht hold ist.
Ich bin angeblich sechzehn, aber ich fühle mich mindestens doppelt so alt. Mit vierzehn habe ich mich gefühlt wie vierzehn, habe mich benommen wie elf und mich danach gesehnt, endlich achtzehn zu sein. Aber in den letzten Monaten bin ich um Jahre gealtert. Ist das möglich? Menschen mit den geschlossenen Bewusstseinsknospen schütteln jetzt den Kopf und antworten mit einem klaren Nein, während die aufgeblühten ein Kann sein signalisieren. Alles ist möglich, meinen sie. Aber das stimmt nicht. Es ist nicht alles möglich.
Zum Beispiel ist es nicht möglich, meinen Dad wieder lebendig zu machen. Ich hab es versucht, als ich ihn tot auf dem Boden in seinem Büro gefunden habe – »endgültig tot«, könnte man sagen, blau im Gesicht, neben sich eine leere Tablettenpackung, auf dem Schreibtisch eine ebenfalls leere Flasche Whiskey. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, aber ich habe trotzdem meine Lippen auf seine gepresst, um ihn zu beatmen, und dann mit den Händen rhythmisch auf seine Brust gedrückt, um es mit einer Herzmassage zu versuchen. Aber nichts davon hat funktioniert.
Es hat auch nichts gebracht, dass meine Mutter sich bei der Beerdigung auf den Sarg geworfen und den Lack zerkratzt hat, als sie meinen Vater ins Grab hinunterlassen wollten – das, nebenbei bemerkt, mit grünem Kunstrasen ausgelegt war, was ich ziemlich albern fand. Wollte man uns weismachen, dass es etwas anderes war als die madendurchsetzte Erde, in die man Dad für den Rest der Ewigkeit einbuddelte? Obwohl ich Mum dafür bewundere, dass sie es wenigstens versucht hat, war auch ihr Zusammenbruch auf dem Friedhof erfolglos.
Und auch die endlosen Geschichten, die man sich bei der Feier nach der Beerdigung im Zuge einer Art Wettbewerb zum Thema »Wer kannte George am besten?« über meinen Vater erzählte, haben es nicht geschafft, ihn wieder zum Leben zu erwecken. Ständig wurden neue Anekdoten aufgetischt, eingeleitet mit Phrasen wie »Echt lustig, deine Geschichte, aber wartet, bis ihr meine gehört habt …« oder »Als George und ich mal …« oder »Ich weiß noch genau, wie George gesagt hat …«. Und so weiter. Alle waren so eifrig bei der Sache, dass sie sich ständig gegenseitig ins Wort fielen und nicht nur Tränen, sondern auch Rotwein auf Mums neuem Perserteppich vergossen. Jeder gab sein Bestes, und man hätte fast denken können, Dad wäre bei uns im Zimmer, aber im Endeffekt haben ihn auch die ganzen Erinnerungen nicht zurückgeholt.
Es half auch nichts, dass Mum kurz darauf die Wahrheit über Dads Finanzen herausfand, die ungefähr so zerrüttet waren wie er selbst. Dad war bankrott, die Bank hatte bereits die Pfändung unseres Hauses und des ganzen übrigen Besitzes angeordnet, sodass Mum alles – wirklich alles! – verkaufen musste, um die Schulden zu bezahlen. Nicht mal da ist Dad zurückgekommen, um uns zu helfen, und irgendwann habe ich dann begriffen, dass er weg war. Endgültig. Ich dachte mir, wenn er uns das alles alleine durchziehen lässt, wenn er mich Luft in seinen Körper pumpen und Mum vor all diesen Leuten seinen Sarg zerkratzen lässt und dann auch noch dabei zuschaut, wie wir alles verlieren, was wir jemals besessen haben, dann kann ich ziemlich sicher sein, dass er ein für alle Mal aus unserem Leben verschwunden ist.
Ganz schön schlau von ihm, sich rechtzeitig zu verabschieden und den ganzen Zirkus nicht mitmachen zu müssen. Der war nämlich garantiert genauso grässlich und demütigend, wie er es befürchtet hat.
Wären meine Eltern mit blühenden Bewusstseinsblumen und nicht nur mit Knospen ausgestattet gewesen, hätten sie den ganzen Schlamassel vielleicht – ganz vielleicht! – vermeiden können. Aber so war es eben nicht. Es gab für sie kein Licht am Ende dieses Tunnels, und wenn doch mal eines auftauchte, war es ein heranbrausender Zug. Sie sahen keine andere Möglichkeit, keine andere Art, mit der Lage umzugehen. Meine Eltern waren vernünftige, praktische Menschen, und eine vernünftige, praktische Lösung war nicht im Angebot. Wenn mein Vater Vertrauen gehabt hätte, Zuversicht, irgendeine Art von Glauben, dann hätte er möglicherweise die Kraft gefunden, durch die Talsohle zu kommen. Aber davon besaß er nichts, und als er getan hat, was er getan hat, hat er uns letzten Endes mit sich in dieses Grab hinuntergezogen.
Es fasziniert mich, dass der Tod, so dunkel und endgültig er ist, dennoch häufig so ein helles Licht auf den Charakter eines Menschen wirft. In den Wochen nach Dads Tod hörte ich endlose, rührende Geschichten über ihn. Doch so tröstlich sie waren, so gern ich mich in ihnen verlor, in mir gab es immer Zweifel, ob sie wahr waren. Dad war kein netter Mensch. Natürlich habe ich ihn geliebt, aber ich weiß, dass er kein wirklich guter Mensch war. Wenn wir miteinander geredet haben – was nicht sehr oft vorkam –, geschah das meist in der Form einer Auseinandersetzung. Oder er gab mir Geld, um mich abzuwimmeln. Dad war reizbar und aufbrausend, hat seine Mitmenschen eingeschüchtert und ihnen nur allzu gerne seine Meinung aufgedrückt. Er war ziemlich arrogant, und wenn er einen anderen Menschen dazu brachte, sich unbehaglich und minderwertig zu fühlen, genoss er das in vollen Zügen. Manchmal ließ er sein Steak im Restaurant drei- oder viermal zurückgehen, nur um zuzusehen, wie der Kellner ins Schwitzen geriet. Oder er bestellte eine Flasche vom teuersten Wein und ließ ihn dann unter dem Vorwand zurückgehen, er hätte Kork. Wenn es in unserer Straße eine Party gab, beschwerte er sich bei der Polizei wegen des Lärms und sorgte dafür, dass sie dem Treiben ein Ende machte – nur weil er nicht eingeladen worden war.
Selbstverständlich erwähnte ich nichts davon auf seiner Beerdigung und auch nicht bei der kleinen Feier, die danach in unserem Haus stattfand. Genau genommen sagte ich überhaupt nichts. Ich trank ganz allein eine Flasche Rotwein und kotzte dann auf den Boden neben Dads Schreibtisch, genau auf die Stelle, wo er gestorben war. Dort fand Mum mich irgendwann und gab mir eine schallende Ohrfeige, weil sie meinte, ich hätte alles kaputtgemacht. Keine Ahnung, ob sie damit den Teppich oder die Erinnerung an Dad meinte, aber egal – ich war sicher, dass er beides ganz allein vermasselt hatte.
Aber ich will nicht meinen ganzen Hass auf Dad abladen, ich war selber ein schrecklicher Mensch. Die schlimmste Tochter, die man sich vorstellen kann. Meine Eltern haben mir alles gegeben, und ich habe mich nie bedankt. Oder wenn ich es doch getan habe, dann kam es nicht von Herzen, denn ich wusste nicht wirklich, was Dankbarkeit bedeutet. »Danke« ist ein Zeichen der Wertschätzung. Mum und Dad haben mir ständig von den hungernden Babys in Afrika erzählt, weil sie glaubten, so könnten sie mich dazu bringen, für das, was ich besaß, Dankbarkeit zu empfinden. Rückblickend ist mir aber klar geworden, dass ich es wahrscheinlich am ehesten gelernt hätte, wenn sie mir nicht ständig alles gegeben hätten.
Wir wohnten in einer modernen Villa mit sechshundertfünfzig Quadratmetern, sechs Schlafzimmern, einem Swimmingpool, einem Tennisplatz und einem Privatstrand in Killiney, in der Nähe von Dublin. Mein Zimmer lag auf der rückwärtigen Seite des Hauses und hatte einen Balkon mit Blick zum Strand, den ich mir, soweit ich mich erinnere, aber nie anschaute. Zum Zimmer gehörten eine eigene Dusche und ein Jacuzzi mit einem Plasmafernseher – TileVision, um genau zu sein – über der Wanne. Ich hatte einen Schrank voller Designerhandtaschen, einen Computer, eine PlayStation und ein Himmelbett. Kurz gesagt, ich war ein Glückspilz.
Aber als Tochter war ich der absolute Albtraum. Unhöflich, frech, verwöhnt ohne Ende. Und um alles noch schlimmer zu machen, nahm ich den ganzen Luxus für selbstverständlich. Ich ging blind davon aus, dass ich ihn verdiente, denn alle, die ich kannte, waren genauso reich. Keine Sekunde wäre mir in den Sinn gekommen, dass meine Bekannten das ganze Zeug vielleicht auch nicht wirklich verdient hatten.
Um mich auch abends und nachts jederzeit mit meinen Freunden treffen zu können, hatte ich eine Methode entwickelt, mich unbemerkt aus meinem Zimmer zu schleichen. Ich kletterte von meinem Balkon an der Regenrinne aufs Dach des Swimmingpools hinunter, und von dort war es nur ein kurzer Sprung auf den Boden. Dann versammelten wir uns an einer bestimmten Stelle unseres Privatstrands und konsumierten ziemlich große Mengen Alkohol. Die Mädchen tranken meistens sogenannte Dolly Mixtures, das heißt, wir mischten in einer Plastikflasche alles zusammen, was wir in den Alkoholvitrinen unserer Eltern vorfanden. Auf diese Art sank der Pegel der einzelnen Flaschen immer nur um ein paar Zentimeter, und niemand schöpfte Verdacht. Die Jungs tranken jede Sorte Cider, die sie in die Finger bekamen, und sie knutschten mit jedem Mädchen, das dazu bereit war. Dieses Mädchen war meistens ich. Meiner besten Freundin Zoey spannte ich einen Jungen namens Fiachrá aus, dessen Vater ein berühmter Schauspieler war, und um ehrlich zu sein, ließ ich mir von ihm nur aus diesem Grund jeden Abend ungefähr eine halbe Stunde unter den Rock fassen. Ich dachte, wenn ich nett zu ihm war, würde ich bestimmt eines Tages seinen Vater kennenlernen. Aber dazu kam es nie.
Meine Eltern fanden es wichtig, dass ich die Welt kennenlernte und erfuhr, wie andere Menschen lebten. Immer wieder erklärten sie mir, was für ein Glück ich hatte, dass ich in diesem schönen großen Haus am Meer wohnte, und zur Erweiterung meines Horizonts verbrachten wir den Sommer in unserer Villa in Marbella, die Weihnachtsferien in unserem Chalet in Verbier und Ostern im New Yorker Ritz, natürlich nicht ohne ausführliche Einkaufstouren. Für meinen siebzehnten Geburtstag stand ein rosa Mini Cooper Cabrio auf meinen Namen bereit und ein Termin im Aufnahmestudio eines Freundes meines Vaters, der mich singen hören und mir eventuell einen Plattenvertrag geben wollte. Allerdings hätte ich keinen Moment mehr mit ihm irgendwo allein verbracht, nachdem er mir einmal den Hintern betatscht hatte. Dieser Preis war mir für das Berühmtwerden zu hoch.
Das ganze Jahr über nahmen Mum und Dad immer wieder an irgendwelchen Charity-Veranstaltungen teil, bei denen Mum meistens noch mehr Geld für ihr Kleid als für den Eintritt ausgab. Zweimal im Jahr packte sie all ihre Impulskäufe zusammen, Sachen, die sie nie anzog, stopfte sie in einen Plastiksack und schickte sie ihrer Schwägerin Rosaleen, die auf dem Land wohnte – für den Fall, dass Rosaleen Lust hatte, die Kühe in einem Sommerkleidchen von Pucci zu melken.
Jetzt, wo wir nicht mehr in der gleichen Welt wie früher leben, ist mir klar, dass wir keine sonderlich netten Menschen waren. Ich glaube, dass meine Mutter das irgendwo unter ihrer erstarrten Oberfläche auch weiß. Nicht dass wir böse gewesen wären, das nicht – wir waren einfach nur nicht nett. Wir gaben weit weniger, als wir nahmen.
Aber was dann passierte, haben wir trotzdem nicht verdient.
Früher habe ich nie an morgen gedacht. Ich habe ganz im Hier und Jetzt gelebt. Wenn mir der Sinn nach etwas stand, wollte ich es haben, und zwar sofort. Als ich meinen Vater zum letzten Mal im Leben sah, habe ich ihn angeschrien, habe ihm gesagt, ich würde ihn hassen, habe die Tür zugeknallt und bin einfach gegangen. Nie wäre ich früher auf die Idee gekommen, meine kleine Welt mal aus der Distanz zu betrachten und darüber nachzudenken, was ich tat oder sagte. Ob ich damit vielleicht einen anderen Menschen verletzte. Meinem Dad warf ich bei dieser letzten Gelegenheit an den Kopf, dass ich ihn nie wiedersehen wollte – und genau das passierte dann ja auch. Ich dachte nie an den nächsten Tag, und so kam mir natürlich auch nicht in den Sinn, dass das die letzten Worte sein könnten, die ich mit ihm wechseln würde, die letzten Momente, die ich mit ihm erlebte. Jetzt muss ich irgendwie damit zurechtkommen, und das fällt mir nicht leicht. Es gibt eine ganze Menge Dinge, die ich bereue und die ich mir irgendwann verzeihen muss. Aber das dauert.
Jetzt, wo mein Dad tot ist, und auch wegen der ganzen Geschichte, die ich euch ja noch erzählen muss, habe ich gar keine andere Wahl, als an morgen zu denken und an all die Menschen, die von diesem Morgen beeinflusst werden können. Jetzt bin ich, wenn ich morgens aufwache, froh, dass es diesen Morgen gibt.
Ich habe meinen Vater verloren. Er hat sein Morgen verloren und ich all die gemeinsamen Morgen mit ihm. Man könnte sagen, dass ich sie jetzt zu schätzen weiß. Jetzt möchte ich das Beste aus ihnen machen.
2
Zwei Fliegen
Bei den Ameisen gibt es immer eine Vorhut, die alleine loszieht, um den besten Weg zu einer Nahrungsquelle auszukundschaften. Sobald diese einzelne Ameise die richtige Route gefunden hat, hinterlässt sie für die anderen eine Duftspur, der dann alle folgen können. Wenn man aber auf so eine Ameisenkarawane tritt oder wenn man – eine etwas weniger gemeine Methode – die Duftspur auf irgendeine Weise manipuliert, geraten die Tiere in helle Panik. Diejenigen, die zurückbleiben, krabbeln hektisch hin und her und bemühen sich, den Pfad wieder aufzuspüren. Ich sehe gern zu, wie sie zuerst völlig orientierungslos herumwimmeln, vollkommen verwirrt, sich gegenseitig umrennen, aber schließlich zu einer neuen Formation finden und irgendwann wieder in gerader Linie hintereinander hermarschieren, als wäre nichts geschehen.
Die panischen Ameisen erinnern mich an meine Mum und mich. Jemand hat unsere Karawane zerstört, unseren Anführer und unsere Orientierung geraubt und uns ins Chaos gestürzt. Ich glaube – ich hoffe –, dass wir irgendwann auf unseren Weg zurückfinden und weitergehen können. Aber wir brauchen einen Anführer, und da Mum die Sache passiv auszusitzen scheint, denke ich, dass ich diejenige sein werde, die sich erst mal alleine auf die Socken machen muss.
Gestern habe ich eine Schmeißfliege beobachtet. In ihrem Eifer, aus dem Wohnzimmer zu entkommen, flog sie ständig gegen die Fensterscheibe, wobei sie sich jedes Mal gnadenlos den Kopf am Glas stieß. Irgendwann jedoch gab sie die Geschossnummer auf und beschränkte sich von nun an bei ihren Bemühungen auf ein kleines Stück Scheibe, auf dem sie in sinnloser Panik herumbrummte. Ein frustrierender Anblick, vor allem angesichts der Tatsache, dass die Freiheit so leicht zu erreichen gewesen wäre – sie hätte nur ein kleines bisschen höher hinauffliegen müssen, statt es immer wieder auf die gleiche, erwiesenermaßen aussichtslose Weise zu versuchen. Ich konnte mir gut vorstellen, was für ein schreckliches Gefühl es sein musste, die Bäume, die Blumen, den Himmel zu sehen, aber einfach nicht hinkommen zu können. Ein paarmal versuchte ich, dem dummen Tier zu helfen, indem ich es in Richtung des offenen Fensterflügels scheuchte, aber das machte ihm nur noch mehr Angst, es ergriff die Flucht vor mir und raste quer durchs Zimmer, nur um irgendwann zur gleichen Stelle am gleichen Fenster zurückzukehren. Ich konnte mir fast einbilden, sein verzweifeltes Stimmchen zu hören, wie es brummte: »Also, hier bin ich aber doch reingekommen …!«
Während ich so in meinem Sessel saß und den Brummer beobachtete, überlegte ich mir, ob Gott sich wohl so fühlte wie ich in diesem Moment – falls es einen Gott gab. Ob er sich zurücklehnte und das große Ganze sah, so, wie ich jetzt mühelos durchschaute, dass die Freiheit für die Fliege zum Greifen nah war und sie nur ihre Taktik ein bisschen ändern musste. Das Tierchen saß gar nicht wirklich in der Falle, überhaupt nicht – es rackerte sich nur an der falschen Stelle ab. Ich fragte mich, ob Gott wohl auch einen Ausweg für mich und Mum wusste. Wenn ich das offene Fenster für den Brummer sehen konnte, dann war es für Gott bestimmt kein Problem, das Morgen für mich und Mum zu sehen. Irgendwie fand ich diese Idee tröstlich. Na ja, jedenfalls bis ich ein paar Stunden später von einer Erledigung wiederkam und auf dem Fenstersims eine tote Schmeißfliege vorfand. Vielleicht war es nicht die gleiche Fliege, aber trotzdem … Ich fing prompt an zu weinen – woran ihr sehen könnt, in welcher Verfassung ich mich zurzeit befinde … Dann wurde ich sauer auf Gott, weil in meinem Kopf der Tod des Brummers bedeutete, dass Mum und ich nie einen Ausweg aus diesem Fiasko finden würden. Was nutzt es denn, wenn man den Überblick hat und sieht, wie einfach die Lösung eines Problems ist, aber nichts tun kann?
Dann wurde mir klar, dass ich in diesem Fall tatsächlich Gott war. Ich hatte versucht, dem Brummer zu helfen, aber er hatte meine Hilfe nicht angenommen. Da bekam ich Mitleid mit Gott, weil ich plötzlich seinen Frust verstehen konnte. Manchmal wird man weggestoßen, wenn man die Hand ausstreckt, um jemandem zu helfen, denn jeder Mensch möchte sich lieber selbst helfen.
Früher habe ich über solche Dinge nie nachgedacht. Über Gott, über Fliegen, über Ameisen. Ich hätte mich nicht mal tot in einem Sessel mit einem Buch in der Hand erwischen lassen, wie ich an einem Samstagnachmittag eine dreckige Fliege beobachte, die gegen die Fensterscheibe rumst. Vielleicht hatte Dad in seinen letzten Momenten etwas Ähnliches gedacht: Ich möchte lieber tot in meinem Arbeitszimmer gefunden werden, als die Demütigung zu erleben, dass ich alles verloren habe.
Samstage verbrachte ich früher für gewöhnlich mit meinen Freundinnen bei Topshop, wo wir endlos Klamotten anprobierten und irgendwann, wenn Zoey genügend Accessoires in ihre Hose geschmuggelt hatte, den Laden unter nervösem Gekicher und doch möglichst unauffällig wieder verließen. Wenn wir nicht bei Topshop waren, hingen wir den Tag gemütlich bei einem Gingersnap Latte – grande natürlich – und einem Honig-Bananen-Muffin bei Starbucks ab. Vermutlich machen die anderen das immer noch genauso.
Seit der ersten Woche hier habe ich von keiner meiner Freundinnen mehr etwas gehört, abgesehen von einer SMS, die Laura mir geschickt hat, kurz bevor mein Telefon abgeschaltet wurde. Eine Menge Klatsch und Tratsch; unter anderem erfuhr ich, dass Zoey und Fiachrá wieder zusammen waren und in Zoeys Haus Sex gehabt hatten, als ihre Eltern übers Wochenende in Monte Carlo waren. Zoeys Dad ist spielsüchtig, was Zoey und wir anderen toll fanden, weil ihre Eltern immer erst spät nach Hause kamen und wir bei ihr sturmfreie Bude hatten. Anscheinend hatte Zoey Laura erzählt, dass Sex mit Fiachrá sie an damals erinnerte, als die Lesbe vom Hockeyteam aus Sutton ihr den Schläger zwischen die Beine geknallt hatte – nur noch schlimmer. Und die Sache mit dem Schläger war schon echt fies gewesen, das könnt ihr mir glauben – ich war dabei. Daher war sie wohl auch nicht gerade versessen darauf, den Versuch in absehbarer Zeit zu wiederholen. Inzwischen hatte sich allerdings Laura mit Fiachrá fürs nächste Wochenende verabredet, wo sie es mit ihm tun wollte – sie hoffte, dass es mir nichts ausmachte, aber ich durfte es bitte keinem verraten, vor allem nicht Zoey. Als könnte ich es dort, wo ich jetzt bin, irgendjemandem erzählen, selbst wenn ich wollte.
Dort, wo ich jetzt bin. Das hab ich noch gar nicht erklärt, richtig? Aber ich habe Rosaleen schon erwähnt, die Schwägerin meiner Mutter, die Mum früher mit ihren missglückten Spontankäufen beglückt hat, wenn der Platz im Kleiderschrank nicht mehr reichte. Teilweise hingen noch die Preisschilder an den Sachen, die bei Rosaleen landeten.
Rosaleen ist mit meinem Onkel Arthur, dem Bruder meiner Mutter, verheiratet. Sie wohnen in einem Torhaus auf dem Land, in einem Dorf namens Meath, mitten in der Pampa, praktisch am Ende der Welt. Wir haben sie ein paarmal besucht, und ich habe mich immer zu Tode gelangweilt. Die Fahrt dorthin dauerte eine Stunde und fünfzehn Minuten, und es war echte Zeitverschwendung. Für mich waren die beiden einfach nur zwei Bauerntrampel in einem Provinzkaff, und ich bezeichnete sie gern als »unsere beiden Dorfpunks«. Soweit ich mich erinnern kann, war das der einzige Witz von mir, über den Dad jemals gelacht hat. Übrigens kam er nie mit, wenn wir Rosaleen und Arthur besuchten, obwohl ich mich nicht erinnern kann, dass sie jemals Streit hatten oder so. Wahrscheinlich war es wie bei den Pinguinen und den Eisbären: Sie lebten so weit voneinander entfernt, dass sie schlicht nichts miteinander anfangen konnten. Ja, und in diesem Kaff wohnen wir jetzt. Im Torhaus, bei den Dorfpunks.
Eigentlich ist das Haus echt süß – zwar nur etwa ein Viertel der Größe unserer Villa, aber das ist ja an sich nichts Schlimmes – und erinnert mich an das Hexenhäuschen in Hänsel und Gretel. Es ist aus Kalkstein gebaut, und die Fensterrahmen und Holzverkleidungen am Dach sind oliv angestrichen. Oben gibt es drei Schlafzimmer, unten sind Küche und Wohnzimmer. Mum hat ein Zimmer mit eigenem Bad, das andere Bad teilen sich Rosaleen, Arthur und ich. Da ich es gewohnt bin, mein eigenes Bad zu haben, finde ich das furchtbar, vor allem, wenn ich nach meinem Onkel Arthur reinmuss, der gerne lange Sitzungen abhält und dabei Zeitung liest. Rosaleen ist ein echter Putzteufel und so zwanghaft ordentlich, dass sie keine Sekunde still sitzen kann. Ständig räumt sie irgendwas auf, macht irgendwas sauber, sprüht Duftsprays in die Luft und hält nebenbei auch noch Vorträge über Gott und seinen Willen. Einmal hab ich zu ihr gesagt, ich hoffte, dass Gottes Wille besser sei als Dads letzter Wille. Da hat sie mich entsetzt angestarrt und ist schnell weggewuselt, um an einer anderen Stelle Staub zu wischen.
Rosaleen hat ungefähr so viel Tiefgang wie ein Schnapsglas. Was sie sagt, ist alles hohles Zeug. Über das Wetter. Über das traurige Schicksal irgendeines armen Menschen auf der anderen Seite der Welt. Über ihre Freundin, die ein Stück die Straße runter wohnt und sich den Arm gebrochen hat. Über eine andere Freundin, deren Vater nur noch zwei Monate zu leben hat. Über die Tochter eines Bekannten, die irgendeinen Blödsack geheiratet hat, der sie jetzt mit dem zweiten Kind im Bauch sitzen lässt. Rosaleen liebt Untergangsszenarien, die sie unweigerlich mit einem Spruch über Gott vervollständigt, mit abgedroschenen Phrasen wie »mit Gottes Hilfe« oder »so Gott will« oder »Gott steh ihnen bei«. Nicht dass ich selbst so viel Wichtiges zu sagen hätte, aber jedes Mal, wenn ich bei ihren Geschichten nachhake und etwas Genaueres über einen dieser armen Menschen erfahren oder einem Problem auf den Grund gehen möchte, ist bei Rosaleen sofort der Ofen aus. Sie will nur darüber sprechen, wie traurig und schwierig alles ist, aber die Gründe, die zu der misslichen Lage geführt haben, interessieren sie nicht die Bohne. Genauso wenig wie die Frage, ob es eine Lösung für das geschilderte Problem gibt. So schnell sie kann, stopft sie mir mit ihren Gottphrasen den Mund und vermittelt mir das Gefühl, dass mein Kommentar unpassend ist und ich sowieso viel zu jung bin, um die Tragweite dessen, was sie erzählt, auch nur ansatzweise zu begreifen. Aber meiner Meinung nach ist es genau umgekehrt. Meiner Meinung nach redet sie nur über diese Dinge, damit sie nicht das Gefühl haben muss, dass sie vor solchen Themen kneift, aber sobald sie diesen Anspruch erfüllt hat, erwähnt sie kein Wort mehr davon.
Von meinem Onkel Arthur habe ich in meinem ganzen Leben schätzungsweise fünf Worte gehört. Irgendwie kommt es mir vor, als hätte meine Mum ihr Leben lang für sie beide gesprochen – obwohl er ihre Ansichten ganz sicher nicht immer teilt. Zurzeit redet Arthur allerdings deutlich mehr als Mum. Er hat eine ganz eigene Sprache, die ich allmählich zu entziffern lerne. Arthur kommuniziert mit Grunzen, Nicken und Schleimschnauben – eine Art von verrotztem Einatmen, das er einsetzt, wenn er etwas missbilligt. Ein kurzes »Ah« mit zurückgeworfenem Kopf bedeutet, dass ihm etwas egal ist. So ungefähr spielt sich zum Beispiel ein typisches Frühstück ab:
Arthur und ich sitzen am Küchentisch, und Rosaleen wuselt wie üblich mit toastbeladenen Tellern und kleinen Behältnissen für hausgemachte Marmelade, Orangenkonfitüre und Honig durch die Gegend. Das Radio dröhnt so laut, dass ich auch noch in meinem Zimmer jedes Wort verstehen könnte – irgendein Mann erzählt in nervigem Jammerton, was in der Welt wieder alles Furchtbares passiert ist. Nun tritt Rosaleen mit der Teekanne an den Tisch.
»Tee, Arthur?«
Arthur wirft den Kopf zurück wie ein Pferd, das eine Fliege aus seiner Mähne schüttelt. Ja, er möchte Tee.
Währenddessen klagt der Mann im Radio darüber, dass schon wieder eine Fabrik in Irland geschlossen wird und hundert Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren.
Arthur atmet ein, zieht eine Ladung Schleim durch die Nase hoch und von dort hinunter in den Rachen. Das heißt, ihm gefällt diese Nachricht nicht.
Dann erscheint Rosaleen mit dem nächsten Toaststapel. »Oh, ist das nicht schrecklich? Gott steh diesen armen Menschen bei! Vor allem den Kindern – jetzt, wo ihr Daddy keine Arbeit mehr hat.«
»Und den Müttern«, füge ich hinzu und nehme mir eine Scheibe Toast.
Aufmerksam sieht Rosaleen zu, wie ich in meinen Toast beiße, und ihre grünen Augen werden ganz groß, während ich langsam kaue. Immer beobachtet sie mich beim Essen, es macht mich ganz kirre. Als wäre sie die Hexe aus Hänsel und Gretel, die überprüft, ob ich schon fett genug bin, dass es sich lohnt, mich auf dem großen Holzherd zu braten, die Hände auf den Rücken gefesselt, einen Apfel im Mund. Ein Apfel wäre mir übrigens sehr recht. Das wäre das Kalorienärmste, was mir hier jemals vorgesetzt worden ist.
Ich schlucke den Bissen hinunter und lege den Rest des Toasts auf meinen Teller.
Enttäuscht über meine schwache Leistung wendet Rosaleen sich ab.
Jetzt reden sie in den Nachrichten über eine von der Regierung angeordnete Steuererhöhung, und Arthur zieht wieder kräftig Schleim hoch. Wenn ihm noch mehr schlimme Nachrichten zu Ohren kommen, ist er so verschleimt, dass er bald keinen Platz mehr für sein Frühstück hat. Er ist Mitte vierzig, sieht aber viel älter aus und benimmt sich auch so. Von den Schultern nach oben erinnert er mich an eine Riesengarnele, immer gebeugt, sei es über sein Essen oder über seine Arbeit.
Rosaleen erscheint wieder, mit einem irischen Frühstück, von dem sämtliche Kinder der hundert entlassenen Fabrikarbeiter locker satt werden würden.
Arthur wirft den Kopf zurück. Er freut sich.
Dann steht Rosaleen neben mir und schenkt mir Tee ein. Ein Gingersnap Latte wäre mir natürlich wesentlich lieber, aber ich kippe ein bisschen Milch in das Gebräu und fange an zu schlürfen. Rosaleen lässt mich nicht aus den Augen, bis ich schlucke.
Wie alt Rosaleen genau ist, weiß ich nicht, wahrscheinlich auch Anfang, Mitte vierzig, aber auch sie sieht locker zehn Jahre älter aus. In ihrem vorn durchgeknöpften Blümchenkleid und dem Unterrock könnte sie aus den Vierzigerjahren stammen. Meine Mum hat noch nie Unterröcke getragen, sie ist überhaupt sehr sparsam mit ihrer Unterwäsche. Ihre straßenköterbraunen Haare trägt Rosaleen kinnlang, streng in der Mitte gescheitelt und hinter ihre kleinen rosa Mauseöhrchen geklemmt, sodass man deutlich die grauen Ansätze sieht. Noch nie habe ich Ohrringe oder Make-up an ihr gesehen, dafür hat sie immer ein goldenes Kruzifix an einer goldenen Halskette umhängen. Sie gehört zu den Frauen, von denen meine Freundin Zoey immer sagt, sie sehen aus, als hätten sie in ihrem ganzen Leben noch nie einen Orgasmus gehabt. Während ich den Fettrand vom Schinkenspeck abschneide und Rosaleen deswegen schon wieder die Augen aufreißt, frage ich mich, ob Zoey wohl einen Orgasmus hatte, als sie mit Fiachrá geschlafen hat. Dann denke ich an den Hockeyschläger, und sofort kommen mir Zweifel.
Auf der anderen Straßenseite, direkt gegenüber vom Torhaus, steht ein kleines, einstöckiges Haus, ein Bungalow. Keine Ahnung, wer dort wohnt, aber Rosaleen bringt jeden Tag Essenspakete hin. Zwei Meilen die Straße runter ist die Post, die jemand in seinem Privathaus betreibt, und gegenüber davon die kleinste Schule, die ich je gesehen habe und die – ganz anders als meine Schule zu Hause, in der das ganze Jahr über stündlich irgendwelche Aktivitäten stattfinden – im Sommer komplett leer steht. Ich habe Rosaleen gefragt, ob da vielleicht Yogakurse oder etwas Ähnliches angeboten würden, aber sie hat mir erklärt, dass sie mir gerne zeigen kann, wie man selbst Joghurt macht. Dabei machte sie so einen glücklichen Eindruck, dass ich es nicht übers Herz brachte, sie über das Missverständnis aufzuklären. In der ersten Woche habe ich ihr tatsächlich beim Zubereiten von Erdbeerjoghurt zugeschaut. Sie hat so viel davon gemacht, dass nach zwei Wochen immer noch was davon übrig war.
Das Torhaus, in dem Arthur und Rosaleen wohnen, hat im achtzehnten Jahrhundert den Seiteneingang des Kilsaney Castle bewacht. Den Haupteingang zum Schloss bildet ein heruntergekommenes, irgendwie sehr unheimliches gotisches Tor. Jedes Mal, wenn ich daran vorbeikomme, stelle ich mir vor, dass abgeschlagene Köpfe daran hängen. Das Schloss wurde als Befestigungsanlage des Norman Pale erbaut – das war die Gegend im Osten Irlands, die nach der Invasion von Strongbow von den Normannen und Engländern kontrolliert wurde –, also irgendwann zwischen 1170 und 1270, was, wenn man es sich überlegt, eine ziemlich vage Zeitangabe ist. Ob etwas von mir oder von meinen Halbroboter-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Enkeln stammt, macht doch einen ziemlichen Unterschied, finde ich. Jedenfalls gehörte das Schloss einem normannischen Kriegsherrn, und deshalb denke ich immer an die abgehackten Köpfe. Denn das haben die damals doch gemacht, oder nicht?
Die Gegend hier nennt sich County Meath. Früher hieß sie East Meath, und zusammen mit West Meath – wer hätte das gedacht! – bildete sie eine eigenständige fünfte Provinz Irlands, das Territorium des Hochkönigs. Der ehemalige Sitz der Hochkönige, der Hill of Tara, liegt nur ein paar Kilometer entfernt. Derzeit ist er ständig in den Nachrichten, weil ganz in der Nähe eine Autobahn gebaut werden soll. Vor ein paar Monaten mussten wir in der Schule darüber diskutieren. Ich habe für den Bau der Autobahn plädiert, unter anderem mit der Begründung, dass es dem König bestimmt gefallen hätte, wenn er auf dem Weg in sein Büro nicht durch irgendwelche matschigen Mistfelder waten und sich die Sandalen hätte dreckig machen müssen. Außerdem brachte ich noch das Argument vor, dass die Gegend durch die Autobahn für die Touristen zugänglicher werden würde – sie könnten einfach direkt ranfahren oder den Hügel von den zweistöckigen offenen Bussen ablichten, die mit hundertzwanzig Stundenkilometern über die Autobahn brettern. Eigentlich war das ironisch gemeint, aber unsere Aushilfslehrerin tickte völlig aus, weil sie dachte, es wäre mein Ernst, und sie gehörte zu einer Bürgerinitiative, die den Bau der Straße verhindern will. Es ist so leicht, Aushilfslehrer an den Rand des Nervenzusammenbruchs zu bringen. Vor allem diejenigen, die glauben, sie könnten den Schülern etwas Gutes tun. Ich hab euch ja gesagt – ich war ziemlich eklig.
Nach dem normannischen Psycho lebten verschiedene Lords und Ladys in dem Schloss, die alle irgendwelche Ställe und Nebengebäude anbauen ließen. Ein Lord konvertierte sogar zum Katholizismus, nachdem er eine katholische Frau geheiratet hatte, was sehr kontroverse Reaktionen hervorrief. Als besonderes Geschenk für die Familie ließ er eine Kapelle bauen. Ich und Mum haben als besonderes Geschenk einen Swimmingpool bekommen – aber jedem das Seine. Das Grundstück ist von einer sogenannten Hungermauer umgeben, einem Projekt, das den Menschen während der Großen Hungersnot Arbeit verschaffen sollte. Die Mauer verläuft direkt neben Arthur und Rosaleens Garten und Haus, und ich bekomme jedes Mal eine Gänsehaut, wenn ich sie ansehe. Wäre Rosaleen jemals bei uns zum Essen zu Gast gewesen, hätte sie wahrscheinlich auch gleich so eine Mauer um uns herum bauen lassen, denn wir essen nichts Kohlehydratreiches. Jedenfalls haben wir das früher nicht getan, aber jetzt stopfe ich so viel in mich hinein, dass ich locker alle Fabriken, die geschlossen werden, mit Energie versorgen könnte.
Bis etwa 1920 lebten weiterhin Abkömmlinge der Kilsaneys im Schloss, aber dann bekamen ein paar Brandstifter aus irgendwelchen Gründen nicht mit, dass die Bewohner Katholiken waren, und zündeten ihnen das Dach über dem Kopf an. Danach war nur noch ein kleiner Teil des Schlosses bewohnbar, denn es war nicht genug Geld vorhanden, um alles zu reparieren und zu beheizen, und so wurde das Gebäude in den Neunzigerjahren des letzten Jahrhunderts schließlich verlassen. Keine Ahnung, wem es inzwischen gehört, aber es ist ziemlich verfallen: kein Dach, eingestürzte Mauern, keine Treppen, ihr könnt es euch in etwa vorstellen. In der Ruine wächst alles Mögliche, und jede Menge Lebewesen huschen darin herum. Das habe ich während eines Schulprojekts selbst recherchiert. Mum hatte nämlich angeregt, ich könnte doch ein Wochenende bei Rosaleen und Arthur verbringen und ein bisschen Forschung betreiben. An diesem Tag hatten sie und Dad den größten Krach, den ich jemals gesehen oder gehört habe. Als Mum vorschlug, ich könnte wegfahren, ging Dad total an die Decke, und da ich es ohnehin für meine Tochterpflicht hielt, ihm das Leben zur Hölle zu machen, war ich nur allzu gern bereit, zu Diensten zu sein. Ehrlich gesagt, war die Atmosphäre so schrecklich, dass ich froh war, abhauen zu können. Aber kaum war ich fort, hatte ich eigentlich überhaupt keine Lust mehr, mich umzuschauen und die Geschichte des Anwesens zu erforschen. Ich überstand mit Müh und Not den Lunch bei Rosaleen und Arthur, dann zog ich mich aufs Klo zurück und rief meine philippinische Kinderfrau Mae an – die wir inzwischen übrigens entlassen und heimschicken mussten –, damit sie mich abholte. Rosaleen erzählte ich, ich hätte Magenkrämpfe, und versuchte, nicht zu lachen, als sie mich fragte, ob ich glaubte, dass es von ihrem Apfelkuchen kam.
Am Schluss schrieb ich dann aus dem Internet einen Artikel über das Schloss ab. Prompt wurde ich zur Direktorin gerufen, und sie gab mir wegen Plagiats null Punkte für die Arbeit, was vollkommen lächerlich war, denn Zoey hatte komplett alles über Malahide Castle aus dem Internet kopiert und lediglich ein paar Wörter und Daten verändert – teilweise sogar falsch –, damit es authentischer wirkte, und bekam trotzdem eine bessere Note als ich. Wo bleibt da die Gerechtigkeit?
Das Schloss ist umgeben von gut vierzig Hektar Land, um die Arthur sich kümmert. Bei so einem riesigen Grundstück ist er natürlich schon frühmorgens auf den Beinen, kommt aber Schlag halb sechs zurück, so verdreckt wie aus dem Kohlebergwerk. Aber er beklagt sich nie, jammert auch nicht übers Wetter, nein, er steht einfach nur auf, isst sein Frühstück, bei dem er sich mit dem Radio die Ohren betäubt, und geht dann an die Arbeit. Rosaleen packt ihm eine Thermoskanne Tee und ein paar Sandwiches ein, die ihn bei Kräften halten, und er kommt zwischendurch nur selten zum Haus zurück – höchstens mal, um etwas aus der Garage zu holen, was er vergessen hat, oder weil er aufs Klo muss. Dem äußeren Anschein nach ist Arthur ein einfacher Mensch – nur nehme ich ihm das nicht recht ab. Jemand, der so wenig spricht, ist garantiert nicht so einfach, wie man auf den ersten Blick denken könnte. Es ist schwierig, nicht viel zu sagen, denn wenn man nicht redet, dann denkt man, und ich glaube, Arthur denkt eine ganze Menge, wenn der Tag lang ist. Meine Mum und mein Dad haben ständig gequasselt. Aber Schwätzer denken nicht viel, ihre Worte übertönen die Stimme des Unterbewusstseins, die fragt: Warum hast du das gesagt? Was denkst du denn wirklich?
Früher bin ich an Schultagen und Wochenenden so lange wie möglich im Bett geblieben, genau genommen, bis Mae mich irgendwann gegen meinen erbitterten Widerstand aus dem Bett zerrte. Aber hier wache ich früh auf. In den großen Bäumen tummeln sich die Vögel, und die sind so laut, dass ich von ihrem Gezwitscher aufwache. Ohne mich im Geringsten müde zu fühlen. Gegen sieben bin ich auf den Beinen, was für mich ein richtiges Wunder ist. Mae wäre stolz auf mich. Die Abende hier sind zu lang, deshalb muss man sich bei Tag beschäftigen. Es gibt schrecklich viel unausgefüllte Zeit.
Im Mai hat Dad seinen Entschluss gefasst, dass er genug vom Leben hatte – direkt vor meiner Prüfung fürs Junior Certificate, was ein bisschen unfair war, denn bis dahin lebte ich in dem Glauben, ich wäre diejenige, die irgendwann den Drang verspüren würde, Selbstmord zu begehen. Ich habe meine Prüfungen trotzdem gemacht. Die Ergebnisse erfahre ich erst im September. Wahrscheinlich bin ich durchgefallen, aber das kümmert mich nicht besonders, und ich glaube auch nicht, dass es sonst jemandem schlaflose Nächte bereitet. Meine ganze Klasse war auf Dads Beerdigung, es gab nämlich einen Tag schulfrei. Trotz des ganzen Chaos war es mir peinlich, dass ich vor versammelter Mannschaft heulen musste – ist das zu glauben? Aber so war es, und als ich anfing, dauerte es nicht lange, bis erst Zoey und dann Laura einstimmten. Ein Mädchen aus meiner Klasse, Fiona, mit der nie jemand redete, umarmte mich ganz fest und überreichte mir eine Karte von ihrer Familie, auf der stand, dass sie in Gedanken bei mir seien. Dann gab mir Fiona auch noch ihre Handynummer und ihr Lieblingsbuch und sagte, falls ich mit jemandem reden wollte, wäre sie immer für mich da. Damals fand ich es ein bisschen arm, dass sie sich mir beim Begräbnis meines Vaters so an den Hals schmiss, aber als ich später noch mal darüber nachdachte – und ich denke jetzt eine Menge –, fand ich, dass niemand an diesem Tag so nett zu mir war wie Fiona.
In der ersten Woche in Meath fing ich an, das Buch zu lesen. Es ist eine Art Gespenstergeschichte von einem Mädchen, das für alle anderen Menschen auf der Welt unsichtbar ist, auch für ihre Familie und ihre Freunde, obwohl alle wissen, dass sie existiert. Sie kam einfach unsichtbar zur Welt. Den Rest verrate ich nicht, aber am Ende freundet sie sich mit jemandem an, der sie sieht. Mir gefiel die Idee, und ich dachte, dass Fiona mir damit etwas sagen wollte, aber als ich bei Zoey übernachtete und ihr und Laura davon erzählte, meinten sie, das sei ja wohl der größte Quatsch, den sie je gehört hätten, und Fiona sei anscheinend noch komischer, als sie bisher gedacht hätten. Wisst ihr, was? Mir fällt es zunehmend schwer, ihre Argumente nachzuvollziehen.
In der ersten Woche hier fuhr Arthur mich nach Dublin, damit ich bei Zoey übernachten konnte. In der ganzen eineinviertel Stunde Fahrt sprachen wir kein Wort. Das Einzige, was er sagte, war: »Radio?«, und als ich nickte, stellte er einen von den Sendern ein, in dem nur über die Probleme des Landes geredet und kein Ton Musik gespielt wird, und dazu schleimschnaubte er die ganze Zeit. Trotzdem war es besser als totale Stille. Nachdem ich die Nacht bei Zoey und Laura verbracht und ununterbrochen über Arthur gemeckert hatte, fühlte ich mich ganz zuversichtlich. Das war endlich wieder mein altes Selbst. Wir waren alle der Meinung, dass Arthur und Rosaleen ihrem Ruf als Dorfpunks alle Ehre machten und dass ich mich nicht in ihre Spinnerexistenz hineinziehen lassen durfte. Das bedeutete, dass ich auf der Heimfahrt im Auto gefälligst hören konnte, was ich wollte. Aber als Arthur mich am nächsten Tag mit seinem verdreckten Land Rover abholte, über den Zoey und Laura gar nicht genug kichern konnten, tat mir mein Onkel leid. Ja, er tat mir richtig leid.
Aber dass ich in ein Haus zurückmusste, das nicht meines war, in einem Auto, das nicht meines war, dass ich in einem Zimmer schlafen musste, das nicht meines war, und mit einer Mutter reden musste, die sich überhaupt nicht wie meine Mutter benahm – das alles weckte in mir den Wunsch, mich wenigstens an dem einen festzuhalten, was mir vertraut war. An der Person, die ich einmal war. Natürlich war es nicht unbedingt das Richtige zum Festhalten, aber besser als nichts. Deshalb veranstaltete ich im Auto ein Mordstheater und sagte Arthur, ich wollte einen anderen Sender hören. Einen Song lang ließ er meinen Lieblingssender laufen, aber dann war er entsetzt von den Pussycat Dolls, die davon sangen, dass sie sich richtige Titten wünschten, grummelte eine Weile und schaltete schließlich doch wieder auf den Quasselsender um. Ich starrte wütend aus dem Fenster, hasste ihn und hasste mich. Eine halbe Stunde lauschten wir einer Frau, die dem Moderator am Telefon vorheulte, dass ihr Mann seinen Job in einer Computerfirma verloren hatte und keine neue Stelle finden konnte, obwohl sie doch vier Kinder zu versorgen hatten. Meine Haare hingen mir ins Gesicht, und ich konnte nur hoffen, dass Arthur nicht sah, wie ich heulte. Traurige Dinge gehen mir zurzeit total an die Nieren. Natürlich hatte ich solche Geschichten schon öfter gehört, aber irgendwie nie richtig wahrgenommen. Weil mir so was einfach nie passiert war.
Ich hatte keine Ahnung, wie lange wir bei Rosaleen und Arthur wohnen würden, und niemand war bereit, mir diese Frage zu beantworten. Arthur redete nicht, mit meiner Mum konnte man auch nicht mehr kommunizieren, und Rosaleen war von einer Frage dieser Größenordnung sowieso überfordert.
Mein Leben verlief ganz und gar nicht nach Plan. Ich war sechzehn und hätte Sex mit Fiachrá haben sollen. Den Sommer hätte ich in unserer Villa in Marbella verbringen sollen, jeden Tag schwimmen gehen, auf Grillpartys und abends im Angels & Demons rumhängen, um den nächsten Typen kennenzulernen, mich in ihn zu verknallen und mit ihm zu schlafen. Ich war überzeugt, dass es mein Tod wäre, wenn der erste Mann, mit dem ich schlief, am Ende mein Ehemann würde. Aber nun lebte ich in diesem Kaff. In einem Torhaus mit drei Verrückten, und in der Nähe gab es weiter nichts als einen Bungalow, dessen Bewohner ich noch nie zu Gesicht bekommen hatte, ein Postamt, das sich praktisch im Wohnzimmer eines Privathauses befand, eine leer stehende Schule und eine Schlossruine. Nichts, mit dem ich auch nur das Geringste anfangen konnte.
Jedenfalls dachte ich das.
Aber vielleicht sollte ich meine Geschichte lieber mit unserer Ankunft beginnen.
3
Der Neuanfang fängt an
Barbara, die beste Freundin meiner Mum, fuhr uns zu unserer neuen Bleibe nach Meath. Den ganzen Weg sagte Mum kein Wort. Kein einziges Wort. Auch nicht, wenn man sie direkt ansprach oder etwas fragte. Das war ziemlich schwer zu ertragen, und irgendwann war ich so genervt, dass ich sie anschrie – zu diesem Zeitpunkt habe ich noch versucht, eine Reaktion aus ihr herauszulocken.
Es passierte, weil Barbara sich verfahren hatte. Das Navi in ihrem BMW X5 erkannte die Adresse nicht und schickte uns einfach in den nächsten Ort, den es ermitteln konnte. Als wir diesen Ort, ein Städtchen namens Ratoath, erreichten, musste sich Barbara dann wohl oder übel auf ihr eigenes Gehirn verlassen und konnte nicht mehr auf die Hilfe der Gerätschaften in ihrem SUV zurückgreifen. Leider ist Barbara, wie sich herausstellte, keine große Denkerin. Nachdem wir zehn Minuten auf irgendwelchen Landstraßen mit wenig Besiedlung und keinerlei Beschilderung herumgekurvt waren, wurde sie allmählich nervös. Diese Straßen existierten ihrem Navi zufolge überhaupt nicht. Vielleicht hätte das ein Zeichen für mich sein sollen. Da Barbara es gewohnt war, sich auf ein Ziel zuzubewegen, und nicht, auf unsichtbaren Sträßchen herumzuirren, begann sie Fehler zu machen, fuhr blind über Kreuzungen, geriet gefährlich oft auf die andere Fahrbahn. Leider war ich im Lauf der Jahre auch nicht sehr oft in der Gegend gewesen und konnte ihr nicht viel helfen, aber wir hatten vereinbart, dass ich auf der linken Seite nach dem Torhäuschen Ausschau halten sollte und sie auf der rechten. Plötzlich fauchte sie mich an, ich sollte mich gefälligst konzentrieren und nicht vor mich hin träumen, dabei hatte ich mich nur ein bisschen ausgeruht, weil ich genau sehen konnte, dass es mindestens eine Meile überhaupt kein Tor gab und es deshalb auch sinnlos war, nach einem Torhaus Ausschau zu halten. Das teilte ich Barbara auch mit. Doch sie hatte inzwischen die Grenze ihrer Belastbarkeit erreicht und schimpfte munter weiter, das würde ja wohl nichts anderes als »scheiß drauf« bedeuten, und wenn wir doch schon auf »beschissenen Straßen, die es nicht gibt« herumgondelten, könnte das »beschissene Torhaus«, das wir suchten, doch genauso gut auch »ein beschissenes Haus ohne ein beschissenes Tor« sein. Das Wort »beschissen« so oft aus Barbaras Mund zu hören, war ziemlich krass, denn normalerweise benutzt sie bestenfalls Ausdrücke wie »Pustekuchen« oder »Papperlapapp«, wenn sie sich ärgert.
Natürlich hätte Mum uns helfen können, aber sie saß auf dem Beifahrersitz und betrachtete stumm lächelnd die Landschaft. In meiner Verzweiflung legte ich den Mund ganz dicht an ihr Ohr – okay, ich sehe ein, dass das nicht richtig und auch nicht sehr schlau war, aber es fiel mir echt nichts Besseres mehr ein – und brüllte sie an, so laut ich konnte. Mum zuckte erschrocken zusammen, hielt sich die Ohren zu, und als sie den Schock überwunden hatte, begann sie mit beiden Händen auf mich einzudreschen, als wäre mein Kopf ein Bienenschwarm, den sie verscheuchen wollte. Es tat auch richtig weh. Sie zog mich an den Haaren, kratzte und ohrfeigte mich rechts und links, und ich schaffte es nicht, mich loszureißen. Jetzt hatte Barbara endgültig die Nase voll, fuhr an den Straßenrand und trennte Mum mit Gewalt von mir. Dann stieg sie aus und fing an, schluchzend am Straßenrand auf und ab zu wandern. Ich heulte ebenfalls, und mein Kopf dröhnte, weil Mum ihn so in die Mangel genommen hatte. Dort, wo ich herkomme, ist es Mode, die Haare wie einen Heuhaufen zu stylen, aber Mum hatte meinen sorgfältigen Aufbau total ruiniert, und ich sah aus wie aus der Klapsmühle ausgebrochen. Schließlich kletterte ich auch aus dem Auto, und nun saß Mum allein da, kerzengerade, und starrte wütend geradeaus.
»Komm her, Herzchen«, rief Barbara unter Tränen, als sie mich sah, und streckte mir die Arme entgegen.
Sie brauchte mich nicht zweimal zu bitten, ich sehnte mich nach einer Umarmung. Selbst wenn Mum gut drauf war, hatte sie kein großes Bedürfnis nach Körperkontakt. Sie war extrem schlank, immer auf Diät und hatte zum Essen die gleiche Beziehung wie zu Dad. Sie liebte es, wollte aber meistens nichts davon wissen, weil sie dachte, es wäre nicht gut für sie. Das weiß ich, weil ich mal ein Gespräch zwischen ihr und einer Freundin belauscht habe, als sie um zwei Uhr morgens von einem Ladys-Lunch zurückkam. Was das Umarmen anging, so war es ihr einfach unbehaglich, jemandem körperlich so nahe zu sein. Sie war selbst kein Mensch, der in sich ruhte, deshalb konnte sie auch keine Geborgenheit vermitteln. Genauso, wie man anderen auch keine Ratschläge geben kann, wenn man selbst ratlos ist. Ich glaube nicht, dass andere Menschen unwichtig für sie waren. Ich hatte nie das Gefühl, dass Gleichgültigkeit ihr Problem war. Na ja, manchmal vielleicht schon, aber bestimmt nicht immer und nicht grundsätzlich.
So standen Barbara und ich am Straßenrand, hielten einander im Arm und weinten, und Barbara entschuldigte sich immer wieder, weil das für mich alles so unfair sei. Als sie ausgestiegen war, hatte sie den Wagen ziemlich schräg stehen lassen, und er ragte ein ganzes Stück in die Straße, sodass sich jedes vorbeifahrende Auto verpflichtet fühlte, uns anzuhupen. Aber wir achteten einfach nicht darauf.
Danach hatte die Spannung etwas nachgelassen. Ihr wisst schon – wie sich die Wolken vor dem Regen zusammenballen, so ähnlich war es uns auf dem Weg von Killiney auch ergangen. Das Unwetter hatte sich zusammengebraut und schließlich entladen. Aber weil wir nun die Chance gehabt hatten, wenigstens einem Teil unseres Kummers Luft zu machen, konnten wir uns besser auf das einstellen, was vor uns lag. Wie sich herausstellte, hatten wir dazu allerdings nicht mehr wirklich Gelegenheit, denn als wir um die nächste Kurve bogen, waren wir am Ziel. Trautes Heim, Glück allein. Rechts war ein Tor und kurz dahinter, auf der linken Seite, ein Haus – das Hexenhäuschen. Und hinter dem kleinen grünen Gartentor standen Rosaleen und Arthur, die sicher schon Gott weiß wie lange auf uns warteten, denn inzwischen hatten wir fast eine Stunde Verspätung. Wahrscheinlich hatten sie sich vorgenommen, uns ganz locker und ungezwungen zu empfangen, aber als sie unsere Gesichter sahen, ließ sich die Scharade nicht mehr aufrechterhalten. Da wir nicht gewusst hatten, dass wir schon direkt vor dem Torhaus waren, befanden wir uns in einem reichlich desolaten Zustand. Barbara und ich hatten rote Augen vom Weinen, Mum saß mit grimmigem Gesicht auf dem Beifahrersitz, meine Haare waren völlig zerzaust – na ja, sagen wir mal, noch zerzauster als gewöhnlich.
Wahrscheinlich war dieser Moment für Arthur und Rosaleen ziemlich schwierig, aber ich war so mit mir selbst und meinem Widerwillen gegen diesen Umzug beschäftigt, dass ich keinen Gedanken daran verschwendete, was sie auf sich nahmen – sie stellten ihr Heim zwei Menschen zur Verfügung, zu denen sie eigentlich gar keine Beziehung hatten. Das muss unglaublich aufreibend für sie gewesen sein, aber ich kam kein einziges Mal auf die Idee, mich zu bedanken.
Barbara und ich stiegen aus. Sie ging zum Kofferraum, um das Gepäck zu holen, und vermutlich auch, um uns die Gelegenheit zu geben, uns in Ruhe zu begrüßen. Aber so lief es nicht: Ich blieb wie versteinert stehen, starrte Arthur und Rosaleen an, die sich ihrerseits keinen Schritt hinter ihrem grünen Gartentörchen hervorwagten, und wünschte mir, ich hätte Brotkrümel auf dem Weg von Killiney bis hierher ausgestreut, damit ich den Weg zurück nach Hause finden konnte.
Hektisch wie ein Erdmännchen blickte Rosaleen von einem zum andern und versuchte offenbar, gleichzeitig das Auto, Mum, mich und Barbara ins Visier zu bekommen. Dabei verschränkte sie abwechselnd die Hände vor der Brust und löste sie wieder, um sich das Kleid glatt zu streichen – absurde, fahrige Gesten, die mich an ein Mädchen erinnerten, das sich zur Kirmeskönigin wählen lassen will. Schließlich raffte Mum sich auf, öffnete die Autotür und stieg aus. Zögernd setzte sie einen Fuß nach dem anderen auf den Kies, aber als sie zum Torhaus hochblickte, verschwand auf einmal der Zorn aus ihrem Gesicht, und sie lächelte, sodass ihre mit Lippenstift verschmierten Zähne blitzten.
»Arthur!«, rief sie und breitete die Arme aus, als wäre sie selbst die Gastgeberin und würde ihren Bruder an ihrer Haustür zu einer Dinnerparty empfangen.
Arthur schleimschnaubte, atmete den Rotz tief ein – das erste Mal, dass ich diese Art der Kommunikation miterlebte –, und ich rümpfte unwillkürlich die Nase. Dann trat er auf Mum zu. Sie ergriff seine Hände und sah ihn mit zur Seite geneigtem Kopf an, während das seltsame Lächeln noch immer an ihren Lippen zog wie ein schlechtes Lifting. Mit einer linkischen Bewegung beugte sie sich vor und legte ihre Stirn an seine. Arthur ertrug die Berührung eine Millisekunde länger, als ich es von ihm erwartet hätte, dann tätschelte er Mums Nacken und wandte sich ab, um mir einen Klaps auf den Kopf zu geben wie einem treuen Collie, was meine Haare noch mehr durcheinanderbrachte. Schließlich ging er zum Kofferraum, um Barbara mit dem Gepäck zu helfen. So blieben Mum und ich mit Rosaleen allein und konnten uns ungestört anstarren, nur starrte Mum nicht mit, sondern atmete mit geschlossenen Augen die frische Luft ein und lächelte weiter. Trotz der deprimierenden Situation hatte ich in diesem Moment das Gefühl, dass der Umzug Mum guttun könnte.
Damals habe ich mir nicht so viele Sorgen um sie gemacht wie heute. Seit Dads Begräbnis war erst ein Monat vergangen, und wir fühlten uns beide noch wie betäubt und unfähig, viel miteinander – oder auch mit anderen – zu sprechen. Die meisten unserer Bekannten waren so damit beschäftigt, uns nette Dinge, taktlose Dinge oder was ihnen sonst so in den Kopf kam, zu sagen – manchmal kam es mir fast so vor, als müssten wir sie trösten, statt umgekehrt –, dass Mums Verhalten gar nicht weiter auffiel. Genau wie alle anderen seufzte sie gelegentlich und ließ hier und da ein paar passende Worte fallen. Eigentlich ist eine Beerdigung wie ein Spiel. Man muss einfach mitmachen, das Richtige sagen, das Richtige tun und ansonsten abwarten, bis es vorbei ist. Freundlich sein, aber auch nicht zu viel lächeln, traurig aussehen, aber nicht zu traurig – man möchte ja nicht, dass die Familie sich noch schlechter fühlt –, Hoffnung verbreiten, aber nicht so, dass der Optimismus als Mangel an Mitgefühl oder als Unfähigkeit zur Realitätsbewältigung ausgelegt werden kann. Denn wenn alle absolut ehrlich wären, würde es jede Menge Krach und Streit geben – Schuldzuweisungen, Tränen und Geschrei.
Ich finde, es müsste einen Realitäts-Oscar geben. Und der Oscar für die beste Hauptdarstellerin geht an Alison Flanagan! Dafür, dass sie letzten Montag ordentlich geschminkt und geföhnt durch den Hauptgang im Supermarkt marschiert ist, obwohl sie eigentlich sterben wollte, und dabei sogar noch Sarah und Deirdre von der Elternvertretung freundlich angelächelt und sich überhaupt nicht so benommen hat, als wäre sie gerade von ihrem Ehemann mit drei Kindern sitzen gelassen worden. Bitte, Alison, kommen Sie auf die Bühne, und nehmen Sie Ihre wohlverdiente Auszeichnung entgegen! Der Preis für die beste Darstellerin in einer Nebenrolle geht an die Frau, wegen der Alisons Mann sie verlassen hat. Sie hat nur zwei Gänge weiter am Regal gestanden und so hastig den Supermarkt verlassen, dass sie zwei Zutaten für die Lieblingslasagne ihres neuen Freunds vergessen hat. Als bester Hauptdarsteller wird Gregory Thomas ausgezeichnet, und zwar für seine Leistung beim Begräbnis seines Vaters, mit dem er die letzten zwei Jahre kein Wort gewechselt hat. Bester Nebendarsteller ist Leo Mulcahy für seine Rolle als Trauzeuge bei der Hochzeit seines besten Freunds Simon mit der einzigen Frau, die Leo jemals wirklich geliebt hat und lieben wird. Kommen Sie, und holen Sie Ihre Trophäe ab, Leo!
Damals dachte ich, Mum würde einfach die Rolle der guten Witwe spielen, aber als sich ihr Verhalten nicht änderte und ich immer mehr den Eindruck gewann, dass sie wirklich nicht wusste, was um sie herum abging, als sie die gleichen kleinen Worte und Seufzer einfach weiter bei jedem Gespräch benutzte, fragte ich mich, ob sie vielleicht bluffte. Ich frage mich immer noch, wie viel sie tatsächlich begreift und wann sie uns nur was vorspielt, um sich nicht mit der Wirklichkeit auseinandersetzen zu müssen. Dass sie sich unmittelbar nach Dads Tod sonderbar verhalten hat, ist ja verständlich. Aber als die anderen sich dann wieder ihrem eigenen Leben zuwandten, wurde sie nicht etwa langsam wieder normal, sondern driftete immer weiter ab, und offenbar war ich der einzige Mensch, der das bemerkte.