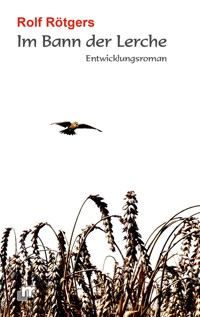
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Basierend auf persönlichen Aufzeichnungen aus seiner Jugendzeit widmet sich Rolf Rötgers der eigenen Geschichte. Dazu gibt er seinem Protagonisten einen anderen Namen, denn diese winzige Distanz benötigt er, um nicht hoffnungslos in den persönlichen Erlebnissen zu versinken. So zoomt er sich hinein in das Leben des 18-jährigen André und weicht ihm die folgenden zwei Jahre nicht mehr von der Seite. Dabei öffnet er die Tore zu intimen Welten aus Ängsten, Zweifeln und Hoffnungen, Tragik und Melancholie, aber auch absurder Komik. Mal beschwingt und gut gelaunt, mal ernst und berührend, manchmal todtraurig und geheimnisvoll zerrt der Autor den Leser in das verworrene Seelendickicht eines ausweglos besessenen Sprachenthusiasten. Ein sehr privates Buch für alle, die so wie André von der optimistischen Einstellung heimgesucht wurden, dass neben jedem stechenden Dorn mit etwas Glück durchaus eine saftige Brombeere baumeln könnte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 389
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zum Autor
Rolf Rötgers schreibt, malt, singt, musiziert und gestaltet seit seiner Jugendzeit. Er publizierte und illustrierte Bücher in den Genres Belletristik, Kinderbuch, Lyrik / Poesie, war Mitbegründer verschiedener Start-ups und entwickelte Spiele und neue Sportarten. In der Kultur- und Medienwerkstatt sowie im Musiclabel indigoteam veröffentlichte er eine Reihe von Alben in den Genres Chanson, Jazz, Experimental und Weltmusik, die er im eigenen Studio aufnahm.
Im Bann der Lerche ist sein erster Roman.
Mehr zum Autor finden Sie im Internet unter
www.rolf-roetgers.net
Inhaltsverzeichnis
Einstieg
Blackout
Sira
Joe
Der alte Richard
Anne
Die Lerche
Marie
Der Traum
Die Reise
Die Entscheidung
Das Haus
Käsekuchen
Der Bote
Abschied
Elena
Robert
Bardel
Besuch
Pusteblume
Zweifel
Antworten
Gerüchte
Nachtrag des Autors
Einstieg
Ich bin André. Und dies ist meine Geschichte. Wir schreiben das Jahr 1976, und ich bin 18 Jahre alt. Ich werde einen schweren Krampfanfall erleiden, und von da an wird sich mein Leben verändern. Mein Körper und meine Psyche werden Schaden nehmen und plötzlich am Abgrund taumeln.
Ich jedoch werde die Zeichen nicht zu deuten wissen, werde über eine lange Zeit nicht begreifen, woher meine Ängste und meine dunklen Visionen kommen.
Schon seit meiner Kindheit will ich die Welt mit meinen Träumen erobern, doch seit jeher erobert sie mich. So schleppe ich einen Sack voller Fragen mit mir herum und einen zweiten, in dem ich Antworten sammle für mein kleines, kompliziertes Leben, das sich nicht richtig einpassen lässt in diese aufdringliche Wirklichkeit.
Auf meiner Reise zwischen Hingabe und Widerstand, Hoffnung und Zweifel, Liebeskummer und Rasterfahndung schließe ich außergewöhnliche Freundschaften mit einem holländischen Koch, der gerade aus einem deutschen Gefängnis entlassen wird, mit Marie, meiner unerfüllt bleibenden Liebe, mit einer Katze und einem Sperling, und mit der Lerche, diesem wahnsinnigen Vogel, der im Sommer senkrecht über den Feldern aufsteigt und minutenlang singt, ohne Luft zu holen.
Diese Geschichte ist weder frei erfunden noch ist sie völlig ungelogen. Sie entspricht also der Wahrheit und der Wirklichkeit genauso wie der Lüge und der Phantasie. Das sei korrekterweise erwähnt. Ändern wird es nichts.
Blackout
"Meine Damen und Herren, Sie hören das Wetter: Heute gibt es eitel Sonnenschein für Machos, es ist wechselnd bewölkt für Enthusiasten und wir haben eine Unwetterwarnung für Idealisten vorliegen. Die gefühlten Werte schwanken zwischen keine und zu viel. Darüber hinaus schwirren einige Feststellungen und Fragen durch den Raum. Wir wissen, dass unter Bäumen ein Mensch steht, ein unbedeutender Mensch, dass unter Menschen ein Baum steht, ein unbedeutender, einsamer Baum, und dass unter Menschen ein Mensch steht, ein unbedeutender, einsamer, fragender Mensch. Er lebt, um zu leben. Er hat Angst vorm Leben, weniger vorm Tod. Er hat Angst vor Schmerzen. Er ist ich. Ich bin André. Aber wer bin ich?"
Ich sah in den Spiegel, sprach zu mir selbst und dachte nach. In jeder wachen Minute dachte ich. Aber denken vermochte ich sogar im Schlaf. Ich dachte nach über jeden, über mich und über sie. Sie bot mir ein kleines Stück Hoffnung, vielleicht einen Traum, den es wirklich gab. Sie erschien mir wertvoller als ich mir selbst, weil ich mir ohne sie ziemlich wertlos vorkam. Aber das wusste sie nicht, konnte sie nicht wissen - ich hatte es ihr ja nicht gesagt. Und ich wusste es auch nicht, damals. Mein Gefühl jedoch sprach es wortlos aus.
Sie war meine erste große Liebe, die erste Verschmelzung des Ich mit dem Du. In meinem Bauch floss glühende Lava, immer noch, obwohl die Verschmelzung längst in Widerstand erstarrte. Das Du entfernte sich ganz langsam und ließ eine neue Dimension des Leidens in meinem Leben zurück. Meine Hoffnung hielt das Leiden aufrecht. Lag darin etwa der Sinn der Hoffnung?
"Hey, Spiegel! Ich seh mich. Aber seh ich mich wirklich oder ist das nur eine Projektion? Und was ist mit dir? Gibt es dich oder bestehst du aus der Projektion meines Gehirns? Sind Spiegel Persönlichkeiten oder spiegeln sie allenfalls Persönlichkeiten?"
Ich lachte.
"Ist dieses Lachen echt?"
Der Spiegel antwortete nicht. Das Lachen hatte sich längst verselbständigt. Es entsprang einer seltsamen Zufriedenheit, die sich im freien Raum zwischen dem Unglück ausbreitete. Aber viel Platz gab es da nicht. Das Glück quetschte sich in einen kleinen Spalt und wurde von allen Seiten bedrängt.
Ich studierte meinen Körper. Der baute sich schlank mit breitem Brustkorb, starken Armen und einem Entenarsch vor mir im Spiegel auf. Solch ein Hohlkreuz störte natürlich. Die übertriebene Biegung der Wirbelsäule verdarb letztendlich ein gelungenes Design.
"Kann man solch eine Wirbelsäule eigentlich geradebiegen?"
Diese Frage stellte ich mir nicht zum ersten Mal. Viele Selbstversuche hatte ich schon unternommen. Erfolglos.
"Das Biest geht immer wieder in die alte Form zurück. Sehr wahrscheinlich muss ich mich damit abfinden."
Zwischendurch rasten die Gedanken zu ihr. Sie ließen mich nicht los, schüttelten und streichelten und schlugen mich. Ich verließ das Zimmer, noch einmal ein kurzer Blick. Sie war nicht da.
"Verfluchter Mist! Warum bin ich nur ein Mensch? - Jaja, weil ich kein Huhn bin, das weiß ich. Ist aber vermutlich nicht die Antwort auf meine Frage. Das Menschsein fühlt sich so schwer an, erdrückend, existentiell. Eine Last. Tagein, tagaus dieses Gewicht. - Als hätte ich jemals Gewichtheber sein wollen."
Besonders leicht ertrug ich mein Leben nicht. Und das sollte sich in den folgenden zwei Jahren kaum ändern. Natürlich, es würde gute Phasen geben und glückliche Momente, aber insgesamt betrachtet hatte ich Probleme ohne Ende an den Hacken.
"Am liebsten würde ich auf einem Kissen sitzend übers Meer schaukeln. Stattdessen glotze ich in den Spiegel und begegne mir. Ein kompliziertes Pärchen, mein DoppelIch, bei dem der Eine den Anderen nicht versteht. Oder verstehen wir uns? Ich dich und du mich? Ich mich und du dich?"
Ich stand, mich selbst betrachtend, da - und wurde plötzlich traurig. Unter solchen Gefühlen dachte ich mit dreifacher Geschwindigkeit. Eine Träne floss mir an der Nase entlang und klammerte sich an die Oberlippe. Meine Zunge wischte sie weg.
"Trauer schmeckt salzig. Ich glaube, ich wäre glücklich, wenn ich jetzt ihren Atem spüren könnte."
Nichts passierte.
"Verdammtes Leben! - Ich schlag alles kaputt, den Tisch, den Stuhl, den Schrank!"
Ich hämmerte gegen die Tür.
"Ich reiß dich raus, du Scheißtür! Ich reiß alles raus!", brüllte ich. Dann rannte ich aus dem Haus, stürmte in den Wald und schrie, als würde jemand mir Gewalt antun. Ein morsches, dünnes Bäumchen sollte herhalten für meinen Frust. Ich trat zu. Mit der Fußoberseite. Ziemlich unüberlegt und äußerst unangenehm.
Ich wälzte mich zwischen den Blaubeerbüschen und zählte den Schmerz in Buchstaben. Das Alphabet war im Nu durchschritten.
"Du saublödes Alphabet!"
Vom Waldboden aus sah ich durch die Blaubeerbüsche in die Kiefern- und Fichtenkronen.
"Hier bleibe ich liegen bis zu meinem Tod."
Ein schneller Entschluss mit einer noch schnelleren Halbwertszeit, denn auf meinem linken Arm kribbelte es. Da saß eine Ameise. Nein, vierzig, fünfzig. Ich schlug zu und sprang hoch.
"Idioten!"
Anschließend humpelte ich aus dem Wald. Das morsche, dünne Bäumchen stand noch so wie zuvor. Ich würdigte es eines unwürdigen Blickes und flüsterte: "Ich komm wieder ... mit Axt. Und dann werde ich einem unbedeutenden, einsamen Baum zeigen, wozu ein unbedeutender, einsamer Mensch fähig ist, wenn ihn die Neugier treibt, zu erleben, wozu ein unbedeutender, einsamer Mensch fähig ist, wenn er mit einer Axt bewaffnet zu einem unbedeutenden, einsamen Baum geht. - Ach, verdammt! Ist mir schon klar, dass du mich nicht ernst nimmst und auch nichts dafürkannst. Wer nimmt mich schon ernst? Selbst bei ihr weiß ich nicht, wie bedeutend ihre Liebe zu mir ist. Und trotzdem. Ich glaube, ich wäre glücklich, wenn ich jetzt ihren Atem spüren könnte."
Nichts passierte. - Doch! Kaum merkbar und seltsam. Ein kühler Hauch wirbelte um meinen Körper. Das war nicht ihr Atem. Nein. Das war etwas Fremdes. Etwas, das sich den Weg in mein Leben bahnte.
Am nächsten Morgen lag ich wach im Bett. Der Gedankenmotor begann zu brummen. Ich gab Gas, und mein Turbolader schob mich rasch weiter ins Reich der Phantasie. Das Spiel mit Worten beherrschte ich in einer mir ansonsten eher uneigenen Spontanität. Trotzdem war Sprache für mich eine große Herausforderung, denn ich wollte weit mehr, als nur in abgedrehten Monologen und Dialogen glänzen. Ja, ich spürte eine tiefe Sehnsucht und eine befriedigende Freude an philosophischen Erkenntnissen, sofern sie denn von mir kamen. Natürlich wusste ich, dass auch andere Menschen gute Gedanken hatten und viele Weisheiten schon existierten, bevor sie mir einfielen. Entscheidend war einfach, dass ich erst nach meiner eigenen Erleuchtung von ihrer Existenz erfuhr. In anderen Fällen fühlte ich mich um die persönliche Leistung betrogen, was leider häufiger vorkam.
Ich biss in meine Zudecke, zerrte und riss mit den Zähnen an ihr herum und kaute anschließend auf einem Büschel Wollflusen. Lecker war das nicht. Aber ich erwartete auch keine kulinarischen Genüsse. Es war einfach von Bedeutung, dass ich etwas tat, was man normalerweise nicht tat.
"Hey! Ich muss noch viel verrückter werden, damit die anderen begreifen, wie normal sie sind."
Schade nur, dass mich dabei niemand sah, denn die erhoffte Wirkung fand während des Alleinseins lediglich in meiner Phantasie statt und drang auf diese Weise nicht vor bis in die adressierte Außenwelt.
Eine Fliege surrte an mir vorbei, zog einige Kreise und landete dann kurz vor meiner Hand auf dem Bett.
"Na, kleine Fliege! Du glaubst bestimmt, du hast dir diesen Landeplatz ausgewählt, oder? Stimmt nicht. Der Landeplatz wählte dich. Schließlich hat der schon eine ganze Weile auf dich gewartet. So ist das nämlich."
Langsam schob ich meinen Zeigefinger an sie heran. Noch fünf Zentimeter, noch vier, noch drei, die Spannung wuchs. Flog sie davon? Noch einen Zentimeter, ich glaubte, sie schon zu fühlen. Sie saß regungslos da, anscheinend voller Erwartung. Jetzt berührte ich sie, und dann spürte ich, wie ihre Beine sich über meinen Finger bewegten.
"Streng dich an, André. Du musst dich ganz locker konzentrieren und dann jeden einzelnen Schritt von ihr zählen. Zähl mit, los, zähl mit!"
Unmöglich.
"So dumm sind wir Menschen. Und wie klug bist du, du kleines Leben?"
Ich pustete sie weg.
"Ich weiß, ich weiß! In Wirklichkeit wolltest du nur auf meinem Windstoß reiten. Deshalb warst du überhaupt gelandet. - Bist du ein Männchen oder ein Weibchen?", rief ich ihr hinterher. "Ich jedenfalls halte mich für ein Männchen, aber man kann ja nie wissen."
Ich sah nach, nickte bestätigend, schlurfte ins Badezimmer und stand vorm Spülstein. In Kopfhöhe der Spiegel, schon wieder. Ich erkannte mich darin. Dem Spiegel ging's genauso.
"Blödes Ding."
Jetzt drehte ich ihn um, befestigte den Spiegel also mit der Vorderseite an der Wand. Ich grinste, keiner grinste zurück. Zufrieden begann ich, mich zu waschen. Zähne putzen.
"Dabei muss ich mich sehen."
Wieder wendete ich den Spiegel. Dem war's egal, er hatte keine Zähne.
"Noch schnell die Haare bürsten und dann auf die Waage. 125 Pfund, Donnerwetter!"
Ich hüpfte herunter, stellte mich noch mal drauf.
"124 1/2 Pfund, schon besser."
Dann wog ich ein drittes Mal.
"124 Pfund. Die Waage gefällt mir. Die frisst meine Pfunde. Die ist viel flexibler als ein Spiegel und nimmt mich jederzeit anders wahr. Hörst du das, Spiegel? Nur in dir seh ich immer gleich aus. Dabei bin ich niemals gleich. Ich lass dich jetzt mit dir allein. Dann kannst du die gegenüberliegende Wand anstarren, die sich ja in dir spiegelt. Theoretisch müsstest du dann auch als Wand gucken können und so dich selber sehen. Aber was verstehst du schon?"
Ich verließ das Badezimmer, nahm eine Banane und schälte sie.
"Der Gorilla wurde von der Banane gefressen. Er muss also in ihrem Bauch sein. Aber wo hat sie ihren Bauch? Hallo, Banane, wo hast du deinen Bauch? Sicher in der Mitte der Krümmung. Ich will den Gorilla."
Ich durchbohrte mit dem Zeigefinger die Banane. An drei verschiedenen Stellen. Kein Gorilla zu finden.
"Erstaunlich! Viel Platz bleibt jetzt nicht mehr für ihren Bauch."
Ich umfasste sie mit beiden Händen und drückte zu. Alles Matsche. Kein Gorilla.
"Vielleicht habe ich ihn zerquetscht?"
Enttäuscht warf ich die Banane in den Komposteimer.
"Ich will doch keinen Affen mitessen."
Ich verzichtete auf das Frühstücken.
"Kann ja keiner wissen, wo überall ein Affe drinsteckt."
Möglicherweise steckte er in mir selbst.
Die Stunden strichen dahin und füllten sich mit allerlei verrückten Gedanken. Ich genoss die heißen Tage des Sommers 1976 auf meiner Haut, doch manchmal fror es mich innerlich in einem wallenden Meer aus süßer, trauriger Sehnsucht.
Vieles trug zu diesen Gefühlen bei, vieles aus meinem bisherigen Leben, das vor achtzehn Jahren so voreilig begann. Die Menschen schrieben damals einen eher bedeutungslosen Tag in die Geschichtsbücher, den 22. März 1958. Keine natürliche und keine weltpolitische Katastrophe jagte als Nachricht um den blauen Planeten. Persönliche Schicksale aber gab es viele, gerechte und grausame, glückliche und bedrückende, spannende und langweilige, täglich, stündlich und unwichtig für die große Bühne, auf der der Deutsche Bundestag, parteipolitisch bis in die Haarspitzen engagiert, über die Außenpolitik, die Wiedervereinigung und die atomare Rüstung debattierte.
Verteidigungsminister Strauß erklärte, ein Verteidigungsminister sei ein Friedensminister, der Starfighter ein umweltfreundliches Segelfluggerät und der Kampfpanzer Leopard ein technologisches Spitzenprodukt, das sich insbesondere zum Pflügen der Äcker bewährt habe. Da näherte sich die 77-jährige CDU-Abgeordnete Dr. Helene Weber mit einem freundlichen Lächeln und zwei Tafeln Schokolade bewaffnet der Regierungsbank und reichte Dr. Adenauer und Dr. von Brentano die parlamentarische Tagesration menschlicher Zuneigung. Verteidigungsminister Strauß wurde bei diesem süßen Angriff nicht berücksichtigt, weil er ohnehin schon eine schlechte Figur machte.
Parallel dazu quälte ich mich in der Stadt Gronau in Westfalen im evangelischen Krankenhaus ans Licht der Welt. Ich kam genau einen Monat zu früh. Vielleicht lief die Zeit auch nur zu langsam ab. Sollte das zu Schwierigkeiten in den deutschen Verwaltungen führen, weil ich nun einen zusätzlichen Lebensmonat besaß, so sah ich absolut kein Problem darin, diesen Monat später durch Geschwindigkeitsverzicht wieder auszugleichen. Wenn es sein musste, war ich langsamer als jede Verwaltung.
Die Hebamme griff mit einer Hand von hinten um meinen Rücken und hielt viereinhalb Pfund Skelett in die Luft, von dem die überschüssige Haut in langen Falten herabhing. Aus zweierlei Gründen vollzog ich die Geburt so voreilig. Erstens wollte ich meinen Vater noch kennenlernen, und zweitens bestand ich darauf, ein Märzkind zu sein, denn die Natur erwachte gerade aus dem Winterschlaf. Die Stare flogen aus dem Süden ein und riefen meinen Namen. Nur wenigen Menschen war es vergönnt, von den Staren auf die Welt gerufen zu werden, nur jenen eben, die die Gabe in sich trugen, die Sprache der Tiere zu verstehen. Eingesperrt im Mutterleib lauschte ich gespannt den Stimmen der Vögel. Ohne Zweifel, sie meinten mich. Also kam ich heraus, dem verlockenden Ruf der Stare folgend.
Nun blieben mir 30 Tage Zeit für Begegnungen mit meinem Vater. Dieser Monat reichte jedoch nicht für eine spätere Erinnerung, denn mein Vater starb absolut pünktlich zu meinem offiziellen Geburtstermin. Er fuhr mit dem Motorrad in ein Schaf. Das Motorrad war kaputt, das Schaf war kaputt, mein Vater war kaputt. Und niemand wusste etwas von dem Austausch, der sich damit heimlich vollzog. Denn der so Verstorbene pflanzte seinen Abschied in meinen kindlichen Beginn und machte damit für mich jeden Anfang und jedes Ende zu unzertrennlichen Gefährten.
Mein ganzes Leben sollte davon bestimmt werden, von den starken Gegensätzen, die oft unvereinbar schienen. Und ich hörte wieder die Stare, die die letzten auserwählten Kinder aus den Bäuchen der Mütter lockten, und ich lauschte den Schwalben, die mich aufgeregt weiter in das Jahr zerrten. Und als der warme Sommerwind meine faltige und schrumpelige Haut ganz glattgebügelt hatte, da vernahm ich zum ersten Mal die Lerche. Sie sang von tiefer Trauer und von großer Freude und schloss eine melancholische Freundschaft mit mir, dem Frühlingskind. Sie erzählte Lied für Lied von den kalten Tagen, die zu jeder Jahreszeit kommen können und die ich noch nicht kannte. Die Lerche war unglaublich. Wie ein Magnet zog sie mich in ihren Bann. Ihr Gesang tropfte vom Himmel und rieselte nieder auf mich. Und ich stand wie gefesselt da als staunendes Kind und später als fragender, junger Mann. Jahr für Jahr brachte sie mein Herz mit ihrer gewaltigen Stimme zum Glühen. Aber sie vermochte es auch einzufrieren. Davor schützte nicht einmal der heißeste Sommer. Sie sprach von Liebe, und ich schmolz dahin in einem fernen Glück. Sie sprach von Angst, und ich fühlte mich beobachtet.
Es gab eine Mystik, die tief und verborgen lag, unentdeckt, verschüttet und lauernd. Mit meiner Fähigkeit, die Sprache der Vögel zu verstehen, wurde ich in die Welt geboren und wuchs ich auf. Ich konnte diese Tatsache nicht leugnen, vor mir selbst schon gar nicht. Aber kaum jemand nahm mich ernst, wenn ich davon erzählte. Und es lebte niemand mehr, der mir das wirklich glaubte.
Dennoch stand ich damit erst am Anfang einer rätselhaften und unheimlichen Geschichte, meiner Geschichte, die sich manchmal in diffusen Ahnungen ankündigte. Sie lag verschwommen und ungreifbar vor mir, wie eine entfernte Spiegelung auf erhitztem Asphalt.
All diese Erlebnisse und Wahrnehmungen trugen zu meiner Sehnsucht bei, die keinen festen Ursprung und kein festes Ziel kannte. Unbändig explodierten meine Gefühle, manchmal chaotisch und meistens bestimmend. Ich probierte beides aus, mich ihnen hinzugeben oder mit ihnen zu kämpfen, wenn sie von mir Besitz ergriffen. Dann wehrte ich mich mit Händen, Füßen und Worten gegen ihre Eroberungsversuche.
"Ich lass mich von euch nicht an der Nase herumführen. Ich bin Herr im eigenen Körper! Da spielt es überhaupt keine Rolle, ob der einen Entenarsch hat oder nicht. Für destruktive Gefühle habe ich einfach keinen Platz, die brauch ich nicht, die will ich nicht, die sind auch nicht von mir“, sagte ich zu meinen Gefühlen in zornigen Minuten und meinte eigentlich mich selbst.
So gern ich es auch leugnete, ich war viel zu oft nicht Herr meiner Gefühle, und von nun an auch nicht mehr Herr meines Körpers. Denn dieser geriet plötzlich außer Kontrolle.
Ausgerechnet mein Körper! Auf den hatte ich mich gestützt, dem konnte ich vertrauen, der war verlässlich. Und nun ließ er mich derart unvermittelt im Stich. - Warum?
Im Sog dieser neuen Erfahrung wankten schlagartig auch meine Gedanken, mein Verständnis und mein Selbstverständnis in einem unbekannten Ausmaß, jene Pfeiler des Vertrauens, an denen die Zweifel bereits seit einiger Zeit rüttelten. Und dann die verworrenen Emotionen, die Planlosigkeit, das Geheimnisvolle, diese ganze Last des Lebens, diese mir auferlegte Bürde da zu sein und mit der Wirklichkeit irgendwie zurechtkommen zu müssen. Das brachte mich zu Fall. An diesem Morgen. Jetzt!
Ich spürte ein leichtes Zucken in der Unterlippe.
"Nanu?", wunderte ich mich.
Es wurde stärker.
"Hey, hey, das ist meine Lippe. Und wenn die zucken soll, dann sag ich es ihr schon!"
Ungeachtet dessen begann die Oberlippe ebenfalls unruhig zu hüpfen. Ich stand auf, um in den Spiegel zu sehen. Meine Sprache verstummte nun bereits vor den Stimmbändern. Kein Wort drang mehr von innen nach außen. Die Beine knickten unsicher ein. Ich stolperte durch die offene Tür. Meine Kiefermuskeln verkrampften sich. Ich fiel vornüber und landete mit der rechten Stirn auf der spitzen Ecke der Schrankschublade. Ein kurzer Stich jagte durch meinen Kopf. Den Körper gebeugt, kniete ich auf dem Boden. Meine Oberlippe zog sich links hoch, die Unterlippe rechts runter. Verzweifelt leistete ich Widerstand, versuchte ich, meinen verzerrten Mund zu öffnen. Dann fühlte ich einen seitlichen Salto, und es wurde finster. Ich hatte keine Chance gegen diesen plötzlich auftretenden Krampfanfall. Eine gewaltige Attacke.
Wahrscheinlich nach ein paar Minuten kam ich wieder zu mir. Ich nahm meine Umgebung noch unklar wahr, aber meine Sinne erwachten allmählich. Ich sah meine roten, blutverschmierten Hände und das eingefärbte Hemd. Die Kopfwunde schmerzte. Was passiert war, wusste ich nicht. - Also kroch ich zum Telefon.
"St. Antonius-Hospital Gronau, guten Morgen."
"Guten Morgen. Ich bin's. Wenn Sie gerade nichts zu tun haben, könnten Sie mir einen Krankenwagen schicken."
"Wer sind Sie, und worum geht es denn?"
"Ich bin André, und es geht um mich. Ich blute. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ich brauche einen Krankenwagen."
"Wo sind Sie?"
"In Bardel. Die Straße, die zum Kloster führt. Und dort die Hausnummer 37a."
"Es wird gleich jemand kommen."
"Danke."
Das dauerte eine Weile, denn ich lebte mit meiner Mutter in der Gemeinde Bardel, acht Kilometer entfernt von der nächsten Stadt. Kurz nach meinem fünften Geburtstag zogen wir damals in diese schöne ländliche Gegend am Rande des Münsterlandes. An ihrer Westseite verlief die holländische Grenze, und im Osten schloss ein großes Moor ihre Fläche ab. Diese kleine, schwach besiedelte Insel bekam für mich schnell Weltbedeutung. Sie war für mich berauschend wie das Nachtleben der Großstädte, aber bei weitem nicht so oberflächlich. Ich liebte die Natur in all ihren Facetten. Es gab Orte, für die empfand ich eine extrem tiefe, innige Verbindung. Eine Art Zuhause-Gefühl. Nein, eigentlich verbarg sich da noch mehr. Eine Zuhause-Gefühl-Illusion. Denn unter dem Zuhause-Gefühl versteckte sich eine weitere Emotion, die Sehnsucht.
In den ersten Jahren hatte dieses Sehnen keine Adresse. Es gab nur eine süße Trauer hinter einem diffusen Schleier. Den Grund für die Existenz meiner Sehnsucht konnte ich lange Zeit nicht entdecken, nämlich die Tatsache, dass jeder Tag, jede Stunde, jede Minute, ja, die Gegenwart an sich durchtränkt war mit permanentem Abschied. Die Vergänglichkeit machte mich heimlich melancholisch. Ich mochte diesen Zustand durchaus. Doch es gab auch ein in die Zukunft gerichtetes Verlangen. Und dieses zeigte mir beständig, dass in meinem Leben etwas fehlte. Aber da ich noch nicht wusste, was das war, wusste ich auch nicht, wonach ich suchen sollte.
Manchmal fragte meine Mutter mich: "Was machst du eigentlich immer im Wald? Jeden Tag verschwindest du stundenlang in diesem grünen Dickicht. Was gibt es da zu sehen?"
"Ach, Mütterchen", antwortete ich darauf, "der Wald besitzt eine Tiefe, die kein Haus in sich verbergen kann. - Es gibt allerdings auch Tiefen, in denen sich kein Wald befindet. Und die wiederum entdecke ich manchmal sogar in einem Haus. Die Welt zeigt sich in solchen Momenten teuflisch verzwickt, findest du nicht auch?"
Sie schüttelte verständnislos den Kopf, denn das war wieder eine meiner typischen Antworten. Nicht wirklich konkret, aber auch nicht so sinnlos, als dass man mir vorwerfen könnte, ich hätte die Frage außer Acht gelassen. Was sollte ich machen, wenn mir die Antworten, die alle Fragenden hätten zufriedenstellen können, nicht zur Verfügung standen?
Wir wohnten in einer kleinen Siedlung alter Zollhäuser, die gebaut waren aus roten Ziegeln und jeweils zwei Familien Platz boten. Hier sollte ich den größten Teil meiner Kindheit verbringen. Für manche wäre es vielleicht ein trostloser Ort gewesen, für mich nicht. Als wir damals nach Bardel zogen, wusste ich noch nicht, dass dies meine erste und auch letzte Heimat werden würde. Aber gleich der Anfang gestaltete sich zu einem unvergesslichen Ereignis.
Während die Erwachsenen Möbel schleppten, sah ich mir sämtliche Räume meines neuen Zuhauses an. Als ich die Badezimmertür öffnete, machte mein Herz einen Sprung und ich flüsterte: "Guck mal!"
Ich staunte und schwieg minutenlang sprachlos vor Begeisterung über diese erste fest installierte Badewanne meines Lebens. Und weil ich so drängelte, füllte meine Mutter sie abends bis zum Rand mit dampfendem Wasser. Ich sackte in den heißen See und entschwand in ferne Welten. Das Brennholz im Heizkessel knisterte und die Temperatur in dem kleinen, gerade einmal drei Quadratmeter großen Raum kletterte in fast unerträgliche Dimensionen. Kaum etwas anderes empfand ich je als so wunderbar, wie in der Badewanne zu sitzen und meine Gedanken fliegen zu lassen. Diese wohlige Wärme, die den ganzen Körper erfasst, strahlt von außen nach innen. Von außen nach innen Wärme zu verbreiten, scheint der Natur vorbehalten, also den lebenswichtigen Elementen und den Lebewesen, deren Natürlichkeit intuitiv ist Es gibt auch solche Menschen.
Nebenan lebte ein altes Ehepaar. Herr und Frau Sieder verteilten zur Nachbarschaftsbegrüßung eingekochte Pfirsiche. Sie saßen oft am Ende des großen Gartens auf einer kleinen Bank vor den Kaninchenställen. Sie redete und er schwieg, das änderte sich während meiner ganzen Kindheit und Jugend nicht.
Herr Sieder schaffte es trotz seines hohen Alters, stundenlang im Garten Kartoffeln auszugraben und einzusammeln. Die redeten wenigstens nicht. Das verlieh ihm Ausdauer und Kraft. Der Garten konnte deshalb auch nicht groß genug sein. Außerdem musste jeden Sommer Brennholz gesägt, gehackt und äußerst penibel gestapelt werden. Die übertriebene Sorgsamkeit war keine Pflicht. Er schenkte sich selbst ein wenig schweigsame Zeit, indem er den Vorgang in die Länge zog.
Auf dem Areal der Sieders standen Pfirsich-, Kirsch- und Esskastanienbäume, bei uns einige Apfel-, Pflaumen- und Birnenbäume.
Es gab keine Straßennamen in Bardel, nur Hausnummern, die fortlaufend verteilt wurden. Jedes neue Wohngebäude bekam die nächsthöhere noch unbesetzte Ziffer. Die kleinste Nummer markierte somit das älteste Haus. Die Räume in den Zollhäusern besaßen etwa 3,50 m Deckenhöhe. Für mich war das eine Fehlkonstruktion.
"Mein Zimmer wäre wesentlich größer, wenn ich es umkippen könnte", kommentierte ich diesen Zustand. "Da ich aber mein Zimmer nicht umkippen kann, ist dieses Gebäude keine architektonische Meisterleistung."
Diese Feststellung veränderte an den Tatsachen leider überhaupt nichts. Ich wohnte in einem Hochkantzimmer. Manchmal lehnte ich mich bäuchlings gegen eine seiner Wände, drehte den Kopf zur Seite und bildete mir ein, ich läge auf dem Fußboden. Das war jedoch keine nachhaltige Lösung, denn nachts hätte ich mein Bett senkrecht stellen und mich daran festbinden müssen, um das Wegsacken der Beine beim Einschlafen zu verhindern.
Meine Mutter arbeitete in einem nahegelegenen Franziskaner-Kloster, das in sich viele Geschichten und persönliche Schicksale verbarg. Meine Erinnerungen an die eigene Kindheit sollten später fest verwachsen sein mit dem Kloster Bardel, für immer gezeichnet von den zwiespältigen Gedanken an meine nicht erfüllten Träume und an meine großen menschlichen Enttäuschungen.
Jetzt lag ich auf dem rauen Kokosteppich des Flures und wartete auf den Krankenwagen. Durch die geöffnete Haustür ließ ich Luft und Licht herein. Vielleicht erhellte das meinen Geist. Welch unbändige Kraft hatte einige Minuten zuvor von meinem Körper Besitz ergriffen. Ich war tief beeindruckt von diesem wilden Überfall, der so urplötzlich und unvorbereitet geschah. Und ich stand dem Ereignis noch völlig verständnislos gegenüber. Während also meine verwirrten Gedanken in mir suchend umherjagten, blieb mir weder Zeit noch Sinn für die Gefühle der Angst. Ein kleiner Vorteil für den Moment. Die Angst allerdings fand genau in diesen Augenblicken einen neuen, nahrhaften Boden für ihre Existenz. Sie nutzt jede Gelegenheit, um sich einzunisten. Und sie verwertet Krankheiten und unangenehme Erlebnisse wie wir unsere Nahrung. Ihr Charakter entpuppt sich als hilfreich oder tyrannisch, das sind ihre zwei Gesichter. Dazwischen gibt es nichts.
Ich atmete tief, als die graue Wolke am Himmel vom Wind vertrieben wurde und die Morgensonne durch die Zweige des Apfelbaumes hindurchschoss und mir ins Gesicht strahlte. Das tat gut, und allmählich fühlte ich mich besser. Der Schmerz schwächte sich ab und meine Wahrnehmung klärte sich.
"Steh auf, Alter! Du musst einen Zettel schreiben, damit sie weiß, wo du abgeblieben bist."
Ich wankte etwas, aber der Körper gehorchte meinen Anweisungen wieder.
"Schau an, die Feinmotorik funktioniert noch. Da muss ich mich wohl unter den Lebenden befinden", sprach ich und schrieb: Liebes Mütterchen, mich hat's erwischt. Ich weiß zwar nicht, was es war und was es wollte, aber es suchte mich ziemlich eindeutig aus. Ansonsten kann ich sogar noch Briefchen vollkritzeln. Ich ruf Dich an. André.
Als draußen der Krankenwagen vorfuhr, kam ich den Sanitätern schon entgegen. Meine Kopfwunde blutete nicht mehr, die rechte Gesichtshälfte jedoch leuchtete rot in der Sonne. Ich hatte mir das im Spiegel angesehen und sofort folgenden Entschluss gefasst: "Davon wisch ich nichts ab!"
Irgendwie liebte ich diese harmlose Dramatik und natürlich hoffte ich, meiner großen Liebe, die im Krankenhaus arbeitete, so zu begegnen. Ob das etwas verändern würde, wusste ich nicht. Ihre Nähe war wichtig. Wie sie zustande kam, war unwichtig. Als man mich in die Ambulanz brachte, sah ich ihre erschreckten Augen. Welch ein glücklicher Zufall, dass sie heute, exakt zu dieser Zeit an diesem Ort anwesend war! Mir huschte voller Freude ein Lächeln auf meine Lippen.
"Wusstest du, dass ich heute Dienst habe?", fragte sie.
"Kein Stück", protestierte ich entsetzt. "Glaub nur nicht, dass ich absichtlich hier bin."
"Ist ja schon gut", beruhigte sie mich. "War bloß so 'ne Idee."
Mir blieb die Genugtuung, ihr einen übertrieben schlimmen Anblick bieten zu können. Sie wusch mir das Gesicht, und ich genoss heimlich diese so vermisste Zuwendung.
"Deine Wunde muss genäht werden."
"Kannst du das?"
"Nein."
"Und die anderen Wunden!?"
"Welche anderen Wunden?"
"Innerlich gibt es ein paar ..."
"Die kann ich ... glaube ich ... auch nicht."
Ich schwieg ab nun betroffen. Es sah nicht gut aus zwischen uns. Wenigstens musste ich vorläufig zur Beobachtung im Hospital bleiben. Damit war ihre Nähe gesichert.
Man führte mich in mein Krankenzimmer. Dort lagen zwei Männer. Der eine, gut in den Dreißigern, musterte mich still mit skeptischen Blicken. Ich mochte das nicht. Arrogante Leute beeinflussten mein Verhalten unangenehm. Darauf reagierte ich manchmal so cool, dass ich mir irgendwie selbst fremd erschien. Der andere Mann war wesentlich älter und von offenem Gemüt. Er streckte mir die Hand entgegen und stellte sich vor.
"Guten Tag. Ich bin Opa Hagelmann. Mit mir muss man immer etwas lauter sprechen, ich höre nämlich schlecht. Du kannst ruhig Opa zu mir sagen. Schließlich bin ich einer."
"Hallo Opa."
"Auf dich haben wir gewartet", meldete sich der Jüngere zu Wort. "Nicht wahr, Opa. Das ist unser dritter Mann."
"Soll ich euch zur Flucht verhelfen?", fragte ich.
"Hier wird ab heute Skat gespielt."
Meine Reaktion darauf sorgte für Enttäuschung bei den Hoffenden.
"Ich kann kein Skat. - Aber wie wär's mit Schach? Opa, spielst du vielleicht zufällig Schach?"
"Schach!? Um Himmels willen! Ich spiele nur Skat."
"Ich spiele auch kein Schach", ergänzte der andere vorsichtshalber.
"Dann können wir eben nicht zusammen spielen", resümierte ich, legte mich aufs Bett und schwieg.
Später kam ein Arzt. Dunkler Bart.
"Guten Morgen. Mein Name ist Dr. Schubert."
"André."
"Schön, André. Ich möchte Ihnen einige Fragen stellen. Sind Sie damit einverstanden?"
"War das schon die erste?"
"Äh ... eigentlich nicht."
"Na gut! Man muss ja schließlich wissen, wann es losgeht."
"Jetzt geht es los. Welches Datum haben wir heute?"
"Den Zweiundzwanzigsten. Steht auf Ihrem Zettel."
Freundliches Lächeln. Von uns beiden.
"Und welchen Tag?"
"Wenn meine Ohnmacht nur von kurzer Dauer war, haben wir heute Dienstag."
"Das stimmt."
"Mein Hungergefühl sprach auch für den Dienstag. Wenn wir schon Mittwoch gehabt hätten, dann wäre Opa Hagelmann längst meinem unkontrollierten Kannibalismus zum Opfer gefallen."
Opa guckte fragend, als hätte er seinen Namen gehört. Er war sich aber nicht sicher.
"Wie heißt der Bundeskanzler?", fragte Dr. Schubert.
"Noch Helmut Schmidt. Aber Kohl hat gesagt: Ich will Bundeskanzler werden. Schon schlimm genug. Noch schlimmer ist: Wenn er es wirklich schafft, dann will er es auch bleiben - und zwar für immer."
"Wir reden jetzt aber nicht über Politik."
"Sie haben damit angefangen!"
"Ich habe nur ... na gut! - Hatten Sie in Ihrem Leben schon mal eine Kopfverletzung?"
"Ist Verrücktheit eine Kopfverletzung?"
"Ich glaube nicht. Hören Sie ..."
"Dann war ich bisher kopfverletzungsfrei."
"Schön. - Wie alt sind Sie?"
"Achtzehn."
"Üben Sie einen Beruf aus?"
"Beruflich bin ich bisher noch nicht fündig geworden."
Dr. Schubert betrachtete mich nachdenklich. Er zweifelte, ob er sich auf meine Wortspiele einlassen sollte. Aber er ließ sich letztendlich verleiten.
"Haben Sie überhaupt gesucht?"
"Ach, wissen Sie, das Suchen ist ja keine Kunst, sondern das Finden. Und deshalb sollte jeder, bevor er einem Beruf nachgeht, erst einmal seine Berufung entdecken."
"Mit dieser Einstellung werden Sie voraussichtlich nicht weit kommen im Leben."
"Kann schon sein, Herr Schubert, dass Sie mit Ihrer Einstellung weiter gekommen sind, als ich das jemals schaffen werde. Aber haben Sie auch gelebt?"
"Ich bin Realist."
"Ich bin Träumer."
"Und damit wollen Sie punkten?"
"Na klar! Denn als Träumer darf ich mir meine Punktezahl selber geben. - Und Sie? Sind Sie glücklich?"
"Ich bin glücklich verheiratet."
"Ich bin unglücklich verliebt."
"Und das finden Sie besser?"
"Mit dem Finden bin ich ja noch beschäftigt. Deshalb kann ich diese Frage zurzeit nicht beantworten."
Schubert hatte keine Lust mehr. Er ging. In der Tür drehte er sich um und sagte: "Wir werden Sie vorerst zur Beobachtung hierbehalten und anschließend an einen Neurologen überweisen. Solch ein Krampfanfall kann sehr viele unterschiedliche Ursachen haben, das gilt es jetzt herauszufinden."
"Gehirntumor?"
"Das wäre eine mögliche Ursache. Um die auszuschließen, muss ein EEG gemacht werden. Deshalb der Neurologe."
"Was ist mit einer Überlastung des Gehirns durch zu heftiges Denken?"
"Diagnosen sollten Sie besser den Experten überlassen."
"Ein weit verbreiteter Irrtum, denn Experten legen den Fokus immer auf ihr Spezialgebiet. Befinden sich die Ursachen jedoch außerhalb ihrer Kenntnisse, neigen sie dazu, ihre Ahnungslosigkeit mit Fehldiagnosen zu kaschieren. Das kann für unsereins ganz übel ausgehen."
Die Tür knallte ins Schloss. Ich musste grinsen. Schubert hatte selber schlechte Nerven und benötigte einen Neurologen dringender als ich. Meine Zimmermitbewohner starrten mich an, bis Opa Hagelmann bemerkte: "So kann man doch nicht mit dem Herrn Doktor umgehen."
Und ich antwortete: "Ich glaube, ein bisschen Abwechslung im Umgang tut dem Herrn Doktor ganz gut."
Anschließend schwiegen wir gemeinsam.
"Sie kann raus und ich nicht", sprach ich später am Fenster stehend.
"Wer?", fragte mein Bettnachbar, der Hubert hieß.
"Sie. - Aber ich will sie nicht verlieren."
"Wen?"
"Na, sie. - Vielleicht bin ich ein zu großer Optimist?"
"Was quatschst du denn da? Ich verstehe kein Wort."
"Macht nix. Mich versteht eh keiner."
"Den Eindruck habe ich auch."
Mein kleiner, intimer Funken Zuversicht entsprang meiner Liebe zu ihr, die mir die Liebe zu mir selbst erst sinnvoll erscheinen ließ. In den großen, allumfassenden Gedanken jedoch, dem generellen Blick auf die Welt, wusste ich nicht, wie ich glücklich leben und traurig sterben sollte. Ich konnte momentan nur traurig leben und glücklich sterben. Aber beides wollte ich nicht.
"Ich bin ein Mensch zwischen 1000 Menschen. Ich denke und fühle, ich verstehe und kann akzeptieren. Vieles verstehe ich nicht, und manches will ich nicht akzeptieren."
"Was redest du denn nun schon wieder?", erkundigte sich Hubert halb genervt, halb neugierig.
"Ich hätte nie geglaubt, dass die Liebe in der Lage ist, mich so gefangen zu nehmen. Sie schlägt mir auf mein Gemüt. Manchmal deprimiert sie mich. Und dann, in kuriosen Momenten, schafft sie es, mich zum Lachen zu bringen. Vielleicht, um alles zu überspielen?"
"Über die Liebe darfst du gar nicht so viel nachdenken. Genieße einfach das Leben!"
"Ich weiß nicht. Die Tage sind gegen mich. Die Nächte auch. Die ganze Zeit ist gegen mich."
"Ach was! Du selbst bist gegen dich, das ist alles."
"Ich könnte aus dem Fenster springen und in den Stadtpark laufen. - Ich könnte versuchen, Enten zu fangen."
"Solch einen Blödsinn habe ich ja noch nie gehört!"
"Bei der Geburt beginnt das Leben, die Qualen setzen ein. Das ist doch schon das Ende. Beim Tod endet das Leben wieder, die Qualen sind vorbei. Und dann beginnt das Leben nach dem Tod. Endergebnis: Plus minus null. Man hat also nie gelebt und ist nie gestorben. Wozu soll das gut sein?"
"Hör endlich auf zu denken!"
Ich dachte daran, mit dem Denken aufzuhören. Aber das klappte nicht.
"Sie war bestimmt gestern in der Badeanstalt. Ihr Gesicht glänzte. Ihre Beine enden irgendwo im Niemandsland. Unerreichbar. Und ich sitz hier völlig unbeabsichtigt zwischen zwei Skatspielern!"
"Es gibt Schlimmeres, mein Junge."
"Ja, Alter. Es gibt immer Schlimmeres. Sieh dir den blauen Himmel an, leuchtend blau. Aber wo ist der Lichtblick? Neben der Tür hängt ein Kreuz mit einer angenagelten Leiche und macht die Stimmung nur noch beschissener."
"Für manche ist er ein Lichtblick."
"Vielleicht sollte ich ihm eine Flasche an den Kopf werfen oder ihm einen Spiegel vor die Nase halten, damit er weiß, wie er aussieht?"
"Also, das ist doch ...!", fuhr Opa Hagelmann hoch.
"Ich weiß", sagte ich. "Das ist doch sinnlos. Er kann weder lachen noch weinen."
"Läster du nur! Irgendwann werden dir die Augen schon aufgehen."
"Nichts dagegen einzuwenden, wenn sich der Blick lohnt."
Opa drehte sich um und murmelte etwas von respektloser Jugend. Ich jedenfalls fand dieses Kreuz mit dem unechten Jesus an der Wand völlig deplaziert. Also stellte ich mich ganz nah vor die kleine aufgehängte Figur und sagte: "Na, du armer Kerl. Das war doch alles schon schlimm genug mit der Kreuzigung. Aber wenn du gewusst hättest, dass man von deiner Qual millionenfache Abbildungen an die Wände dieser Welt hängt, wärst du klugerweise bereits vor deinem Tod gen Himmel gefahren. - Stimmt's?"
In der folgenden Nacht schnarchte Opa unerträglich. Mich brachte das um den gesamten Schlaf, Hubert ebenfalls.
"Soll ich ihm die Nase zudrücken?"
"Nee, lass den alten Mann mal ruhen", flüsterte mein Kollege.
"Okay! Ich bin sowieso zu faul zum Aufstehen."
Danach hielten wir beide bis zum Frühstück Wache, obwohl wir nicht wussten für wen, denn Überfälle erwarteten wir keine.
"Du siehst ziemlich müde aus", stellte Opa morgens über seine Kaffeetasse hinweg fest. "Vielleicht solltest du nachts mal schlafen und weniger denken."
Ich glotzte ihn schweigend an. Das hatte man nun von seiner Rücksichtnahme. Zudem interpretierte Hagelmann mein Schweigen als Unhöflichkeit. Da er das, was ich sagte, jedoch fast immer genauso deutete, war es eigentlich egal, wie ich mich verhielt.
Die weiteren Stunden saß ich im Bett und schrieb. Das Radio von Hubert lief ständig. Verließ er den Raum, schlich Opa hin und stellte es ab. Am dritten Tag hatten sie sich endlich in der Wolle.
"Kann man ja nicht aushalten, das Gedudel den ganzen Tag!", beschwerte sich der alte Hagelmann.
"Du hörst doch sowieso schlecht", verteidigte sich Hubert.
"Aber ich höre es, das Gedudel. Dieser ständige Geräuschpegel ist zum Wahnsinnigwerden!"
"Radiohören ist die einzige Abwechslung. Wenn wir schon nicht Skat spielen können!"
Ein kapitulierendes Brummen war zu vernehmen. Trotzdem stellte der andere das Radio ein bisschen leiser. Ich wollte jetzt auch mal was sagen, schlurfte zum Fenster und schaute zum Park hinaus.
"Menschen, ich sehe Menschen, leicht bekleidet. Ich höre viele Stimmen, das Geschrei aus dem Freibad."
"Na und?", bemerkte Hubert gelangweilt.
"Ich war noch nicht schwimmen in diesem Jahr. Ich geh nämlich nur bei unerträglicher Hitze ins Wasser. Am liebsten aber wäre mir ein See mit heißen Quellen, eine Badewanne unterm Vollmondhimmel."
"Mein Gott, du hast Wünsche!"
"Natürlich habe ich Wünsche. Ich wünsche mir Sex mit ihr auf einer Wiese. Und ich wünsche mir, ein Buch zu schreiben."
"Sex kannst du auch mit einer anderen haben. Und wenn du ein Buch schreiben willst, warum machst du es dann nicht?"
"Ich krieg das noch nicht hin. So'n Buch hat einfach zu viele Seiten."
"Ja, meine Herren! Wenn du zu blöd bist, ein Buch zu schreiben, warum willst du dann überhaupt eins schreiben?"
"Damit ich schlauer werde. Ist doch logisch."
"Also, ich versteh dich wirklich nicht."
"Das Problem kenn ich", bestätigte ich ihm, setzte mich aufs Bett und wartete.
Nach zehn Minuten fragte ich: "Wo bleibt eigentlich das Abendessen?"
"Wir haben gerade erst zu Mittag gegessen", antwortete Hubert.
"Das ist mir egal. So ein Abendessen kann ruhig mal unpünktlich kommen."
"Du bist bescheuert."
"Schon möglich. Aber ein kleiner Besuch wäre doch nicht zu viel verlangt."
"Auch ein Besuch kann unpünktlich sein."
"Was soll ich ihm bloß erzählen, dem Besuch?"
"Kommt immer darauf an, wer es ist."
"Kommt darauf an, was mir einfällt."
Hubert verdrehte die Augen. Solch eine Sichtweise war ihm völlig fremd. Ich wartete den ganzen Nachmittag auf einen Besuch, der nicht kam.
"Siehst du!?", prahlte Hubert, als das Abendessen serviert wurde. "Deine ganzen Besuchsgedanken waren für die Katz. Aber du hörst ja nicht auf mich."
"Stimmt! Ich höre am liebsten nur auf mich. - Ach, Schwester, kann ich einen weiteren Gang bestellen?"
"Sie haben ja noch gar nicht angefangen zu essen."
"Das macht nichts! Ich bin mir absolut sicher."
"Da müsste ich mal in der Küche nachfragen. Die Portionen sind nämlich ..."
"Kein Problem! Wenn schon alles verteilt ist, dann bringen Sie mir bitte einfach eine Schwester."
"Wie?"
"Wie Sie mir die bringen, das ist mir egal."
"Witzbold! - Was wollen Sie mit einer Schwester?"
"Als Nachtisch."
"Ich bin eine Schwester. Aber kein Nachtisch."
"Das habe ich befürchtet. Deswegen wollte ich ja auch eigentlich eine andere. Eine ganz bestimmte. Soll ich Ihnen den Namen nennen?"
"Daraus wird nichts! Wir sind hier schließlich in einem Krankenhaus und nicht in einem Bordell."
Ich sah mich genötigt, ein wenig zu predigen: "Ich weiß natürlich, dass dies kein Bordell ist. Deshalb würde ich ja auch auf keinen Fall etwas bezahlen für solcherlei Liebenswürdigkeiten. Aber wenn eine kranke Seele in einem kranken Körper wohnt, dann brauchen beide Nahrung für ein neues Leben. Also bitte, es muss doch irgendeine willige Heilerin geben, die ihren Körper zu meinem Körper gesellen und mit mir ein leidenschaftliches Feuer entfachen mag, um glühend heiß die Wirklichkeit zu verzaubern. Das muss doch möglich sein!"
"Ich bringe Ihnen gleich ein paar Beruhigungstabletten", bemerkte die Schwester grinsend. Humor hatte sie jedenfalls.
"Wozu? - Ich bin die Ruhe selbst."
"Nur gegen die sexuelle Entregung!", sprach sie. "Ach, und morgen dürfen Sie übrigens nach Hause."
"Tja", warf ich lässig in die Runde, "die wissen auch nicht, was sie mit mir machen sollen."
"Kann ich nachvollziehen", kommentierte Opa Hagelmann erstaunlich angriffslustig. "Immerhin sind die in der Lage, dich vor die Tür zu setzen. Da hat manch anderer vielleicht weniger Glück."
"Ich finde es sehr berührend, Opa, dass du mittlerweile wieder Kraft für solch bissige Beiträge besitzt. Und es freut mich, dass ich dir dabei helfen konnte."
"Ich versteh die Jugend einfach nicht mehr."
"Das geht der Jugend genauso", antwortete die Jugend.
Der Tag hinterließ wieder einmal eine undefinierbare Sehnsucht. Wie lange noch würde ich die ertragen müssen? Ich saß da und hoffte auf ein Wunder. Aber das Wunder kam nicht. Eventuell suchte es nach mir und konnte mich nur nicht finden?
"Man müsste ein Leuchtturm sein, der nachts weit auf das Meer hinausblinkt. Dann würden alle guten Seelen, die einen sicheren Hafen bräuchten, ganz von selbst auf mich zufahren. Und es gäbe immer frischen Wind mit viel Sauerstoff für die Lungen und das Gehirn. Der putzt die Gedanken sauber und klärt den Blick. Das wäre 'ne geile Sache."
Hubert verkniff sich einen Kommentar. Er hatte dazugelernt.
Die letzte Nacht verstrich. Es war 5:00 Uhr morgens. Heute mussten die Fäden gezogen werden. Ich trank Malzbier. Draußen vorm Gebäude sah ich Enten, Teichhühner und Amseln. Es war schon lange hell. Die Viecher warteten aufs Frühstück der Patienten.
"Warum hat die Angst solche Macht?"
"Lass mich bloß schlafen!", brummte der nicht schlafende Hubert.
Immer und immer wieder stellte ich mir diese Frage. Ich wusste keine Antwort. Trotz meiner manchmal vorlauten Art fühlte ich mich oft alleingelassen mit meinen Gedanken. Sehr wahrscheinlich lag das an der Methode des Denkens, die war irgendwie anders. Deshalb schrieb ich in zunehmendem Maße auf, was ich dachte. Irgendwann würde das bestimmt jemand lesen und begreifen. Vielleicht in ferner Zukunft? Vielleicht erst, wenn ich tot war? Das wäre allerdings nicht nett, denn schließlich hatte ich jetzt, in diesen Momenten etwas zu sagen. Gleichzeitig fürchtete ich mich davor, von niemandem verstanden zu werden. Zu Lebzeiten. Dann wäre meine ganze Existenz sinnlos. Ich reichte Hubert zum Abschied einen Zettel. Auf dem stand: Ich will Glück!
"Das wollen wir alle", war Huberts letzter Kommentar.
Sira
Wenn ich das Glück hätte beschreiben sollen, dann war es für mich wahrscheinlich ein Zustand zwischen Wunsch und Wirklichkeit, denn zu selten hatte ich erlebt, dass Wunsch und Wirklichkeit zueinander fanden. Dadurch verblasste das Glück nahezu bis zur Unkenntlichkeit. Es war die Hölle.
Die erste sterbende Liebe einer Frau ließ mich sogar daran zweifeln, dass die Erde rund ist. Ratlos hüpfte ich durch die Küche und hielt meiner Mutter einen Vortrag. Das war sie gewohnt.
"Und ich sage dir, hinterm Horizont geht's nicht mehr weiter. Wie soll ich mich bloß damit abfinden? Manchmal verfluche ich den Tag meiner Geburt und das Land, in dem ich lebe. Irgendwie haben wir uns ineinander verbissen, dieser Staat und ich. Ich bekomme keinen Orden. Ich will auch keinen. Aber manch anderer ist sehr ausgezeichnet ausgezeichnet und stolz darauf, mit Wimpeln und Wappen, Pokalen und Sternchen bestochen worden zu sein. In Glanz und Gloria schwelgen die Neurosen, und jedes Lächeln schubst eine neue Leiche ins Grab. Schlips und Kragen, Hände schütteln und grinsen. Freundlicher Hass reicht der hässlichen Freude die Pranke. Und das Volk jubelt, das blöde.
Für jede Patrone endet ein Leben. Es gibt weniger Menschen als Patronen. Bleiben also welche übrig. Der Papst denkt mit. Keine Abtreibung - mehr Menschen, keine Pille - mehr Menschen, keine Kondome - mehr Menschen, die Munition kann verbraucht werden. Viele Tote, viele Engel, die den Menschen helfen dürfen. Die Menschen jedoch sind ausgestorben. Wozu braucht die Welt dann Engel? Überflüssige Engel müssen erschossen werden. Womit aber erschießt man Engel? Mit Patronen. Die sind jedoch alle verbraucht. Und wer erschießt Engel? Na, sie selbst. Sie werden also wieder zu Menschen gemacht und auf die Erde geschickt, um Patronen zu produzieren. Was hat sich geändert? Nichts hat sich geändert. Und ich weiß auch nicht, wie ich's machen soll!"
"André, du redest wirres Zeug. Das ist der Liebeskummer und die Trauer. Eure Beziehung war doch im Grunde schon lange vorbei. Also solltest du versuchen, sie zu vergessen."
"Ach, Mütterchen, ich vergesse grundsätzlich nur unwichtige Dinge."
"Das Leben geht trotzdem weiter. Und glaube mir, wenn etwas Zeit verstrichen ist, bist du darüber hinweg."
"Natürlich, ich bin ja sportlich", antwortete ich, sprang elegant darüber hinweg und rief: "Na super! Jetzt geht's mir schon viel besser."
Ich saß am Wohnzimmerfenster und schaute an der mächtigen Eiche vorbei über das Roggenfeld hinter der Straße bis zu meinem Lieblingswald. Es war Sonntag. Für mich war jeder Tag Sonntag. Die Glocken läuteten, bevor der Gottesdienst im nahegelegenen Kloster begann. Sie läuteten auch am Ende. Manchmal sogar zwischendurch, wenn jemand besoffen am Seil zupfte oder sich aus Versehen an dem Strick erhängte. Das geschah aber nur in meiner Phantasie. Ich suchte immer nach neuen Erklärungen für das Gebimmel.
"Da fahren sie wieder", sagte ich zu meiner Mutter. "Sie werfen Unmengen von Geld in die Teller am Kircheneingang, und die Patres kaufen sich davon Schnaps und Zigarren."
"Rede nicht solche Dinge."
"Wieso nicht? Vielleicht stimmt es ja!?"
"Ach, das ist doch Quatsch."
Ich hatte wieder so eine bescheuerte Pille geschluckt, die machte mich total fertig. Seit meinem Krankenhausaufenthalt schluckte ich Valiumtabletten zur Entspannung. Auf diese Art und Weise wollten die Ärzte weiteren Krampfanfällen vorbeugen. Die Auswirkungen jedoch gefielen mir überhaupt nicht. Und währenddessen dachte ich unaufhörlich an sie und wartete auf das Wunder.
"Mit beiden Augen sehe ich alles doppelt. Muss ich wohl eins zumachen. Du mieses Valium. Wenn ich dich wirklich wollen würde, dann ging's mir gut. Ich will dich aber nicht!"
Vielleicht wollte das Valium ja mich? Ich saß da und überlegte.
"Wenn ich möchte, dass sich etwas ändert, dann muss ich wahrscheinlich selbst etwas verändern."
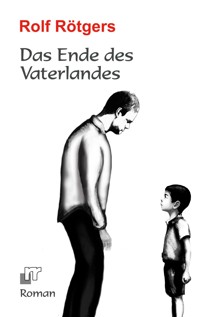













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














