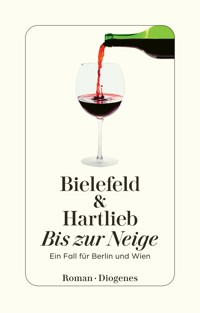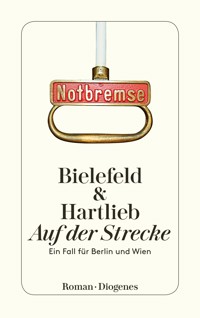10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Berlin und Wien
- Sprache: Deutsch
Echt oder falsch? Die temperamentvolle Frau Inspektor Anna Habel aus Wien und der grüblerische Kommissar Thomas Bernhardt aus Berlin ermitteln in ihrem vierten Fall gemeinsam im Spiegelkabinett des Kunsthandels und stellen fest: Selbst Fälschungen können teuer sein – und manchen kosten sie das Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Claus-Ulrich BielefeldPetra Hartlieb
Im großen Stil
Ein Fall fürBerlin und Wien
Roman
Die Erstausgabe erschien 2015 im Diogenes Verlag
Covermotiv: Nach einem Foto von Bernard Jaubert
Copyright © plainpicture/B.Jaubert
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2017
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 24385 7 (1.Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60465 8
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] Alle Personen und Ereignisse in diesem Roman sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen oder mit tatsächlichen Ereignissen wären also rein zufällig.
[7]1
Thomas Bernhardt nieste und nieste und nieste… Eine wahre Explosion. Als er endlich wieder Luft bekam, putzte er mehrmals seine Nase. Die gebrauchten Tempo-Taschentücher steckte er links und rechts in seine Hosentaschen, die sichtbar ausgebeult waren. Seine Augen tränten, und er sah den jungen Arzt nur verschwommen, der mit schiefgelegtem Kopf vor ihm stand.
»Eigentlich sollte in Ihrem Alter eine Pollenallergie langsam schwächer werden.«
»Sollte.«
Thomas Bernhardts Stimme klang rauh. Morgens um drei war er mit Atemnot aufgewacht. Er hatte sich auf den Balkon seiner Hinterhauswohnung gestellt und versucht, ruhig zu atmen. Die Bronchien pfiffen, leichte Panik, er hatte sich erst beruhigt, als es hell geworden war und unzählige Vögel in der riesigen Kastanie im Hof zu toben anfingen und ihr morgendliches Lärmkonzert gaben.
Der Arzt wirkte ziemlich ungerührt. »Klare asthmoide Tendenz. Kriegen wir mit einer Kortisonspritze gut in den Griff, die hat Depotwirkung und gibt immer nur kleine Dosen ab, da sind Sie bis September auf der sicheren Seite.«
[8]»Will ich aber nicht, dämpft mich zu stark ab.«
»So? Dann müssen Sie halt ein bisschen leiden.«
Der mochte ihn nicht, sagte sich Bernhardt. Und er mochte ihn auch nicht. Klare Verhältnisse.
Der Arzt setzte noch einen drauf. »Die Psychoanalyse sagt übrigens, dass der Allergiker gar nicht von seinen Beschwerden befreit werden will.«
»Tatsächlich. Will er nicht. Sagt die Psychoanalyse. Und warum will er nicht?«
»Krankheitsgewinn. Er will an sich und der Welt leiden, er will sich bedauern, und er will bedauert werden. Er kultiviert seinen Status als der große Sensible. In Wirklichkeit hat er Angst vor Vitalität und Fruchtbarkeit.«
Bernhardt nieste wieder, putzte sich mit seinem letzten Tempo die Nase und atmete mühsam durch.
»Das ist ja toll, dass Sie mich an Ihrem geballten Wissen teilnehmen lassen. Da soll noch mal einer über die Fließbandmedizin klagen. Nur dreht sich Freud gerade um in seinem Grab.«
Der Arzt hatte wortlos ein Rezept über einen Rachen- und einen Nasenspray ausgefüllt und Bernhardt mit zusammengekniffenem Mund, ohne Abschiedsgruß und ohne Handschlag entlassen.
Draußen wehte ein milder Wind und trieb Blütenstaub durch die Straßen. Ein später Frühling war mit Urgewalt ausgebrochen. Hatte noch jemand daran geglaubt? Anfang November war Berlin in einem grauen Dunst versunken, der sich immer mehr ausgebreitet und die Konturen der Stadt zum Verschwimmen und schließlich beinahe zum Verschwinden gebracht hatte. Die Sonne kam über [9]Monate nicht zum Vorschein, Ende März lagen die Temperaturen unter null Grad, die Seen der Stadt waren zugefroren, im April pfiff ein eisiger Wind, Anfang Mai dümpelten die Temperaturen zwischen acht und zehn Grad. Die Hoffnungen der Menschen auf Wärme sanken ins Bodenlose.
Und dann erstrahlte die Stadt von einem auf den anderen Tag in gleißendem Licht. Das bis dahin schlappe Grün der Bäume leuchtete plötzlich auf, die Straßenfluchten öffneten sich und gewannen an Tiefe und Schärfe, die Menschen liefen unter dem blauen Himmel leicht schwankend und wie betäubt umher, sich und anderen immer wieder versichernd, dass das doch wirklich unglaublich sei. Auf den Straßen hielten sie die blassen Gesichter in die Sonne. Starke Farben gaben der Stadt Kontur, der üppige Duft der blühenden Linden breitete sich aus, eine wohlige Wärme hüllte die Menschen ein.
Selbst das Büro der Mordkommission in der Keithstraße mit seinem großen Besprechungstisch, über den eine Plastikdecke mit Blümchenmuster gespannt war, dieses trübe Büro, mit den an die Wand gepinnten Bildern von Mordopfern, mit der Tafel, auf der oben in großen Buchstaben ›Pro‹ und ›Kontra‹ geschrieben stand, wirkte nun beinahe frisch.
Als Thomas Bernhardt den Raum betrat, waren alle schon da. Bernhardts Kollege, der junge Cellarius, huldigte dem herrlichen Frühlingstag mit einem olivgrünen Anzug und einem blütenweißen Hemd. Cellarius war eine Art weißer Rabe in einer Stadt, in der grundsätzlich textile Nachlässigkeit angesagt war. Krebitz, nur hinter [10]vorgehaltener Hand ›der Nussknacker‹ genannt und wegen seines schnellen Beleidigtseins und des dann folgenden verbissenen Schweigens gefürchtet, trieb es wie gewohnt am weitesten: Er trug eine dreiviertellange Cargo-Hose, darunter Sandalen und graue Socken. Auch die Kollegen Martin und Luther, die gerne gemeinsam auftraten und deshalb »der doppelte Reformator« hießen, gaben sich frühlingshaft locker, beide hatten sich für Hemden mit wildem Karomuster entschieden.
Eine reine Augenweide war hingegen Katia Sulimma, die nach all den Wintermonaten endlich wieder eins ihrer leichten Blümchenkleider trug, auf ihren roten High-heels herumstöckelte und wie ein fröhlicher Amazonas-Kolibri zwitscherte. Den Blumenstrauß auf dem Tisch hatte sicher sie gekauft.
Als gehörte sie nicht dazu, saß Cornelia Karsunke mit geschwollenen Augen am Rande der Gruppe, eingehüllt in eine Aura der Einsamkeit und Melancholie. Oder war’s nur Müdigkeit? Waren ihre beiden kleinen Mädchen wieder einmal krank?
Thomas Bernhardt nieste beim Eintreten, und wie jedes Jahr fühlten sich alle bemüßigt, den heuschnupfengeplagten Chef der Mordkommission zu bedauern und vor allem: ihm Ratschläge zu erteilen. Hatte er es schon mit Gelee Royale versucht? Akupunktur? Hypersensibilisierung? Stündliche Nasendusche mit Meersalz? Hypnose? Broccoli mit Zitrusfrüchten? Impfen? Pestwurz?
Bernhardt winkte ab. Er werde einen Monat nach Helgoland gehen. Die Kollegen reagierten verblüfft: Wirklich? Aber erst, fügte er hinzu, wenn sie diesen verdammten [11]Messerstecher hätten. Seit Monaten versuchten sie, dem Kerl auf die Schliche zu kommen, der eine Joggerin in einem Waldstück attackiert und erstochen hatte und dann mit seinem Mountainbike davongeradelt war. Sie hatten Aussagen von Augenzeugen, sie hatten ein gar nicht so schlechtes Phantombild, sie hatten akribisch gearbeitet, aber sie waren einfach nicht näher an den Mörder herangekommen. Wegen neuer Fälle hatten sie dann ihre Ermittlungen runterfahren müssen. Es war ein Zustand der Schwebe eingetreten, den Bernhardt hasste. Wie jeder unaufgeklärte Fall bereitete ihm auch dieser schlaflose Nächte. Worüber er mit niemandem sprach und was ihm selbst nur zum Teil bewusst war: Bernhardts tiefster Antrieb für seine Arbeit war es, wieder Ordnung zu schaffen, das durch die Tat erzeugte Ungleichgewicht im Weltlauf ein bisschen auszugleichen. Wer gegen das fünfte Gebot verstieß, musste gefasst und bestraft werden. Und das gelang hier nicht. Zudem lagen noch zwei ältere Fälle vor, die ebenfalls unaufgeklärt waren, eine Frau war auf einem Friedhof erstochen worden, ein Zeitungsbote am frühen Morgen in einem Park. Sie hatten keine Verbindungslinien zwischen den Fällen gefunden. Aber Bernhardt fürchtete, dass es einen Irren gab, der ziellos mit einem Messer durch die Stadt lief und irgendwann wieder zuschlagen würde.
Für diesen Tag hatte sich Bernhardt nun vorgenommen, die Fälle noch einmal durchzugehen, vielleicht den einen entscheidenden Hinweis zu entdecken, der zum Messerstecher führte.
Als er in sein Büro gehen wollte, klingelte das Telefon. [12]Er nahm ab, und gleich war klar: Der Messerstecher-Fall musste, zumindest im Moment, auf die lange Bank geschoben werden.
Pankow, Majakowskiring. Von Beginn an spürte Thomas Bernhardt: Dies ist eine Welt, in die du nur schwer hineinfinden wirst. Alles wirkte zu still, der Pulsschlag der Stadt war kaum zu spüren. Ihm schien, als hinge ein unsichtbares riesiges Schild über den Häusern: Bitte nicht stören!
In einem langgestreckten Oval zog sich die Straße durch viel Grün dahin und kehrte in ruhigem Schwung wieder zum Ausgangspunkt zurück. Ein geschlossener Ring, dem sie mit ihrem Auto gefolgt waren, vorbei an Häusern aus den zwanziger Jahren, die, von wenigen Ausnahmen abgesehen, sorgfältig restauriert waren, vorbei an neuen viereckigen, weißen Hauskisten, ziemlich armselige Bauhaus-Kopien, wie Bernhardt fand, vorbei an Baustellen, wo weiße Steinplatten, die wie Styropor aussahen, zusammengeklebt wurden. Immerhin gab es ein neues schön geschwungenes Haus, das sich an der östlichen Biege des Ovals wie ein großer Schiffsbug auf das dichte Grün eines Parks zuschob.
Endlich näherten sie sich dem Flatterband und einem Grüppchen Schaulustiger, das sich vor einem kleinen, mit Efeu überwucherten Haus versammelt hatte. Der Garten war leicht verwildert, ein paar blühende Fliederbäume, ineinander verhakte Wildrosenbüsche und krüpplige Obstbäume breiteten sich aus. Bernhardts erster Eindruck: ein verwunschenes Haus, ein Haus, das sich der [13]Anpassung an die neuen Zeiten widersetzte. Hellen Verputz, Carport, solide Messingzäune, gerne auch mit nach außen gekehrten Spitzen, wie er sie später bei seinen Rundgängen durch die Straße missmutig registrierte – das gab’s hier nicht.
Als Bernhardt mit Cornelia Karsunke und Cellarius auf das Haus zuging, krampfte sich sein Magen zusammen. Wie ihm das alles zuwider war, er würde sich nie damit abfinden: die Neugierigen, die Presse, die Leiche. Das alte Schlachtross von der Regionalschau, das – aus Erfahrung klug – mit geradezu demütiger Gestik und Mimik auf ihn zukam, schnauzte er an, er konnte einfach nicht anders: »Wie lange wollen Sie eigentlich diesen Scheißjob noch machen?« Der Reporter antwortete schlagfertig: »Und selbst?« Und grinste. Immerhin hatte er einen der Bernhardt’schen Ausbrüche eingefangen, die von den Zuschauern geliebt und deshalb gerne im Jahresrückblick der Regionalschau noch einmal gebündelt abgespielt wurden. Sina Kotteder, die blonde B.-Z.-Reporterin, lächelte ihn an und schüttelte leicht den Kopf. Deine blauen Augen…, dachte Bernhardt und wurde etwas ruhiger. Sie hatten sich lange nicht mehr getroffen. War auch besser so. Nie Dienstliches mit Privatem verquicken, obwohl…
Im weißen Kapuzenoverall, den er sich inzwischen übergezogen hatte, und mit den Plastikhandschuhen kam sich Bernhardt immer wie ein Außerirdischer vor. Cornelia Karsunke wirkte wie ein trauriger Heinzelmann und Cellarius wie George Clooney, der in Beverly Hills [14]ermittelt. Als sie das Haus betraten, blieben sie nach ein, zwei Schritten abrupt stehen, als seien sie gegen eine Wand gelaufen. Fröhlich von der Spurensicherung, der sich mit seinen Jungs von der weißen Truppe, wie Bernhardt sie nannte, schon an die Arbeit gemacht hatte, beschrieb mit der Hand einen Halbkreis, der die Wände ringsherum umfasste.
»Na, Meesta, wat sachste dazu?«
Was sollte er sagen? Erst einmal verschlugs ihm die Sprache. Was war das denn? Ein Museum? Dicht an dicht hingen hier wertvoll aussehende Bilder, säumten den Treppenaufgang ins Obergeschoss. Eine Überfülle, die Bernhardt den Atem nahm. Wie bei seinen wenigen Museumsbesuchen ging’s ihm auch hier. Er konnte sich nicht auf ein einzelnes Bild einlassen, sondern er sah zunächst nur eine farbige Gesamtkomposition, fremd, überwältigend.
Und das Mordopfer? Bernhardt wurde von Fröhlich aus dem Flur in ein Zimmer im Erdgeschoss gelotst. Ein älterer Mann saß dort in sich zusammengesunken in einem Ledersessel. Er machte einen recht rüstigen Eindruck. Wenn man davon absah, dass er tot war. In der Mitte des Raumes waren mehrere Schränke mit flachen Schubladen platziert, und neben dem Sessel stand ein kleiner Tisch.
Thomas Bernhardt schloss die Augen und versuchte, sich zu konzentrieren. Er musste in diesem Raum, in diesem Haus ankommen, er musste seinen Blick schärfen, dem toten Mann nahekommen. Es war eine beinahe magische Handlung, die er vollzog. Sich öffnen, alles in sich einströmen lassen. Es dauerte nur wenige Sekunden, aber nach dieser gesteigerten Wahrnehmung war er [15]erschöpft – und hatte immer Angst, dass ihm etwas entgangen war, er haarscharf an einem wichtigen Indiz vorbeigesehen und die Untersuchung dadurch auf einen falschen Weg gebracht hatte. Ein Selbstzweifel, der ihn bei jedem Fall begleitete.
Er öffnete die Augen. Ein Kollege von der Spurensicherung schwenkte mit seiner 3-D-Kamera den Raum ab. Auch er schweifte mit seinem Blick durch den Raum, allerdings auf andere Art als die Kamera, zögerlich und subjektiv. Das Chaos der Eindrücke, das ihn beim Betreten des Raumes zu überwältigen gedroht hatte, schwand langsam.
Die Bilder an der Wand waren ordentlich aufgehängt, aber sie waren sich zu nah. Bernhardt spürte geradezu körperlich, dass sich in dem Raum ein zu hohes Energiepotential aufbaute. Die Bilder konkurrierten miteinander. Aber vielleicht war das gewollt?
Bernhardt hatte keine Ahnung, aber immerhin erkannte er, dass an einer Wand alte Meister hingen. Italiener. Während mehrerer Toskana-Urlaube hatte er vor Jahren in zahllosen Kirchen und Museen unzählige Verkündigungsmadonnen gesehen, und nun begegnete er ihnen in diesem seltsamen Haus wieder. Dann: Niederländer. Höchst ehrbare, streng blickende Handelsherren schienen sich zwischen den Madonnen etwas unwohl zu fühlen. Er starrte sie an und sie ihn. Und wie hieß dieser Maler, Hieronymus Bosch? An der gegenüberliegenden Wand Bilder in expressiven Farben, ein lasziv hingelagertes Mädchen mit geöffneten Schenkeln in kreischendem Gelb. Bernhardt fragte sich, wieso sich jemand diese [16]Vielzahl von Kopien, offensichtlich sehr guten Kopien, an die Wand hängte.
Und der Mann im Sessel, an dem sich jetzt der Gerichtsmediziner Dr.Holzinger zu schaffen machte? Der hatte offensichtlich ganz zufrieden in seinem kleinen Reich gelebt. Bernhardt sah den Kronleuchter an der Decke, die Spotlights, die auf die Bilder gerichtet waren. Er schaute genauer hin, probierte die vielen Schalter an der Wand. Er spielte, blendete auf, dimmte. Jedes Bild konnte angeleuchtet werden, gewann Leben, wenn es in Licht getaucht war. Bernhardt stellte sich vor, wie der Bewohner dieses Hauses sich schöne Abende machte, ein Glas Cognac in der Hand, und Zwiegespräche mit den Bildern führte. Und der verwilderte Garten war die perfekte Tarnung für diese leicht zwanghafte Inneneinrichtung.
Er trat zu Dr.Holzinger, der sich aufrichtete und ihn durch seine dicken Brillengläser wie ein weiser Marabu anschaute.
»Älterer Herr. In ganz guter Verfassung, soweit sich das sagen lässt. Ich schätze, gestern am späten Abend, zwischen zweiundzwanzig Uhr und Mitternacht, erschossen. Ist aber mit Vorsicht zu genießen. Ist sehr warm hier. Genaueres… na, Sie wissen schon.«
Dr.Holzinger zählte zu den wenigen im Kollegenkreis, die das ›Sie‹ als Form aufrechterhielten. Doch er nutzte es nicht zur Distanzierung, sondern eher, um eine kühle und dennoch freundliche Sachlichkeit herzustellen. Anders als sein Kollege, der Bücher über seine spektakulärsten Obduktionen veröffentlichte und durch die TV-Shows [17]tingelte, stilisierte sich Dr.Holzinger als trockener Preuße, leicht kurios und ein bisschen aus der Zeit gefallen, was ihn nicht hinderte, gelegentlich sarkastische Scherze zu machen. Bernhardt mochte ihn.
»Tja. Und der Schuss fast aufgesetzt. Direkt ins Herz. Unmittelbar tödlich. Keine Abwehrbewegung. Wohl kleineres Kaliber, soweit ich das beurteilen kann.«
In diesem Moment überkam Bernhardt ein größerer Niesanfall, was Fröhlichs Unwillen erregte.
»Nee, nee, Meesta, jetzt hier nich so ’ne Bakterien- und dna-Verunreinigungsschleuder anwerfen, wa? Mundschutz oder raus.«
Fröhlichs Unverschämtheiten ärgerten Bernhardt von Fall zu Fall mehr. Gar nicht erst zuhören, sagte er sich, ging noch ein bisschen unschlüssig hin und her – hatte er jetzt alles aufgesaugt? – und stellte sich dann neben Cornelia Karsunke, die mit einer älteren, aufgeregten Frau redete. Als spräche sie mit einem ihrer Mädchen, ging sie in dem ihr eigenen sanften Ton, den Bernhardt so sehr liebte, beruhigend auf die Frau ein.
Und die erzählte in ihrem gebrochenen Deutsch: Ja, Putzfrau, jeden Tag zu Herrn Wessel, Bilder, Staub weg, ja, jeden Tag, viel Arbeit, aber gut. Andere Arbeit? Nein, eine Woche sie, nächste Woche Tochter, Arbeit teilen mit Tochter, immer im Wechsel. Mit Bus hin und her, sechzehn Stunden. Ja, Polen, Dorf in Ostpolen. Eine Woche Arbeit in Berlin, eine Woche zu Hause in Polen. Besucher? Andere Männer, andere Frauen? Manchmal Frau, blond, sehr schön, reich, bestimmt… Nein, nie allein bei Putzen, Herr Wessel immer da. Schlafen? Nein, nicht hier, [18]Wohnung in Hohenschönhausen, ganz klein, teilen mit Tochter, manchmal mit andere Polen, ja, ja.
Cornelia Karsunke legte ihr beruhigend die Hand auf die Schulter. Bernhardt wandte sich ab und stieg die leicht geschwungene Treppe hoch ins Obergeschoss, wo Cellarius gerade ein Telefonat beendete. Bernhardt schaute ihn erwartungsvoll an.
»Dr.Theo Wessel heißt der Mann.«
»Ja, und?«
»Katia Sulimma hat bis jetzt nicht viel rausgekriegt. Der ist hier gemeldet. Seit wann genau, muss noch geklärt werden. Immerhin haben wir das Geburtsdatum, 27.6.1940. Ansonsten nur ein paar verwackelte Bilder im Internet, sagt Katia. Da steht ein kaum erkennbarer Typ auf Kunstauktionen rum, immer in der zweiten oder dritten Reihe, wird mal als Liebhaber, mal als Experte in den Bildunterschriften bezeichnet. Mehr nicht.«
»Na ja, selbst Big Brother ist noch nicht perfekt.«
Cellarius zeigte auf ein Notebook und ein iPhone auf einem großen Schreibtisch.
»Mit Passwörtern gesichert. Müssen die Computerjungs ran, aber das sollte kein Problem sein.«
Cellarius wies auf eine Wand, an der nur ein Bild angebracht war. Was seine Wirkung hatte, da die anderen Wände leer waren. Bernhardt trat näher heran. Er kannte das Bild, eine Art Wimmelbild, es hatte mal als Poster in seiner Küche gehängt. Mindestens hundert Personen trieben sich in einer mittelalterlichen Landschaft herum.
Das Bild hatte ihn fasziniert. Eine Zeitlang hatte er sich immer wieder auf Wanderungen durch das Bild begeben [19]und jedes Mal neue Entdeckungen gemacht: Mensch und Getier tummelten sich hier, Mönche, Bauern, Gaukler, Betrüger und Händler begegneten sich in den seltsamsten Konstellationen, der Herrgott selbst war zu sehen, dem von einem betrügerischen Mönch ein Bart umgebunden wurde, der Teufel saß unter einem Baldachin, ein Gänseei lief auf zierlichen Füßchen durch die Gegend, zwei Typen fingerhakelten, ein großer Fisch fraß einen kleinen, ein Mann schiss aus einem Aborthäuschen, zwei Hunde balgten sich um einen Knochen, ein Mann hatte seinen Eimer mit Brei umgeworfen.
Er hatte sich eine Bilderklärung aus dem Internet ausgedruckt und dann verstanden, worum es ging: um niederländische Sprichwörter, die den deutschen ziemlich ähnlich waren. Er drehte sich leicht zu Cellarius, der ihn erwartungsvoll anschaute.
»Hatte ich mal als Poster in meiner Küche. Die niederländischen Sprichwörter von…«
»Pieter Brueghel dem Älteren, genau.«
»Wieso hat er das solo an die Wand gehängt?«
»Vielleicht hat’s ihm besonders gut gefallen. Vielleicht ist’s sein wertvollstes Stück.«
»Wertvollstes Stück? Das kann doch kein Original sein?«
»Natürlich nicht, das hängt in der Gemäldegalerie am Kulturforum. Wir waren da letzthin mit Freunden, die uns besucht haben. Die konnten sich gar nicht mehr lösen von dem Brueghel. Mit dem Erklärungsschema, das es da gibt, haben die versucht, alle Sprichwörter zu identifizieren.«
[20]»Habe ich auch mal gemacht. Ein schönes Spiel. Sind, glaube ich, mehr als hundert Sprichwörter.«
Sie näherten sich bis auf wenige Zentimeter dem Bild. Cellarius schüttelte irritiert den Kopf.
»Ist dir aufgefallen, dass es in diesem Haus keine Drucke gibt? Nur richtige Gemälde, auf Holz, auf Leinwand und was weiß ich. Und jedes Gemälde wirkt, als sei es ein Original. Sie haben – wie sagt man? – so eine Art Patina. Die kommen irgendwie echt rüber. Komisch, oder?«
»Aber sie können nicht echt sein.«
»Nein, natürlich nicht. Ich frage mich…«
Sie gestanden sich ein, dass sie zu wenig Ahnung hatten. Aber schließlich mussten sie keine Kunstsachverständigen sein. Es ging um Mord. Und um das Motiv. Spielten die Bilder da eine Rolle? Nicht auszuschließen.
[21]2
»Frau Chefinspektor, wir haben eine Leiche, männlich.«
»Und?«
»Wahrscheinlich Kohlenmonoxidvergiftung. Der Schima ist schon unterwegs.«
»Adresse?«
»Gluckgasse dreizehn, das ist hinter der Albertina.«
»Nobel geht die Welt zugrunde. Ich mach mich auf den Weg. – Kolonja? Wir haben was.«
»Jetzt? Ich wollt gerade mittagessen gehen.«
»Ich komm mit, Frau Habel, ich hab eh keinen Hunger.« Annas junger, dienstbeflissener Kollege Motzko sprang mit solchem Eifer von seinem Schreibtisch auf, dass der Bürostuhl gefährlich wackelte.
»Nein, nein, Sie bleiben schön da und halten die Stellung, der Kolonja muss auch mal wieder raus ins wilde Leben. Und solange Frau Kollegin Kratochwil krank ist, müssen Sie uns von hier aus unterstützen.«
Kolonja verdrehte kurz die Augen und erhob sich ächzend. Seit er sich vergangenen Winter beim Skilaufen einen komplizierten Bänderriss zugezogen hatte, war er noch schwerfälliger geworden, und Anna hatte ihn manchmal im Verdacht, er spiele mit dem Gedanken, sich in den Innendienst versetzen zu lassen.
[22]Sie traten aus dem Haustor, und beide waren gleichermaßen irritiert vom warmen Wind, der sie in der Berggasse anwehte. Der Winter hatte dieses Jahr endlos gedauert, zu Ostern gab es noch Schnee, und der Mai war bisher eine einzige graue Depression mit heftigen Regenfällen und Überschwemmungen als krönendem Abschluss gewesen. Und plötzlich schien die Sonne vom Himmel, als wollte sie alle Menschen verhöhnen, die unsicher in ihren zu dicken Jacken und mit Schirmen bewaffnet durch die Straßen liefen. Auch Annas Pullover war viel zu warm, und bereits auf dem kurzen Weg zum Auto spürte sie, wie ihr der Schweiß aus den Poren trat. Kaum saßen sie im Wagen, drehte Kolonja die Klimaanlage sofort auf achtzehn Grad und fuhr sich mit dem Handrücken über das rote Gesicht. »Puh, ist ja Wahnsinn, diese Hitze.«
»Jetzt sei doch froh, dass es mal nicht regnet. Ist doch schön – endlich Frühling. Schau, die ganzen Leut, wie glücklich die sind.«
»Ja, eh. Nur kommt der Frühling normalerweise in Etappen, und da kann man sich dann langsam daran gewöhnen.«
»Du bist ein echter Wiener. Immer raunzen.«
Kolonja sagte nichts mehr, blickte gedankenverloren aus dem Seitenfenster. Vor dem Eisgeschäft am Schwedenplatz hatte sich eine riesige Schlange gebildet.
Die Wohnung in der Gluckgasse war eine typische Wiener Großbürgerwohnung. Oberstes Stockwerk, die einzige Wohnung auf der Etage. Aus dem Augenwinkel registrierte Anna beim Hineingehen das Türschild: [23]Grafenstein/Wiedering stand in zierlicher Lateinschrift auf einem blankpolierten Messingschild. Die Düsterkeit des riesigen Vorzimmers wurde durch einen dunkel gemusterten Teppich, der augenscheinlich nicht aus einem billigen Möbelhaus stammte, verstärkt. Ein uniformierter Beamter wies Anna Habel und Robert Kolonja den Weg in ein Badezimmer, das irgendwie nicht zum Rest der Wohnung passte. Schmal und fensterlos, billige Wasserhähne, schwarzweiß gekachelter Fliesenboden. Ein bestialischer Geruch, der Anna unwillkürlich den Arm vors Gesicht halten ließ. In der Badewanne lag ein nackter Mann, sein ohnehin mächtiger Bauch war grotesk aufgebläht, die Augen quollen aus den Höhlen, die Haut sah aus, als würde sie bei der geringsten Berührung platzen. Eine graue Locke hing ihm in die Stirn und wirkte angesichts des Zustands des Körpers mehr als bizarr. Anna versuchte den Blick nicht abzuwenden, bis sie von einem würgenden Geräusch abgelenkt wurde. Kolonja lief aus dem kleinen Badezimmer.
Der Gerichtsmediziner Schima wusch sich sorgfältig die Hände im Emailwaschbecken. »Wahrscheinlich eine Kohlenmonoxidvergiftung. Genaueres kann ich erst sagen, wenn ich ihn untersucht habe. Richtig appetitlich, oder? Eins ist jedenfalls klar: Der liegt da schon länger als vierundzwanzig Stunden.«
»Hat schon jemand die Therme untersucht?« Anna sah sich im Raum um, ihr Blick fiel auf eine offene Klappe, die Verkleidung für das Heizgerät.
»Der Techniker ist unterwegs. Muss jeden Augenblick hier sein. Können wir ihn mitnehmen?«
[24]»Aber warum heizt der bei den Temperaturen?«
»Ist so ein Kombigerät – Heizen und Warmwasser.«
»Lag er im Wasser, als ihr gekommen seid?«
»Ja, aber viel war da nicht mehr, ich hab’s rausgelassen, bevor ich ihn untersucht habe. Hatte meine Badehose nicht dabei.«
Anna Habel und Robert Kolonja inspizierten den Rest der Wohnung. Natürlich war das nicht das einzige Badezimmer, es gab noch eines, das war dreimal so groß, inklusive einer schönen alten Badewanne mit Löwentatzen. In der Küche hatte man früher wohl eine Großfamilie bekocht, es war ein geräumiger Raum mit neuen Küchenschränken aus gebürstetem Stahl. Auf der graphitgrauen Arbeitsfläche türmte sich schmutziges Geschirr, Essensreste, die nicht mehr besonders appetitlich aussahen, zwei fleckige Rotweingläser. Der Beamte, der sie in der Wohnung empfangen hatte, trat leise an die beiden Kriminalpolizisten heran: »Da drüben sitzt einer und heult.«
Das Wohnzimmer hatte mit einem Zimmer, wie Anna es kannte, nicht viel zu tun. Es war eher ein Ballsaal, mindestens fünfzig Quadratmeter groß, durch einen Erker wirkte er noch ausladender. Das Haus gegenüber war etwas niedriger, so dass man durch die riesigen Fenster den Turm der Kapuzinerkirche sehen konnte. Auch hier ein orientalischer Teppich; eine Bücherwand und ein glänzender Flügel. Die Szenerie wirkte ein wenig wie aus einer Wahlkampfbroschüre der övp, wären da nicht die Bilder gewesen, die den Raum dominierten. Drei riesige Gemälde hingen an einer ansonsten leeren Wand, und Anna konnte ihren Blick kaum abwenden. Drei [25]Kinderporträts, fast wirkten sie wie Fotos. Gewölbte Stirn, große Augen, ernster Gesichtsausdruck, in jedem Gesicht eine kleine Blessur, die erst auf den zweiten Blick zu erkennen war: die Andeutung eines Blutergusses am Auge, eine kleine Schramme an der Lippe, ein Riss in der Wange. Kolonja schüttelte angewidert den Kopf und deutete auf ein dunkles Ledersofa, in dem eine zusammengesunkene Gestalt saß, das Gesicht in den Händen verborgen.
»Guten Tag. Mein Name ist Anna Habel. Polizei. Wer sind Sie?«
Der Mann nahm die Hände vom Gesicht und blinzelte sie aus geschwollenen Lidern an. Sein Gesicht war aufgedunsen und rot, zwischen Nase und Mund konnte man deutlich eine Schleimspur erkennen. Anna reichte ihm ein Taschentuch, das er mehrere Sekunden lang ungläubig anstarrte, bis er sich damit über das Gesicht fuhr. Anna wollte ihm noch ein wenig Zeit geben, aber Kolonja wurde plötzlich ungeduldig. »Wenn Sie uns bitte Ihren Namen verraten würden.«
»Wiedering. Christian Wiedering.«
»Schön, Herr Wiedering. Und?«
»Was und?«
»Wohnen Sie hier? Standen Sie Herrn Grafenstein nahe?«
»Ja.«
»Was ja? Sie wohnen hier?«
»Ja.«
»Und standen Herrn Grafenstein nahe? Sehr nahe?«
»Seit fünfundzwanzig Jahren sind wir ein Paar. Er ist mein Lebensmensch. Ohne ihn hat das alles keinen Sinn.« [26]Der Mann erhob sich plötzlich und ging leicht taumelnd in Richtung Erkerfenster. Anna stupste ihren Kollegen in die Seite und raunte ihm zu: »Sei nicht so ungut. Was hast du denn gegen den?«
»Der geht mir auf die Nerven mit seinem Getue. Aber bitte, mach du doch. Bist ja berühmt für deine zartfühlende Art.«
»Herr Wiedering?« Anna trat neben ihn und blickte über das grüne Dach des gegenüberliegenden Hauses. Sie fasste ihn vorsichtig am Arm, er zuckte kurz zusammen, nahm dann ihre Hand und umklammerte sie wie ein Kind, das Angst im Dunklen hat.
»Herr Wiedering. Haben Sie Herrn Grafenstein gefunden?«
»Ja, heute Morgen. Es war so … so schrecklich. Er hat immer so viel Wert auf sein Äußeres gelegt, und dann muss er so enden!«
»Um wie viel Uhr war das denn?«
»Ich bin um zehn Uhr nach Hause gekommen. Ich hab aufgesperrt und gerufen, aber er hat nicht geantwortet. Da war ich ein wenig enttäuscht, wir wollten zusammen frühstücken, und ich dachte, er hätte es vergessen. Später bin ich in sein Bad gegangen, und da lag er. O mein Gott, was soll ich nur tun?«
»Wo waren Sie denn?«
»In Hamburg.«
»Was haben Sie da gemacht?«
»Geschäftlich.«
»In welcher Branche sind Sie tätig?«
»Immobilien.«
[27]»Und Herr Grafenstein?«
»Kunst. Er ist Kunstexperte.«
Kolonja hatte inzwischen den Raum verlassen. Aus den Augenwinkeln sah sie, dass das kleine Badezimmer mittlerweile von den Kollegen der Spurensicherung inspiziert wurde, Wiedering schien das aber völlig egal zu sein. Er setzte sich wieder auf die Ledercouch und sah Anna ausdruckslos an. Trotz seiner schlechten Verfassung wirkte er wie aus dem Ei gepellt, lediglich seine roten verquollenen Augen störten das gepflegte Äußere. Ein Polohemd mit Emblem, eine sorgfältig gebügelte Leinenhose, ein altmodisch gezwirbelter Schnurrbart und ein Siegelring mit Wappen – auf Anna wirkte er wie der Prototyp des österreichischen Adeligen. Er würde ihren Chef, Hofrat Hromada, wahrscheinlich kennen, und wenn nicht, würde es nicht lange dauern, bis sie sich über gemeinsame Bekannte ausgetauscht hätten.
»Herr Wiedering, ich weiß, das ist jetzt sehr schwer für Sie, aber Sie müssen mir ein paar Fragen beantworten.«
Er zog die Nase hoch und setzte sich aufrecht hin. »Ja, fragen Sie nur, ich schaffe das.«
»Wann haben Sie das letzte Mal mit Herrn Grafenstein telefoniert?«
»Vorgestern Nachmittag. Samstag.«
»Und war da irgendwas Besonderes?«
»Nein, er war wie immer. Ein bisschen einsam – er hatte es nicht gern, wenn ich weg war.«
»Hatte er eine Verabredung für den Abend?«
»Nein, er war müde, wollte früh ins Bett.«
[28]»Aber er hat gekocht.«
»Ja, ich hab mich auch gewundert. Es ist so gar nicht seine Art, alles so zu hinterlassen. Er ist ein ordentlicher Mensch.« Seine Stimme brach, er schlug wieder die Hände vors Gesicht, als würde er über das dreckige Geschirr weinen.
»Er hat also nicht erwähnt, dass er für jemanden kochen wollte?«
»Nein.«
»Hat er manchmal für sich selber gekocht?«
»Nein. Wenn ich nicht da war, hieß das für ihn: Dinner-Cancelling. Er fühlte sich immer zu dick.«
»Und gestern? Haben Sie gestern nicht telefoniert?«
»Nein. Also, ich hab es ein paarmal versucht, aber er ging nicht ran.«
»Und hat Sie das nicht alarmiert?«
»Nein. Er war immer so nachlässig mit seinem Handy. Hat oft vergessen, es aufzuladen.«
»Herr Wiedering. Hatte Ihr Lebensgefährte eine Affäre? Wissen Sie etwas, oder haben Sie einen Verdacht?«
»Wir sind seit fünfundzwanzig Jahren zusammen. Er hat keinen anderen auch nur angesehen.«
»Sind Sie ganz sicher?«
Christian Wiedering schüttelte angewidert den Kopf. »Ihr Heteros glaubt immer, wir Schwulen kennen keine Treue und keine Verbindlichkeit!«
»Jetzt interpretieren Sie aber ein bisschen viel rein in meine Frage, oder? Ich möchte doch nur wissen, für wen Herr Grafenstein so aufwendig gekocht hat. Wissen Sie, wann Ihre Therme das letzte Mal gewartet wurde?«
[29]»Wie – gewartet?«
»Na, wann der Rauchfangkehrer bei Ihnen war oder ein Installateur?«
»Das war vor dem Winter. Ich kann mich gut erinnern, am ersten kalten Tag im Oktober. Wir wollten einheizen, und das Gerät sprang nicht an. Wissen Sie, wie lang es in dieser Stadt dauert, einen Installateur zu bekommen?«
»Ja, ich kann’s mir vorstellen. Und dann kam einer?«
»Nach zwei Tagen. Der hat irgendwas rumgeschraubt und dann hundert Euro kassiert. Warum fragen Sie? War die Therme nicht in Ordnung? Musste Josef deswegen sterben?«
»Das wird sich in den nächsten Stunden herausstellen. – Erzählen Sie mir ein wenig über den Beruf Ihres Lebensgefährten? Was macht ein Kunstexperte?«
»Er berät Museen und Privatleute in Sachen Kunst.«
»Wie darf ich mir das vorstellen?«
»Na ja, er schreibt Expertisen und schaut, ob die Bilder echt sind, und schreibt auch Artikel in Fachzeitschriften.«
»Hat er ein Büro?«
»Ja, im KHM. Aber er arbeitet auch viel von hier.«
»KHM?«
»Kunsthistorisches Museum.« Wiedering verdrehte ein wenig die Augen.
Anna fühlte sich müde und kraftlos. Das Gefühl, das sie normalerweise bei einem neuen Fall packte, wenn das Adrenalin plötzlich durch ihren Körper strömte, blieb aus. Sie dachte an die mühsame Kleinarbeit, an die tausend Befragungen und Recherchen. Sie schloss für einen [30]Augenblick die Augen, und in ihr keimte die Hoffnung auf, dass das Ganze doch ein Unfall war.
»Sagen Sie, warum hat Herr Grafenstein das kleine Badezimmer benutzt?«
»Das machte er meistens. Wir lieben uns sehr, aber das mit dem Badezimmer war immer schwierig. Er braucht so lang, und da kam es immer wieder zu Konflikten. Deswegen haben wir vor ein paar Jahren das kleine Zimmer umbauen lassen. Das war früher ein Dienstbotenzimmer.«
»Und das hat ausschließlich er benutzt?«
»Ja. Warum fragen Sie?«
Annas Blick wurde von einem gestikulierenden Kollegen, der in der Tür stand, abgelenkt. »Frau Chefinspektor, kommen Sie mal?«
»Einen Moment bitte, ich bin gleich wieder bei Ihnen.«
Der junge Kollege führte sie zurück ins Badezimmer, wo ein grimmig aussehender Mann auf einer Stehleiter balancierte. Er blickte kurz nach unten und klopfte dann mit einem Schraubenzieher an das untere Ende der Gastherme. »Also für mich ist das eindeutig, die Therme wurde manipuliert.«
»Wie?« Anna streckte sich und versuchte etwas zu erkennen.
»Der Gasströmungswächter wurde beschädigt. Wie genau, weiß ich noch nicht. Der ist dafür zuständig, dass… Ach, das verstehen Sie eh nicht, jedenfalls ist das eine Vorrichtung, die die Gaszufuhr stoppt, wenn da was dumm läuft. Und dumm gelaufen ist es deswegen, weil da oben die Therme verstopft wurde. Diesen Fetzen hab ich da rausgezogen.«
[31]Anna folgte seinem Blick in die Duschtasse, in der ein zerknülltes Handtuch lag.
»Das ist da nicht von selber reingeflogen, da hat sich jemand ziemlich Mühe gegeben.«
Gut. Kein Unfall. Kein natürlicher Tod. Wohl auch kein Selbstmord, oder – warum eigentlich nicht? Der Techniker beantwortete ihre nicht gestellte Frage: »Ich glaube nicht, dass das ein Suizid war. Er hätte da raufklettern müssen, über dieses Kasterl, hätte das Handtuch reinstopfen und dann noch den Strömungswächter zerstören müssen, hätt sich ein Wasser eingelassen und zum Sterben in die Wanne gelegt, also ich weiß nicht recht.«
»Danke.«
Anna Habel wandte sich an den jungen Kollegen, der neben ihr stand. »Können Sie mir so schnell wie möglich den schriftlichen Bericht ins Büro liefern. Vielleicht versteh ich das dann ja mit dem äh… Gasströmungswächter.« Anna dachte an ihren Physikprofessor, der zwar ein sympathischer Typ war, ihr Interesse für die Welt der festen, flüssigen und gasförmigen Stoffe aber nie hatte wecken können.
»Jawohl. Das geht schnell. Morgen früh hamm S’ den Bericht.«
Anna Habel kehrte ins Wohnzimmer zu Wiedering zurück, neben dem nun ein Kollege stand, der wie gebannt auf die großformatigen Kinderbilder an der Wand starrte.
»Herr Wiedering, ich muss Sie bitten, die Wohnung für die nächsten Tage zu verlassen. Haben Sie Familie oder Freunde, bei denen Sie vorübergehend wohnen können?«
[32]»Warum? Jetzt ist mein Liebster nicht mehr, da wollen Sie mir auch noch meine Wohnung nehmen?«
»Es ist nur für ein paar Tage. Wir müssen die Wohnung gründlich auf Spuren untersuchen. Können wir Sie irgendwohin bringen?«
»Ja, zu meiner Schwester, die wohnt in Hietzing.«
»Gut. Sie halten sich bitte zur Verfügung. Jetzt werden nur noch Ihre Fingerabdrücke abgenommen, die brauchen wir zum Vergleich. Geben Sie mir bitte Ihre Telefonnummer, damit wir Sie erreichen können. Der Kollege bringt Sie zu Ihrer Schwester.«
Anna Habel und Robert Kolonja atmeten auf, als der so unerwartet verwitwete Lebensgefährte aus der Wohnung geführt wurde. Sie setzten sich nebeneinander auf das Ledersofa, automatisch fiel ihr Blick auf die Kinderporträts.
»Pervers.« Kolonja zog angewidert die Mundwinkel nach unten.
»Was?«
»Na, sich solche Bilder an die Wand zu hängen. Kinderbilder. Zwei Schwule.«
»Das ist Kunst.«
»Das ist mir egal, ich find’s pervers. Sag bloß, dir gefällt das!«
»Ich finde es interessant.«
»Ah ja. Interessant. Und du kennst sicher auch den Maler.«
»Es sieht aus wie Gottfried Helnwein. Aber ob die echt sind? Die Bilder von dem sind nicht gerade billig.«
»Das ist mir egal, ich find sie trotzdem scheußlich.«
[33]»Na, darf ich eure Kunststunde kurz unterbrechen?« Martin Holzer von der Spurensicherung war so leise an sie herangetreten, dass beide zusammenzuckten, als hätte man sie bei etwas Verbotenem ertappt. Anna stand auf. »Hast du was?«
»Ja, Fingerabdrücke ohne Ende. Vor allem in der Küche. Scheint ein gastfreundlicher Haushalt gewesen zu sein. Im Badezimmer leider bis jetzt nichts. Außer die Abdrücke von Grafenstein selbst. Die Weingläser und ein paar Essensreste hab ich eingepackt, die werden wir gleich analysieren. Wir sind soweit mal fertig, ihr könnt mit eurem Programm beginnen.«
Das Programm. Alle Bürounterlagen durchwühlen, Computer knacken, Mails lesen, Browserverlauf untersuchen, Handy und Telefon checken, Nachbarn befragen, Geldangelegenheiten ausforschen. Das ganze Programm. Immer und immer wieder. Warum ermüdete Anna der Gedanke heute besonders? Vielleicht war es dieses Gefühl, immer wieder bei null anzufangen. Obwohl, in welchem Beruf war es anders? Arzt, Lehrer, ja sogar ihre Buchhändlerin stöhnte über die immer neuen Verlagsprogramme. Sie gab Helmut Motzko telefonisch die Daten des Opfers durch, er sollte sich gleich mal auf die virtuelle Spurensuche begeben: Internet, Meldeamt, Strafregister, Bankgeschäfte, Mobilfunkbetreiber.
Das Schlafzimmer war eine Höhle in Rot. Burgunderfarbene Satinbettwäsche, dunkelrote Samtvorhänge, ein purpurfarbenes Bild an der Wand. Kolonja wandte sich angeekelt ab, Anna musste lachen. »Ich wusste gar nicht, dass du so ein Problem mit Schwulen hast? Was ist denn [34]so schlimm an den beiden, ist doch schön, wenn zwei sich so liebhaben.«
»Wer weiß. Vielleicht hat er ihn umgebracht. Eifersucht oder Geldgier oder was weiß ich.«
»Das glaub ich nicht, aber wir werden natürlich gleich überprüfen, ob er wirklich im Flugzeug saß. Und spätestens morgen wissen wir den genauen Todeszeitpunkt, dann können wir das ausschließen. Ich hab seine Bordkarte übrigens da draußen im Vorzimmer auf diesem Biedermeiertischchen liegen gesehen, die sah echt aus.«
Das Arbeitszimmer war großzügig angelegt. Zwei Schreibtische standen sich mitten im Raum gegenüber. Da hatten sie also gesessen, die beiden Herren, auf ihren Designerbürostühlen, der eine machte in Immobilien, der andere in Kunst. Wiederings Schreibtisch – Anna erkannte ihn an einem schuhschachtelgroßen Modell der Werkbundsiedlung – war penibel aufgeräumt, auf der grünen Ablagefläche lagen ein Mäppchen und ein paar Briefumschläge. Grafensteins Schreibtisch war das komplette Gegenteil. Papiere in unordentlichen Stößen, mehrere Bildbände aufgeschlagen übereinander, überall klebten gelbe Post-it-Zettel. Kolonja drückte auf die Leertaste der Computertastatur, und mit einem leisen Pling erhellte sich der Bildschirm. »Hoppla, kein Passwort, alles an. Na, der hat nix zu verbergen.«
Anna beugte sich vor und überflog den Text auf dem Schirm.
»Der beschreibt irgendein Bild, schau, da: Die Farben sind im unteren Drittel des Bildes etwas stumpf, eventuell wurde das Bild durch Wasser oder zu hohe [35]Luftfeuchtigkeit beschädigt. Die Leinwand zeigt eine Struktur, die in den Niederlanden des 17.Jahrhunderts… Sehr interessant. Worüber schreibt er da?« Kolonja scrollte nach oben und las die Überschrift vor, als würde er ekliges Essen bestellen: »Jan van Goyen. Flusslandschaft mit Fischern.«
»Das wird ein Fall für dich, lieber Robert. So viel Kunst und Kultur, da hüpft doch dein Herz, oder?«
Kolonja zog eine Grimasse. Es war ein alter Witz zwischen ihnen: Anna Habel, die in ihrer Freizeit am liebsten mit einem Stapel Bücher auf dem Sofa lag und im Auto das Programm von Ö1 rauf und runter hörte. Und daneben ihr Kollege Robert Kolonja, der jede Zeitung prinzipiell beim Sportteil aufschlug und sein Autoradio permanent auf Radio Wien eingestellt hatte. Theater, Film und Buch machten ihn nervös, und das Museumsquartier war für ihn nicht mehr als eine Location, wo man im Sommer schön urban ein kühles Bier trinken konnte. Auch Anna musste zugeben, dass sie mit den bildenden Künsten nicht wirklich viel am Hut hatte, bei ihrer Rezeption von Bildern gab es nur zwei Möglichkeiten: Gefällt mir oder gefällt mir nicht. Ihr mittlerweile fast erwachsener Sohn Florian hatte als kleiner Junge eine gewisse Leidenschaft für Museen entwickelt, und besonders die alten Meister hatten es ihm angetan. Damals waren sie stolze Besitzer einer Jahreskarte für das Kunsthistorische Museum gewesen, und Anna dachte kurz an die verträumten Nachmittage, an denen ihr Sohn, mit Audioguide bewaffnet, völlig fasziniert die Säle ablief. Sie hatte damals immer ein etwas schlechtes Gewissen gehabt, weil sie Florians Begeisterung nicht teilte. Oft setzte [36]sie sich nach einiger Zeit ein wenig abseits auf eine Bank und las im mitgebrachten Buch.
»Aber wenn der über diese Flusslandschaft mit Fischern schreibt, dann muss das doch da irgendwo sein? Ich mein, ich hab ja keine Ahnung, aber wenn man ein Bild so genau beschreibt, muss man es doch vor sich haben, oder?« Kolonja sah sich suchend im Raum um, blieb vor den Gemälden an der Wand stehen, die augenscheinlich nichts mit Flüssen oder Fischern zu tun hatten.
»Korrekt. Und es klingt ja nicht, als würde er es für ein Schulbuch beschreiben. Aber vielleicht wird ja gerade eine Ausstellung vorbereitet, und er arbeitet am Katalog. – Wart mal.« Anna setzte sich an den PC, öffnete den Internetbrowser und gab in die Suchmaschine Jan van Goyen, Flusslandschaft ein. Wikipedia vermeldete: ›Das Gemälde befindet sich im Privatbesitz in Berlin.‹
Auch das E-Mail-Programm war nicht gesichert, und Anna überflog den Posteingang der letzten Tage. Auf den ersten Blick konnte sie nichts Auffälliges erkennen.
»Glaubst du, dass jemand das Bild gestohlen hat und Grafenstein deswegen sterben musste?« Kolonja blickte Anna über die Schulter.
»Raubmord mit Kohlenmonoxidvergiftung? Das hab ich noch nie gehört. Das Türschloss war auch unbeschädigt, der kannte seinen Mörder. Also, ich glaube nicht, dass das etwas mit dem Bild zu tun hat. Wir machen jetzt mal die Nachbarn-Tour.«
[37]3
Bernhardt, Cellarius und Cornelia Karsunke hatten Fröhlich und seine Jungs allein in dem Haus zurückgelassen. Sollten die erst einmal ihre Arbeit machen. In der Nähe fanden sie ein Gasthaus mit einem großen Garten, in dem sie ganz alleine waren. Der Kellner war unfreundlich, der Kaffee eine Plörre. Die übliche Berliner Mischung.
Bernhardt ging es um eine erste Bestandsaufnahme, sie mussten etwas festeren Boden unter die Füße bekommen. Also die ersten Eindrücke ordnen, ein bisschen spekulieren. Bernhardt fing an.
»Das Opfer ist 1940 geboren, das immerhin hat Katia herausgefunden. Hatte irgendwas mit Kunst zu tun. Und: Wir sind hier in Ost-Berlin, das ist euch klar?«
Cornelia seufzte, signalisierte, dass sie nicht völlig beschränkt sei, und spann den Faden weiter, es war ein altbewährtes Spiel.
»Er hat schon lange in dem Haus gelebt, der ist da nicht erst vor ein paar Jahren eingezogen.«
Cellarius übernahm.
»Hat er vor dem Mauerfall schon hier gewohnt? Vorsichtiges Ja meinerseits. Ich gebe Cornelia recht, das Haus ist seit Jahrzehnten von dem eingewohnt, würde ich sagen.«
[38]Cornelia nahm den Ball wieder auf.
»Aber was hat er all die Jahre gemacht, vor dem Mauerfall, nach dem Mauerfall? Und die allerwichtigste Frage: Was ist mit den Bildern?«
Bernhardt schaute in einen Baum, wo ein Specht hartnäckig auf den Stamm einhackte.
»Echt können die nicht sein, das ist klar. Aber sie sehen so aus. Wie erklären wir uns das?«
Cellarius wiegte den Kopf und trank von seinem koffeinfreien Kaffee.
»Also, meine Frau und ich, wir sammeln ja selbst Kunst, seit ein paar Jahren, ein bisschen, also nicht richtig…«
Er verhedderte sich, errötete und suchte nach Worten. Bernhardt mochte es, dass sein Kollege nur ungern erwähnte, die Tochter eines großen Immobilienmaklers mit Villa in Dahlem geheiratet zu haben.
»Also, äh, ja, was ich sagen will: Dabei erfährt man so einiges. Fälschungen sind da weit verbreitet. Hat jeder Angst vor, andererseits verschließen aber auch viele die Augen vor der Gefahr, wenn ihnen nur irgendein Experte die Echtheit des Werks garantiert. Wusstet ihr, dass angeblich neunzig Prozent der Werke von Dalí gefälscht sind?«
Cornelia lachte leise. Bernhardt liebte dieses Lachen, das wie mit leichtem Flügelschlag daherkam. Warum hatten sie es nicht geschafft, ein Paar zu werden? Als hätte sie seine Gedanken gelesen, warf ihm Cornelia einen Blick zu, dem er nicht standhalten konnte. Er räusperte sich.
»Nein, aber Dr.Theo Wessel hatte auch gar keinen Dalí, glaube ich. Und dieser Brueghel, nur mal [39]angenommen, der wäre echt, der könnte doch gar nicht auf den Markt gebracht werden.«
Cellarius hob die Hand. »Auf den offenen Markt sicher nicht. Aber es findet sich bestimmt ein Milliardär, der sich so was gern in sein Schlafzimmer hängt. Übrigens: Es gibt sehr gute Fälscher. In China malt ein ganzes Dorf alte europäische Meister auf Anfrage, und zwei, drei von diesen Chinesen sollen richtige Kopierkünstler sein. Also wenn man denen alte Leinwände oder alte Holztafeln liefert und ihnen erklärt, wie man Farben in alter Manier herstellt… Aber so genau weiß ich’s auch nicht.«
Bernhardt runzelte die Stirn.
»Stopp. Wir haben ein Problem. Wir können keine stichhaltige Aussage über diese Bilder machen, da brauchen wir Fachleute. Und bis wir die haben… Cornelia, ruf Katia mal an, die soll sich mal um ein paar Spezialisten kümmern. Für diesen Kunstkram sind schließlich nicht wir zuständig. Was ist mit den Kollegen vom Kommissariat für Kunstdelikte? Und es muss ja auch Kunsthistoriker geben, die die Echtheit von Bildern erkennen können.«
Cornelia blickte Bernhardt aus leicht zusammengekniffenen Augen an. »Wird gemacht, Chef.« Die Betonung lag auf dem letzten Wort.
»Danke. Ich nehme mir jetzt die beiden Nachbarhäuser von Wessel vor. Ich hoffe, dass da jemand zu Hause ist und etwas mitzuteilen hat. Und ihr geht mal diesen Ring ab, der eine im Uhrzeigersinn, der andere gegen den Uhrzeigersinn, irgendwann stoßt ihr dann aufeinander und habt hoffentlich viele interessante Aussagen zu unserem Kunstfreund zusammengetragen.«
[40]Auf dem Weg in Richtung Bilderhaus, wie er es für sich nannte, hatte Bernhardt den Eindruck, dass die Natur es einfach übertrieb. Die Bäume am Straßenrand und in den Gärten strotzten vor Grün, die Vögel sangen wild durcheinander, als hätten sie eine Überdosis Kokain bekommen, und dann noch diese verdammten Pollenattacken.
Er ging auf das Nachbarhaus zu, das als eines der wenigen Häuser noch den graubraunen Einheitsputz aus der Zeit vor der Wende trug. Er musste mehrmals an die Tür klopfen, bis ihm ein alter Mann die Tür öffnete. Ein alter Mann? Nach Jahren gerechnet sicher, aber seine ganze Erscheinung drückte Straffheit, Konzentration, Unbeugsamkeit aus. Stahlgraues dichtes Haar, ein Gesicht mit scharfen Konturen wie aus Granit gehauen, direkter Blick.
»Er ist tot.«
Das war keine Frage, sondern eine Feststellung. Der geht keine Umwege, sagte sich Bernhardt, was sein Gegenüber gleich noch einmal demonstrierte.
»Bei solch einem schlimmen Heuschnupfen sollte man immer ein Fläschchen Borwasser dabeihaben.«
»Ja, guter Vorschlag, Herr…«
»Ackermann, Hans Ackermann, und Sie sind…?«
»Kriminalhauptkommissar Thomas Bernhardt, LKA 1, ›Delikte am Menschen‹.«
»Kommen Sie rein, Herr Kollege.«
Sie betraten ein karg eingerichtetes Wohnzimmer: ein Sofa, ein Sessel, eine Stehlampe, deren Schirm am unteren Rand Troddeln hatte, ein kleiner Tisch. Alles in gedeckten bräunlichen Farben, die leicht ausgebleicht wirkten. [41]Bernhardt hatte das Gefühl, als machte er eine Zeitreise zurück in die siebziger, sechziger, vielleicht sogar in die fünfziger Jahre. Der Mann führte ihn in die Küche an einen Tisch mit zwei Stühlen.
»Kaffe?« Er sprach das Wort berlinisch aus, mit offenem e am Ende.
»Gern.«
Er hantierte am Herd, drehte sich zu Bernhardt um.
»Einen richtig aufgebrühten Kaffe, trinken Sie so was?«
»Was ist ein richtig aufgebrühter Kaffee?«
»Man gibt heißes, nicht kochendes Wasser über frischgemahlenes Pulver, wartet, bis sich der Sud gesetzt hat, und gießt vorsichtig ein. Gibt nischt Besseres.«
»Das ist die türkische Methode, oder?«
»Nee, die Weddinger. Hat meine Mutter zu Hause im Wedding so gemacht und meine Frau auch. Sind beide schon lang tot.«
Er hat Selbstdisziplin, sagte sich Bernhardt. Hier war es aufgeräumt und sauber, als gäbe es eine fürsorgliche Hausfrau oder eine täglich tätige Putzfrau.
»Und wir sind Kollegen?«
»Na ja, im weiteren Sinne schon.«
»Und das heißt?«
Hans Ackermann stellte die Kaffeemühle, die er zum Mahlen der Bohnen zwischen die Beine genommen hatte, auf den Tisch neben den Herd, zog die kleine Schublade mit dem Kaffeepulver heraus und schüttete den Inhalt in eine bauchige Kanne. Dann goss er das Wasser darüber und kam mit der Kanne und zwei Kaffeepötten zu Bernhardt und setzte sich an den Tisch.
[42]»Wenn Sie Zeit haben, hole ich ein bisschen aus.«
»Nur zu.«
»Gut. Ich hatte Glück. Ich habe den Krieg überlebt, ’44/’45 war ich Flakhelfer auf diesem riesigen Bunker am Humboldthain, kennen Sie vielleicht? Da sind nicht so viele übriggeblieben. Und als alles vorbei war, in dieser völlig zerbombten Stadt, habe ich mir gesagt, jetzt muss alles anders werden.«
»Und da sind Sie Kommunist geworden.«
»Musste ich gar nicht werden, lag sozusagen in den Familiengenen. Roter Wedding, wenn Sie verstehen?«
»Verstehe.«
»Das ging bei mir ’49 los mit der Arbeiter- und Bauernfakultät, wo die Kinder der Arbeiterklasse studieren konnten, dann bin ich zur kasernierten Volkspolizei, und dann bin ich zum Wachregiment hier im Städtchen delegiert worden.«
»Im Städtchen?«
»Aus’m Westen, was? In die Häuser hier am Ring sind nach ’45 die Genossen der kpd und dann der sed eingezogen. Ulbricht, der Name sagt Ihnen doch noch was?, und sein Politbüro. Das Städtchen wurde natürlich streng bewacht. Mit Wachtposten an den Eingängen, man kam nur mit Passierscheinen rein.«
»Und da gehörten Sie zu den Wachhabenden?«
»Ja. Aber nach den konterrevolutionären Ereignissen im Juni ’53 sind die wichtigsten Genossen dann nach Wandlitz in die Waldsiedlung rausgezogen. Konnte man besser sichern.«
»Und Sie sind mitgezogen?«
[43]»Nein, da bin ich zur Kripo. Im Wald wollte ich nicht sitzen. Ich habe dann ganz normale Polizeiarbeit gemacht, war bis ’89 in der Mordkommission.«
»Dann sind wir ja wirklich Kollegen.«
»Na ja, mich haben sie nach der Wende nicht übernommen, angeblich aus Altersgründen.«
»Und der Mauerfall? War schlimm?«
»Wir hätten’s anders lösen können. Sozialistische Demokratie, Initiative und Kampfbereitschaft. Aber es war ja nichts mehr da. Oben die verkalkten Betonköpfe, unten schlug man sich so durch. Alles war ausgehöhlt, ausgelaugt. Wenn ich an die Kampfjahre in den Fünfzigern denke…«
Er stellte seine Kaffeetasse hart auf dem Tisch ab.
»Die Mauer war nötig, aber die Mauer hat uns auch kaputtgemacht.«
»Und, sind Sie noch Kommunist?«
Bernhardt schien es, als sei das Gesicht von Hans Ackermann jetzt noch einen Deut härter und schärfer konturiert als zuvor.
»Wer einmal dazugehört hat, kann nicht einfach aufhören. Das ist wie in einem Orden, man gehört immer dazu, auch wenn man nicht mehr glaubt.«
»Und Sie glauben nicht mehr?«
Hans Ackermann schwieg lange.
»Ich weiß es nicht. Der Klassenkampf, wie wir ihn geführt haben, ist sicher vorbei. Aber es wird neue Kämpfer geben für eine bessere und gerechtere Welt.«
Bernhardts Widerwille gegen Pathos meldete sich zu Wort.
[44]»Aber hier wohnt es sich ganz schön, oder? Wohnen Sie schon seit den Fünfzigern hier?«
»Für Leute wie mich war das Städtchen nicht vorgesehen.«
»Ach so?«
»Ich bin erst nach der Wende hierhergezogen. Ich hatte ein bisschen Geld, und meine Kinder haben mich unterstützt beim Kauf des Häuschens.«
»Schöne Dialektik, dass Sie jetzt hier wohnen können, wo früher nur die Privilegierten leben durften. Und das ohne jeden Sozialismus.«
Er hatte es sich verscherzt. Ackermann schaute ihn böse an.
»Stellen Sie Ihre Fragen!«
»Was wissen Sie über Ihren Nachbarn Dr.Theo Wessel?«
»Wenig.«
»Wirklich? Sie sind doch sicher ein guter Beobachter.«
Der Appell an seine Professionalität stimmte Hans Ackermann milder.
»Na ja, der hat für sich gelebt, nur das Nötigste gesprochen, Kontakte, wenn’s ging, vermieden. Nur die polnische Putze kam an jedem Werktag. Ich würde sagen, der war der letzte Ureinwohner, den’s hier noch gab.«
»Wirklich?«
»Nach ’89 ist hier alles richtig durchgeschüttelt worden. Ein paar von den Genossen konnten sich noch eine Zeitlang halten. Lotte hat hier bis ins neue Jahrtausend in ihrem Haus gelebt und brav ihren täglichen Spaziergang gemacht.«
[45]»Lotte?«
»Ulbricht. Und Krenz, der den Karren ’89 schließlich endgültig in den Dreck gefahren hat, wollte lange nicht weg. Aber gegen die ganzen Anträge auf Rückübertragung war auf Dauer nichts zu machen. Und dann das neue Geld, das hier reingeschissen ist.«
»Alle sind gegangen, und Sie sind gekommen. Hatten ein bisschen Geld.«
»Hatte ich.«
»Gut, aber das ist nicht unser Thema, zumindest jetzt noch nicht. Wessel hat hier also schon lange gelebt. Was hat er beruflich gemacht?«
»Gute Frage.«
»Fragt sich, ob’s eine gute Antwort gibt?«
»Ich weiß es nicht.« Bernhardt spürte eine leichte Abkühlung. Machte Ackermann wieder dicht? »Und es interessiert mich auch nicht mehr wirklich.«
»Wissen Sie, dass in dem Haus die Wände mit teuren Bildern geradezu tapeziert sind?«
»Nee.«
Punkt. Mehr hatte er offensichtlich nicht zu sagen.
Als spürte Ackermann, dass er die Temperatur des Gesprächs zu abrupt abgesenkt hatte, schlug er wieder einen verbindlichen Ton an.
»Na ja, ich kann mich ja mal ein bisschen umhören. Aber versprechen Sie sich nicht zu viel davon.«
Hans Ackermann entließ Thomas Bernhardt mit festem, trockenem Händedruck.
»Können jederzeit wiederkommen, gibt auch Kaffe.«
[46]Das Nachbarhaus auf der anderen Seite von Wessels Hexenhäuschen war das blanke Gegenteil der beiden Häuser, die Bernhardt bislang besucht hatte. Es strahlte in blendendem Weiß, der Rasen war perfekt getrimmt, und sein Grün leuchtete aufdringlich, das Glas der hohen Fenster war offensichtlich verspiegelt, man konnte nicht ins Innere schauen.