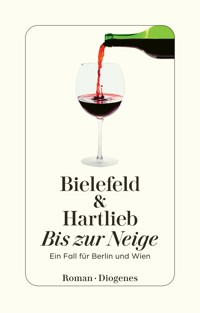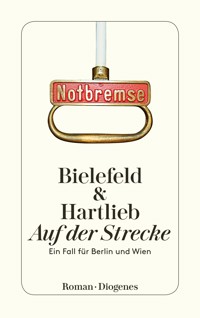9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für Berlin und Wien
- Sprache: Deutsch
Der dritte Fall für das streitbare Ermittlerpaar Thomas Bernhardt und Anna Habel führt ins Theatermilieu von Berlin und Wien. Sophie Lechner war ein Star am Wiener Burgtheater, nun wollte sie auch in Berlin Beifall ernten – doch der letzte Akt kommt für die junge Schauspielerin schneller als gedacht: Sie wird in ihrer Wohnung erstochen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 394
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Claus-Ulrich Bielefeld
Petra Hartlieb
Nach dem Applaus
Ein Fall fürBerlin und Wien
Roman
Die Erstausgabe erschien
2013 im Diogenes Verlag
Umschlagfoto:
Copyright © AGfoto/
iStockphoto
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2015
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 24296 6 (1. Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60344 6
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] Alle Personen und Ereignisse in diesem Roman sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen oder mit tatsächlichen Ereignissen wären also rein zufällig.
[7] 1
Thomas Bernhardt stand mit dem Rücken zum Zimmer. Er starrte aus dem Fenster auf den zugefrorenen, schneebedeckten Lietzensee. Ein paar Jugendliche hatten eine größere Fläche freigeräumt und spielten Eishockey. Er hörte gedämpft das dumpfe Klacken, wenn die Stöcke aneinanderschlugen. Kinder schlitterten auf einer schmalen Eisbahn, die schwarz glänzte. Immer wieder fielen sie hin und purzelten übereinander. Ein paar Mütter standen zusammen und tranken Glühwein, den ein Mann an einem kleinen Stand ausschenkte. Die Schreie und das Rufen der Kinder kamen von weit her, wie aus einer anderen Welt.
Bernhardt ließ seinen Blick schweifen. Wie friedlich alles schien – ganz im Gegensatz zu der Szenerie hinter ihm. Links der Spielplatz vor dem jüdischen Altersheim, ein paar vermummte Gestalten drückten sich in einer Ecke herum, eine Frau schob ein dick eingepacktes Kind auf einer Schaukel immer wieder an. In der Kirche, deren Altarraum mit der großen Glasfront in den Lietzenseepark ragte, brannte Licht. Hunde liefen im Park über die Schneefläche, manche kackten, was ihre Besitzer offensichtlich nicht störte. Hinter den schemenhaft aufragenden Bäumen zog sich in der Waagrechten [8] ein unregelmäßig flackernder Lichterstrom durch den grauen Tag. Die Busse und Autos auf der Neuen Kantstraße.
Er schaltete von Fern- auf Nahblick, von außen nach innen. Noch immer drehte er sich nicht um. Wie in einem dunklen Spiegel zeichnete sich auf dem Fensterglas ab, was er vor wenigen Minuten im hellen Licht, scharf umrissen und in schmerzender Klarheit gesehen hatte: Eine junge Frau, die in einen verrutschten Kimono gehüllt war, lag gekrümmt auf einem weißen Teppich. Eine große Blutlache hatte sich um sie ausgebreitet. Mehrere Gestalten in weißen Kapuzenoveralls sammelten akribisch Spuren. Ein Kollege machte mit einer Kamera eine 3-D-Aufnahme des Raums. Seine Kollegin Cornelia Karsunke sprach mit dem Gerichtsarzt, Kollege Volker Cellarius stand daneben und schrieb in ein kleines Notizbuch.
Thomas Bernhardt drehte sich um. Seine Atemnot, die ihn immer in den ersten Minuten an einem Tatort überfiel, hatte er überwunden. Angst vor dem Ersticken – er kannte das und konnte die aufflammende Panik inzwischen gut im Zaum halten. Diese asthmatische Angst, wie er die Attacke nannte, gehörte einfach dazu. Ganz klar war ihm nicht, was da passierte. Er atmete zu schnell und zu viel ein. War es das? Er war wehrlos gegenüber den Eindrücken, die auf ihn einstürmten, seine Sinne waren aufs Äußerste gespannt. Sein Blick versuchte alles auf einmal zu fassen, jedes Detail zu registrieren und zugleich die Atmosphäre aufzunehmen, den Geist des Ortes zu spüren. Sein Auge wurde zur Kamera, [9] schwenkte den Raum langsam ab und machte eine Vielzahl von Aufnahmen, die er später jederzeit abrufen konnte. Erst wenn der Wahrnehmungsflash vorbei war, konnte er wieder ruhig und gleichmäßig atmen.
In den ersten Momenten einer Untersuchung, quasi mit dem ersten Blick, entschied sich der Verlauf der Ermittlungen, da war er sich sicher. Die Kollegen machten sich gern über sein kurzfristiges Außer-sich-Sein lustig. »Er ist wieder im ›Zustand der Gnade‹«, hatte ein Kollege mal gehöhnt, als Bernhardt wie ein Somnambuler an einem Tatort umhergewandelt war. Jetzt war er wieder bei sich, sah den leuchtend roten Fleck, der sich um den Hals der Toten ausgebreitet hatte, sah das lange Messer, das Fröhlich, der Leiter der Spurensicherung, vorsichtig in eine Plastikhülle gleiten ließ. Er starrte auf die Worte an der Wand. In schwungvollen Schriftzügen stand da: »Der früh Geliebte, nicht mehr Getrübte, er kommt zurück.« Auf den ersten Blick hatte er geglaubt, die Zeilen seien mit dem Blut der Toten geschrieben worden, aber es war weniger dramatisch: Jemand hatte einen dicken Filzstift mit roter Farbe benutzt.
Gegen Mittag war ein Anruf von der Polizeiwache am Kaiserdamm in der Keithstraße bei der Abteilung für Delikte am Menschen eingegangen. In einem Haus am Lietzensee hatte man aus einer Wohnung im vierten Stock laute Musik gehört, Opernarien. Auf das Klopfen der Hausbewohner und der herbeigeholten Polizisten war nicht geöffnet worden. Die Tür wurde schließlich [10] aufgebrochen, in einem Zimmer lag eine Tote auf dem Boden. Erstochen. Mehr wussten sie nicht.
Als Thomas Bernhardt mit Cellarius im Auto über vereiste Straßen zu dem Haus am Lietzensee fuhr, schaltete er das Radio ein – ein Versuch, den neuen Fall noch für einen Moment von sich fernzuhalten. Es lief ein Interview mit dem Regierenden Bürgermeister. Ein Reporter versuchte sich als Stimme des Volkes: Warum wurden nur die großen Straßen vom Schnee geräumt? Warum waren auch sieben Wochen nach dem ersten Wintereinbruch Anfang Dezember die Nebenstraßen immer noch von einer dicken Schnee- und Eisschicht bedeckt? Warum mussten die Hauseigentümer nicht die Wege vor ihren Häusern räumen? War dem Bürgermeister bekannt, dass es in den Krankenhäusern kaum noch freie Plätze für die alten und auch jungen Leute gab, die ausgerutscht waren und sich etwas gebrochen hatten? Die Stimme des Reporters bebte vor Empörung.
Doch der Bürgermeister ließ die Fragen in seiner jovialen und bräsigen Art einfach abprallen. Er sage es ganz offen: Auch vor seinem Haus sei »Holiday on Ice« angesagt. Aber wenn die Natur mal richtig zeige, wozu sie fähig sei, könne auch die Berliner Stadtreinigung mit ihren bewährten Mitarbeitern nur bis zu einem gewissen Grade dagegensteuern. Er empfehle die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel. Was den Reporter zu einem Aufschrei brachte: Aber die S-Bahn fahre ja nur noch gelegentlich, die Weichen seien ständig eingefroren, es fehle an Bremssand, ganze Wagenreihen müssten wegen Wartungsfehlern aus dem Verkehr genommen [11] werden. Ein Einwand, der den Bürgermeister nicht erschütterte. In diesem Falle müsse sich der Reporter an die Deutsche Bahn wenden. Ja aber, wandte der langsam erschöpft klingende Reporter ein, sei er als Bürgermeister für die katastrophale Lage politisch nicht verantwortlich?
»Junger Mann«, sagte der Bürgermeister, und Thomas Bernhardt hatte sich vorgestellt, wie der Bürgermeister sich zurücklehnte, sein unnachahmliches Grinsen aufsetzte und zu großer Form auflief: »Junger Mann, eins ist doch klar, und ich rate Ihnen und vielen anderen, das einfach zu akzeptieren: Berlin ist nicht Haiti.«
Thomas Bernhardt hatte sich kurz Cellarius zugewandt, der die ganze Zeit still neben ihm gesessen hatte. »Teflon-Wowi, oder? Hast du gehört, dass die Eröffnung des Flughafens Schönefeld zum fünften Mal verschoben worden ist? Juckt niemanden, alle lachen sich einen Ast. Ich liebe diese Stadt: Nix funktioniert, aber alles läuft. Irgendwie. Und dazu passt dieser Regierende Bürgermeister wie die Faust aufs Auge.«
»Was soll er machen? Das ist der härteste Winter, den ich je erlebt habe.«
»Und dann herrscht die Eiszeit? Wie sieht’s denn bei euch in Dahlem aus?«
Cellarius, der mit der Tochter eines großen Immobilienhändlers verheiratet war und in einer Villa in Dahlem lebte, zuckte unbehaglich mit den Schultern.
»Wir haben einen Winterdienst, die halten da alles frei.«
Thomas Bernhardt hätte wetten können, dass [12] Cellarius rot geworden war. Aber es war zu dunkel im Auto, um das zu überprüfen.
Mit Mühe hatten sie eine Parklücke in der Kuno-Fischer-Straße, Ecke Suarezstraße, gefunden. Viele Autos waren in einem mit Splitt und Salz gepökelten Schneewall eingemauert, aus dem sie erst bei einer längeren Tauperiode herausgelangen würden. Bernhardt und Cellarius waren fluchend zu dem Haus geeiert. Sie fuhren mit dem Fahrstuhl nach oben in den vierten Stock. Alte Berliner Bürgerlichkeit. Die Fahrstuhltür aus Eisen war filigran geschmiedet, drinnen musste man zwei Holztüren mit blankpolierten Messingbeschlägen schließen, bevor man losfahren konnte. In der mit edlem Holz verkleideten Kabine gab es ein Bänkchen und einen Spiegel, der von Jugendstilornamenten und einem stilisierten Schwanenkopf umrahmt war. Auf einer Plakette stand »Baujahr 1909«. Leise ächzend, als klagte er über Altersschwäche, war der Fahrstuhl nach oben geruckelt.
Die Wohnung mit den glänzenden alten Eichendielen und den hohen Stuckdecken war sparsam möbliert, ein großer Holztisch, zwei Jugendstilstühle, ein Ohrensessel am Fenster, von dem man auf den Lietzensee schauen konnte. Mehrere Bücherstapel auf dem Boden. Bernhardt war auf Cornelia Karsunke zugegangen, die als Erste am Tatort eingetroffen war. Ihre schräggeschnittenen Augen, die ihr etwas rätselhaft Asiatisches gaben, weshalb er sie im Stillen und nur für sich »die Tatarin« nannte, waren gerötet und geschwollen. Sie war schlimm [13] erkältet. Morgens im Kommissariat in der Keithstraße hätte ihr Bernhardt gerne die Hand auf die Schulter gelegt und gesagt: »Komm, geh nach Hause, kümmre dich um deine beiden Mädchen.« Die lagen, wie sie am Vortag erzählt hatte, mit Fieber im Bett. Und Reyhan, die Bauchtänzerin, die häufig auf die beiden aufpasste, war nicht da, hatte irgendwo einen Auftritt. Und der Vater des jüngeren Mädchens war aus der Wohnung ausgezogen. Oder hatte sie ihn rausgeworfen? Das war Thomas Bernhardt nicht ganz klar. Gelegentlich schaute eine Nachbarin aus dem vierten Stock nach den Mädchen.
Cornelia redete seit einiger Zeit mit Thomas Bernhardt nur das Nötigste. Manchmal schaute sie ihn wütend und vorwurfsvoll an, dann wieder tat sie so, als nähme sie ihn gar nicht wahr. Was warf sie ihm vor? Dass er beim letzten Fall zu eng mit der Wiener Kommissarin, in der Keithstraße gerne »Anna die Schreckliche« genannt, zusammengearbeitet hatte? Fast hatte Bernhardt ein schlechtes Gewissen: Ja, es stimmte, es war ein bisschen über das rein Berufliche hinausgegangen. Gut. Aber jetzt ging’s um das Berufliche.
»Und, was habt ihr?«
Sie antwortete nicht gleich, sondern putzte sich lange und gründlich die Nase.
»Scheißwinter, Scheißerkältung.«
»Ja, und sonst?«
»Sonst ist das erst mal eine ziemlich klare Sache. Die Tote ist die Schauspielerin Sophie Lechner. Kennst du bestimmt aus dem Fernsehen.«
Thomas Bernhardt zuckte mit den Schultern.
[14] »Stimmt, du guckst ja nur Fußball. Aber die ist echt berühmt, von der Presse als ›die Wilde vom Dienst‹ oder ›die große Exaltierte‹ bezeichnet. Sollte angeblich demnächst in einem Hollywood-Film mitspielen. Und am Burgtheater in Wien hat sie vor knapp einem Jahr das Gretchen im Faust gespielt. Supermoderne Inszenierung, Gretchen ist nicht nur die Verführte, sondern auch eine Verführerin. Und in einer Szene ist sie ganz nackt. Ist dafür zur Schauspielerin des Jahres gewählt worden.«
»Na toll.«
Cornelia zog aus ihrer Tasche ein iPhone und wischte mit dem Zeigefinger ein paarmal über das Display. »Wart mal, gleich hab ich’s. Ja, genau. In einer Kritik heißt es: ›Sophie Lechner ist eine Schauspielerin, die die Nervenbahnen eines Textes freilegt und Energien fließen lässt, mit denen niemand gerechnet hat.‹«
»Auf was die alles kommen, diese Kritiker.«
Andererseits, sagte er sich: Waren sie nicht auch in gewisser Weise Kritiker, mussten sie nicht auch eine Aufführung, eine Inszenierung beurteilen? In diesem Moment waren sie doch Zeugen des letzten Akts eines Dramas, perfektes Arrangement auf der Wohnzimmerbühne. Nur ging’s hier um ein Menschenleben. Und sie mussten einen Täter finden.
»Also eine berühmte Schauspielerin.«
»Ja, Theater, Film und Fernsehen. Bis vor einem halben Jahr hat sie in Wien gelebt, da war sie am Burgtheater engagiert, ist dann aber nach Berlin gezogen.«
»Wenn sie in Wien Erfolge feiert, wieso kommt sie dann nach Berlin?«
[15] »Sie hat sich in Wien nicht mehr wohl gefühlt. Künstlerischer Stillstand. Auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Aus dem verstaubten Wien ins pulsierende Berlin. Ist wohl immer ziemlich aufs Ganze gegangen. Eine ›Meisterin der Selbstinszenierung‹, noch so ’n Zitat aus der Presse. Laut einem Interview wollte sie da sein, wo die Musik spielt.«
Die Zeiten der langsamen Recherche, das Schnüffeln in Zeitungsarchiven, in Bibliotheken, die langen Telefonate mit Kollegen oder Leuten in irgendwelchen Instituten, das war nicht mehr angesagt. Bernhardt trauerte der computerlosen Zeit, die er in seinen ersten Jahren bei der Polizei noch erlebt hatte, ein bisschen nach. Nicht weil sie besser gewesen war, überhaupt nicht. Aber es war ruhiger damals, die Ermittlungsarbeit wirkte irgendwie echter, authentischer. Man freute sich mehr, wenn man einen Fund gemacht hatte.
Aber jetzt gab’s die schöne Katia Sulimma, die im Büro in der Keithstraße auf ihrem Computer wie auf einem Steinway-Flügel spielte und die erstaunlichsten Ergebnisse binnen kürzester Zeit aus dem Gerät zog. Und er und Cornelia hatten ihre iPhones.
Wie aufs Stichwort war Cellarius zu ihnen getreten, wie immer perfekt gekleidet, diesmal in einem anthrazitfarbenen Anzug aus feinstem Tuch, darunter ein blütenweißes Hemd mit offenem Kragen. Trotz der Vereisung der Welt trug er Maßschuhe.
»Wie wirkt das auf euch? Auf dem Tisch zwei Sektgläser. Eine Champagnerflasche im Eiskübel. Der schöne [16] Jugendstilkerzenleuchter. Die petits fours, ich könnte wetten von Lenôtre im KaDeWe…«
Täuschte sich Bernhardt? Errötete Cellarius schon wieder?
»…die edlen Stoffservietten. Und im CD-Player die schönsten Liebesarien. Alles bereit fürs große Liebesspiel. Schwer nachvollziehbar, dass sie erstochen wurde. Eifersucht? Ende eines erotischen Spiels, das aus dem Ruder gelaufen ist?«
Bernhardt hob die Hand. »Nicht zu schnell. Was sagen uns eigentlich die Worte an der Wand? ›Der früh Geliebte, nicht mehr Getrübte, er kommt zurück.‹ Ist das ein Zitat? Klingt nach einer Liebesgeschichte, die eigentlich gut hätte ausgehen müssen. Oder? Na ja, wir werden sehen. Fragen wir jetzt mal unseren Arzt.«
Er winkte Dr.Holzinger zu, der zögerlich näher kam. Der Arzt schaute durch seine dicken Brillengläser wie ein misstrauischer Marabu und wackelte leise mit dem Kopf. Dass er außerordentlich kompetent war und allerorten geschätzt wurde, sah man ihm auf den ersten Blick nicht an.
»Also, so viel lässt sich sagen: Der Tod ist vor circa zwei bis drei Stunden eingetreten, massive Gewalt gegen den Oberkörper, mehrere Stiche in den Hals, sie ist verblutet. Mehr kann ich erst sagen, wenn ich sie auf meinem Tisch in der Turmstraße habe. Ihr seht ja, dass jetzt Fröhlich mit seinen Leuten von der Spurensicherung am Ball ist.«
Fröhlich hatte seinen Namen gehört, löste sich aus [17] der Gruppe mit den weißen Overalls und kam zu ihnen.
»Ja, Leute, det dauert hier noch. Und bis wa allet ausjewertet ham, det dauert noch ma. Jeduld is die erste Polizistenpflicht, wisst ihr ja. Rumschnuppern in die Schränke, Schubladen und solche Sachen, dauert noch.«
Bernhardt konnte es nicht lassen.
»Und, Fröhlich, was hast du für einen Eindruck?«
Fröhlich hustete ausführlich und rieb sich die Hände. Bernhardt hatte wie immer den Eindruck: Fröhlich lachte sich ins Fäustchen.
»Ja, Meesta, schön, det de frachst. Ich hatte mal ’n Fall, lange her, det war ’ne kleene Schauspielerin, so ’ne Marilyn Monroe aus Neukölln, die hatte drei Jeliebte, ’n Ollen, ’n Mittel-Ollen und dann noch ’n Jungschen. Jute Mischung, wa? Aber denn jab’s da noch ’n janz jungen Järtner, und der hatte ’ne Kettensäje, und denn hat er…«
»Kennen wir, Fröhlich, die Geschichte vom Kettensägenmassaker.«
Fröhlich winkte enttäuscht ab. »Wir sehen uns zu oft.«
Es begann die Routinearbeit. Die Befragung der Bewohner des Hauses und die Feststellung der Personalien hatte Krebitz übernommen. Der war auf den Spuren eines alten, ziemlich kalten Falles in der Nähe unterwegs gewesen und hatte sich nach einem Anruf von Katia Sulimma auf den Weg an den Lietzensee gemacht.
Wie gewohnt war ihm die undankbare Aufgabe zugewiesen worden, den Fuß in die Tür zu setzen, das Misstrauen der Bewohner zu zerstreuen, sich fragen zu lassen, [18] ob seine Erkennungsmarke wirklich echt sei, Angst abzubauen, Vertrauen aufzubauen.
Krebitz, der »Nussknacker«, wie er von den Kollegen genannt wurde, ging seinen Weg mit der Unerschütterlichkeit eines alten Ebers, der sich einen Weg durch das Unterholz schlägt. Krebitz, die Dampframme, der Schultheiss-Trinker, der aber im Umgang mit den Kollegen von höchster Empfindsamkeit war. Immer fühlte er sich zurückgesetzt und nicht anerkannt.
Wie ein melancholischer Bluthund schaute er nun seine Kollegen an.
»Ick tret mir hier die Füße platt. Aber so iss es eben.«
Thomas Bernhardt versicherte ihm, dass niemand so gut wie er die ersten Personenbefragungen durchführen könne. Was habe er denn bis jetzt herausbekommen? Krebitz legte die Hand auf sein Handy, das er wie einen Colt an seinen Gürtel geheftet hatte. Seine Miene hellte sich ein bisschen auf.
»Also jut. Im Erdgeschoss links eine Physiotherapeutin – ist die Frau Schauspielerin immer hingegangen, starke Verspannungen im Lendenwirbelbereich. Im Erdgeschoss rechts ein Instrumentenbauer. Hat nie was von ihr gehört und gesehen. Im ersten Stock links ein Psychotherapeut, kennt sie nur vom Sehen, sie war keine Kundin – oder wie sagt man? – bei ihm. Erster Stock rechts ein Musiker, der auf Tournee ist. Überprüf ich dann mal, wenn ich das machen soll.«
Thomas Bernhardt nickte heftig.
»Zweiter Stock links ein alter Physikprofessor mit Frau. Beide schwerhörig, wissen von nix, sagen sie. [19] Zweiter Stock rechts niemand zu Hause, laut Aussage vom Physikerehepaar ein Zeitungsredakteur, der zurzeit auf Recherchereise in Palästina ist. Sie gießen seine Blumen. Dritter Stock links Rechtsanwaltsehepaar mit Kindern. Kinder anwesend mit ihrem Kindermädchen, ›Nanny‹ hat sie sich selbst genannt, Eltern noch in der Kanzlei. Sie hat die Polizei angerufen, als die laute Musik einfach nicht aufhörte. Dritter Stock rechts Arztehepaar ohne Kinder, noch in der Praxis, laut Auskunft dieser Nanny.«
Krebitz stockte und seufzte. Seine Mimik und Gestik, seine ganze Körpersprache drückten aus: Das erkennt doch wieder mal keiner an. »Ja, und jetzt will ich gerade hier im vierten Stock…«
Thomas Bernhardt nickte gottergeben. Eigentlich wäre er gerne selbst in die Wohnung gegenüber gegangen, um die Atmosphäre auf sich wirken zu lassen. Inwiefern glich diese Wohnung der Wohnung der Toten, inwiefern unterschied sie sich? Was wussten der oder die Bewohner von ihrer Nachbarin?
Krebitz klingelte. Aber niemand öffnete. Auf dem Messingschild neben der Tür stand der Name: H. Hirschmann. Bernhardt bat Cornelia, mal in ihrer Wunderkiste nachzuschauen. Und tatsächlich: Treffer! Henning Hirschmann, Komponist und Liedermacher, laut Wikipedia war er mit seinen Texten und Liedern ganz gut im Geschäft und arbeitete angeblich seit Jahren an einem Singspiel.
[20] Bernhardt beauftragte Krebitz, im Haus zu bleiben und auf die von der Arbeit zurückkehrenden Bewohner zu warten, um sie zu befragen. »Jag ihnen keinen Schrecken ein. Sag ihnen, dass alles Routine ist.«
Krebitz fixierte ihn so nussknackerhaft, dass er ihn mit einem Lob beruhigen und motivieren wollte. »Du bist da genau der Richtige.« Täuschte er sich? Knirschte Krebitz tatsächlich mit den Zähnen? Im Hintergrund nieste Cornelia Karsunke gewaltig und putzte sich dann ausgiebig die Nase. Sie würde noch am Tatort bleiben.
Bernhardt und Cellarius machten sich auf den Weg in die Keithstraße. Als sie aus der Haustür traten, fegten ihnen heftige Schneeböen entgegen. Auf der Straße hatten sich kleine Verwehungen gebildet. Mühsam kamen sie mit ihrem Auto voran, segelten bei Rot über die Straßenkreuzungen, weil sie nicht richtig bremsen konnten, umfuhren vorsichtig querstehende Autos, tasteten sich durch eine Welt aus wirbelndem Weiß.
[21] 2
Das zugeschneite Gebäude in der Keithstraße sah wie ein Palast in einer sibirischen Provinzhauptstadt aus. War das noch Berlin?, fragte sich Bernhardt. Nie war ihm die Stadt fremder und rätselhafter erschienen als jetzt in ihrer eisigen Starre. Und auch die Menschen schienen sich verändert zu haben: Sie sprachen und bewegten sich, als lebten sie auf einem neu entdeckten Planeten, auf dem sie sich vorsichtig zurechtfinden mussten. Ihre Stimmen klangen verhalten, und auch die Geräusche der Stadt hatten einen neuen, fremden Sound, gedämpft und geheimnisvoll.
Nur das Büro hatte sich nicht verändert und wirkte wie eine Rettungsinsel. Noch immer das trübe Licht, die abgeschabten Wände, der abgestandene Geruch, der sich allerdings in der Nähe von Katia Sulimma ins Angenehme wendete. Katia Sulimma duftete gut, nach starken Gewürzen, sie lachte viel, man hätte meinen können, sie käme von einem anderen Stern, wo Licht, Luft und Sonne und immer gute Stimmung herrschten. Sie klatschte in die Hände.
»Da seid ihr ja. Da ist noch ein bisschen Kuchen für euch, selbstgebacken. Und ein schöner Kaffee. Und ich habe euch ein richtiges Dossier über die Tote [22] zusammengestellt. Eine echt starke Frau. War als Mädchen auf einer Klosterschule, ist da vor dem Abitur abgehauen, dann private Schauspielschule und schon seit Jahren total erfolgreich.«
Bernhardt nippte am Kaffee.
»Und was ist mit ihrem Umfeld? Eltern, Geschwister, Verwandte? Ein fester Freund? Eine berühmte Schauspielerin hat doch sicher einen Agenten oder eine Agentur? Hast du da eine Adresse? Und was ist mit der Presse, ist die Meldung schon raus?«
»Nein, Freudenreich hat entschieden, dass die Pressestelle das erst morgen früh rausgibt, damit wir noch ein bisschen in Ruhe arbeiten können.«
»Ein guter Mann, Freudenreich. Wo ist er denn?«
»Der ist zu einem internationalen Kongress im Inter-Conti, irgend so was wie: ›Von der analogen zur digitalen Ermittlungsarbeit in multinationalen polizeilichen Systemen‹.«
Thomas Bernhardt schlug sich mit der Hand leicht vor die Stirn. Ein Glück, dass er damit nichts zu tun hatte. Aber wenn man wie sein alter Freund und Leiter der Abteilung »Delikte am Menschen« Karriere machen wollte, musste man eben auf Kongresse gehen.
»Na gut, hoffen wir, dass die Blondine von der B.Z. keinen Anruf kriegt. Dann ist nämlich Schluss mit der Ruhe.«
Sie telefonierten sich die Finger wund und erreichten doch niemanden, der ihnen helfen konnte. Gab’s das denn, dass jemand ganz allein in der Welt stand? Die [23] Agentur hatte auf Anrufbeantworter geschaltet, »wegen Schneechaos«, wie eine kichernde Jungmädchenstimme verkündete. Die Bewohner des Hauses am Lietzensee waren, zumindest in kriminalpolizeilicher Hinsicht, sauber. Der Computer vermeldete keine dunklen Geheimnisse.
Katia Sulimma war gegangen. Sie hatte einen neuen Freund, mit dem sie auf dem Alexanderplatz an einer Party in einem großen Iglu teilnehmen wollte. »Ich habe sogar Angorawäsche an, supersexy, wird meinem Freund bestimmt Spaß machen, mich da rauszuschälen.« Gut gelaunt hatte sie sich verabschiedet und wäre an der Tür beinahe mit Cornelia Karsunke zusammengestoßen, die in Winterjacke und Mütze niesend den Raum betrat.
»Nix Besonderes mehr am Lietzensee. Sie haben die Lechner mitgenommen zur Gerichtsmedizin. Und Fröhlich braucht noch Zeit.«
Thomas Bernhardt hatte den starken Wunsch, den verschneiten und langsam auftauenden Heinzelmann Cornelia in die Arme zu nehmen.
»Warum bist du nicht gleich nach Hause gefahren?«
»Weil ich einfach wissen wollte, wie’s hier läuft.«
»Die Lechner scheint so eine Art Phantom gewesen zu sein, wenn man sie genauer betrachten will, verflüchtigt die sich. Das Beste, was wir jetzt noch machen können: ins Literaturhaus gehen, da hat dieser Hirschmann heute Abend einen Auftritt mit vertonten Gedichten von, wart mal…, Wondratschek oder so ähnlich.«
Cellarius hob die Hand wie ein gelehriger Schüler. »Henning Hirschmann, zwei CDs. Eine davon heißt Hell-Dunkel-Einstellung.«
[24] »Komm ich mit. Erkältung hin oder her. Ich kenn sogar ein Lied von dem: ›Anais und ihre Freunde‹ – ein richtig schönes Liebeslied.« Cornelia schniefte. »Aber eins habt ihr bestimmt schon gemacht, die süße Anna in Wien angerufen.«
Bernhardt und Cellarius schauten sich an.
»Ach nee, die Lechner kommt aus Wien, und ihr habt nicht gleich Miss Marple angerufen? Also, dann gönne ich mir das mal.«
Das Gespräch dauerte nicht lange. Cornelia lachte, als sie den Hörer auflegte. »Ja, küss die Hand, die Chefinspektorin Haferl ist heute mal früher gegangen, sagt die Frau Schellander. Hatte Angst, dass sie bei dem Schneetreiben nicht mehr nach Hause findet, die Arme. – Also los, dann lasst uns zu unserem Künstler gehen. Beziehungsweise: Fährst du uns, Cellarius, mit deinem Superschlitten?«
Langsam schlichen sie über den Kurfürstendamm. Cellarius erklärte ihnen, dass der Wagen Vierradantrieb habe und noch ein paar andere spezielle Vorrichtungen, die eine Fahrt auch unter diesen Bedingungen zu einem wahren Vergnügen machten.
Schließlich standen sie vor dem Literaturhaus. Am Eingang hing ein Zettel, auf dem in krakeliger Schrift stand: »Liederabend fällt aus wegen Schnee«. Sie stapften weiter zum Restaurant. Auch hier ein Zettel: »Geschlossen wegen Schnee«. Sie gaben auf: höhere Gewalt. Morgen würde man weitersehen. Cellarius startete seine Superkiste und verschwand hinter einer wirbelnden Schneewand.
[25] Cornelia und Thomas gingen die paar Schritte zur U-Bahn-Station Kurfürstendamm. Im Waggon klopften sie sich gegenseitig den Schnee von den Kleidern. Wie üblich musste sich Thomas Bernhardt überwinden. »Hast du Lust, mit zu mir zu kommen? Ich habe einen guten Rotwein.« Sie lächelte, wie er es liebte, verträumt, als käme sie aus einer fernen Welt.
»Wäre schön. Aber es geht ja nicht. Ich muss zu meinen Kindern, und ich bin erkältet, ich würde dich mit meinem Schniefen und Husten und Niesen nachts nur stören.«
»Weißt du, dass man jemanden küssen kann, der erkältet ist, und dass man sich nicht ansteckt, wenn man ihn wirklich liebt?«
Sie schaute ihn an. Ihr Lächeln, die schaukelnde U-Bahn, das flackernde Licht, die paar Fahrgäste, die aussahen, als führen sie schicksalsergeben in ein schwarzes Loch.
»Dann küss mich.«
Er küsste sie auf den Mund.
»Du musst mich richtig küssen. Sonst gilt’s nicht.«
Er spürte ihre Lippen, ihre Zunge.
»Du hast Fieber.«
»Macht doch nix, wenn du mich liebst, steckst du dich ja nicht an.«
An der Station Eisenacher Straße stieg er aus. Sie boxte ihm leicht auf den Brustkorb und blickte ihn ernst an.
»Du bist… Ach, ich weiß nicht, hoffentlich hast du dich jetzt nicht angesteckt.«
Er sah ihr verwischtes Bild hinter der beschlagenen [26] Scheibe, sie winkte ihm zu, dann war die U-Bahn schon im Tunnel verschwunden.
Er kämpfte sich durch die Merseburger Straße vorwärts, spielte mit dem Gedanken, noch ins Renger & Patzsch zu gehen, entschied sich dann aber für den direkten Heimweg. Seine Wohnung im vierten Stock des Hinterhauses war eiskalt, an den Fenstern wucherten Eisblumen. Das hatte er seit seiner Kindheit nicht mehr gesehen. Er schaltete die Gasetagenheizung an, die vor sich hin zischte. Es dauerte, bis die Heizkörper warm wurden. Als er sich mit einem Glas Rotwein an die Küchenwand lehnte, schauderte er vor Kälte. Eine Wohnung mit drei Außenwänden, die kühlte einfach zu stark aus. In den nächsten Tagen musste er die Heizung durchlaufen lassen.
Er trat auf den Balkon hinaus. Die Kälte drang in seine Bronchien, so dass er husten musste. Die Kastanie stand still wie ein riesiges weißes Ungeheuer im Hinterhof. Durch ihre Zweige spähte er in die Wohnung im Haus gegenüber. Warmes Licht. Aber die Frau, mit der er einst befreundet gewesen war, hatte Besuch. Sie beugte sich zu einem Mann hinunter und küsste ihn. Dann zog sie die Vorhänge zu, was sie früher nie gemacht hatte.
Thomas Bernhardt ging zurück in seine Wohnung, in der es kaum wärmer war als draußen. Er wollte gerade den Fernseher einschalten und sich ein Bier aufmachen, der Rotwein war ihm zu sauer, da klingelte das Telefon.
»Bei uns geht die Welt unter.« Wie gewohnt hielt sich [27] Anna Habel nicht mit langwierigen Begrüßungsfloskeln auf.
»Guten Abend, meine Liebe. Inwiefern?«
»Nichts geht mehr. Die Straßenbahnen fahren nicht, die U-Bahnen sind knallvoll, und Taxis sind in der ganzen Stadt keine zu kriegen. Hier schneit es seit Tagen durch.«
»Ist doch schön, oder?«
»Ja, eh. Ein bisschen lästig halt auch.«
»Bei uns ist es auch nicht schlecht.«
»Ich bin die ganze Währinger Straße zu Fuß nach Hause gelaufen.«
»Na, ein bisschen Sport schadet dir ja nicht.«
»Wie meinst du das denn? Ich geh gleich Volleyball spielen, das würde dir auch guttun.«
»Ach, ich geh immer zu Fuß die Treppen hoch, das muss reichen. Und sonst, alles ruhig bei euch?«
»Ja, kaum was zu tun. Den Mördern ist das viel zu viel Schnee hier. Macht mir aber gar nichts aus. Weißt du was? Ich hab spontan beschlossen, mir nächste Woche freizunehmen. Überstundenabbau. Ich geh mit Florian Ski fahren.«
»Du hast es gut. Ich hab hier eine tote Schauspielerin. Die wird mich in den nächsten Tagen beschäftigen.«
»Berühmt?«
»Ich kannte sie nicht. Das heißt aber nicht viel.«
»Jetzt tu doch nicht immer so, als wenn du nicht lesen könntest. Wie hieß sie denn?«
»Lesen kann ich schon, aber keine Klatschzeitungen. Sophie Lechner. Hat auch in Wien gespielt.«
[28] »Klar kennt man die. Ich hab sie sogar mal gesehen, als Ophelia im Hamlet. Ist allerdings schon ein wenig her.«
»Tja, diesmal ist sie nicht freiwillig aus dem Leben geschieden. Erstochen wurde sie. Oder besser gesagt, erdolcht.«
»Du wirst den Fall schon lösen, ich muss jetzt jedenfalls los.«
»Ja, widme du dich mal den wichtigen Dingen im Leben. Ich geh bald ins Bett, morgen muss ich mich wahrscheinlich mit lauter exaltierten Schauspielern rumschlagen, das wird hart.«
[29] 3
Als Anna in die nach kaltem Schweiß riechende Umkleidekabine kam, war Paula schon da und schälte sich aus ihren engen Jeans. »Na?«
»Selber na. Alles klar bei dir?«
»Ja. Stress wie immer. Zwei blöde Interviews, eine Pressekonferenz. Und wenn ich diesem Kanzler auch nur zwei Minuten gegenübersitze, hab ich das Gefühl, ich falle augenblicklich in den Tiefschlaf.«
»Das versteh ich. Ich schalt immer automatisch um, wenn ich ihn im Fernsehen seh.«
Annas Freundin Paula war Redakteurin beim Rundfunk, und nachdem sie sich in den Sparten Gesellschaft, Chronik und Wirtschaft abgearbeitet hatte, war sie endlich in der Königsdisziplin Politik angekommen, auch wenn’s da meist nicht viel spannender war.
»Und bei dir?«
»Voll ruhig. Kolonja hat Urlaub, und mein kleiner Motzko geht mir schon fast auf die Nerven mit seinem Diensteifer. Nächste Woche fahr ich in Skiurlaub. Kann ich mir zwar nicht leisten, aber das ist mir egal.«
»Wow, mit wem fährst du denn?«
»Na, mit Florian. Mit wem sonst?«
»Was ist denn mit deinen vielen Verehrern?«
[30] »Ach, die können mich alle mal.«
»Komm schon, der Pathologe vom Wilhelminenspital wär doch eine gute Partie?«
»Für dich vielleicht. Der ist mir zu beflissen, den halt ich nicht aus.«
»Dann halt den grantigen Berliner Kommissar. Der sieht auch gar nicht schlecht aus.«
»Viel zu kompliziert. Außerdem kann der nicht mit mir Ski fahren, der hat eine tote Schauspielerin. Komm, wir müssen rein.«
Im kleinen Turnsaal des Kolpinghauses waren drei Leute dabei, das Volleyballnetz aufzubauen. Paula und Anna trabten im Laufschritt ein paar Runden, und Anna spürte fast augenblicklich ihre schlechte Kondition. In ihrem Kopf blitzte eine Erinnerung auf: In ihrer Kindheit gab es in der Wintersaison jeden Abend Skigymnastik im Fernsehen, und Anna liebte es, mit ihrem Vater auf dem Wohnzimmerteppich die Übungen mitzumachen. Paula holte sie aus ihren Gedanken: »Die tote Schauspielerin. Kennt man die?«
»Ja. Kennt man. Sophie Lechner.«
»Was? Die Sophie Lechner?« Paula blieb abrupt stehen, und Anna rannte fast in sie hinein. »Und wer war’s?«
»Keine Ahnung. Ist ja nicht mein Fall. Bernhardt erwähnte ein Messer, das ist meistens eine Beziehungstat. Komm, lass uns anfangen.«
Die nächsten eineinhalb Stunden versuchte Anna an nichts anderes zu denken als an den Ball, der sie dennoch immer wieder überraschte. Sie spielte erst seit kurzem wieder in einer Hobbymannschaft und versuchte [31] meist vergeblich, an ihre Leistungen als Studentin anzuknüpfen. Wie immer liefen auch diesmal die ersten Sätze ganz gut, doch nach einer Stunde ließ Annas Konzentration merklich nach, und sie ärgerte sich über einige männliche Mitspieler, die vor lauter Ehrgeiz vergaßen, dass Volleyball ein Mannschaftsspiel war. Paula war im gegnerischen Team und warf ihr vielsagende Blicke zu.
»Gehst noch mit was trinken?« Paula und Anna standen unter der warmen Dusche.
»Ich weiß nicht. Die gehen mir heut so auf die Nerven.«
»Ach, sobald sie ihre Trainingshosen ausgezogen haben, sind sie doch ganz zivilisiert, oder?« Die Frauen der Mannschaft wunderten sich jedes Mal, wie Männer, die im normalen Leben soziale Wesen waren, sich auf dem Spielfeld in testosterongesteuerte Machos verwandelten.
»Na gut, einen Spritzer. Dann erzählst mir was über diese Lechner. Vielleicht kann ich meinen Berliner ja ein wenig mit Informationen versorgen.«
»Genau. Dann klärt er den Fall ganz rasch auf und kann mit dir in den Skiurlaub fahren.«
»Du spinnst ja.«
Beim Italiener bestellten sich alle Pizza und Bier, nur Anna entschied sich aus reiner Vernunft und mit dem Gedanken an die Waage für eine Minestrone.
»Und was weißt du über diese Lechner?«
»Du bist ja ganz wild auf den Fall.«
»Nein, nein, ich hab sie nur mal in der Burg gesehen, [32] ist doch schräg, dass die jetzt mein Berliner auf dem Tisch liegen hat.«
»Iih, wie das klingt – auf dem Tisch! Du bist so grauslich. Also die war mit diesem Hans-Günther Steiner zusammen, du weißt schon – dieser Hedgefonds-Fuzzi, der sich selber immer ›Kulturlobbyist‹ nennt. Die waren so etwas wie das Traumpaar der Seitenblickegesellschaft, keine Woche, in der sie nicht beim Dominic Heinzl waren.«
»Diese Promisendung? Ich glaub, die hab ich noch nie gesehen!«
»Ja, wo der Dominic den Reichen und Schönen bis ins Schlafzimmer nachsteigt. Hast nicht viel versäumt. Jedenfalls waren Steiner und Lechner ständig zu Gast in der Serie. Bis sie dann ziemlich plötzlich nach Berlin abgereist ist, das war so vor einem halben Jahr.«
»Weißt du, warum?«
»Nein, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist ihr Vertrag ausgelaufen. Ich kann mich nur erinnern, dass sie es letzten Frühling mal in die Schlagzeile von Krone,Kurier und Heute schaffte. Da hatte es in der Wohnung, in der sie mit dem Steiner zusammengelebt hat, gebrannt, und sie hat behauptet, es sei ein Anschlag auf sie verübt worden.«
»Und war?«
»Keine Ahnung. Bei uns glaubte man eher, dass viel Alkohol und Drogen im Spiel waren und dann halt jemand nicht aufgepasst hat. Passiert ist eh nicht viel, aber danach wurde es ein wenig ruhiger um die Dame.«
»Na gut. Fein, dass sie nicht in Wien das Zeitliche [33] gesegnet hat, dann wär’s jetzt mein Fall, und ich könnt meinen Urlaub vergessen.«
»Wo fährst du denn hin?«
»Nach Zell am See. Da war ich während meiner Kindheit im Skiurlaub. Ich kenn da jeden Hügel. Sogar die Pension gibt es noch: Haus Lisi.«
»Tja, hoffentlich bist du nicht enttäuscht. Ist sicher jetzt eine riesige, moderne Skischaukel mit allen Raffinessen. Und entsprechenden Preisen. Und das Haus Lisi ist jetzt wahrscheinlich ein Wellness-Tempel.«
»Jetzt verdirb mir nicht die Freude. Das wird total super.«
»Ich beneid dich ja nur. Nächstes Jahr komm ich mit. Dann fährt Florian eh nicht mehr mit dir in Urlaub, und wenn du bis dahin keinen neuen Mann hast, dann schlafen wir im Doppelbett bei Lisi.«
»Wahrscheinlich hast du recht. Ich konnte Florian auch dieses Jahr nur mühsam dazu überreden. Das einzige Argument, das er gelten ließ, war: Mama zahlt.«
Als sie gegen dreiundzwanzig Uhr aus der Pizzeria traten, waren schon wieder mindestens zehn Zentimeter Neuschnee gefallen, und es schneite unverdrossen weiter. Die Kutschkergasse lag unter einem weißen Teppich, die wenigen Menschen bewegten sich langsam und vorsichtig, kein lautes Geräusch war zu hören. Anna blieb kurz mitten auf dem Gehsteig stehen und streckte ihr Gesicht den tanzenden Schneeflocken entgegen. Für einen kurzen Augenblick fühlte sie sich völlig unbeschwert.
[34] 4
Thomas Bernhardt war vom Fauchen der Gastherme in der Küche aufgewacht. Hätte er eigentlich über Nacht abstellen müssen, sagte er sich, kostete einfach zu viel Geld. Aber war natürlich ein echter Fortschritt gegenüber den braungelben Kachelöfen, die bis in die achtziger und neunziger Jahre in den einfacheren Altbauwohnungen gestanden hatten. In einem wahren Modernisierungsrausch waren sie dann innerhalb weniger Jahre abgeschlagen worden. In der Ecke seines Schlafzimmers sah man noch den Grundriss des Ofens, davor ein paar Fliesen und auf den Dielen ein paar Brandflecken.
Thomas Bernhardt hatte nie die Kunst beherrscht, einen Kachelofen am Brennen zu halten. Er schaffte es nicht, die ausgefuchsten Tricks umzusetzen, die ihm erfahrene Kachelofennutzer verraten hatten. Wie war das? Auf die Glut ein Brikett legen, das in feuchtes Zeitungspapier eingewickelt war? Angeblich ging das Feuer dann nicht aus, und man hatte abends noch ein bisschen Glut im Ofen. Bei ihm hatte es nie geklappt. Wenn er als Student abends in seine Einzimmerwohnung am Schlesischen Tor gekommen war, hatte er sich wie in der sibirischen Tundra gefühlt. Die Fensterscheibe der Wohnküche [35] war zugefroren, es dauerte Stunden, bis sich nach dem Anzünden des Ofens eine klamme Wärme ausbreitete und sein Atem nicht mehr als weiße Wolke vor ihm stand.
Sehr verbreitet war damals der Fußsack, den er sich auf Empfehlung eines älteren Kommilitonen zugelegt hatte. Es war ein angenehmes Gefühl, seine Füße in das wattierte Gebilde zu stecken. Für eine Weile vergaß er dann die Kälte in seinem begehbaren Eisschrank.
Kein Grund, jetzt Nostalgiker zu werden, sagte sich Bernhardt, streckte sich auf seiner Matratze aus und starrte ins Dunkel. Gestern Abend hatte er auf den Spuren von Sophie Lechner noch ein bisschen im Internet rumgesucht und war irgendwann in den Fluten der Berichte und Interviews versunken. Der Eindruck, dass er darin alles über sie erfahren konnte, wich bald der Erkenntnis, dass nichts über sie als Person da stand. Desinformation durch Überinformation, sagte er sich. Die Eckdaten waren einfach, aber nicht besonders aussagekräftig: Klosterschülerin, Gesangsausbildung, Schauspielschülerin, frühe Berühmtheit, Exzentrikerin, viele Männer, zuletzt ein bekannter Expolitiker, Finanzmanager und Society-Hengst. Alles wie aus einem Drehbuch. Gab’s überhaupt noch Klosterschulen? Wenn doch Nonnen und Mönche bis auf kleine Restbestände gar nicht mehr existierten, wie konnte es dann noch Klosterschulen geben?
Klosterschülerin. Damit assoziierte er eine aparte Mischung von Unschuld und Perversion, Kreuzgänge, Flüstern, die strenge Mutter Oberin, Weihrauch, klackernde Rosenkränze, Schlafräume mit Doppelstockbetten, [36] morgens kalte Waschungen. Genau das war wahrscheinlich beabsichtigt. Der exotische Touch. Nicht anders der Komponist Hirschmann, der gegenüber von Sophie Lechner wohnte, der war angeblich unter anderem Totengräber auf den Shetland-Inseln gewesen und Pizzabote in Los Angeles.
Raus aus der virtuellen Welt, hinein ins tosende Leben, hatte sich Thomas Bernhardt schließlich ermahnt. Im Radio hatten sie gesagt, dass heute eine geradezu beißende Kälte herrsche, man solle, wenn man länger draußen sei, sein Gesicht schützen, am besten mit einem Schal oder einer Gesichtsmaske.
Beißend, das war der richtige Ausdruck. Als Bernhardt auf die Straße trat, spürte er ein scharfes Prickeln auf Stirn und Wangen, als würden ihm winzige Nadeln in die Haut gedreht.
Die Stadt lag unter einem dunklen Grau, das sich den ganzen Tag über nicht aufhellen würde. Da war er sich sicher. In der U-Bahn hielten die Menschen die Köpfe gesenkt und schwankten still vor sich hin. Als stünden sie unter Hypnose. Jeder Zweite war mit kleinen Kopfhörern verstöpselt, aus denen leise, quäkende Töne drangen und sich vermischten, ein Mozart-Klavierkonzert wurde von der linken Seite mit Heavy Metal und von der rechten Seite mit Grönemeyer unterlegt. So früh am Tag wollte Bernhardt noch alles gut finden: Interessante Mixtur, redete er sich ein.
[37] In den Diensträumen in der Keithstraße taute er auf: Das trübe und doch irgendwie warme Licht, die vollgepackten Schreibtische, die Kollegen – hier fühlte er sich zu Hause. Er ging als Erstes ins Zimmer seines Vorgesetzten Freudenreich und stimmte mit ihm die Pressemeldung ab, die nun einmal raus musste. Freudenreich, der Kumpel aus alten linkssozialistischen Tagen, ermahnte ihn, die Pressevertreter nicht zu reizen, besonders nicht das alte Schlachtross von der Regionalschau und die blonde Reporterin von der Zeitung mit den großen Buchstaben. Bernhardt gelobte, sich nicht provozieren zu lassen, und ging zurück ins Büro.
Katia Sulimma saß am Computer und lächelte ihn an. Allein ihr Lächeln konnte einen Tag retten. »Thomas, ey. Einen Kaffee und ein Croissant?«
Er hatte in seiner Wohnung nicht gefrühstückt. Machte er nie. Sie stellte ihm einen Pott mit dampfendem Kaffee auf den runden Tisch und ein Croissant. Als sie sich über ihn beugte, roch er ihr Parfüm. Warm, aber nicht zu schwer, irgendwas Zimtiges. Sie hatte ihm das mal erklärt: Im Frühling trug sie florale Düfte, Jasmin, Oleander, im Sommer etwas Kühlendes, Zitrone, Limone, im Herbst reife Früchte, Apfel und Quitte, und im Winter etwas Wärmendes, Kaffee und Cognac. Sie schaute ihn an. »Wie findest du mein Parfüm?«
Irgendwann, im verdammt heißen Sommer des vergangenen Jahres, hatte er sie einmal auf ihr Parfüm angesprochen. Das hatte ihr gefallen. Und seitdem kam sie manchmal darauf zurück. »Weißt du, ich habe einen Laden in der Kantstraße gefunden, zwischen [38] Wilmersdorfer und Kaiser-Friedrich. Der hat Hunderte von Duftessenzen, da mixe ich mir jetzt manchmal selbst was zusammen. Was ich heute trage, das ist meine Kreation.«
Cellarius war zu ihnen getreten, hatte höflich zugehört und sich dann kurz geräuspert.
»Katia, wirklich gelungen, aber sollten wir nicht…? Du wolltest doch schauen, wo und wie Sophie Lechner aufgewachsen ist. Da gibt’s bis jetzt nichts richtig Konkretes. Vielleicht wäre es sogar sinnvoll, in Wien bei Anna Habel nachzufragen?«
Katia Sulimma drehte sich einmal um ihre eigene Achse, was erstaunlich elegant aussah, und ging zu ihrem Schreibtisch. Selbstverständlich hatte sie ihre dicken, gefütterten Winterstiefel ausgezogen und trug im Büro schicke High Heels.
»Celli, ich bin dran. Mit ›Anna der Schrecklichen‹ hat’s noch ein bisschen Zeit. Die drängt sich noch früh genug in den Fall. Cornelia hat sie gestern Abend ja schon einmal vorgewarnt.«
Auf Katias Schreibtisch klingelte das Telefon. »Wirklich? Och, Mensch, Cornelia. Fast 40Grad? Nee, bleib zu Hause. Ja, ja, ich sag’s hier. Du weißt ja, was Thomas immer empfiehlt. Wie? Genau. Zwei Liter Lindenblütentee, aber nicht die Beutel mit dem Staub nehmen, sondern richtige Lindenblüten. Ja, genau…« Katia lachte. »…am besten die aus der Provence! Ja, ja, nee, selbst trinkt er wahrscheinlich gar keinen Lindenblütentee. Also, mach’s gut, pass auf dich auf und auf die Kinder.«
Bernhardt und Cellarius winkten Grüße.
»Die zwei Männer grüßen dich. Nee, nicht Krebitz. [39] Celli und Thomas. Wart mal. Sag’s noch mal lauter, Thomas. Ja, also, er empfiehlt dir alternativ ein altes hessisches Rezept: heißen Apfelwein mit Zitrone, Honig und Zimt. Was sagst du? ›Erbarme, die Hesse komme‹? Für so hohes Fieber bist du aber noch ganz gut drauf. Aber jetzt muss unser Hesse erst mal mit Celli raus ins feindliche Leben. Also, halt durch!«
Feindliches Leben war übertrieben. Im Büro des Intendanten des Berliner Theaters war es gemütlich warm. Der Hausherr hatte sich dekorativ in seinen Sessel drapiert – und gab den Intendanten, Typ gnadenloser Gesellschaftskritiker, Gestus: Ich reiße der verlogenen Bourgeoisie die Maske vom Gesicht. Als er sein Amt vor einem gefühlten Vierteljahrhundert antrat, hatte er gleich laut und deutlich sein Motiv benannt: Eine »scharfe Machete« wolle er sein inmitten der kapitalistischen Verhältnisse.
In der Zeitung mit den großen Buchstaben hatte Bernhardt vor einiger Zeit gelesen, dass der Intendant seinen Vertrag vorzeitig verlängert habe. In einem Interview befand er, er sei »wirklich billig für einen Regisseur der Champions League«. Und den Hinweis, dass er mehr als die Bundeskanzlerin verdiene, hatte er mit einem zornigen »So what?« gekontert.
Der scharfen Machete, die inzwischen Mitte siebzig sein musste, fiel eine blonde Haarsträhne in die Stirn. Er erinnerte Bernhardt an einen grünen Politiker, der das Dosenpfand durchgesetzt hatte. Leicht schnarrende Rede, heiße Bekenntnisse bei gleichzeitig klarem, [40] strategisch kühl kalkulierendem Kopf. Das zeichnete beide aus. Vor siebzig, achtzig Jahren hätten die auch zur Elite gehört, sagte sich Bernhardt, natürlich unter entgegengesetzten ideologischen Vorzeichen.
Er nahm sich vor, mal zu prüfen, ob die Machete wirklich so scharf geschliffen war, wie der Intendant es immer vorgab. Aber erst einmal hörte er zu.
»…Ihr Anruf vorhin ein Schock. Sophie war unsere ganz große Hoffnung. Eine Meisterin der leidenschaftlichen Gesten, sich selbst und die Zuschauer an Grenzen führend, wer kann denn heute noch radikal expressionistisch spielen, wenn Sie verstehen, was ich meine? Niemand war wie sie. Ihr Gretchen am Burgtheater – grandios. Nicht zu fassen, dass sie jetzt nicht mehr unter uns ist.«
Er legte die Hand vor seine Stirn, senkte den Kopf und schwieg effektvoll.
Thomas Bernhardt wartete ab. Keine Frage, dass jetzt der Einfühlungskünstler Cellarius gefordert war. Und der begann sein Werk gewohnt zurückhaltend.
»Ein großer Verlust.«
Der Intendant nahm die Hand von seiner Stirn, schaute Cellarius melancholisch an, verhielt kurz in der Geste des Trauernden, warf dann aber seine schüttere blonde Haarsträhne zurück, reckte das Kinn und blitzte Cellarius mit seinen blauen Augen an.
»Wir werden nur schwer darüber hinwegkommen. Ich denke, in der nächsten oder übernächsten Woche machen wir einen schönen Gedenkabend, Lieder, Gedichte, Rezitationen, Erinnerungsstücke. Sie sollte ja die Alkmene [41] in meiner Amphitryon-Inszenierung spielen, wir hatten uns da was ganz Besonderes überlegt, Sprechoper, eine strikte Raum- und Sprachchoreographie. Tja…«
Jetzt wirkte der Intendant ernsthaft erschüttert. Cellarius, auch kein schlechter Regisseur, spürte, dass eine Pause wichtig war. 10Sekunden, 20Sekunden Schweigen. Dann beugte sich Cellarius ganz leicht nach vorne.
»Eine große Schauspielerin, zweifelsohne. Aber wie war sie privat, im Umgang?«
»Im Umgang? Das ist ein Ausdruck, der uns nicht geläufig ist.«
Der Intendant stellte die ihm offensichtlich wichtige Distanz zwischen der Existenz eines Künstlers und dem profanen Leben eines Polizeibeamten klar heraus.
»Sehen Sie, wir setzen uns hier mit einem Text auseinander, geistig, aber auch körperlich. Das ist, wenn Sie so wollen, Hochleistungssport. Am Ende jeden Tages steht Erschöpfung, da ist es das Beste, diesen Kosmos zu verlassen. Da gibt’s nach der Arbeit keinen Kaffeeklatsch oder freundliches Beieinandersitzen mehr.«
Bernhardt fand, dass eine gewisse Verschärfung der Gesprächssituation vonnöten war. »Und eine Kantine gibt’s nicht?«
Der Intendant wandte sich irritiert Thomas Bernhardt zu.
»Herr…, wie war noch mal Ihr Name? Ich habe ihn vorhin nicht verstanden, entschuldigen Sie.«
»Thomas Bernhardt.«
Der Intendant zuckte kurz, als hätte er einen leichten elektrischen Schlag erhalten. »Nein, das ist ein [42] bisschen viel jetzt. Ich bitte Sie. Wissen Sie, dass ich Thomas Bernhard, wie soll ich sagen, sehr nahestand?«
»Naturgemäß. Soweit das möglich war, oder? Ich schreibe mich übrigens mit dt.«
»Ja, also, jetzt haben Sie mich aber… Wo waren wir stehengeblieben?«
»Kantine.«
»Ja, natürlich gibt es eine Kantine. Ist sogar ziemlich berühmt. Da schweben noch die Geister von Bert, Helli und Heiner. Sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Aber das ist nichts für die Großen. Da sitzt eher die mittlere Riege. Ein freier, unruhiger Geist wie Sophie hat da nicht hingepasst. Ab und zu hat sie sich da sehen lassen, um quasi zu demonstrieren, dass sie nicht arrogant ist. Ansonsten: Sie brauchte viel Freiraum. Sie war radikal, sie brannte, wenn Sie verstehen, was ich damit sagen will.«
»Wir versuchen es. So gut uns das möglich ist.«
Nicht schlecht, Cellarius, dachte Bernhardt und lehnte sich zurück. Er musste hier nicht viel machen.
»Ja, sie brannte, und wer sich seiner Leidenschaft für die Kunst und seiner Leidenschaft für das Leben so bedingungslos hingibt, der kann auch verbrennen. Ich verrate hier kein Geheimnis, wenn ich sage: Sie war süchtig nach Grenzerfahrungen.«
»Darf man fragen, welcher Art diese Grenzerfahrungen waren?«
Die zeremonielle Höflichkeit von Cellarius amüsierte Bernhardt, diese ausgefallene Mischung aus solidem Beamtentum und leiser Ironie. Vielleicht hörte ja nur er [43] die Ironie heraus? Der Intendant jedenfalls spürte davon nichts, was dazu führte, dass er sich ein bisschen aufblähte.
»Na ja, Sie müssten Künstler sein, um das wirklich verstehen zu können. Sie experimentierte. Mit ihrem Körper, sie verletzte sich manchmal, fügte sich selbst Schmerzen zu. In ihrer Sexualität gab es Männer und Frauen, auch da suchte sie, glaube ich, den Schmerz. Aber letztlich gab es für sie nur die Kunst, hier ging sie wirklich über sich hinaus und fand sich selbst – auf der Bühne. Aber diesen Augenblick der Gnade, wenn ich das mal so nennen darf, konnte sie nicht mit ins alltägliche Leben nehmen. Deshalb lebte sie eigentlich ständig in einer Mangelsituation, die sie auf der Bühne überwinden wollte. Ein Teufelskreis, dem nur schwer zu entkommen ist. Ja, so war das.«
Zum Schluss hatte der Intendant ganz ernst gesprochen, und Bernhardt war sich nicht sicher: Steckte hinter dem Selbstdarsteller vielleicht doch noch ein anderer, ernsthafterer Mensch?
Es gab nichts mehr zu sagen, die drei Männer erhoben sich und schüttelten sich die Hände. Der Intendant schaute mit einem halb zugekniffenen Auge auf Thomas Bernhardt.
»Thomas Bernhardt mit dt. Wenn man an die Namensmystik glauben wollte.«
»Dann müsste ich so eine Art Stellvertreter des großen Meisters auf Erden sein?«
»Nein, so einfach ist das nicht. Egal. Heute Abend werde ich wieder mal in den autobiographischen [44] Schriften von T.B. lesen. Seltsamerweise helfen mir diese Katastrophenschilderungen über einen Tag wie heute hinweg.«