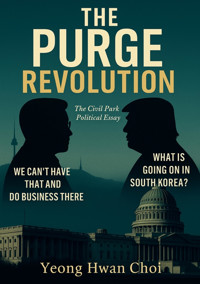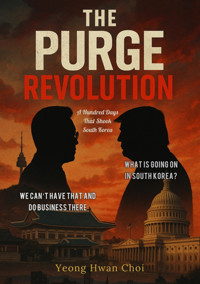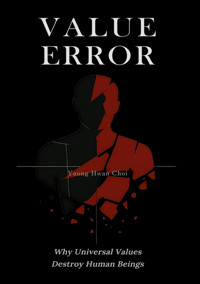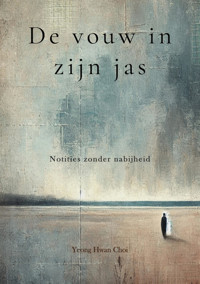3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
《Der Spiegel aus Trug und Licht》 – Ein Roman über das Verschwinden des Ichs Was, wenn alles, was du zu wissen glaubst, ein sorgfältig konstruierter Irrtum ist? Was, wenn das, was du „Ich“ nennst, nie wirklich existiert hat? Irena Leikanto war eine brillante junge Wissenschaftlerin – geboren in Finnland, ausgebildet in Seoul. Inmitten von Strömungsmustern, Bodenverformungen und hydrodynamischen Modellen beginnt sie zu zweifeln: an der Welt, am Körper, an sich selbst. Je tiefer sie in die Gesetze der Natur eindringt, desto stärker beschleicht sie ein Verdacht – dass nichts davon real ist. Dass alles einem System folgt, das nicht aus freiem Willen, sondern aus codierter Notwendigkeit besteht. „Der Spiegel aus Trug und Licht“ ist kein gewöhnlicher Roman. Er ist eine literarische Simulation, ein poetischer Ausnahmezustand. Die Grenzen zwischen Leben und Tod, zwischen Körper und Bewusstsein, zwischen Wissenschaft und Metaphysik beginnen zu verschwimmen. Irenas Erzählung – fragmentarisch, flüchtig und dennoch durchdringend – nimmt uns mit an einen Ort, wo Realität nichts weiter ist als eine programmierte Möglichkeit. Dieser Roman stellt unbequeme Fragen: Sind wir frei? Oder sind wir Teil eines kosmischen Protokolls, das unsere Gedanken längst geschrieben hat? Für Leserinnen und Leser, die keine einfachen Antworten suchen. Sondern den Mut haben, in einen Spiegel zu blicken, der mehr zeigt als nur ihr Gesicht. Ein Roman, der bleibt – wie ein Echo aus einer Welt, die es vielleicht nie gegeben hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Im Spiegel war ich nie allein
Eine Fremde in einem vertrauten Körper
This is a work of fiction. Similarities to real people, places, or events are entirely coincidental.
IM SPIEGEL WAR ICH NIE ALLEIN
First edition. March 23, 2025.
Copyright © 2025 Yeong Hwan Choi.
Written by Yeong Hwan Choi.
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
Copyright Page
Im Spiegel war ich nie allein
<Das Böse in mir>
Das finnische Mädchen | – Der erste Entschluss
Eine fremde Welt | – Blicke, die ich nicht kannte
Liebe &Logik | – Wenn Gefühle berechnet werden
Anfang der Wandlung | – Worte als Spuren
Körper in Bewegung | – Die Form, die ich trug
Wer bin ich? | – Die Illusion vom freien Willen
Der Tempel | – Ein Ort außerhalb der Zeit
Spiegel der Simulation | – Geburten vieler Ichs
<Nichts war je Zufall>
„IM SPIEGEL WAR ICH nie allein. Jemand, der wie ich roch, wie ich atmete – aber nicht ich war.“
<Das Böse in mir>
Ich wusste nie genau, wer ich war. Nicht als Kind, nicht später, nicht einmal in dem Moment, als ich entschied zu gehen. Der Wald war still – nicht ruhig, sondern dumpf wie ein Atem, der kurz vorm Ersticken war. Eine Stille, die drückte. Wie etwas, das mehr wusste als ich selbst. Manchmal glaubte ich, selbst das Licht habe sich zurückgezogen, als hätte es aufgegeben, mich zu erreichen. Ich wollte fort. Raus aus der Stille. Weg von dem Ort. Und vor allem – von mir.
Als ich meinen Eltern sagte, ich wolle nach Korea, sahen sie mich an, wortlos. Dann veränderten sich ihre Gesichter. Erstarrt, bleich. Dann ein zögerndes Rot, das sich wie ein schüchterner Schlag auf ihren Wangen ausbreitete.
„Warum ausgerechnet Korea?“, fragte meine Mutter schließlich.
Ihre Stimme war ruhig, aber angespannt.
„Glaubst du wirklich, du wirst dort glücklich?“
Ich hatte keine Antwort. Ich wusste nur: Sie verstand es nicht. Mich nicht. Und vielleicht verstand ich mich selbst auch nicht.
Meine Schultern fühlten sich schwer an, als ich die Treppe hinaufstieg. Als würde etwas in mir mich zurückhalten. Ich öffnete die Zimmertür vorsichtig, als könnte selbst der Griff widerstehen. Ich legte mich aufs Bett, starrte zur Decke, bis mein Blick sich löste und in der Ecke hängen blieb – am Spiegel. Ich wusste, dass er dort stand, aber ich hatte vergessen, wie genau er hinsieht.
Als ich näher hinschaute, bewegte sich mein Spiegelbild. Kaum merklich. Aber anders, als es sollte.
Ich erschrak nicht. Es war mir seltsam vertraut.
Fast, als hätte ich genau auf diesen Moment gewartet.
Ich wusste es.
Etwas in mir lebte. Schon lange.
Versteckt. Geduldig.
Ich sah mich lange an. Dann flüsterte ich:
War das wirklich meine Entscheidung?
Oder hatte längst jemand – oder etwas – beschlossen, was ich sein würde?
Der Morgen kam leise, schob sich vorsichtig in den Raum. Die Luft war kühl, dünn, als wäre sie durch Glas gefiltert. Ein Hauch bewegte das Wasser auf dem See kaum merklich. Das Licht verließ das Grau, tastete sich langsam ins Blasse. In der Ferne lagen die Berge – nicht gezeichnet, nur geahnt. Wie Schatten, die vergessen hatten, woher sie kamen. Das Dorf schien zu schlafen. Oder gerade aufzuwachen.
Dann, aus der Küche, ihre Stimme:
„Irena... wach auf, Liebes. Heute zählt.“
Sie klang warm. Und gleichzeitig dringlich.
Ich blieb noch einen Moment unter der Decke, Augen geschlossen.
Aber ich hörte sie näherkommen. Die Schritte, der Ton.
Noch bevor sie klopfen konnte, warf ich die Decke zurück und ging ins Bad.
Während ich mir die Zähne putzte, hörte ich das Klirren aus der Küche – regelmäßige Geräusche, Teller, die aneinanderschlugen, leise bewegte Töpfe. Das Frühstück wartete.
Das Frühstück in Finnland war immer schlicht. Kein Überfluss, keine Überraschungen, nur das, was nötig war, das, was genügte – frisches Brot, Fischpastete, ein Stück Käse, manchmal Joghurt. Auch an diesem Morgen würde es wohl nicht anders sein. Ich zog mich an, langsam, gedankenverloren, trat in die Küche und blieb stehen. Der Tisch war gedeckt – nicht wie sonst. Es wirkte beinahe feierlich. Zu ordentlich. Als hätte jemand Abschied gedeckt, ohne das Wort zu sagen. Kaffee dampfte still in weißen Tassen, der Roggen war noch warm, der Lachs wie ein letzter Versuch, Normalität zu spielen.
Meine Mutter wandte sich um, sah mich nicht direkt an, ihre Stimme war weich, aber tastend, als müsste sie erst an den Gedanken heran:
„Ich habe gelesen... Korea sei geteilt. Kein Frieden. Nur Waffenstillstand. Warum willst du ausgerechnet dorthin?“
Ich seufzte, leise, nicht hörbar, zog einen Stuhl zurück, setzte mich.
Sie ließ mich nicht aus den Augen.
„Du könntest nach Schweden. Nach Deutschland. Oder nach Amerika. Alles näher. Alles sicherer. Aber du willst in ein Land, das du nicht kennst, irgendwo ganz weit im Osten.“
Ich spürte, wie meine Stimme sich hob, obwohl ich es nicht wollte:
„Mama, das ist meine Entscheidung. Und Korea ist kein Kriegsgebiet, Mama.“
Sie schwieg kurz, Dann wurde ihr Ton schärfer, schnittiger.:
„Aber es ist geteilt! Und wer weiß, ob es nicht bald wieder Krieg gibt.
Du magst es noch so sehr wollen – aber ich kann meine Tochter nicht dorthin schicken.“
Es wurde still. Nicht unangenehm. Aber gespannt.
In diesem Moment öffnete sich die Tür.
Mein Vater trat ein.
Seine Jacke trug noch die Kälte des Morgens, sie schien an ihm zu haften.
Er sagte nichts, nahm Platz am Ende des Tisches, seine Bewegungen langsam, wach, in der einen Hand eine Tasse, aus der der Dampf aufstieg.
Ich wollte gerade etwas sagen, als er die Tasse hob und trank. Er sah nicht weg. Aber auch nicht hin. In seinem Gesicht lag keine Zustimmung, keine Ablehnung – nur Nachdenken. Eine Art inneres Verschieben, als wüsste er selbst nicht, wohin es ihn zieht.
Dann stellte er die Tasse ab, sah nicht auf, aber sprach.
„Irena, kein Elternteil wünscht sich, die eigene Tochter in Gefahr zu wissen. Was wir sagen, sagen wir aus Sorge. Wenn du ins Ausland gehst, wirst du Dinge erleben, die dir fremd erscheinen. Schwer. Anders, als du es erwartest. Ob Korea, Amerika oder ein anderer Ort – die Heimat zu verlassen bedeutet immer, dass man etwas zurücklässt.“
Ich ließ nicht locker.
„Mama, Papa... ihr versteht das nicht.
Korea ist für mich kein Ort auf der Karte.
Es ist Klang. Bewegung. Wärme.
Wenn ich diese Musik höre – ja, BTS, Blackpink, all das – dann fühlt es sich an, als würde ich endlich atmen.
Und das Essen...
Nicht nur Geschmack, sondern Leben. Scharf, laut, wild.
Nicht so still wie hier.“„Und alles dort... bewegt sich.
Die Straßen. Die Lichter. Die Stimmen.
Es fühlt sich an, als würde die Zeit dort rennen, während sie hier nur kriecht.
Ich will mitten rein. Nicht stillstehen – leben.“
Meine Mutter schüttelte den Kopf. „Ich weiß, dass du dort nicht für immer bleiben willst. Aber es ist vielleicht nicht so bequem, wie du denkst.“
Etwas in mir bäumte sich auf. „Ich bin nicht aus Papier! Ich kann das. Ich will das. Lasst mich gehen. Und es ist meine Entscheidung. Nach dem Abi will ich in Korea studieren. Das ist mein Traum. Ich will das wirklich!“
Für einen Moment war alles still. Dann, plötzlich, ihre Stimme – laut, unruhig: „Du willst da wirklich hin? Bist du verrückt geworden?“
Ich spürte, wie sich in mir etwas entzündete. „Warum glaubst du nie an mich? Warum kannst du mir nicht einfach vertrauen? Ich mache das. Ich entscheide für mich.“
Und dann kam es über meine Lippen, ohne dass ich es wollte. „Verdammt noch mal – ich hab ein Recht. Auf mein Leben. Auf meinen Weg“
Ein Wort, das ich sonst nie benutze. Eine Härte, die mich selbst erschreckte. Ich sah ihre Augen – das Erschrecken, den Schmerz. Und ich wusste, ich war zu weit gegangen.
„Du hast keine Ahnung, was du da tust“, sagte sie. „Die Welt ist nicht so einfach, wie du sie dir vorstellst. Du benimmst dich wie ein Kind.“
Ich kämpfte gegen die Tränen an, aber meine Stimme brach. „Ich bin kein Kind mehr! Ich entscheide. Ich – nicht ihr.“ In mir wuchs ein Trotz, roh und heftig, gespeist von dem Gedanken, dass mein Wille nicht gebrochen werden darf, niemals.
Ich ließ das Frühstück stehen, rannte aus der Küche und warf mich zurück auf das Bett. Mein Atem ging stoßweise, als würde etwas in mir bersten. Mein Kopf war ein Gewirr, ohne Anfang und ohne Ende. Es ging nie nur um Korea. Es ging darum, wer ich bin, wenn niemand mehr sagt, was ich sein soll.
Ich war nicht bereit, mich einzufügen. Ich wollte entscheiden. Selbst. Für mich. Ich glaubte daran, dass ich dazu das Recht hatte – auch wenn es niemand sonst so sah.
Das Licht fiel schräg durch das Fenster, hell, beinahe zu klar. Ich starrte hinaus, versuchte, meinen Zorn hinunterzuschlucken, ihn zu falten wie ein Tuch. Und gerade als ich mich wieder aufrichtete, bereit, zur Schule zu gehen, hörte ich Schritte draußen vor der Tür. Leise. Nah. Und etwas in mir zitterte kurz, obwohl ich versuchte, fest zu bleiben.
***
HEUTE – MEIN SCHULABSCHLUSS. Und vielleicht der erste Tag, an dem ich wusste, wie sich Freiheit anfühlt. Ich verließ das Haus leise, ohne ein weiteres Wort. Die Luft war kalt – und strich mir übers Gesicht, als wollte sie fragen, ob ich wirklich bereit war.
Ich dachte: Heute darf ich nicht zu spät sein. Und begann zu laufen.
Als ich die Aula betrat, war der Raum schon gefüllt mit Stimmen, mit Atemzügen, mit leisen Echos von Freude. Draußen Nordlicht, drinnen Hitze – ihr Lachen war wie Feuer in dieser gefrorenen Stadt. Unsere Abschlussfeier war kurz, ohne große Reden, aber voller Bedeutung. Der Schulleiter nannte die Namen, einer nach dem anderen, in ruhigem Ton, als wären wir Teil eines alten Rituals.
Meine Hände waren feucht, als ich wartete. Die Stimme des Direktors hallte durch den Raum:
„Irena Röikanto.“
Ich stand auf, ging nach vorn. Schritt für Schritt, als gäbe es nichts außer diesen Augenblick. Als ich das Zeugnis entgegennahm, sah ich meine Eltern am Rand der Sitzreihen. Meine Mutter wischte sich die Augen. Stolz, vielleicht auch Erleichterung. Ich senkte den Blick – nicht vor Scham, sondern weil der Moment zu groß für meine Augen war. Nach der Zeremonie füllte sich der Schulhof mit weißen Mützen, mit Stimmen, mit Umarmungen. Ein Lachen – schwankend zwischen Aufbruch und Abschied, wie ein letzter Ton im Echo.
Ich ging nicht zu meinen Eltern. Ich schlich mich an den Rand des Platzes, wo die Bänke im Schatten standen. Der Wind strich durch mein Haar, sanft, fast vorsichtig.
Aus der Ferne sah ich sie – Marie, Sara, Jonna. Sie kamen näher, wie immer. „Irena, Glückwunsch! Wir haben es geschafft!“, rief Marie mit strahlendem Gesicht. Ich lächelte zurück, nicht ganz echt, aber ehrlich genug.
„Ja, es ist vorbei. Aber irgendwie beginnt jetzt erst alles.“
Jonna nickte langsam. „Ja, jetzt gehen wir alle unsere eigenen Wege. Aber dass du wirklich nach Korea gehst... ich kann’s immer noch nicht ganz glauben.“
„Ich versteh deine Entscheidung, Irena. Und ich bewundere deinen Mut – leise, aber ehrlich.“, sagte Sara leise. „Es fühlt sich plötzlich so erwachsen an, oder? Niemand weiß, was kommt. Aber wenn man sich fokussiert, wenn man wirklich wählt – dann öffnet sich der Weg. Du hast dich entschieden. Und das wird dich tragen.“
Ein anderer Freund lachte und sagte: „Du gehst wirklich weit. Wir werden dich nicht oft sehen, aber ich glaube, genau diese Entscheidung wird dich stärker machen.“
Ich lächelte, nickte. „Danke. Ich glaube das auch. Vielleicht werde ich anders. Nicht schlechter, nicht besser – einfach jemand, der sich getraut hat, loszugehen. Und vielleicht ist das genau das, was ich brauche.“
„Natürlich. Du bist die Stärkste von uns“, sagte Jonna mit einem Lächeln, das etwas Festes hatte. „Wenn du dich für etwas entscheidest, dann wird es richtig sein.“
Es war ein warmer Moment, eingefasst von Blicken, die länger hielten als sonst. Und doch verging auch er. Ich sah ihnen nach – Schritt für Schritt verschwammen sie, wie Träume im Nebel des Morgens.
Ihre Silhouetten verschwammen, wie Erinnerungen, die noch zu jung sind, um weh zu tun. Ich stand da, sah ihnen nach und flüsterte:
„Nichts bleibt. Nicht einmal dieser Moment. Auch er wird einmal leiser werden.“
Der Schulhof leerte sich. Die Stille war nicht kalt, sondern offen.
Was ist eine Entscheidung?
Ein Weg ist nie nur einer. Und der, den man geht, führt weiter, immer weiter.
Aber niemand weiß, wohin.
Ich saß noch eine Weile allein auf dem Schulhof. Der Platz hatte sich geleert, aber in mir war es laut. Inmitten all der Gedanken tauchte etwas auf – nicht klar, nicht zwingend, aber da: Vielleicht sollte ich mit meinen Eltern reden. Vielleicht jetzt.
Ich stand auf, klopfte mir den Staub vom Rock. Nicht hastig, aber entschlossen. Zuhause warteten sie bereits im Wohnzimmer. Zwischen uns lag Stille – nicht kalt, sondern klebrig, wie etwas, das nicht gehen will.
Ich setzte mich, atmete ein. Dann sagte ich, leise:
„Mama, erinnerst du dich? Damals, als du von diesem Schatten erzählt hast... im Wald.“
Sie blickte mich an, irritiert, ihre Stirn zog sich leicht zusammen.
„Du meinst die Geschichte aus dem Gebirge? Der ‚Hishi‘?“
Ich nickte. „Ja, genau die. Du hast damals gesagt, du hättest ihn wirklich gesehen. Glaubst du immer noch, dass es echt war?“
Sie schwieg, dann ein tiefer Seufzer, fast müde.
„Ach, Irena... immer diese Träumerei. Du warst schon immer gut darin, den Dingen ein anderes Gesicht zu geben. Ich hab’s gesehen, ja. Damals war es da, und jetzt ist es weg. Niemand glaubt mir, aber ich hab’s gesehen.“
„Ich weiß“, sagte ich, sah nicht direkt zu ihr. „Aber was, wenn du es nicht wirklich mit den Augen gesehen hast?
Vielleicht hat dein Kopf es gesehen, lange bevor die Augen es verstanden haben.“
Meine Mutter wirkte, als hätte sie das Bild wieder vor sich. Etwas, das aus dem Nebel auftauchte, nur kurz.
„Damals... ich war sicher, dass ich es gesehen habe. Aber vielleicht war es auch nur... mein Kopf. Eine Art Täuschung.“ Sie schüttelte den Kopf, langsam, wie gegen sich selbst gerichtet. „Jedenfalls hat mir damals niemand geglaubt.“
Ich nickte kaum merklich.
„Und was, wenn es bei mir genauso ist? Ich will glauben, dass meine Entscheidung echt ist. Aber vielleicht ist sie auch nur ein Hirngespinst.“
In dem Moment, in dem ich ihre Geschichte mit meiner verband, fragte ich mich: Und wenn mein Weg auch nur ein Schatten ist – ein Wunsch, den ich für Wirklichkeit halte?
„Irena, ich versuche dich zu verstehen. Wirklich. Aber für uns als Eltern ist es schwer – dich an einen Ort zu lassen, der uns fremd ist, der gefährlich sein könnte.“ Sie strich sich mit zwei Fingern über die Augen, über die kleinen Falten, die sich dort gesammelt hatten. „Als du klein warst, habe ich dir diese Geschichten erzählt – nicht, weil ich an Geister glaubte. Sondern weil ich wollte, dass du weißt, dass die Welt da draußen nicht immer sicher ist. Ich wollte dich schützen – damals, als du klein warst. Und heute... heute genauso verzweifelt.“
Mein Vater saß auf dem Sofa, die Hände ineinandergelegt. Er hatte bis jetzt geschwiegen, aber ich spürte seinen Blick.
„Irena, es geht nicht darum, dir deinen Weg zu verbauen. Es ist nur Sorge, Irena. Weil wir nicht wissen, ob dein Weg dich trägt – oder dich zerschneidet.“ Er hielt kurz inne, dann sprach er tiefer:
„Du warst schon immer willensstark. Schon als Kind. Aber diesmal... diesmal ist es anders. Schwerer für uns.“
Meine Mutter sah zu ihm, dann zu mir.
„Wir haben immer versucht, deine Entscheidungen zu akzeptieren. Aber Korea... das ist so weit weg. Wir kennen das Land nicht. Nur Bilder, Nachrichten, Geschichten. Und wir wissen nicht, ob es richtig ist, dich dorthin zu lassen. Nicht wirklich.“
Ich sah ihre Gesichter, erkannte das Zögern, das Schweigen hinter den Worten. Sie wollten mich nicht aufhalten, das spürte ich. Und doch – die Angst, mich zu verlieren, schlich sich in jeden Blick, jede Geste.
„Du bist unsere Tochter, Irena. Wir lieben dich“, sagte meine Mutter. Ihre Stimme war ruhig, aber etwas darin zog. „Es macht uns Angst, dass du so weit gehst. An einen Ort, der uns fremd ist.“
Mein Vater senkte den Kopf, sprach langsamer.
„Wir freuen uns, dass du wächst, dass du deinen eigenen Weg suchst. Aber wir wissen nicht, was dich dort erwartet. Vielleicht ist es normal, dass wir Angst haben.“
Meine Mutter legte ihre Hand auf meine. Sie war warm, echt. Und dennoch – in mir tobte die Sehnsucht nach einem Land, das ich kaum kannte, aber unbedingt erreichen wollte.
In ihrem Blick lag ein Widerspruch.
Der Wunsch, mich zu halten. Und zugleich der Zwang, loszulassen.
„Ich konnte dich einmal beschützen. Aber jetzt... ich fürchte, dass dieser Schutz zur Mauer wird.“
Sie sah mich an, atmete ein, zögerte.
„Ich weiß, wie sehr du darüber nachgedacht hast. Wie sehr du dich entschieden hast.“
Ihre Stimme schwankte, ihre Finger zogen sich fester um meine.
Etwas in ihr begann sich zu lösen.
„Wenn du wirklich glaubst, dort etwas zu finden...
Wenn du meinst, dass es dein Weg ist...
Dann werden wir dich nicht aufhalten.
Ich weiß es nicht, Irena. Vielleicht müssen wir es einfach zulassen.“
Nach dem Gespräch ging ich langsam in mein Zimmer zurück.
Die Schritte hätten leicht sein sollen, aber die Entscheidung lag schwer in meinem Rücken.
Mein Blick blieb an der Badezimmertür hängen.
Ich öffnete sie. Das Licht dort war matt, fast schüchtern.
Die Fliesen unter meinen Füßen waren kalt, die Luft roch nach etwas Metallischem, Abgeschlossenem.
Ich stellte mich vor das Waschbecken, putzte mir die Zähne, langsam, mechanisch.
Dann spülte ich meinen Mund aus, beugte mich nach vorne.
Und da war er – der Spiegel.
Er zeigte mich. Und zugleich zeigte er etwas anderes.
Ein Gesicht, das meines war, aber doch nicht.
Verzerrt, als hätte jemand es leicht verschoben, in einer anderen Realität.
„Wer bist du?“, flüsterte ich, kaum hörbar.
„Wirst du ein Handelspartner sein? Oder hast du schon längst mit mir verhandelt?“
Ich legte meine Hände zusammen, nicht wie zum Gebet, eher wie zum Stillhalten.
Und sprach in die Stille: „Das Leben ist ein endloser Knotenpunkt.
Dort treffen wir Entscheidungen. Immer wieder.
Nach Korea zu gehen – es ist nur eine dieser Abzweigungen.
Und ich bin bereit, den Preis zu zahlen.
Denn jede Entscheidung formt uns neu. Schneidet uns zu. Macht uns anders.“
In dieser Nacht glaubte ich: Die Art, wie wir sehen, verändert alles.
Und mit ihr die Richtung, die unser Leben nimmt.
Das finnische Mädchen
– Der erste Entschluss
Der Morgen kam wieder, wie ein alter Gedanke, kühl und schwer.
Draußen standen die Tannen regungslos im Nebel, ihre dunklen Nadeln wie Schatten in der Luft.
Die Stille war nicht freundlich. Der Himmel spannte sich bleigrau über die Welt, das Licht verlor sich zu schnell, und die Schatten blieben zu lang.
Vielleicht war es das, was sich in uns absetzte, wie Staub – diese unausgesprochene Schwermut, die man in Nordlichtern erkennt.
Der Geruch des Waldes, das Raue in der Luft – all das war mir vertraut, aber nie nah.
Es war mein letzter Tag in Finnland, und ich erinnerte mich – nicht laut, eher wie im Rückwärtsgang – an den ersten Moment, in dem ich von diesem fernen Land erfuhr.
Die Erinnerungen tauchten auf wie Schneeflocken an einem Fenster: leicht, kalt, kaum greifbar.
Damals war es Nacht, und es schneite. Mein Zimmer leuchtete hell, beinahe zu hell für den Winter.
Ich war allein, vor einem Bildschirm, als ich zufällig ein K-POP-Video anklickte.
Etwas daran blieb haften. Ich weiß nicht, ob es die Farben waren oder die Körper, die sich mit einer Selbstverständlichkeit bewegten, als wären sie aus Licht.
Die Städte in diesem Video flimmerten, selbst bei Nacht. Sie waren wach, voller Stimmen, voller Leben. Ganz anders als hier.
Dort draußen, in den Straßen von Seoul, war etwas, das atmete.
Mein Körper reagierte darauf. Ich konnte ihn spüren, wie er sich aufrichtete, als hätte er etwas verstanden, das mir noch nicht ganz bewusst war.
Und dann war da diese Sprache. Hangul. Ich hatte nie gedacht, dass ich einmal Lust hätte, Zeichen zu lernen. Aber hier, bei diesen Zeichen, diesen Mustern, war es anders. – sie fügten sich wie ein Spiel, das nur auf mich gewartet hatte.
Ich flüsterte: „Das ist wie ein geometrisches Gedicht.“
Ich las die Untertitel mit, ließ meine Augen den Silben folgen, wie kleine Tiere im Schnee.
Die Musik in meinen Ohren war nicht wie andere.
Mein Kopf nickte, meine Schultern bewegten sich, ohne dass ich es befahl.
Ich sprach so als hätte ich es schon einmal gesagt, vor langer Zeit.
Es kam mir nicht fremd vor. Es kam mir leicht vor. Frei.
Diese Sprache zwang mich nicht. Sie zeigte nur Wege. Und plötzlich sah ich etwas. Eine Tür. Und Korea war der Schlüssel.
Im Geschichtsunterricht gab uns unsere Lehrerin die Aufgabe, ein Land zu erforschen, das uns interessierte.
Ohne zu zögern wählte ich Korea. Ich erinnere mich, wie ich die Seiten durchblätterte, wie ich mich in Daten verlor, die sich anfühlten wie Risse in einer Haut – Fremdherrschaft, Kolonialzeit, die Teilung, ein Land, das sich immer wieder neu zusammensetzte.
Nichts davon wirkte wie Geschichte im Buch. Es war gelebte Realität, etwas, das atmete, das nie ganz verschwunden war.
Es war diese Unmittelbarkeit, diese Nähe zum Schmerz, die mich berührte.
Später entdeckte ich das Nebeneinander von Alt und Neu. Hanoks neben Glastürmen, traditionelle Kleidung im Blitzlicht moderner Technologie.
Ich stellte mir vor, wie jemand im Hanbok auf ein Smartphone blickte, während im Hintergrund ein Konzert begann. Die Ironie war poetisch. Alles daran war surreal – und doch wahr. Es war nicht inszeniert, es war einfach da.
Selbst das Tempo des Alltags schien wie ein anderes Leben. In Finnland warteten wir auf Busse, hielten Abstand, bewegten uns langsam. Dort dagegen flossen die Menschen wie Wasser.
U-Bahnen kamen in Minuten, alles war in Bewegung. Und ich – ich sah mich darin mitziehen, überrascht von der Geschwindigkeit, die dennoch nicht hetzte.
Ich hatte auch gelesen, dass Frauen sich dort sicher fühlten.
Dass man nachts allein nach Hause gehen konnte, ohne Angst, dass Helligkeit und Ordnung keine Funktion von Kontrolle waren, sondern von Vertrauen.
Ich fragte mich, wie es war, in einer Gesellschaft zu leben, in der Dinge einfach dort blieben, wo man sie abgelegt hatte.
Und dann war da das Essen. Ich sah Kimchi, Bibimbap, Tteokbokki in einem Video.
Die Farben, die Bewegung der Hände, der Dampf über den Schüsseln. Unsere Mahlzeiten waren stiller, blasser – Fisch, Kartoffeln, Brot. Aber dort, dort sprach das Essen. Es sagte: Komm. Versuch mich. Wach auf.
Ich spürte ein Ziehen in mir. Nicht nur Neugier. Mehr.
Hunger vielleicht. Oder Sehnsucht nach einer anderen Sprache, auch im Geschmack.
Das Gespräch mit der Lehrerin, dort im Beratungszimmer, ist mir geblieben.
Der Weg dorthin war lang – ein Korridor, den ich gut kannte.
Durch die großen Fenster fiel blasses Licht.
Draußen: Wald, grau, schwer. Himmel, der drückte.
Und zwischen allem: der Schulhof, leer, fast aus der Zeit gefallen.
Im Klassenraum herrschte eigentümliche Ruhe.
Einige saßen einzeln an Tischen, verloren in ihren Büchern.
Andere starrten auf Bildschirme, tippten, träumten.
Wieder andere blickten einfach nur hinaus –
mit offenen Gedanken, mit offenen Gesichtern.
Die Kleidung war eine Sprache für sich.
Weiche Pullover, Jeans, leise Farben.
Oder auch T-Shirts im Winter, nackte Arme trotz Kälte.
Es war, als würde jeder in seinem Körper sagen wollen: Das bin ich.
Ohne Lautstärke. Ohne Angst.
Im Beratungszimmer saß sie schon.
Am Fenster, eine Tasse in der Hand, ein Lächeln, das nichts drängte.
Die Wände kahl, ein paar Bücher aufgestapelt,
Papier, das sich leise neigte im Luftzug vom Fenster.
Draußen: Birken, weiß und stumm.
„Wie geht es dir, Irena?“
Ihre Stimme war warm, aus einer anderen Jahreszeit.
Ich setzte mich, hielt kurz den Atem an.
„Ich will mich an einer koreanischen Universität bewerben“, sagte ich.
Langsam, aber ohne Zögern. „Ich möchte etwas wagen, etwas ganz Neues.“
Sie schwieg einen Moment. Dann sah sie hinaus,
so als würde sie dort eine Antwort suchen.
„Das ist ein bedeutender Schritt, Irena.
Etwas Neues beginnt, wenn man es wirklich will.
Aber... warum gerade Korea?“
Es war keine dieser Fragen, die man einfach beantwortet. Sie kam leise, fast beiläufig, aber sie traf einen Punkt, den ich selbst noch nicht benennen konnte. Ich hätte sagen können: „Weil ich Korea interessant finde. Weil ich eine neue Kultur erleben möchte.“ Aber das wäre zu einfach gewesen. Ihre Stimme suchte nicht nach einer Ausrede, sondern nach einer Spur.
„Nicht Oxford oder Helsinki. Nicht Paris“, sagte sie, ruhig, ohne Urteil. „Sondern Seoul. Ein seltener Entschluss.“ Sie sah mich nicht an, sondern hinaus ins fahle Licht. „Ich glaube nicht, dass du das nur aus Neugier tust. Vielleicht hat deine Entscheidung mit dem zu tun, was du hier fühlst. Mit dem, was dir fehlt.“ Ihre Worte blieben im Raum, wie Staub im Licht.
Unsere Schulen geben Raum, und manchmal ist genau dieser Raum die Wand, gegen die man stößt. Die Freiheit, die sich plötzlich wie ein Gitter anfühlt. Ich wollte raus. Nicht vor etwas davonlaufen, sondern auf etwas zugehen. Korea war nicht das Ziel, sondern die Bewegung.
Ich schwieg lange. Nicht aus Unsicherheit, sondern weil ich wusste, dass Worte das nicht erklären würden. Ich spürte das Gewicht in meinem Brustkorb, die Unruhe meiner Hände, die Hitze in meinem Nacken. Dann sagte ich: „Ich lerne Hangeul. Noch ist es schwer, aber irgendwie fühlt es sich an, als würde ich mir damit eine neue Tür öffnen.“ Sie nickte nicht. Aber sie hörte zu.
Ich erinnere mich nicht mehr an jedes Wort. Vielleicht war es auch nur der kindliche Versuch, etwas Bedeutungsvolles zu sagen. Etwas, das größer war als ich selbst. „Und ich möchte mich für Bauingenieurwesen bewerben, Frau Mattinen“, sagte ich. „Ich finde es faszinierend, was man aus Erde und Wasser machen kann. Nicht nur so, wie sie von Natur aus sind, sondern wenn man Stahl und Beton hinzufügt und daraus etwas Neues erschafft.“
Sie sah mich an, die Augen schmal, das Kinn leicht gesenkt, ein zustimmendes Nicken. „Du meinst die Verbindung von Natur und Technik. Und wie daraus etwas entsteht, das den Menschen nützt.“
„Genau“, sagte ich, und meine Stimme wurde sicherer. „Erde und Wasser folgen der Schwerkraft. Sie fließen, sinken, verändern sich. Aber Beton und Stahl sind starr. Und wenn man beides zusammenführt, kann man Brücken bauen. Häuser. Ganze Städte. Es ist, als würden zwei Welten sich begegnen.“
Sie schwieg einen Moment. Dann sagte sie: „Du bist mutig, Irena. Aber hast du dich auch gefragt, ob das wirklich zu dir passt? Unsere Schulen fördern Freiheit. In Korea wird vieles anders sein. Strenger. Schneller. Und du wirst dich beweisen müssen.“
Ich nickte langsam. „Gerade deshalb will ich dorthin. Ich glaube, dass ich dort wachsen kann. Die Energie. Das Tempo. Es zieht mich an. Ich will herausfinden, wie weit ich gehen kann.“
Ein paar Monate später kam die Nachricht.
Ich hatte mich beworben, nicht laut, nicht mit großen Gesten.
Aber als der Brief der Mirae-Universität aus Korea eintraf, war der Moment wie eine Linie, die sich im Nebel abzeichnet. Es war ein Samstagnachmittag. Ich lag auf dem Sofa, ein Comic in der Hand, das Licht draußen war gedämpft – die Sonne hing flach über dem Horizont. Der Wind strich leise gegen das Fenster, und alles war in jener winterlichen Stille gefangen, die manchmal wie Watte klingt.
„Irena! Post ist da!“, rief mein Vater aus dem Flur.
Ich legte das Buch zur Seite und ging langsam ins Wohnzimmer.
Er saß auf dem Sofa, die Beine überschlagen, ein weißer Umschlag in der Hand, sein Blick zwischen Neugier und etwas, das ich nicht ganz benennen konnte. Ich sah den Aufdruck auf der Briefmarke – das Logo. Klar. Vertraut. Unerwartet.
„Was ist das?“, fragte er.
Ich lächelte flüchtig. „Ach, nur was von der Schule. Wahrscheinlich ein Projekt.“
Meine Stimme klang beiläufig, doch innerlich zog sich etwas zusammen.
„Ein Projekt?“, fragte er, den Umschlag betrachtend. „Das ist doch Koreanisch, oder nicht?“
„Internationale Programme. So was gibt’s jetzt oft“, sagte ich schnell.
Ich nahm den Brief und wich seinem Blick aus.
„Na gut ... aber ich bin neugierig, was drinsteht.“
„Später, Papa. Ich erklär’s dir später.“
Ich bemühte mich, ruhig zu sprechen, doch ich wusste, dass meine Hände zitterten. Und ich war mir sicher, er hatte es längst gemerkt.
Mit dem Umschlag in der Hand stieg ich die Treppe hinauf.
Meine Schritte wirkten ruhig, fast mechanisch, aber in mir war es laut.
Schon mit der ersten Stufe begann mein Herz schneller zu schlagen.
Ein Gedanke schob sich zwischen die anderen: Ist das wirklich möglich?
Bei jedem Schritt vermischten sich Zweifel und Erwartung, Hoffnung und Angst – schwer voneinander zu trennen.
Oben angekommen stand ich vor der Tür. Sie war wie immer, vertraut in ihrem abgewetzten Holz, doch plötzlich schien sie mir eine Schwelle zu sein. Ich atmete ein, legte die Hand auf die Klinke, als müsste ich etwas beruhigen, das in mir tobte. Dann öffnete ich.
Das Zimmer war wie immer – der Schreibtisch, das Regal, der Stuhl am Fenster. Alles an seinem Platz. Und trotzdem fühlte es sich anders an. Die Stille, sonst tröstlich, war jetzt gespannt. Als wüsste sie, was geschehen würde.
Ich setzte mich auf die Bettkante. Der Umschlag lag noch immer in meiner Hand. Ich starrte darauf, als könnte ich seinen Inhalt ohne Berührung erkennen. Sekunden dehnten sich. Das Papier war kühl an den Fingerspitzen, glatt und leicht rau zugleich.
Langsam riss ich die Kante auf, vorsichtig, als wollte ich nichts zerstören. Nicht den Moment, nicht das, was darin lag. Ich zog das Dokument heraus. Und da stand es, schwarz auf weiß, deutlich und doch kaum zu fassen: Zugelassen.
Meine Augen verloren kurz den Fokus, mein Herz nicht.
„Das ist es also ...“
Und ich wusste: Nicht nur meine Eltern, nicht nur meine Freunde – ich würde auch dieses Land verlassen.
Wirklich. Bald.
Ich stand auf. Lehnte mich an die Rückenlehne des alten Holzstuhls, der neben dem Fenster stand.
Die Maserung des Holzes war vertraut, doch in dieser Vertrautheit lag etwas, das mich zurückzog. Etwas, das nicht zu benennen war, aber da war. Ich richtete mich auf und ging zurück. Zurück zum Bett.